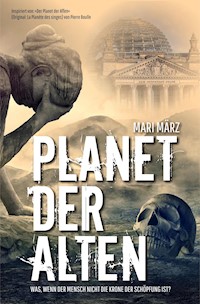Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
MAD-MIX 2 ist ein unterhaltsames Potpourri aus Erzählkunst, Tragik, Lyrik, Thrill und Satire. Ein bunter Aufwasch aus der Zeit der Corona-Pandemie. Der Lockdown war nicht nur scheiße, oder? Wir haben unsere Kleiderschränke aufgeräumt, unsere Garagen oder Keller entrümpelt, unsere Wohnungen renoviert, gegebenenfalls Beziehungen ausgemistet und den Garten oder Balkon auf Vordermann gebracht. Immerhin! Wir haben unsere Kinder besser kennengelernt, ihren Tagesablauf, ihre Bedürfnisse, ihren Alltag, ihre Sorgen und vielleicht ihre geheimen Wünsche. Wir haben verstanden, wie wertvoll Herzenswärme ist, wie wichtig eine Berührung, aber auch wie lebensrettend Abstand sein kann. Wir haben gelernt, dass die Welt nicht hinter Aachen, Schwedt, den Alpen oder der Ostsee aufhört. Die Pandemie zeigte uns, wie groß aber auch wie klein die Welt ist und wie mächtig die Natur. Wir haben erfahren, wie korrupt Politiker sein können, wie eigensinnig Ministerpräsidenten, wie fragil unsere Freiheit und wie schützenswert unsere Demokratie. Und wir haben hoffentlich kapiert, dass die Menschheit nicht die Krone der Schöpfung ist, wenn uns ein winziger Virus global in die Knie zwingen kann. Das Positivste für mich und meine Leser ist wohl, dass ich 2020/2021 so viel geschrieben habe wie noch nie. Der Lockdown kostete mich Nerven, diverse Aufträge, jede Menge Geld, aber er schenkte mir auch Zeit, die nicht bezahlbar ist. Viel Spaß mit meiner literarischen Aufarbeitung der Pandemie. Geschichten, Gedanken und Gedichte, die ich in der Corona-Zeit schrieb.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARI MÄRZ
MAD-MIX2
Corona-Shorts
MAD-MIX 2 ist ein unterhaltsames Potpourri aus Erzählkunst,
Tragik, Lyrik, Thrill und Satire. Ein bunter Aufwasch aus der Zeit
der Corona-Pandemie.
Handlungen und Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Markennamen sowie Warenzeichen werden in diesem Buch in einem ausschließlich fiktionalen Zusammenhang verwendet.
MAD-MIX2
Corona-Shorts
Copyright © 2021
DIE TEXTWERKSTATT
www.korrekt-getippt.de
Cover-Grafiken: Pixabay
MARI MÄRZ
Alle Rechte vorbehalten.
www.mari-märz.de
facebook.com/marimaerz
twitter.com/mari_maerz
instagram.com/mari_maerz
INHALT
INHALT
LOCKDOWN
ZEITENWENDE
MEMO
Wir schreiben zu Hause
HOLLYWOODSYNDROM
Die Sehnsucht nach dem Verfall
BROKEN MINDS
Tränen
Angst
Sascha
Würde
Zweifel
Taten
Henkersmahlzeit
Antikörper
Anmerkung zu Broken Minds
HOLLYWOODSYNDROM
Die Suche nach dem Traummann
DANNY
Die Mord(s)lustigen
Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
NERVUS MAXILLARIS
KAUSALITÄTEN KRASSER KOPULATION
SOHN DER SÜNDE
DER PORREE UND FRAU BRIEST
GÖTTERDÄMMERUNG
Anmerkung zu Götterdämmerung
Heißhunger
Ein kulinarischer Lese-Quickie
Nachschlag?
Hörbücher
LOCKDOWN
Was machst du den ganzen Tag?
Du hast doch Zeit, da kannst du doch mal ...
Im ersten Lockdown 2020 verstummten all jene Besserwisser, die glaubten, Home-Office wäre eine aufgeblasene Bezeichnung für ein sonst nicht definierbares Gammel-Dasein zwischen Haushalt und gepflegt die Füße in die Sonne halten. Na ja, ich arbeite gern in verbeulter Jogginghose und auch gern in der Sonne – diesbezüglich möchte ich den Klugscheißern sogar rechtgeben. Und wisst ihr was? ICH LIEBE ES! Warum das Home-Office dennoch nichts für Feiglinge ist?
Es bedarf Selbstdisziplin, Zeitmanagement und den Mut zur Lücke. Man muss auch mal nein sagen können, Prioritäten setzen – gegenüber dem eigenen Perfektionsdrang aber auch gegenüber Freunden, der Familie, dem Haushalt.
Als ich begann, im heimischen Büro zu arbeiten, war mein Sohn elf. Ich musste also nicht nur zwischen Haushalt, Job, Postboten, Callcenteranrufen und den notwendigen Alltagsherausforderungen um Ruhe ringen, sondern mich auch einem Jungen widmen, der ein Recht hatte, dass man ihm Aufmerksamkeit schenkte, sich für seine Sorgen interessierte, ihm bei den Hausaufgaben half. All das, was jetzt so vielen da draußen zu schaffen machte.
Klare Regeln helfen! Mehr will ich dazu nicht sagen, ich bin Autorin – kein Therapeut oder Coach.
Dafür Profi in den eigenen vier Wänden, die auch bisweilen mobil sind. Nach dreiundzwanzig Jahren im öffentlichen Dienst arbeite ich seit nunmehr acht Jahren in meiner selbstgewählten Freiheit, was bedeutet, dass ich die komplette Pubertät mit meinem Sohn erleben durfte. Es hat geklappt. Nicht immer harmonisch, aber letztlich doch recht ordentlich. Der junge Mann geht jetzt zur Uni.
Da mein Arbeitstag gegen 8:00 Uhr beginnt und meist erst nach 20.00 Uhr endet, sind da ausreichend Stunden, in denen ich alle möglichen »Ablenkungen« hinnehmen muss. Insofern kann ich selbstverständlich nachvollziehen, wie es all jenen geht respektive ging, die im Lockdown ihre Kinder betreuen und »nebenbei« im Home-Office oder auch an der Front ihren Job meistern mussten. Was mich nervt, ist die einseitige Darstellung im TV und ja ... letztlich das Jammern auf höchstem Niveau.
Diese leidliche Debatte beispielsweise, dass Mütter und Väter mit ihren Kindern überfordert sind oder Hausfrauen ihre Arbeit bezahlt haben wollen. Von wem? Was ist mit all jenen, die den Haushalt neben Kind und Karriere auf die Reihe kriegen?
Wenn ich also solche Beiträge im TV sehe, schwillt mir die Galle beim Gedanken an jene Frauen, die misshandelt, missbraucht, gedemütigt werden und es leider nicht schaffen, sich aus dem Teufelskreis zu befreien.
Deshalb schrieb ich BROKEN MINDS, das war mein Ventil, mit dieser kollektiven Aufregung klarzukommen. Während der Corona-Lockdowns gab es Millionen Einzelschicksale – von den wirtschaftlichen Konsequenzen ganz zu schweigen. Ich denke an die unzähligen Firmeninsolvenzen, an zig Unternehmer weltweit, deren Lebenswerk den Bach runterging – die ökonomischen Spätfolgen stehen uns noch bevor. Wie ging es Menschen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren und immer noch sind, wie all jenen, die unter Depressionen oder psychischen Krankheiten leiden? Wie denen, die Angehörige an oder durch Covid-19 verloren haben?
Auch wenn es hier keine Pauschalaussagen gibt, glaube ich, dass all jene, denen das Wasser tatsächlich bis zum Hals steht, keine Zeit und auch keine Kraft haben, öffentlich zu jammern.
Aber nun mal weg vom Negativen. Home-Office ist und bleibt eine Herausforderung. Man muss Grenzen und Prioritäten setzen können, multitaskingfähig sein und über jede Menge Selbstdisziplin verfügen – gern auch mal sieben Tage die Woche und weit über die durchschnittliche Arbeitszeit hinaus. DAS ist u.a. für mich das Positive, was uns Corona und sogar die Jammerbeiträge beschert haben: Die Arbeit am heimischen Schreibtisch ist mindestens genauso viel wert wie in einer Firma. Es ist RICHTIGE Arbeit!
Und was hat Corona noch mit mir/uns gemacht? Zum Beispiel mit der Buchbranche?
Immer öfter lese ich, dass Autoren nicht mehr schreiben, weil die Einnahmen fehlen. Selbst namhafte Autoren und Verlage verschieben Buchveröffentlichungen und werben neuerdings offensiv online. Veranstalter mussten massive Verluste durch knapp zwei Jahre Verbot hinnehmen. Tja, das ist wohl kein gutes Zeichen. Man könnte glauben, die Menschen hätten im Lockdown mehr Zeit zum Lesen gehabt. Hatten sie sicherlich, nur sinken die Verkaufszahlen trotzdem, auch bei mir.
Aber es gibt auch einige positive Aspekte, die ich der Pandemie abgewinnen kann. Als jemand, der wie meine #MissVerständnis Menschen – vor allem in größeren Mengen und mit engem Körperkontakt – nicht unbedingt mag, geht es mir momentan mit den Abstandsregeln nicht sooo schlecht. Okay, ich sehne mich danach, wieder öffentlich lesen zu dürfen, Freunde und Kollegen zu treffen, in Berlin ohne Mundschutz einen Kaffee zu trinken und shoppen zu gehen. Aber das sind letztlich Luxusprobleme.
Der Mangel im Lockdown hat mich und hoffentlich einige mehr zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ich sagte seinerzeit ja gern süffisant, dass es wie in der DDR sei: Nüscht im Regal und reisen jeht och nich.
Der Überfluss wird erst in Zeiten des Mangels deutlich, nicht wahr? Klar war es nervig, nach Klopapier anzustehen, aber auch verdammt lehrreich.
Reisen geht nun halbwegs wieder und verhungern werden wir auch nicht. Die Umwelt konnte sich erholen, das ist doch was. Vielleicht zieht es die Menschen tatsächlich aufs Land, sollte sich das Home-Office etablieren. Es wäre letztlich eine Win-win-Situation für Großstädte, Gemeinden, unsere Work-Live-Balance und die Natur.
Der Lockdown war also nicht nur scheiße, oder?
Wir haben unsere Kleiderschränke aufgeräumt, unsere Garagen oder Keller entrümpelt, unsere Wohnungen renoviert, gegebenenfalls Beziehungen ausgemistet und den Garten oder Balkon auf Vordermann gebracht. Immerhin!
Wir haben unsere Kinder besser kennengelernt, ihren Tagesablauf, ihre Bedürfnisse, ihren Alltag, ihre Sorgen und vielleicht ihre geheimen Wünsche.
Wir haben verstanden, wie wertvoll Herzenswärme ist, wie wichtig eine Berührung, aber auch wie lebensrettend Abstand sein kann.
Wir haben gelernt, dass die Welt nicht hinter Aachen, Schwedt, den Alpen oder der Ostsee aufhört. Die Pandemie zeigte uns, wie groß aber auch wie klein die Welt ist und wie mächtig die Natur.
Wir haben erfahren, wie korrupt Politiker sein können, wie eigensinnig Ministerpräsidenten, wie fragil unsere Freiheit und wie schützenswert unsere Demokratie.
Und wir haben hoffentlich kapiert, dass die Menschheit nicht die Krone der Schöpfung ist, wenn uns ein winziger Virus global in die Knie zwingen kann.
Das Positivste für mich und meine Leser ist wohl, dass ich 2020/2021 so viel geschrieben habe wie noch nie. Der Lockdown kostete mich Nerven, diverse Aufträge, jede Menge Geld, aber er schenkte mir auch Zeit, die nicht bezahlbar ist.
ZEITENWENDE
MARI MÄRZ © 2020
Schneller!
Weiter!
Nur nicht zurückschauen!
Immer im Kreis.
Die Zeit ist gefangen
in einem Hamsterrad der Ewigkeit.
Termine.
Deadlines.
Nur nicht zu spät kommen!
Immer im Stress.
Wir sind gefangen
in einer Endlosschleife der Ansprüche.
STOPP!
Stillstand!
Isolation!
Was bedeutet Zeit im Nirwana der Angst?
Die Welt ist gefangen
im Strudel der globalen Ernüchterung.
Hamstern!
Jammern!
Verschwörungstheorien!
Das Haupt der Schöpfung ist leer.
Wir klammern uns an Götzenbilder,
unser Spiegelbild trägt keine Krone mehr.
Zeit für das Wie. Zeit für das Was.
Zeit für das Wohin.
Wie soll ich leben? Was macht mich glücklich?
Weiß ich, wer ich bin?
Chancen!
Taten!
Helden des Alltags!
Wer oder was ist relevant fürs System?
Gemeinschaft ist, was uns längst verbindet.
Nur konnten wir das bisher nicht sehn.
Länder!
Menschen!
Was ist die Welt?
Erkenntnis frohlockt – es ist noch nicht zu spät.
Entschleunigung bringt uns die Kraft des Wandels.
Wir drehen uns nicht mehr, aber mit uns der Planet.
Zeit für das Wie. Zeit für das Was.
Zeit für das Wohin.
Wie soll ich leben? Was macht mich glücklich?
Weiß ich, wer ich bin?
Die Zeit ist da, schon immer gewesen.
Die Uhr tickt für jeden gleich.
Was fangen wir an, ist die Menschheit genesen.
Wohin wird die Reise geh’n?
Schneller, weiter sind Begriffe von gestern.
Heute zählt nicht das Wann.
Zeit für das Wie. Zeit für das Was.
Zeit für einen neuen Plan.
So will ich leben. Das macht mich glücklich.
Ich weiß jetzt, wer ich bin.
MEMO
Auch erschienen in der Anthologie
von Sebastian Fitzek (Hrsg.)
#wirschreibenzuhause
Glitzer und Staub – zwei Dinge, die nicht zusammengehören und doch hier an diesem Ort vereint sind wie ein Paar Socken, von denen eines ein Loch hat. Ich bin die Socke mit dem Loch, war es immer gewesen. Ich bin der Staub, den man gern unter den Teppich kehrt wie unliebsame Wahrheiten.
Melissa kehrt nach fünfzehn Jahren an jenen Ort zurück, wo sie ihre Kindheit verbrachte. Ihre Mutter überreicht ihr einen Karton, in dem ein altes Handy liegt. Es empfängt Nachrichten, die nicht real sein können.
Oder doch?
Erinnerungen sind subjektive Wahrnehmungen, die unser Gehirn speichert. Aber was, wenn dieser Speicher defekt ist?
MEMO – ein düsterer Seelentrip von Mari März.
Eine Kurzgeschichte, die dank des überwältigenden Leservotums auch in Sebastian Fitzeks Anthologie WIR SCHREIBEN ZU HAUSE veröffentlicht wurde.
Wir schreiben zu Hause
Im ersten Lockdown 2020 rief Sebastian Fitzek unter dem Hashtag #wirschreibenzuhause seine Instagram-Follower zu einer Schreibsession auf. Ich muss zugeben, dass ich bis dato kein Fitzek-Follower war. Natürlich las ich einige seiner Bücher, aber ich besitze null Fan-Attitüde. Eine Autorenkollegin erzählte mir von jenem Schreibwettbewerb, und da die Erlöse des geplanten Werkes der gebeutelten Buchbranche zugutekommen sollten, war ich durchaus interessiert. Also schrieb ich einen düsteren Seelentrip und MEMO kam dank zahlreicher Gutfinder in besagte Charity-Ausgabe.
Wie bei Anthologien im Allgemeinen üblich, gab es natürlich ein bis fünf Vorgaben in Bezug auf Thema, Setting, Inhalt etc. Herr Fitzek dachte sich die folgenden aus (ich zitiere):
1. Die Geschichte soll unter dem Thema »Identität« stehen.
2. Jemand findet ein fremdes Handy, auf dem er/sie Bilder von sich selbst entdeckt.
3. Die Hauptfigur hat ein dunkles Geheimnis.
4. Das Handlungsmotiv des Gegners ist Rache.
5. Unter dem dunklen Geheimnis leidet der Gegner noch heute.
So weit – so gut. Wer Gegner und wer Hauptfigur ist, durfte ich proaktiv entscheiden, was durchaus günstig war, denn ich mag bekanntlich kein reines Schwarz und Weiß.
Das Thema »Identität« brachte mich spontan zur Schizophrenie und Psychose. Ich begann zu recherchieren und fand unter anderem die Symptome Wahnvorstellungen, Desorientierung sowie bizarres Verhalten bis hin zum Realitätsverlust. Und natürlich wollte ich wie immer keine Klischees bedienen und plakativ dem Bösewicht die psychische Erkrankung andichten. Nein. Wie schon in PSYCHO-PAT und auch MISS VERSTÄNDNIS erzähle ich eine (wenngleich kurze) Geschichte über die Krankheit.
Wie fühlt es sich an?
Weshalb kam es dazu?
Was muss passieren, bis eine Seele bricht?
Und genau deshalb endet diese Geschichte, wie sie eben enden muss. Mari-März-Fans wissen mit Doktor Kramer, dem Therapeuten aus dem BLISS, etwas anzufangen. Nicht wahr?
Aber nun genug der langen Vorrede. Stürzen wir uns in die düsteren Erinnerungen einer Frau, die ebenjene aus bestimmten Gründen verdrängen musste ...
MEMO
MARI MÄRZ © 2020
Was sagt ein Haar über einen Menschen aus? Ist etwa ähnlich wie bei Jahresringen eines Baumes feststellbar, welches Leben dieser Mensch führte? Ich lasse ein solches Haar durch meine Finger gleiten.
Es ist meins.
Lang und blond.
Die Farbe ist nicht echt.
Wie so vieles an mir nicht echt ist.
Die letzten Zentimeter sind brüchig.
Ein Indiz, das mein Leben auszeichnet.
»Mel-Schätzchen, was tust du denn da? Iss lieber was von dem Kuchen, du bist viel zu dünn!«
Essen. Wie kann meine Mutter jetzt an Essen denken? Sie flaniert durchs Wohnzimmer, serviert ihren Gästen Getränke und Häppchen, als wäre das hier eine beschissene Party. Aber das hier ist keine Party, es sind auch nicht ihre Gäste.
Meine Schwester ist keinen Deut besser. Sie benimmt sich wie Mutter, als würde sie mit ihr wetteifern. Schon als kleines Mädchen hat sie das getan. Die billige Kopie einer Frau, die selbst keine Bereicherung für diese Welt darstellt.
»Lass die Kleine doch. Sie trauert und hat wahrscheinlich keinen Appetit.«
Onkel Dieter. Was weiß der schon über mich? Fünfzehn Jahre war ich nicht hier gewesen, habe versucht, mein Leben zu leben. Ohne dieses Haus und ohne diese Familie. Aber heute musste ich wohl kommen, um Abschied zu nehmen.
»Sie hat ihren Vater doch so geliebt«, höre ich meine Mutter sagen. Nein, sie sagt es nicht, sie singt die Worte. Für diese Frau ist alles rosarot, hübsch sortiert und blankgeschrubbt. Niemand weiß, wie es wirklich in ihr aussieht, hinter dieser Fassade aus Glitzer und Staub. Das habe ich wohl von ihr geerbt. Wahrscheinlich ist sie sogar froh, dass Papa tot ist. Drei Jahre hat er gelitten, bis der Krebs gewann.
Niemand interessiert sich heute dafür. Dieser Leichenschmaus passt zu meiner Mutter – verlogen, verfressen, verdammt. Eine Tradition, die mir genau wie diese Frau suspekt ist.
Ich wickle das Haar um meinen Zeigefinger und beobachte die Gäste. Das halbe Dorf ist hier, faselt, frisst und furzt. Hier, in diesem Kaff vor den Toren Berlins, wo ich meine Kindheit verbrachte. Warum bin ich hier? Um Papa die letzte Ehre zu erweisen? Weil es sich so gehört, dass die Tochter zur Beerdigung ihres Vaters erscheint?
Direkt nach der Beisetzung hätte ich verschwinden sollen. Ab in den nächsten Flieger und zurück in mein Leben, den Abstand wiederherstellen, sechstausend Kilometer zwischen mir und diesem Haus.
»Ja, unsere Melli hat ihren Papa sehr geliebt«, flötet meine Mutter in die Runde. Onkel Dieter hat sich zum Rauchen nach draußen verzogen. In mir steigt die Gier nach einem Joint. Den letzten hatte ich vor der Beisetzung, das ist jetzt zwei Stunden her. Aber wenn ich zu Onkel Dieter in den Garten gehe, wird er glauben, ich laufe ihm nach. Nein, das ist nichts für mich. Anbiedern ist das Steckenpferd meiner Schwester. Als Ebenbild unserer Mutter füllt sie Gläser auf, reicht Tabletts mit Kuchen und Canapés herum, präsentiert ihr Friede-Freude-Eierkuchen-Lächeln und glaubt offensichtlich sogar, dass alles in bester Ordnung sei.
Das Haar ist so fest um meinen Zeigefinger gewickelt, dass ich ein schmerzhaftes Pochen spüre. Mein Blut kann nicht mehr richtig fließen, die Gefäße sind eingeengt von einem schlichten Haar. Mein Finger und ich haben vieles gemeinsam. Ich zerre das Haar von meinem Fleisch, gebe ihm Raum, werfe es auf den Teppich zu den Kuchenkrümeln der Gäste. Wenn ich noch länger zwischen all diesen netten Menschen sitze, werde ich explodieren.
»Wo willst du denn hin, Schätzchen?«
Meine Mutter hat ihre Augen überall, sieht aber letztlich nur das, was sie sehen will. Mich hat sie seit meiner Ankunft fest im Blick, auch wenn sie keine Ahnung hat, wie es mir geht. Ich habe gehofft, dass sie nicht bemerkt, wie ich mich aus dem Haus stehle, aber weit gefehlt. Ihre Unterhaltung mit zwei älteren Damen ist nur Fassade – wie alles hier.
»Ich gehe mal an die frische Luft«, brumme ich eine lieblose Erklärung und verlasse meinen Platz auf der Couch. Er wird sofort von einigen Kindern okkupiert, die ich nicht kenne. Keine Verwandtschaft, soweit ich weiß. Aber was weiß ich schon?
Alles hier wirkt fremd, wie aus einem Film, den ich irgendwann einmal gesehen habe. Die Erinnerungen sind bruchstückhaft, längst versunken in der Zeit. Ich bahne meinen Weg an Menschen vorbei, die mir fremd sind, durch ein Haus, das irgendwann mein Zuhause war. Der Geruch nach Vergangenheit begleitet mich, hüllt mich ein wie dichter Nebel, klebt an mir wie eine Patina – Schicht für Schicht ein Erlebnis, das ich vergessen habe.
Ich öffne die Tür, atme die frische Frühlingsluft, empfange das Licht der Märzsonne auf meiner Haut und könnte fast glauben, dass ich mich gut fühle.
Glitzer und Staub – zwei Dinge, die nicht zusammengehören und doch hier an diesem Ort vereint sind wie ein Paar Socken, von denen eines ein Loch hat. Ich bin die Socke mit dem Loch, war es immer gewesen. Ich bin der Staub, den man gern unter den Teppich kehrt wie unliebsame Wahrheiten.
»Na, Melli-Herz, auch ’ne Kippe?«
Onkel Dieter. Natürlich! Der Bruder meines Vaters. Sein Ebenbild oder vielmehr das Negativ – seitenverkehrt, entgegengesetzte Farbgebung, umgekehrt belichtet. Wie ich und meine Schwester. Sie ist der Glitzer, ich der Staub.
Nur widerwillig lächle ich Onkel Dieter zu und gehe weiter. Er wohnt nebenan, die Grundstücke gehörten früher zusammen. Jeder Bruder bekam genau die Hälfte, baute ein Haus; das eine hell und schön, das andere dunkel. Im Gegensatz zu Papa war Onkel Dieter viel zu Hause. Bei sich und bei uns. Er half mir bei den Schularbeiten, meiner Mutter im Garten, meiner Schwester bei was auch immer. Er war immer da – wie ein Möbelstück, das man nicht wegwerfen will oder kann.
Ob er meiner Mutter immer noch im Garten hilft? Alles sieht gepflegt aus, Hecken und Sträucher sind bereits geschnitten, Schneeglöckchen, Krokusse und Narzissen recken ihre bunten Spitzen siegesmutig der Sonne entgegen. Kein Frühblüher steht zufällig, ihre Zwiebeln wurden präzise in den Boden gesteckt; zwischen Gartenzwerge und Dekosteine. Und falls sich doch eine Pflanze erdreisten sollte, am falschen Fleck zu wachsen, dann wird sie herausgerissen und weggeworfen. Immer hübsch akkurat und adrett.
Schon als Kind hasste ich diese pedantische Ordnung, fühlte mich wie in einer Filmkulisse. Nichts war real und ich nicht mehr als ein Requisit. Vielleicht kann ich mich deshalb nur schwer an jene Zeit erinnern. Sie war nicht echt, fühlte sich falsch an.
Wie von selbst tragen mich meine Füße zu dem alten Apfelbaum. Seine Krone ist gestutzt, für den Sommer vorbereitet. Er wird Früchte tragen.
Die Schaukel hängt noch. Eines der wenigen Rudimente meiner Kindheit. Meiner und ...
Ich halte mich fest an den kalten Ketten der Schaukel. Der starke Ast des Apfelbaums ächzt unter meinem Gewicht. Mein Fuß tritt auf den Rasen, stößt sich ab.
Bewegung.
Mein Körper schwingt vor und zurück, während ich den Joint aus meiner Jackentasche krame, ihn anzünde und tief jene Substanz inhaliere, die mir all die Jahre beim Vergessen half.
Entspannung.
Mit jedem weiteren Zug spüre ich, wie eine Last von mir fällt. Ich schwinge, schaukle, drifte zurück durch die Zeit. Jetset, Meetings, Afterwork, Manhatten, Skyline, mein Apartment, Männer, namenlos ... Arbeit, Termine, Hektik, Yogastudio, Achtzigstundenwochen, Studium, Freiheit ... Auszug, Abschlussball, Konfirmation, Sommer, Baden im See, Hausaufgaben, Pickel, die erste Menstruation, Onkel Dieter ...
Wie früher steht er hinter mir, gibt mir einen Schubs, noch einen, bis ich auf meiner Schaukel durch die Luft fliege.
Mochte ich das früher, mag ich es jetzt?
Bilder.
Der Film, in dem ich mich mein Leben lang gefangen fühlte, wird von einer imaginären Macht abgespielt.
Stück für Stück.
Bild für Bild.
Ich will ihn nicht sehen.
»Das gefällt dir, stimmt’s?«, brummt Onkel Dieter hinter mir. Mein Körper fliegt, doch mein Blick ist starr auf ein kleines Mädchen gerichtet. Es steht direkt vor mir in einem hübschen Sommerkleid ... am Eingang zur Garage.
Papas Domizil.
Wo kommt es plötzlich her?
»Halte an, Onkel Dieter!«
Ich höre sein Lachen, rieche den Zigarettenqualm. Alles wie früher. Doch heute bin ich erwachsen, kann mich wehren. Deshalb springe ich von der Schaukel, lande hart vor den Füßen des Mädchens. Noch immer haften meine Augen an der Kleinen. Auf ihrem Kleid erkenne ich jetzt einen Namen mit rosarotem Garn gestickt.
LISSI.
Wer ist Lissi, zu wem gehört sie?
Ich drehe mich zu Onkel Dieter, will ihn fragen. Er zündet sich die nächste Zigarette an und grinst. Dann zeigt er auf den halbgerauchten Joint, der unter der Schaukel im Gras liegt. »Das mit den Drogen haste immer noch nich im Griff, wa?«
»Das ist Medizin. Was geht es dich an?!«, erwidere ich trotzig wie ein Teenager, klaube den Joint vom Boden und stecke ihn zurück in meine Jackentasche. Dann stehe ich auf, klopfe mir Grashalme von der Jeans, und während ich mich zurück zu dem Mädchen drehe, sage ich: »Willst du jetzt schaukeln?«
Meine Frage erreicht den Empfänger nicht. Lissi ist verschwunden. Verwirrt schaue ich mich um, kein Mädchen, kein Kleid mit rosarot gestickten Buchstaben.
»Wer, ich?« Onkel Dieter feixt vor sich hin, hustet, zieht an seiner Zigarette und brummt: »Mädel, du bist noch genauso irre wie früher.«
Ich will das nicht hören, stürze an ihm vorbei, zurück ins Haus. Keine Sekunde länger kann ich hierbleiben. Meine Tasche, wo ist meine Tasche? Ich werde sie holen und dann von hier verschwinden.
Für immer!
»Mel-Schätzchen, da bist du ja! Komm, setz dich zu uns! Wir unterhalten uns gerade über Papa. Du warst doch sein Liebling, also erzähl doch bitte etwas Nettes über ihn!«
Die Luft ist stickig hier drin. Zu viele Menschen. Warum gehen sie nicht endlich? Was haben sie hier zu suchen? Papa ist tot, da hilft es auch nicht, etwas Nettes über ihn zu sagen.
»Mir fällt nichts ein«, will ich ihrer Bitte ausweichen, weiß aber, dass es keinen Sinn hat. Denn meine Mutter ist daran gewöhnt, dass man ihren Wünschen nachkommt. Jeder, der es bisher wagte, ihr etwas abzuschlagen, musste mit den Konsequenzen leben, die von Nervenzusammenbrüchen bis Selbstmorddrohungen reichten. In dieser Familie sind alle darauf konditioniert, Mutters Wünsche zu respektieren. Auch ich.
Deshalb schlurfe ich widerwillig zur Couch, quetsche mich zwischen Tante Claudia und meine Mutter, hole tief Luft und ...
Mir fällt wirklich nichts ein. Aus purer Verzweiflung schnappe ich mir den Teller vom Tisch, auf dem immer noch jenes Kuchenstück liegt, das ich vorhin nicht essen konnte. Auch jetzt habe ich keine Lust darauf, aber vielleicht lenkt es meine Mutter ab.
»Mmh, ist der lecker! Wer hat den gebacken?«
Tante Claudia neben mir hebt lächelnd den Zeigefinger. Ich könnte ihr eines meiner Haare darum wickeln.
»Mama, wo hast du eigentlich meine Tasche hingestellt?«
Mutter starrt mich an. Ich weiß, was in ihrem perfekt frisierten Kopf vorgeht. Sie will, dass ich etwas Nettes über Papa sage. Doch jetzt lamentiert Tante Claudia über ihren Kuchen, erläutert die Zutaten, erklärt bis ins Detail, wie sie ihn gebacken hat. Ein neues Rezept aus diesem Internet.
Viele am Tisch schauen skeptisch. Sie sind zu alt, um das Internet zu kennen. Meine Schwester nutzt diesen vermaledeiten Umstand, die Unterhaltung zu unterbrechen und damit Tante Claudia die Show zu stehlen. Das macht sie immer so. Genau wie Mutter. Diese ringt um ihre Fassung. Am liebsten würde sie jetzt Migräne bekommen oder theatralisch in Ohnmacht fallen, nur um im Mittelpunkt zu sein. Stattdessen hat sie offenbar einen anderen Plan. Sie steht auf, streicht sich das Kleid glatt, prüft mit geübtem Handgriff, ob ihre Frisur noch sitzt, und verschwindet im ersten Stock, wo früher unsere Kinderzimmer waren. Das meiner Schwester dient heute als Wäscheraum, meins wurde umfunktioniert zu einem privaten Wellnesstempel. Gleich nach meinem Auszug musste Papa die Wand zum Bad herausreißen, alles frisch renovieren und eine Sauna bauen, wo einst mein Bett stand. Alles, was ich bei meinem Auszug nicht mitgenommen habe, landete in der Altkleidersammlung oder auf dem Sperrmüll.
Nichts von mir ist übrig in diesem Haus.
Ich bin nicht traurig darüber.
»Schätzchen, schau mal, was ich für dich habe!«
Mutter ist zurück. Sie hält einen Karton in der Hand, den ich erkenne. Als kleines Mädchen habe ich Schuhkartons mit buntem Papier und glitzernden Pailletten beklebt, um darin alles Mögliche aufzuheben. Einen dieser Kartons stellt Mutter nun neben den Kuchenteller auf den Couchtisch. Mit einem strahlenden Lächeln nimmt sie den Deckel ab und schiebt ihn unter den Karton. »Ich hätte dir das auch schicken können, aber irgendwie dachten wir, dass es schöner wäre, wenn du die Sachen hier an dich nimmst.«
Welche Sachen? In dem Karton liegt nur altes Zeug. Eine Puppe, Tagebücher, mein erstes Handy. Was soll ich damit? Alles, was ich brauche, habe ich in meinem Apartment in New York City. Zum Glück geht morgen mein Flug nach Hause. Wenn ich endlich weiß, wo Mutter meine Tasche hingestellt hat, könnte ich mir ein Taxi rufen und irgendwo in Flughafennähe ein Hotelzimmer mieten. Ich muss hier weg, und zwar schleunigst!
»Das Handy habe ich versucht aufzuladen.«
Hat sie das gerade wirklich gesagt? Dieses blöde Handy ist fünfzehn Jahre alt! Was soll ich damit?
Mutter stellt mir den Karton auf den Schoß. Da ist dieses Drängen in ihrer Aura, das ich früher schon hasste. Immer muss es nach ihrem verdammten Willen gehen. Alle am Tisch schauen mich an, nein, sie glotzen. Hässliche Fratzen. Penetrant.
Was wollen sie von mir?