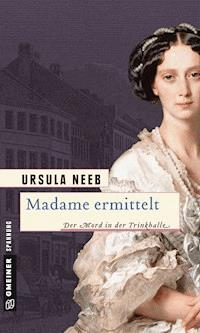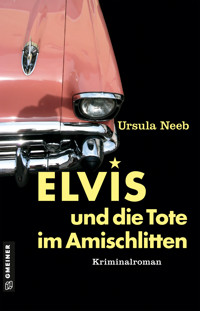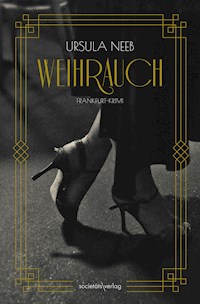Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dichterin Sidonie Weiß
- Sprache: Deutsch
Frankfurt, 1836. Eine Serie von Giftmorden an jungen Dienstmädchen, die alle nebenbei der Prostitution nachgingen, lässt die heile Fassade der Stadt am Main bröckeln. Augenzeugen haben keine Zweifel, dass der Täter der besseren Gesellschaft angehört. Der ebenso verschlafenen wie korrupten Polizeibehörde unter der Leitung von Oberinspektor Brand gelingt es aber nicht, dem Mörder auf die Spur zu kommen. Nach dem Dafürhalten von Presse und Obrigkeit handelte es sich bei den Opfern ohnehin um „liederliche Weibsbilder“, deren schlimmes Ende nicht verwunderlich sei. Empört über so viel Unfähigkeit und Ignoranz beginnt die Frankfurter Dichterin Sidonie Weiß, gemeinsam mit ihrem Jugendfreund Johann Konrad Friedrich, auf eigene Faust in den mysteriösen Mordfällen zu ermitteln. Unterstützung finden die beiden bei dem Arzt und städtischen Leicheninspektor Heinrich Hoffmann. Ihre Nachforschungen führen Fräulein Sidonie, Johann und Doktor Hoffmann in die Salons des großbürgerlichen Frankfurts, aber auch in die schäbigen Dachkammern der Dienstboten …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Ursula Neeb
Madame empfängt
Historischer Roman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 MeßkircH
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Katja Ernst
Korrekturen: Doreen Fröhlich, Katja Ernst, Sven Lang
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung des Bildes
»Louise de Broglie, Contesse d’Haussonville«
von Jean-Auguste-Dominique Ingres,
http://www.wikipedia.org
ISBN 978-3-8392-3472-3
Widmung
Für Markus und Mocho.
»Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag: Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache; das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker.«
(Georg Büchner ›Der Hessische Landbote‹,
Darmstadt 1834)
Prolog
Vor einigen Jahren noch eine malerische Gartenlandschaft, lediglich durchsetzt von den einfachen Behausungen der Erwerbsgärtner, war das Frankfurter Westend längst zu einem begehrten Wohnquartier der Wohlhabenden geworden. Schmucke Sommerhäuser verdrängten nach und nach die Katen der Gärtner und entwickelten sich rasch zu prachtvollen Wohnpalästen, die von ihren Eigentümern dauerhaft genutzt wurden.
Die Innenstadt, und erst recht die Altstadt, war für die besseren Leute keine Wohngegend mehr. Dort waren die Straßen oft sehr schmutzig, an manchen Stellen konnte man keinen Schritt tun, ohne sich die Hosen oder den Rocksaum mit Kot zu beschmutzen, und es stank barbarisch. Die Einwohnerzahl Frankfurts stieg beständig, in bestimmten Bezirken der Altstadt lebten nur noch arme Leute mit vielen greinenden Plagen, und der Lärmpegel war entsprechend.
Hier draußen im Grünen dagegen konnte man frische Landluft atmen, und die Nachbarschaft hatte klangvolle Namen wie Rothschild, Gontard, Passavant und Brentano. In den Häusern pflegte man die gehobene Gastlichkeit in Form von exquisiten Diners, vornehmen Soireen und glanzvollen Bällen. Und bei aller Pracht durfte die Behaglichkeit des Biedermeiers nicht fehlen, der man im privaten Kreis der Familie und enger Freunde bei Hausmusik huldigte.
In diesem Geiste fand sich am Abend des 20. Juli 1832, in einer Villa in der Bockenheimer Chaussee Nummer 14, unweit des Palais Rothschild, eine kleine Abendgesellschaft zusammen. Prachtvolle Equipagen fuhren über die gewundene, weiß gekieste Auffahrt bis vor ein in blassem Pistaziengrün gehaltenes Gebäude im klassizistischen Stil. Damen und Herren in Abendrobe begaben sich über eine marmorne Freitreppe zum Portal, wo sie von Dienstboten empfangen und zur Gartenterrasse geleitet wurden. Zu beiden Seiten der ovalen Terrasse luden Arkaden mit duftenden Kletterrosen zum Lustwandeln ein. Vor der Veranda befand sich ein Springbrunnen aus milchblauem Carrarischem Marmor mit einer Nachbildung der auf einem Panther ruhenden Ariadne. Der weitläufige englische Garten verfügte über alten Baumbestand.
Die hohen Fenster im Erdgeschoss waren vom Gaslicht der Kristalllüster hell erleuchtet. Die gläserne Flügeltür des Salons war weit geöffnet, weiße Chiffongardinen bauschten sich im Abendwind. In dem quadratischen Raum mit glänzendem Parkett war alles in einem Weiß gehalten, das ins Graue ging. Das Mobiliar war gediegen, kühl und vornehm. Auf verschiedenen Kommoden und zierlichen Tischen von schlichter Eleganz standen Blumenvasen mit duftenden Rosenbuketts. Im Halbkreis um einen Klavierflügel waren Stühle im Biedermeierstil angeordnet.
Ein Dutzend Damen und Herren, auch einige Kinder und Jugendliche, hielten sich im angrenzenden Garten und auf der Terrasse auf. Die Damen trugen Abendkleider aus schillernden Seidenstoffen mit voluminösen, ballonartigen Ärmeln in allen erdenklichen Varianten. Die Frisuren waren kunstvoll mit Bändern und Schleifen geschmückt. Manche weibliche Gäste hielten, obgleich ihre Häupter von Hauben ähnlichen Hüten bedeckt waren, zierliche Sonnenschirme in den Händen. Die Herren trugen Frack und Zylinder und trotz der sommerlichen Temperatur enggeschnürte Hemdkragen mit dunklen Krawatten. Viele hatten Oberlippen- oder Kinnbärte und lange Koteletten.
Die Erwachsenen tranken Champagner und Erdbeerbowle, die Kinder Waldmeisterlimonade, und alle genossen den lauschigen Sommerabend inmitten der idyllischen Umgebung. Überall im Garten blühten Rosen und verströmten einen zauberhaften Duft.
Nach einer Weile unterbrach die Gastgeberin die angeregte Konversation der Anwesenden durch ein Händeklatschen und forderte die Gäste damit höflich auf, sie in den Salon zu begleiten. Die kleine Abendgesellschaft war bereits in bester Champagnerlaune. Das Motto des Abends, von der Dame des Hauses mit wohlgesetzten Worten verkündet und passend zur Jahreszeit der Rose gewidmet, wurde mit freudigem Applaus begrüßt. Nachdem verschiedene junge Leute vor das Publikum getreten waren, um ausgewählte Rosengedichte berühmter Dichter vorzutragen, erhob sich die Gastgeberin von ihrem Stuhl, verbeugte sich vor der Runde und begab sich an den Flügel, um, wie sie einleitend bemerkte, sich selbst beim Vortrag des vertonten Gedichts ›Unsterblich verliebt‹ der Frankfurter Dichterin Sidonie Weiß zu begleiten:
»In weiter Ferne,
dem Blick fast verborgen,
ein Wetterleuchten, verhalten nur blitzt es
in den Augen des Veilchens
beim Anblick der Rose,
was ihm oft so fremd, sie besitzt es.
Sie vergisst alle Pose,
möchte nur noch verweilen
bei ihm, wird ganz sanft, fast bescheiden
und öffnet sich schimmernd, doch übersieht,
dass blaue Blumen sich verschließen,
wenn eine Rose für sie blüht.
Sie bleiben sich fern
und sind doch so verwoben,
eine seltsame Hochzeit, die sich hier hat vollzogen:
Von denen, die sich schätzen
und sich liebgewonnen
und trotzdem nie zusammenkommen.
Ein Zauber bleibt, der sie stets umhüllt,
weil nichts vergehen und welken kann,
was sich nie erfüllt.1«
Mit ihrem zarten Porzellanteint und den silberblonden, schlicht im Nacken zusammengesteckten Haaren war die Gastgeberin eine Dame von klassischer Schönheit. Ihre angenehme Altstimme und das wohltönende Klavierspiel waren von ungekünstelter Eleganz. Kurz vor dem Ende ihrer Darbietung jedoch begann die Dame wild mit den blassblauen Augen zu rollen, die immer größer zu werden, ihr fast schon aus den Augenhöhlen zu quellen schienen und sich zunehmend verdunkelten. Was hatte das zu bedeuten? Ein solches Gebaren passte mitnichten zu ihrem Vortrag und mutete in Anbetracht der poetischen Verse geradezu grotesk an. Kaum war der letzte Ton verklungen, sprang sie, ohne noch den Beifall abzuwarten, mit irrem, gehetztem Blick von ihrem Klavierschemel auf und stürzte in offenkundiger Panik unter schrillen, hysterischen Schreien wie eine Tobsüchtige in den Garten. Ihr Gatte, gefolgt von einer Gruppe alarmierter Gäste, eilte der Verzweifelten hinterher und konnte seine in panischer Angst im Garten herumirrende Ehefrau einfach nicht beruhigen.
Immer wieder stammelte sie, sie könne nicht mehr richtig sehen, alles komme in großen Wellen auf sie zu und drohe sie zu verschlingen, alles werde immer schwärzer und von den Bäumen tropfe Blut, was sie erneut verzweifelt aufschreien ließ. Während der besorgte Ehemann, der einen derartigen Ausbruch bei seiner stets so beherrschten Gemahlin noch niemals erlebt hatte, einen der Diener damit beauftragte, schleunigst den Hausarzt herbeizuholen, versuchten die anderen Helfer, die inzwischen in konvulsivischen Zuckungen sich windende Frau ruhig zu halten. Nachdem diese immer wieder in schlimmster Todesangst um ihr Laudanum gebettelt hatte und eine Bedienstete mit dem Fläschchen in den Händen vom Haus herbeigeeilt war, versuchte einer der Helfer, der Krampfenden behutsam einige Tropfen davon einzuflößen, doch ehe er dazu kam, entriss ihm die Tobende die Phiole, führte sie sich selbst mit bebenden Händen an den Mund und trank sie fast zur Hälfte leer. Doch schien ihr das Opiat keine Beruhigung zu verschaffen, im Gegenteil, ihre Krämpfe und Zuckungen wurden immer heftiger, und sie verfiel in ein wahnsinniges Wimmern. Erst, als endlich der Arzt eintraf und der Dame eine hoch dosierte Bromlösung injizierte, beruhigte sie sich allmählich. Die Krämpfe und ihre entsetzlichen Schreie ließen nach und wurden von einer für die Kranke wie für alle Anwesenden wohltuenden Bewusstlosigkeit abgelöst. Sie wurde in ihr Schlafgemach gebracht und aufs Bett gelegt. Dort untersuchte sie der Arzt noch einmal genauer, fühlte den Puls, hob ihre Lider an und leuchtete immer wieder in die Augen. Die Pupillen waren so geweitet, dass sie nahezu die ganze Iris mit ihrer Schwärze bedeckten, und zogen sich trotz des Lichtstrahls nicht zusammen. Nachdem der Doktor dem Ehemann noch einige Fragen zu dem Anfall seiner Frau gestellt hatte, schüttelte er besorgt und gleichermaßen irritiert den Kopf und kam auf das wiederholte Drängen des Hausherrn nicht umhin, eine schwere Belladonna-Vergiftung2 zu diagnostizieren.
1
Frankfurt am Main, vier Jahre später:
Am Samstagnachmittag des 25. August 1836 verließ das Dienstmädchen, Gerlinde Dietz, gegen halb eins ihre Kammer im Dachgeschoss der Villa Saltzwedel am Schaumainkai 15 des Sachsenhäuser Mainufers und stieg, beladen mit einem schweren Korb und einem großen Paket, die Dienstbotentreppe hinunter bis zum Erdgeschoss. Vor der Flügeltür des großen Salons, wo ihre Herrschaft nach dem Mittagessen gerade den Kaffee nahm, machte sie Halt, stellte ihr Gepäck ab und klopfte an. Als sie aufgefordert wurde, einzutreten, öffnete die junge Frau die Tür, knickste artig vor dem Apotheker, Ottmar Saltzwedel, und seiner Gattin Pauline, der sie als Kammerzofe diente, und verabschiedete sich. Nachdem sie sich noch einmal in aller Ergebenheit für den freien Nachmittag bedankt hatte, versprach sie, pünktlich um halb sieben wieder zurück zu sein. Es war ein heißer Sommertag, und die zierliche, dunkelhaarige Frau eilte am Mainufer entlang in Richtung Offenbach, um ihre beiden Söhne zu besuchen, die sie dort zu einer Tante in Pflege geben musste, weil sie sonst ihre Stellung nicht hätte antreten können. Sie freute sich so sehr auf die Kinder, dass ihr Herz vor Sehnsucht schier bersten wollte. Für Gerlinde war es ein Kreuz, dass sie die beiden so selten sehen konnte, und sie merkte, wie ihr vor Traurigkeit darüber die Tränen kamen. Doch sie vertrieb ihre Wehmut und schritt stattdessen noch rascher aus. Der Korb war voller Lebensmittel, die sich die junge Frau vom Munde abgespart hatte, denn die Dienstbotenkost im Hause Saltzwedel war recht kärglich. In dem Karton befanden sich Geschenke: ein Holzpferdchen auf Rädern an einer Schnur für den dreijährigen Anton, ein Steckenpferd für den fünfjährigen Robert und ein Stück Lavendelseife für die Tante. Gerlinde selbst zählte gerade einmal 20 Jahre. Sie war eine hübsche Frau mit dunkelbraunen Locken, großen samtigen Augen und einem frischen, hellen Teint. Wie immer an ihren freien Nachmittagen hatte sie sich auch heute fein herausgeputzt und trug ein fesches, geblümtes Sommerkleid mit Bändern und Rüschen und einen fliederfarbenen Strohhut mit einem hübschen Veilchenbukett.
In ihrem jungen Leben waren ihr schon zahlreiche Widrigkeiten begegnet, allen voran die Verachtung, die ihr als lediger Mutter immerzu entgegenschlug.
Gerlinde entstammte einer rechtschaffenen Frankfurter Handwerkerfamilie. Ihren Eltern, einfachen und frommen Leuten, war das Ansehen in der Nachbarschaft heilig. So heilig, dass sie ihre hochschwangere Tochter verstießen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Kindsvater, ein junger Maurergeselle und Luftikus, das Weite gesucht und Gerlinde im Stich gelassen hatte. Gerlinde hatte große Schande über die Familie gebracht und verhielt sich auch sonst verstockt und uneinsichtig. Sie weigerte sich, die Empfehlung ihrer Mutter und anderer wohlmeinender Verwandter zu beherzigen, eine Engelmacherin aufzusuchen, und war auch nicht bereit, ihren Säugling nach der Geburt freizugeben und der städtischen Fürsorge zu überlassen. Einzig ihre Tante Emilie Dietz, eine alleinstehende Schneiderin aus Offenbach, kümmerte sich um ihre Nichte und nahm die ledige Mutter mit ihrem Kleinkind bei sich auf. Mehr schlecht als recht schlugen sich die beiden Frauen durch, zumal Gerlindes Eltern, die mit ihrem Enkel, dem entehrenden Sprössling, nichts zu tun haben wollten, der gefallenen Tochter keinerlei Unterstützung zukommen ließen. So kam es der jungen Mutter sehr gelegen, als sie schließlich einen gestandenen Mann kennenlernte, der es ehrlich mit ihr zu meinen schien, und bereit war, sie trotz des unehelichen Kindes zu heiraten. Deswegen mochte sie sich dem jungen Soldaten auch nicht bis nach der Hochzeit versagen und gab seinem Drängen nach. Kurze Zeit später, Robert war gerade zwei Jahre alt, war Gerlinde wieder schwanger und ihr Heiratskandidat über alle Berge. Genau wie bei ihrem ersten Kind obsiegte bei der jungen Frau trotz aller Verzweiflung und Not auch dieses Mal die Mutterliebe, und sie entschloss sich, das Kind auszutragen und großzuziehen. Als Gerlinde nicht mehr ein und aus wusste, ersuchte sie die öffentliche Wohlfahrt der Stadt Offenbach um Hilfe. Auch hier stieß sie auf Verachtung und Vorwürfe. Das hätte sie sich früher überlegen sollen, was sie sich und ihren armen Kindern durch ihren Frevel zufügen würde, musste sie sich von dem selbstgerechten Beamten sagen lassen. Und wenn sie es nicht schaffe, dann müsse sie halt ihre Kinder in ein Waisenhaus geben, beschied der Amtmann barsch. Als die junge Frau daraufhin entsetzt ausrief, niemals werde sie ihre Kinder weggeben, musste die tapfere junge Mutter dem verknöcherten Bürovorsteher doch einen gewissen Respekt abgenötigt haben, denn er bewilligte ihr immerhin eine kleine Beihilfe, die den Aufwendungen einer Amme im Fürsorgeheim entsprach. Gerlinde war überglücklich über diese Zuwendung, musste aber bald feststellen, dass das Geld dennoch nicht ausreichte. Sie wusch und putzte in den besseren Häusern der Nachbarschaft und war sich für keine Arbeit zu schade, denn ihren Söhnen sollte es an nichts fehlen.
Ohnehin hatten es die Kleinen nicht leicht. Als uneheliche Kinder waren sie, genau wie ihre Mutter, mit einem unauslöschlichen Makel behaftet, und man pflegte sie in der Nachbarschaft mehr oder weniger direkt als Bankerte und Bastarde zu bezeichnen. Gerlinde blutete das Herz, wenn den Buben so etwas widerfuhr, und sie litt dann immer unter bohrenden Schuldgefühlen, die sie durch besondere Fürsorglichkeit zu lindern suchte. Glücklicherweise hatte sie inzwischen eine gute Stellung in Frankfurt und konnte wenigstens einen Großteil der Unterhaltskosten für die Kleinen bestreiten. Um den Rest aufzubringen und den Buben auch mal ein kleines Geschenk machen zu können, ging sie zudem seit einiger Zeit einem Nebenerwerb nach, von dem allerdings niemand etwas wissen durfte.
Als sie vor gut einem Jahr ihre Stellung in Frankfurt angetreten hatte, lernte Gerlinde auf dem Roßmarkt die Blumenverkäuferin Cornelia Brendel kennen, die dort einen kleinen Verkaufsstand betrieb. Die gleichaltrige junge Frau verhielt sich Gerlinde gegenüber sehr freundlich, war stets guter Dinge und immer zu einem Plausch aufgelegt. Gerlinde, die sich in Frankfurt recht einsam fühlte und ihre beiden Jungen sehr vermisste, war froh über etwas Ansprache, und so spielte es sich bald ein, dass Gerlinde, wenn sie in der Frankfurter Innenstadt Einkäufe zu erledigen hatte, die Blumenverkäuferin an ihrem Stand besuchte, und oft schenkte ihr Nelly, wie sie von allen genannt wurde, ein hübsches Blumensträußchen oder ein Stück selbstgebackenen Kuchen. Gerlinde fand bald Zutrauen zu der aufgeschlossenen Frau, erzählte von ihren Buben, von ihrem schweren Stand als ledige Mutter, die ganz allein für ihre Kinder aufkommen musste. Sie redeten auch über Herzensdinge. Gerlinde sprach mit Nelly über die Väter ihrer Söhne, die sie so schwer enttäuscht hatten, dass sie für den Rest ihres Lebens die Nase von Männern gestrichen voll habe. Nelly lachte daraufhin und erklärte, ihr ginge es genauso. Sie brauche schon lange keinen Kerl mehr, der sich auf ihre Kosten besaufen und sie als Dank dafür bei jeder Gelegenheit verdreschen und betrügen würde, wie sie das schon so oft erlebt habe. Sie käme ohne Mann besser über die Runden, und ihr fehle es an nichts. Männer seien für sie nur noch geschäftlich von Interesse, hatte sie hinzugefügt und Gerlinde dabei tief in die Augen geblickt. Gerlinde hatte sich zunächst nichts dabei gedacht und war der Meinung, Nelly meine damit ihre männliche Kundschaft. Die Blumenhändlerin war immer gut gekleidet, und Gerlinde ging davon aus, dass ihr Gewerbe entsprechend lukrativ sein müsse. Manches Mal, wenn sie sich bei Nelly am Blumenstand aufhielt, war ihr aufgefallen, wie Herren Blumen kauften und Nelly dann mit ihnen ein Stück zur Seite trat, mit ihnen tuschelte und Geld zugesteckt bekam. Immer wieder kam es vor, dass auch junge Frauen, meist Dienstmägde, an Nellys Blumenstand kamen und mit der Inhaberin flüsterten.
Eines Tages hatte Nelly Gerlinde anvertraut, dass sie bereits als 13-Jährige ihr eigenes Geld verdiente, indem sie Lebkuchen und Backwaren auf den Straßen und Anlagen verkaufte, und zuweilen habe sie sich auf ihren Touren auch gut betuchten Herren für Geld hingegeben. Gerlinde reagierte tief betroffen und machte keinen Hehl daraus, wie sehr sie die käufliche Liebe verachtete. Nelly hielt der Freundin entgegen, dass die Männer sie, Gerlinde, doch ebenfalls nur benutzt hätten, um die Lust an ihr zu stillen, nur dass letztendlich sie selbst die Dumme gewesen sei, die einen hohen Preis dafür gezahlt habe. Das wäre aber auch andersherum möglich. Sie solle doch einmal die Augen aufmachen. Viele Mägde gingen an ihren freien Tagen einher wie feine Damen, angetan mit seidenen Kleidern und feschen Hüten, die sie sich von ihren armseligen Löhnen gar nicht leisten könnten. Oft handele es sich dabei um Geschenke ihrer Dienstherren, mit denen sie ein Liebesverhältnis unterhielten, denn es sei schließlich ein offenes Geheimnis, dass mancher Ehemann aus vornehmen Kreisen seine Magd mehr liebe als seine Gattin – was längst nicht immer auf Gegenseitigkeit beruhe. Und dadurch wären manche Dienstmädchen ein Stück schlauer geworden und hätten sich gedacht, wenn sie sich schon von den Herren des Hauses oder ihren heranwachsenden Söhnen immer betatschen lassen müssten, dann könnten sie das auch auf eigene Rechnung tun, und seien dazu übergegangen, sich mit ihren Gefälligkeiten ein lukratives Zubrot zu verdienen. Zumal viele von ihnen mit unehelichen Kindern oder stellungslosen Ehemännern belastet seien, die sie mit ernähren müssten, was sie, wie Gerlinde ja wisse, von ihren kargen Einkünften ohnehin nicht bestreiten könnten. Gerlinde solle sich doch einmal in Ruhe überlegen, ob sie das nicht auch machen wolle. Sie wäre ihr auch gerne dabei behilflich und würde dafür Sorge tragen, dass Gerlinde es nur mit ausgesuchten Herren zu tun bekäme, die sehr gut zahlen würden. Denn sie sei sich sicher, dass Gerlinde mit ihrem anziehenden Äußeren fantastisch verdienen würde. Außerdem könne man das alles so diskret handhaben, dass niemand etwas davon zu erfahren brauche, was im Übrigen auch ganz im Sinne der Kundschaft sei.
Gerlinde, die lange über Nellys Vorschlag nachgedacht hatte, war zu dem Schluss gekommen, dass sie, was ihr Ansehen anbetraf, sowieso nichts mehr zu verlieren hatte, und sich schließlich bereit erklärt, es auf einen Versuch ankommen zu lassen. Sie konnte sich noch genau an dieses erste Stelldichein erinnern und wie sehr sie sich vor dem Freier geekelt hatte. Später in ihrer Kammer hatte sie sich am ganzen Körper so lange mit Kernseife abgeschrubbt, bis ihre Haut ganz rot geworden war, und trotzdem hatte sie das Gefühl gehabt, immer noch den Geruch des Mannes an sich zu haben. Doch die 40 Kreuzer waren schnell verdientes Geld, das sie dringend gebrauchen konnte, und einzig deshalb hatte sie weitergemacht, auch wenn sie sich immer noch ganz entsetzlich dafür schämte, dass ihre Söhne eine Hure zur Mutter hatten.
Und so ging es jetzt schon seit fast einem Jahr: An ihren freien Tagen traf sich Gerlinde mit Herren. Nelly vereinbarte am Blumenstand Ort und Uhrzeit für das Rendezvous und teilte es Gerlinde mit. Leider hatte die junge Mutter dadurch noch weniger Zeit für ihre Kinder, doch sie kam wenigstens nicht mehr mit leeren Händen und wusste, dass sie genug zu essen hatten und anständig gekleidet waren.
Als Gerlinde das große Mietshaus in der Offenbacher Luisenstraße erreichte, wo ihre Tante im zweiten Stockwerk ihre kleine Wohnung und Änderungsschneiderei hatte, war es, obwohl sie so schnell gelaufen war, dass sie ins Schwitzen gekommen war und Seitenstechen hatte, schon ein Uhr, und in drei Stunden musste sie wieder in Frankfurt sein. Die Nelly hatte ihr vorgestern noch gesagt, sie solle sich pünktlich um vier im Weingarten des Herrn Adam auf dem Klapperfeld einfinden, sich separat an einen Tisch setzen, ein Veilchenbukett am Hut tragen und warten, bis sie angesprochen werde. Es sei ein feiner Pinkel, und er zahle sehr gut, 50 Kreuzer hätten sie ausgemacht.
Sie hatte also gerade einmal zweieinhalb Stunden Zeit für ihre Buben, und trotzdem war die Freude groß, als sie sie kurze Zeit später in die Arme schließen und ihnen die Mitbringsel übergeben konnte. Auch die Tante freute sich über die feine Lavendelseife und hatte, wie jeden Samstagnachmittag, wenn ihre Nichte zu Besuch kam, einen Kuchen gebacken und Kaffee gekocht. Die Frauen unterhielten sich, Gerlinde spielte und tobte mit ihren Jungen und wurde nicht müde, die beiden zu herzen und zu küssen, und war einfach nur glücklich. Die Zeit verging jedoch wie im Flug, und schweren Herzens musste sie sich um kurz vor halb vier von den Kindern verabschieden. Es war jeden Samstag das Gleiche mit ihnen: Wenn die Mutter kam, freuten sie sich wie die Schneekönige und jauchzten vor Glück über die Geschenke, wenn Gerlinde dann gehen musste, waren sie zu Tode betrübt und heulten jämmerlich. Gerlinde, der ebenfalls immer die Tränen kamen, versuchte tapfer zu sein und tröstete die Buben mit dem Versprechen, am nächsten Samstag wiederzukommen und ihnen etwas Hübsches mitzubringen.
Während Gerlinde am Mainufer entlang in Richtung Frankfurt hastete, spürte sie die ganze Zeit einen Kloß im Hals. Am liebsten hätte sie sich in ein stilles, schattiges Eckchen am malerischen Mainufer zurückgezogen und sich ihrer Traurigkeit hingegeben. Nicht nur der Abschied von den Söhnen schmerzte sie in der Seele, sondern auch der Anblick der zahlreichen glücklichen Paare, die, einander untergehakt und mit ihren fröhlichen Kindern an den Händen, bei dem schönen Wetter einen Sommerspaziergang machten. Nur sie war auf sich gestellt und musste sich, anstatt bei ihren geliebten Buben bleiben zu dürfen, nun wieder mit einem wildfremden Mannsbild einlassen, vor dem es sie schon jetzt grauste. Aber sie brauchte das Geld, also musste sie sich zusammennehmen und durfte sich ihre Schwermut auf keinen Fall anmerken lassen. Sie schluckte ihre Tränen herunter und dachte wie so oft über ihren Plan nach, den sie vor einigen Monaten gefasst hatte: Sie würde sich weiterhin so gut es ging Geld zurücklegen, um sich in zwei, drei Jahren vielleicht eine Existenz als Putzmacherin aufzubauen. Sie wollte klein anfangen, in der Schneiderwerkstatt ihrer Tante, die ihr Stoffe und Dekorationen zuliefern könnte, und vielleicht würde sie es eines Tages sogar zu einem gut gehenden Laden mit Angestellten bringen, der sie alle ernährte, sodass sie nicht länger Dienstmagd sein müsste und ihren verhassten Nebenerwerb endlich loswürde. Und vor allem könnte sie dann wieder mit ihren Buben zusammenwohnen. Wäre das schön!
In solche Tagträume versunken, überquerte Gerlinde die Mainbrücke und ging durch die lange Fahrgasse, bis sie auf die Zeil stieß. Sie bog rechts in die Stelzengasse ab, lief an der nächsten Straßenecke links und erreichte rechter Hand endlich das Klapperfeld mit seinen vielen Gartenlokalen, die an dem herrlichen Wochenende voll gutgelaunter Gäste waren. Auch der Weingarten des Herrn Adam war gut besucht. Der Wein war eher mäßig, dafür aber billig, und an den Wochenenden wurde zum Tanz aufgespielt. Die einfachen Leute aus der Nachbarschaft nutzten den Garten als Stammlokal, und auch viele Dienstmädchen und Handwerksburschen verkehrten hier an ihren arbeitsfreien Tagen. Gerlinde hatte kürzlich mit einer jungen Frau namens Irmgard ein Glas Wein hier getrunken. Wie es der Zufall wollte, saß Irmgard mit einer Gruppe anderer Dienstmägde an einem Tisch und winkte Gerlinde zu. Die Frauen begrüßten sich, und Gerlinde wurde von Irmgard eingeladen, sich zu ihnen zu gesellen, was sie mit der Erklärung, sie habe gleich eine Verabredung, bedauernd ablehnte. Die Absage wurde von Gerlindes Bekanntschaft ohne großes Aufhebens akzeptiert. Irmgard war ebenfalls Gelegenheitsprostituierte und über Gerlindes Nebenerwerb im Bilde. Die beiden hatten sich an Nellys Blumenstand kennengelernt und bald darauf hier wiedergetroffen.
Gerlinde fand am Rande des Weingartens noch einen freien Tisch, an dem sie Platz nahm. Sie bestellte ein Glas säuerlichen Frankfurter Wein und hörte, dass es vom benachbarten Uhrtürmchen an der Friedberger Anlage vier Uhr schlug. Angespannt blickte sie sich um. Der kleine Tanzboden war voller Paare. Junge Gesindemägde und Wäscherinnen in geblümten Sommerkleidern tanzten mit Schneidergesellen oder Friseurgehilfen. Überall sah man verliebte Pärchen beim Turteln. Zuweilen zogen sich die Liebesleute in den verwinkelten Garten zurück, um sich im Schutz des Dickichts dem Liebesspiel hinzugeben. Viele der jungen Leute kannten sich untereinander und waren befreundet, das knappe Zehrgeld wurde zusammengelegt, und man machte sich einen vergnügten Nachmittag. Nicht wenige der Gäste waren bereits in angetrunkener Stimmung. Einzelne Frauen waren auffällig herausgeputzt. Sie trugen modische Kleider und ausgefallene Hüte wie Damen der besseren Gesellschaft. Gerlinde vermutete, dass es sich bei ihnen entweder um Mägde handelte, die wie sie der Gelegenheitsprostitution nachgingen, oder um die heimlichen Geliebten wohlhabender Herren, denn vornehme Damen, da war sie sich sicher, würden sich hier nicht aufhalten. Bessergestellte Herren hingegen schon. Auch heute sah sie wieder einige gutbetuchte Herren, die es nach einem amourösen Abenteuer mit einem einfachen Mädchen gelüstete, nicht zuletzt, weil sie dieses Vergnügen nicht viel kostete. Gerlinde erkannte an einem der Tische einen korpulenten älteren Herrn, vor dem Irmgard sie das letzte Mal gewarnt hatte. Es handele sich bei ihm um einen gewissen Herrn von Uhland und er sei sehr reich. Regelmäßig verbringe er die Wochenenden hier und halte Ausschau nach hübschen jungen Dingern. Gerlinde solle bloß die Finger von ihm lassen und ihm einen Korb geben, falls er ihr einen Antrag machen würde. Der alte Knabe sei nämlich die Knickrigkeit in Person. Sie habe einmal den Fehler gemacht und war auf ihn hereingefallen. Er habe nur den billigsten Wein bestellt und um jeden Kreuzer mit ihr gefeilscht. Im Weingarten habe er deswegen auch längst seinen Ruf weg. Hier hieße er bei allen nur noch der ›Batzemann‹3, weil er, obgleich sehr wohlhabend, niemals mehr als sechs Kreuzer für ein Schäferstündchen auszugeben bereit war. Was an sich schon eine Zumutung, bei einem so unansehnlichen alten Zausel aber ohnehin die reinste Heimsuchung sei. Gerlinde erinnerte sich, wie sie mit Irmgard darüber gescherzt hatte, und musste auch jetzt schmunzeln, als sie den alten Geizhals sah. Ein Fehler, wie sich herausstellte, denn der ›Batzemann‹ erhob sich von seinem Platz und steuerte zielstrebig auf Gerlinde zu. Auch das noch!, dachte sie verärgert, als in nächster Minute ein ganz anderer Herr vor ihrem Tisch stand und sie mit gedämpfter Stimme ansprach: »Verzeihung, die Dame! Habe ich das Vergnügen mit Fräulein Gerlinde?«
»Ja, das bin ich«, erwiderte Gerlinde erschrocken und fühlte, wie sie rot wurde. Sie hatte den Mann überhaupt nicht kommen sehen. Wie ein Geist war er plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und füllte nun ihr Blickfeld mit seiner großen, hageren Gestalt aus. Er verbeugte sich und erkundigte sich höflich, ob er Platz nehmen dürfe. Während er sich gegenüber von Gerlinde niederließ, brachte der Kellner den Wein. Der Mann nestelte sofort nach seiner Brieftasche und beglich die Rechnung. Gerlinde beobachtete ihn verstohlen. Er schien noch jung zu sein, vielleicht in ihrem Alter, was jedoch schwer zu bestimmen war, denn er hatte einen dichten Backenbart, und seine Augen waren von einer dunkel getönten Brille verdeckt. Er war sehr elegant gekleidet und trug einen sandfarbenen leinenen Gehrock. Der lange, schmale Hals war bis zum Kinn von einem Vatermörderkragen umschlossen und mit einer kunstvoll geknoteten Krawatte verschnürt, die auf seine geblümte Seidenweste farblich abgestimmt war. Trotz der Hitze hatte er Handschuhe an und trug den Zylinder aus beigefarbenem Filz tief in die Stirn gezogen.
Ein feiner Pinkel, genau, wie Nelly gesagt hat, ging es Gerlinde durch den Sinn. Für eine Weile herrschte betretenes Schweigen und Gerlinde nippte verlegen an ihrem Wein. Dann räusperte sich der Mann, zückte eine goldene Taschenuhr und warf einen kurzen Blick darauf.
»Meine Liebe, was halten Sie davon, wenn wir in Bälde aufbrechen? Heute ist fürwahr ein herrlicher Tag, und wir könnten doch eine kleine Ausflugsfahrt unternehmen. Vielleicht über Bornheim bis zum Lorberg hin und dort den schönen Ausblick genießen. Und auf der Rückfahrt könnten wir noch irgendwo nachtmahlen. Sie haben doch hoffentlich genügend Zeit mitgebracht?«
»Um halb sieben muss ich wieder in Frankfurt sein, mein Herr!«
»Das sollte uns genügen. Nun denn, erheben Sie sich!«, drängte er zum Aufbruch. Gerlinde ließ ihr halbvolles Weinglas stehen und folgte dem Herrn nach draußen.
Der hat es aber eilig! Man hätte sich ja erst mal ein bisschen in Stimmung trinken können. Ein komischer Heiliger ist das. So rappeldürr und eine Stimme wie eine Frau. Die reinsten Steckenbeine hat der!
Gerlinde betrachtete die langen, dünnen Beine ihres Begleiters in den enggeschnittenen, hellgrauen Bügelhosen, die unter den Schuhen befestigt waren. Beim Hinausgehen tauschte sie noch einen vielsagenden Blick mit Irmgard, die ihr aufmunternd zunickte. Schweigend gingen sie zum nahe gelegenen Friedberger Tor, wo vor den Eingängen der Promenaden mehrere Kutschen und Droschken bereitstanden.
»Meine Liebe, wären Sie vielleicht so freundlich, schon eine Kutsche für unsere Zwecke anzumieten? Sagen Sie dem Kutscher, dass er uns zum Lorberg fahren möge und dass wir unterwegs nicht gestört zu werden wünschen. Sie wissen, was ich meine. Bezahlen Sie am besten im Voraus. Hier, das dürfte wohl genügen.« Der Mann gab Gerlinde einige Münzen und erklärte, er halte sich so lange im Hintergrund, und wenn sie alles erledigt habe, solle sie ihm einen Wink geben, er würde dann zusteigen. Als Gerlinde sich den Kutschen näherte, wurde sie von einem der Kutscher, der auf einem Kutschbock saß, mit anzüglichem Grinsen gefragt, ob sie denn wieder eine ›Porzellankutsche‹ benötige. Gerlinde kannte den Mann. Schon mehrfach hatte sie seine Kutsche für ein Rendezvous genutzt, ein in galanten Kreisen weitverbreiteter Brauch. Häufig standen Droschkenkutscher mit Kupplern und Prostituierten in Geschäftsverbindung. Gegen ein entsprechendes Trinkgeld stellten sie bereitwillig ihre Kutsche für ein Stelldichein von Hure und Freier zur Verfügung. Die Wagen waren eigens für solche Zwecke mit blickdichten Gardinen versehen, die man zuziehen konnte, und die Sitze waren besonders weich gepolstert. Auf Wunsch fuhren die Kutscher so langsam und sachte, als hätten sie zerbrechliches Porzellan geladen, weswegen eine solche Fahrt im Volksmund auch als ›Porzellanfuhre‹ bezeichnet wurde. Gerlinde trat an den Kutscher heran, bezahlte ihn und erteilte Anweisung, wohin es gehen sollte. Dann gab sie dem im Schatten eines Baumes wartenden Herrn ein Zeichen, dieser eilte herbei, und beide stiegen ein.
Gleich darauf setzte sich die Droschke in Bewegung, und der vornehme Herr zog sofort die Gardinen vor die Fenster. Im gedämpften Tageslicht saßen sich Gerlinde und ihr Freier im Kutscheninnern gegenüber. Die Stimmung war angespannt. Da zog der Mann ein kleines Päckchen aus seinem Gehrock und reichte es Gerlinde mit den Worten: »Ein kleines Präsent für Sie. Ich hoffe, Sie mögen Pralinen?«
»Vielen Dank, der Herr! Sehr freundlich. Ja, ich nasche für mein Leben gern«, bedankte sie sich artig und bewunderte die kleine Bonbonniere, die in Seidenpapier mit der Aufschrift der feinen Konditorei Krantz eingeschlagen war. Gerlinde freute sich tatsächlich über das nette Mitbringsel. Eine solche Freundlichkeit seitens eines Freiers hatte sie bisher noch nicht erlebt. Deshalb mochte sie ihm nun auch ein wenig entgegenkommen und setzte sich neben ihn. Sie schmiegte sich an ihn und erkundigte sich flüsternd nach seinen Wünschen. Der Mann zuckte zusammen und rückte zur Seite, als wäre ihm die Berührung unangenehm.
»Begebe sie sich doch bitte wieder auf Ihren Platz!«, maßregelte er Gerlinde in kaltem Tonfall, sie in der dritten Person ansprechend, wie man es Domestiken gegenüber für angemessen erachteteund fuhr, ein wenig milder werdend, fort: »Nichts für ungut, aber wir haben ja schließlich noch Zeit genug, und mit Verlaub, ich habe es auch nicht so eilig. Vielleicht können wir uns ja ein wenig unterhalten und, meine Liebe, Sie können doch einstweilen schon einmal von dem Konfekt kosten«, forderte er Gerlinde auf und lächelte sie zum ersten Mal an. Gerlinde erwiderte sein Lächeln und nickte zustimmend.
Was für ein Stockfisch! Dem muss man Zeit lassen. Das wird ein schweres Stück Arbeit werden!
Sie gelangte immer mehr zu der Überzeugung, dass es sich bei ihrem Begleiter um einen sehr schüchternen jungen Mann handeln müsse, der wahrscheinlich noch nie intimen Kontakt zu einer Frau hatte. Andererseits kam er ihr aber auch recht sonderbar vor, und es wurde ihr ganz mulmig in seiner Gegenwart. Mit dem lapidaren Gedanken, dass sie halt an ein verstocktes Söhnlein aus gutem Hause geraten war, rief sie sich wieder zur Räson und öffnete ihr Geschenk. Drei herzförmige Pralinen der Geschmacksrichtungen Nugat, Vollmilch und Zartbitter waren in der mit Spitzenpapier ausgelegten Schachtel angeordnet wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Auf einem rosafarbenen Deckblatt aus Seidenpapier befand sich in schwungvollen, goldenen Buchstaben die Aufschrift: ›Viel Glück!‹
Gerlinde war gerührt. »Das kann ich brauchen. Wie schön! Fast zu schade zum Aufessen«, bemerkte sie lächelnd und hielt ihrem Begleiter, bevor sie zugriff, die geöffnete Bonboniere hin. Der junge Mann lehnte höflich ab. Er mache sich nicht viel aus Süßigkeiten. Gerlinde hatte sich für die helle Nugatpraline entschieden. Während sie die Süßigkeit genüsslich auf der Zunge zergehen ließ, musste sie plötzlich an ihre Buben denken. Sie wird die restlichen Pralinen für die beiden aufheben und sie ihnen das nächste Mal mitbringen. Aber so gut schmeckt die Praline gar nicht, sie schmeckt irgendwie bitter, dachte sie dann bei sich.
Gerlinde spürte auf einmal ein unangenehmes Brennen und Kribbeln am ganzen Körper, und es wurde ihr so kalt, dass sie zu schlottern anfing. Mit klappernden Zähnen wollte sie ihren Begleiter um Hilfe bitten, doch sie brachte keinen Ton hervor. Sie kriegte kaum noch Luft und hatte das Gefühl zu ersticken. In wilder Panik wollte sie die Kutschentür öffnen, doch sie konnte sich nicht mehr rühren.
Gerlindes Todeskampf dauerte zehn Minuten. Bei vollem Bewusstsein durchlebte sie die schlimmsten Todesqualen. Sah mit schreckgeweiteten Augen, die ihre Pein nur allzu deutlich widerspiegelten, wie ihr Begleiter sie die ganze Zeit mit regem Interesse beobachtete, dass er einen Schreibblock gezückt hatte, auf dem er sich eifrig Notizen machte.
Das Letzte, was sie vor ihrem Tod wahrnahm, war die grausame Kälte, die von ihm ausging, und viel zu spät erkannte sie, dass es kein Mensch war, der mit ihr in der Kutsche saß, sondern eine Bestie. Eine Bestie ohne jegliches Mitgefühl.
2
Das Dienstmädchen, Gerlinde Dietz, wurde von dem Droschkenkutscher Heinrich Schuch am Samstagabend gegen halb sechs tot in der Kutsche aufgefunden. Der aufgeregte Mann entschied sich, die Polizei zu verständigen, und fuhr mit der Ermordeten in der Kutsche vom Lorberg zurück nach Frankfurt. Der Beamte, der an diesem Sommerabend in der Amtsstube der Hauptwache Dienst tat, reagierte unwillig auf Schuchs Anliegen: »Für Mord und Totschlag bin ich net zuständig«, erklärte er dem Droschkenkutscher bärbeißig.
»Und wer ist dafür zuständig?«, erkundigte sich Schuch.
»Der Herr Oberinspektor Brand, der ist aber momentan net da.«
»Und wo ist der Herr Oberinspektor? Hätten Sie vielleicht die Güte, ihn herzuholen? Ich hab nämlich da draußen eine Leiche in der Kutsche, und keine Lust, die noch ewig spazieren zu fahren!«, entgegnete der Droschkenkutscher aufgebracht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!