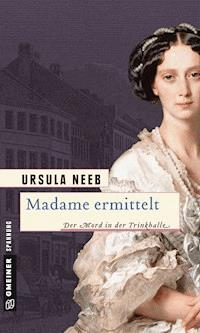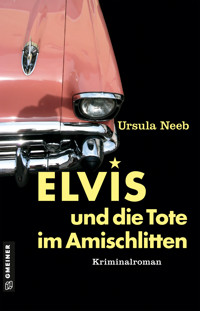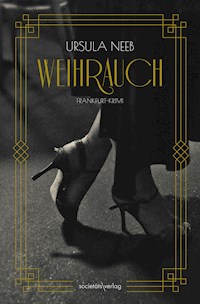4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kriminalfall für die Vorsteherin der Hurengilde Frankfurt am Main, 1522: Während der Herbstmesse wird die Stadt von einem Verbrechen erschüttert, das sich schon bald zu einer beängstigenden Mordserie auswächst. Die Opfer sind stets Frauen von Lutheranhängern. Der Mörder tötet mit sieben Dolchstößen, die an die sieben Schmerzen der Mutter Jesu erinnern. Handelt es sich bei ihm um einen geisteskranken Marienverehrer? Während sich die Stadt über diese Gräueltaten immer mehr zwischen Anhängern des alten Glaubens und den Reformierten zu spalten droht, versucht Ursel, die Vorsteherin der Hurengilde, einen kühlen Kopf zu bewahren. Nicht umsonst bittet die Obrigkeit ausgerechnet sie um Hilfe … doch der Mörder ist ihr bereits näher, als sie ahnt! Ein authentischer, fesselnder Historienroman, der das alte Frankfurt des 16. Jahrhunderts in all seiner Pracht und seinem Schrecken wiederaufleben lässt. Für Fans von Ulrike Schweikert und Astrid Fritz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankfurt am Main, 1522: Während der Herbstmesse wird die Stadt von einem Verbrechen erschüttert, das sich schon bald zu einer beängstigenden Mordserie auswächst. Die Opfer sind stets Frauen von Lutheranhängern. Der Mörder tötet mit sieben Dolchstößen, die an die sieben Schmerzen der Mutter Jesu erinnern. Handelt es sich bei ihm um einen geisteskranken Marienverehrer? Während sich die Stadt über diese Gräueltaten immer mehr zwischen Anhängern des alten Glaubens und den Reformierten zu spalten droht, versucht Ursel, die Vorsteherin der Hurengilde, einen kühlen Kopf zu bewahren. Nicht umsonst bittet die Obrigkeit ausgerechnet sie um Hilfe … doch der Mörder ist ihr bereits näher, als sie ahnt!
Über die Autorin:
Ursula Neeb wurde 1957 in Bad Nauheim geboren und studierte Geschichte, Kulturwissenschaft und Sozialpsychologie in Frankfurt am Main. Aus der Idee für ihre Doktorarbeit über verfemte Berufe im Mittelalter entstand ihr erster Roman. Nachdem Ursula Neeb viele Jahre für das Deutsche Filmmuseum und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig war, lebt sie seit 2005 als freie Autorin im Taunus und veröffentlichte bereits zahlreiche historische Kriminalromane in renommierten Verlagen. Ihre Faszination mit menschlichen Abgründen und Alfred-Hitchcock-Klassikern inspirierte sie zu ihrem Roman »Der Hölle Zorn«.
Die Autorin im Internet: www.facebook.com/ursula.neeb.1
Bei dotbooks veröffentlichte Ursula Neeb ihren Roman »Der Hölle Zorn«, der als eBook- und Printausgabe erhältlich ist.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2024
Copyright © der Originalausgabe 2014 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/aicandy und shutterstock/Kompaniets Laras
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-757-7
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ursula Neeb
Die Rache der Hurenkönigin
Historischer Roman
dotbooks.
Für meine Mutter, die mir als Kind so wunderbar
vorgelesen, und meinen Großvater, der mir spannende,
selbst erfundene Geschichten erzählt hat und dadurch
die Lust am Fabulieren in mir geweckt hat.
»Lasst den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist anbeten,
aber lasst niemanden Maria anbeten.«
(Epiphanias, um 530)
TEIL 1Mater dolorosa –die Schmerzensmutter
Prolog
Als sie um die Mittagszeit das Hoftor öffnete und angespannt auf die Gasse hinausspähte, ob jemand aus der Nachbarschaft unterwegs war, der sie ansprechen konnte, stellte sie erleichtert fest, dass das Messegetümmel zuweilen auch von Vorteil war, und mischte sich unbehelligt unter die Besucherströme.
Nachdem sie den belebten Rossmarkt hinter sich gelassen hatte und von der Zeil in die Eschersheimer Gasse eingebogen war, nahm das Gewimmel deutlich ab, und je weiter sie voranschritt, desto ruhiger und menschenleerer wurde es. Erleichtert atmete sie auf. Zum Glück war ihr niemand begegnet, und dass ihr hier, in dieser abgelegenen Gegend, jemand über den Weg laufen würde, war mehr als unwahrscheinlich. In der Region um das Eschenheimer Tor, die auch »zu den Gärten« genannt wurde, herrschten landwirtschaftliche Betriebe mit großen Wirtschaftshöfen, Scheunen und Obstgärten vor.
Tief sog sie die würzige Luft ein, der Geruch von Früchten, Erde und Laub, den sie so mochte. Die Sonne stand hoch, und der wolkenlose Himmel war von strahlendem Blau. Ein Herbsttag von spätsommerlicher Milde. Die junge Frau ließ ihre Blicke über die malerischen Obstwiesen schweifen. In den abgeernteten Bäumen hingen noch vereinzelt Äpfel, Birnen oder Pflaumen – doch zu weit oben in den Kronen, um für sie erreichbar zu sein. Sie musste unversehens grinsen. Als Kind war das für sie kein Hinderungsgrund gewesen. Da war sie in die Bäume geklettert wie ein Gassenjunge und hatte sich in der Krone den Bauch vollgeschlagen. Manchmal war sie dabei erwischt worden, von irgendeinem Bauern, und dann gab es Ärger zu Hause. Es geziemt sich nicht für eine junge Adelsdame, Äpfel zu stehlen!
Sie seufzte vernehmlich und hielt sich die Hand auf den gewölbten Leib, in dem sich, wie so oft in letzter Zeit, ihr Kind bewegte. Ein seliges Lächeln breitete sich über ihr hübsches sommersprossiges Gesicht. Sie freute sich unsagbar auf das Kleine – und ihr Mann mindestens genauso. Sie waren jetzt knapp ein halbes Jahr verheiratet – bei der Hochzeit war sie schon guter Hoffnung gewesen, aber das wussten nur die wenigsten. Einmal mehr wurde ihr bewusst, wie verliebt sie immer noch ineinander waren, und sie wünschte sich sehnlichst, dass dieser Zustand niemals enden möge.
Eigentlich könnte sie sehr glücklich sein – wäre da nicht die nagende Sorge um ihren Ehemann. Und deswegen war sie jetzt auch hier und ging zu diesem ominösen Treffen. Sie erinnerte sich noch genau an das, was der sonderbare Mann ihr heute Morgen zugeraunt hatte: »Gegen Euren Gatten ist eine Verschwörung geplant. Mehr kann ich Euch jetzt nicht sagen. Kommt heute Mittag in die alte Zehntscheune hinterm Rahmhof, dann erfahrt Ihr mehr – und zu niemandem ein Wort, habt Ihr kapiert, sonst bin ich dran!«
Daran hatte sie sich widerstrebend gehalten. Obwohl sie am liebsten zu ihrem Mann ins Kontor gelaufen wäre, um ihm alles zu erzählen. Aber sie konnte ihn ja nicht einfach so bei der Arbeit stören, wo doch Messe war und wichtige Geschäftstermine anstanden.
Erst mal hören, was er ihr zu sagen hatte. Es war sehr anständig von ihm, dass er sie warnen wollte. Wenn unter den Anhängern des alten Glaubens ruchbar werden würde, dass er das getan hatte, würde ihm das nur Ärger einbringen. Bekümmert zog sie die Stirn in Falten. Was für eine Verschwörung konnte das nur sein? Ihr schwante nichts Gutes. Sicherlich hatte es etwas mit dem Glaubenskrieg zu tun, der seit einigen Jahren in Frankfurt wie im ganzen Land entbrannt war und die Menschen in zwei feindliche Lager spaltete: auf der einen Seite die Anhänger des alten Glaubens, die sich verbissen gegen jedwede Neuerung sperrten und fanatisch am Althergebrachten festhielten; auf der anderen die von Tag zu Tag immer größer werdende Schar der Bewunderer Martin Luthers, die begeistert seine Lehren verbreiteten. Wie die meisten Humanisten in der Stadt gehörte auch ihr Mann diesem Lager an.
Wenngleich es für sie selbstverständlich war, ihrem geliebten Gatten und seinen mitunter recht kompromisslosen, radikalen Ansichten uneingeschränkte Loyalität entgegenzubringen, so ging ihr doch sein Übereifer, den er im Dienste der Reformation zuweilen an den Tag legte, ganz schön auf die Nerven. Seit gut einer Woche, seitdem die Herbstmesse angefangen hatte, war er fast jeden Abend außer Haus. Ging zu irgendwelchen Versammlungen und Lesungen, und gestern Abend in der Buchgasse war es dann zu diesem Eklat gekommen. Er war mit dem Dekan der Liebfrauenkirche aneinandergeraten und hatte sich doch tatsächlich dazu hinreißen lassen, dem Geistlichen eine Ohrfeige zu verpassen. Warum musste er denn auch immer so ein Heißsporn sein? Sicher, der Priester war ein schlimmer Hetzprediger und Fanatiker, aber ein solcher Ausrutscher hätte nicht sein müssen. Wahrscheinlich wehte von daher auch der Wind, und die Papisten und Marienanhänger sannen auf Rache gegen ihren Gatten.
Als sich die junge Frau der Scheune näherte, die sich baufällig und windschief am Rande der Stoppelfelder abzeichnete, überkam sie mit einem Mal ein heftiger Schauder. Die Sorge um ihren Gatten wurde so übermächtig, dass ihr Tränen in die Augen traten. – Es hatte doch schon einen Mord gegeben! Mit Grauen musste sie an die junge Frau denken, die Ehefrau eines ehemaligen Kaplans, die so bestialisch ermordet worden war ...
Was, wenn ihr Liebster schon jetzt in größter Gefahr schwebte und die Papisten auch ihm nach dem Leben trachteten?
Ihr entrang sich ein gequälter Aufschrei. Nein, das darf nicht sein! Er ist doch mein Ein und Alles!
Sie fühlte, wie ihr plötzlich der kalte Schweiß ausbrach, und gleichzeitig spürte sie einen stechenden Schmerz im Unterleib. Bloß keine vorzeitigen Wehen! Das hätte ihr gerade noch gefehlt, so alleine hier draußen auf dem Feld. Doch sie war gar nicht alleine, denn im nächsten Moment nahm sie die Umrisse einer Gestalt vor der Scheune wahr. Das musste er sein. Er wartete bereits auf sie. Als sie näherkam, winkte er ihr zu. Sie erwiderte seinen Gruß. Während sie einander die Hände schüttelten, sah sie, dass er eine Milchkanne bei sich trug. Er bemerkte ihren Blick.
»Ich dachte mir, eine kleine Stärkung werdet Ihr in Eurem Zustand sicher gut gebrauchen können. Vom Hirschgraben bis hierher, das ist schon ein Stück«, sagte er und hielt ihr fürsorglich die Scheunentür auf.
Sie bedankte sich und trat mit wackligen Beinen ein. Im Innern der Scheune herrschte Zwielicht. Durch die Ritzen im Gebälk drangen vereinzelt Sonnenstrahlen. Es roch nach modrigem Stroh. Ihr wurde ganz flau im Magen, und sie blickte sich nach einem Sitzplatz um. Neben dem Mittelbalken standen mehrere alte Fässer. Kurzatmig ließ sie sich auf einem nieder. Er musste bemerkt haben, dass es ihr unwohl war, denn er holte kurzerhand einen Becher aus der Jackentasche, füllte ihn mit Milch und reichte ihn ihr, während sein Blick auf ihren vorgewölbten Bauch fiel.
»Ihr seid ja schon ganz schön rund«, sagte er und lächelte. »Wann ist es denn soweit?«
»Anfang November«, antwortete sie leicht verlegen. Für einen flüchtigen Moment kam es ihr so vor, als sei ihm bewusst geworden, dass sie vorehelichen Geschlechtsverkehr gehabt hatte, und als stünde er im Begriff, sie deswegen zu tadeln.
Doch er presste nur kurz die Lippen zusammen und murmelte: »Das ist ja schön!«
Sie fühlte, dass ihr Mund ganz trocken war, und leerte den Becher in wenigen Zügen. Sogleich fühlte sie sich entspannter. Eine wohlige Wärme breitete sich in ihrer Magengrube aus, so, als ob der Milch Branntwein beigemischt worden wäre. Verstört blickte sie ihn an.
Er lächelte ihr aufmunternd zu und sagte: »Bringen wir es hinter uns.«
Sie nickte träge und bemerkte gleichzeitig mit Befremden, wie ihre Lider schwer wurden. – Nicht nur die Lider, auch der Kopf und die Glieder. Sie fühlte sich plötzlich so müde und schläfrig. Irritiert blinzelte sie zu ihm hinüber. Er hatte sich heruntergebeugt und machte sich an einem Behältnis zu schaffen, das auf dem Boden lag. Sie konnte es nicht genau erkennen, denn sie sah alles nur noch wie durch einen weißen Schleier, der immer dichter wurde.
Er sagte etwas zu ihr, und dann kicherte er. Sie konnte es nicht verstehen, doch es klang irgendwie boshaft.
Sie wollte ihn fragen, was mit ihr los sei, brachte jedoch keinen Ton heraus. Der Kopf sank ihr auf die Brust, und sie hatte nur noch den Wunsch zu schlafen. Tief und fest zu schlafen.
Und dann hatte sie diesen merkwürdigen Traum, aus dem sie nie wieder erwachen sollte. Sah den Racheengel mit dem Schwert in den Händen, der sie mit erbarmungslosen Augen fixierte. Vernahm seine dröhnende Stimme, strafend und schonungslos wie das Jüngste Gericht: »Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen!«
Kapitel 1
Sonntag, 14. Oktober 1522 – Frankfurter Herbstmesse
Ursel Zimmer hatte Schmetterlinge im Bauch, als ginge sie zu einem galanten Rendezvous. Es war das erste Mal, dass sie ihren Geliebten Bernhard von Wanebach zu einem Essen mit seinem Frankfurter Verleger im renommierten Gasthaus »Zum goldenen Hirschen« in der Buchgasse begleiten sollte. Die ganze Zeit über war die Gildemeisterin der städtischen Hurenzunft in der weitläufigen Schankstube des Frauenhauses schon unruhig auf und ab gegangen, wobei sie immer wieder aus dem Fenster spähte, ob Bernhard nicht bald kommen würde, als sie endlich das laute Schlagen des Türklopfers vernahm.
»Das wird er sein!«, rief sie aus und hastete zum Eingangsportal, um ihm zu öffnen.
Während der Geliebte sie zärtlich auf den Mund küsste, haderte die Zimmerin mit ihm, dass er sie so lange hatte warten lassen. »Wo bleibst du denn nur? Zur sechsten Stunde wolltest du hier sein«, murrte sie.
»Tut mir leid, mein Herz, aber durch das Messegewimmel kommt man nur langsam voran. Besonders im Buchhändlerviertel herrscht ein Hochbetrieb, wie ich ihn in all den Jahren noch nie erlebt habe ...«, entschuldigte sich der Gelehrte und musterte die Hurenkönigin, die sich dem Anlass entsprechend in ein elegantes dunkelbraunes Samtgewand gekleidet hatte, mit Wohlgefallen. »Gut schaust du aus, meine Liebe«, sagte er, während sein Blick zu Ursels schwarzen Augen wanderte, die ihn hinter den neuen, oval geformten Augengläsern erwartungsvoll anfunkelten. Er bot ihr zuvorkommend den Arm an. »Komm, lass uns gehen«, forderte er sie gut gelaunt auf.
»Hättet Ihr nicht diese üppige Figur und die frechen roten Haare, die aus Eurer Haube herausragen, Meistersen, dann könnte man Euch glatt für einen Blaustrumpf halten«, spöttelte die Jennischen Marie, die mit drei anderen Huren am Tisch saß und Karten spielte.
Ursel grinste und erwiderte: »Ich tu mein Bestes, Mädel. Aber ich glaube, diesbezüglich kann ich nur den Messefremden etwas vormachen, die Frankfurter wissen alle, wer ich wirklich bin!«
Nachdem sich die Gildemeisterin von den Huren und ihrer Stellvertreterin verabschiedet und ihnen einen geruhsamen Abend an dem einzigen arbeitsfreien Tag der Woche gewünscht hatte, trat sie an Bernhards Seite auf die Alte Mainzer Gasse hinaus. Obwohl es bereits anfing zu dämmern, war die Gasse noch voller Menschen, die sich an den überwiegend mit Büchern und Druckerzeugnissen übersäten Verkaufstischen drängelten, denn in der Alten Mainzer Gasse und der Buchgasse befand sich das traditionelle Frankfurter Buchhändlerviertel. Mit staunenden Blicken streifte Ursel die Bücherstapel sowie die Händler und Besucher aus aller Herren Länder, die sich hier ein Stelldichein gaben.
Die Buchmessen, in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, waren inzwischen längst zu einem bedeutenden Teil der Frankfurter Herbstmessen geworden. Im Buchhändlerviertel, an dessen Rand auch das Frauenhaus lag, wurden nicht nur Unmengen von Büchern verkauft, sondern auch Nachrichten, Ideen und neue geistige Strömungen diskutiert und weitergegeben. In den letzten Jahren galt dies besonders für die fünfundneunzig Thesen Martin Luthers, die auch das religiöse Leben in der freien Reichsstadt nachhaltig beeinflussten.
Die Frauenhauswirtin, die erst vor wenigen Jahren Lesen und Schreiben gelernt hatte – was ihr schon immer ein Herzenswunsch gewesen war –, liebte es, gemeinsam mit ihrem langjährigen Geliebten, der ein angesehener Gelehrter war, an den Bücherständen entlangzustreifen und sich interessante Neuerscheinungen anzuschauen. Sie mochte die Unruhe, die fremden Sprachen, die vergeistigten Gesichter, die sich um die Büchertische tummelten. Heute jedoch schien es hier regelrecht zu brodeln. Als Ursel und Bernhard in die Buchgasse abbiegen wollten, wo sich die Gastwirtschaft »Zum goldenen Hirschen« befand, war plötzlich kein Durchkommen mehr. Vor einem Verkaufsstand hatte sich eine immer dichter werdende Menschentraube gebildet. Hektisches Stimmengewirr war zu vernehmen, das durchsetzt war von wüsten Flüchen und Beschimpfungen. Am Rande schien es sogar schon die ersten Rangeleien zu geben.
»Was ist denn hier los?«, stieß die Hurenkönigin hervor, die, ebenso wie ihr Begleiter, stehen geblieben war und fassungslos auf die aufgebrachte Meute starrte.
Bernhard runzelte die Stirn und murmelte konsterniert: »Dort ist ein Verkaufsstand, der die Schriften Martin Luthers feilbietet – die sich übrigens verkaufen wie warme Semmeln. Und das scheint einigen Papisten nicht zu passen.« Der Gelehrte wies auf eine Gruppe Geistlicher, die im Gedränge standen und erregt gestikulierten.
»Und was machen wir jetzt? Zur siebten Stunde sind wir doch mit deinem Verleger verabredet ...« Ursel blickte Bernhard fragend an.
»Abwarten. Wir haben ja noch eine gute halbe Stunde Zeit. Vielleicht haben sich bis dahin die Gemüter ein wenig beruhigt. Da begeben wir uns jedenfalls nicht hinein«, sagte Bernhard missmutig, als unversehens ein Mann in einem kuttenartigen Gewand an sie herantrat und ihnen ein Flugblatt überreichte.
»Ach, das ist doch der Michel!«, entfuhr es Bernhard bei seinem Anblick erstaunt. »Was machst du denn hier?«
»Ich verteil Schriften«, erklärte der junge Bursche mit den strähnigen blonden Haaren gewichtig und schwenkte einen Papierstapel.
»Soso«, erwiderte Bernhard mit amüsiertem Lächeln. »Was steht denn da drauf?«
Während er den Inhalt überflog, verdüsterte sich seine Miene zunehmend. »›Tod dem Minotaurus im Mönchsgewand und seiner Pfaffenhure‹«, las er halblaut. »›Kampf den reformierten Frevlern, die das heilige Zölibat brechen und die Gottesmutter entthronen ... Das ist ja die reinste Hetzschrift!«, wetterte der Gelehrte und musterte den Mann in der braunen Kutte empört. »Und so etwas verteilst du, Michel! – Es wäre schlauer, wenn du dich auf deine Milchlieferung beschränken würdest!«
Der junge Mann, der für den städtischen Rahmhof die Milch ausfuhr, senkte verlegen den Blick. »Aber es ist doch wegen unserer Heiligen Jungfrau«, stieß er hervor. »Wir können doch nicht zulassen, dass die Reformierten sie einfach absetzen!« Das schmale Gesicht des Mannes, das von zahlreichen Pockennarben übersät war, rötete sich vor Aufregung. »Das ist eine schwere Todsünde und darf nicht ungesühnt bleiben!«, ereiferte sich der Milchlieferant aufgebracht. »Unser Herrgott wird sie dafür bestrafen, diese Frevler! – Das sagt auch der Herr Pfarrer ...« Er blickte Beistand heischend in das Getümmel.
Bernhard gewahrte unter der Priestergruppe das wutverzerrte Gesicht von Johannes Cochläus, dem Dekan der Liebfrauenkirche, der allgemein als der Rädelsführer der Reformationsgegner bekannt war. »Ach, daher weht der Wind«, bemerkte er finster.
»Dann hat der Herr Pfarrer womöglich auch dieses Pamphlet verfasst. Er lässt doch nichts aus, um noch weiter Öl ins Feuer zu gießen, dieser Demagoge ...«
Michel, der es sich mit Herrn von Wanebach, der immer ein freundliches Wort für ihn hatte und ihm manches Mal ein Trinkgeld zusteckte, nicht verderben wollte, stierte betreten vor sich hin. »Das dürfen wir nicht zulassen, dass sie die Gottesmutter vom Thron stoßen!«, entführ es ihm trotzig.
Ursel, die selbst eine Marienverehrerin war, hatte Mitleid mit dem armen Teufel, der unter schwerer Fallsucht litt. »Das wird auch niemals geschehen, Michel«, sagte sie mit mildem Lächeln. »Die Himmelskönigin wird immer in den Herzen der Menschen sein. Man kann sie nicht einfach absetzen!«
Michel strahlte die Zimmerin an. »Gott schütze Euch, Hurenkönigin«, murmelte er dankbar und entfernte sich.
Bernhard indessen, der den Altgläubigen als gebildeter Humanist kritisch gegenüberstand und den bahnbrechenden Gedanken Martin Luthers durchaus zugeneigt war, runzelte spöttisch die Stirn. »Die Marienverehrung ist zuweilen schon der reinste Götzendienst ... Aber in Gottes Namen, wenn du unbedingt deine Jungfrau Maria brauchst ...«
»Die Menschen brauchen eine gütige Mutter als Fürsprecherin für den gestrengen Herrgott, der uns immerzu mit Strafen und Heimsuchungen plagt«, konterte die Hurenkönigin resolut, die mit ihrem Geliebten deswegen schon manchen Strauß ausgefochten hatte. Obgleich Ursel die Thesen Martin Luthers eingehend studiert hatte und dem Wittenberger in vielerlei Hinsicht recht gab, vor allem was das Zölibat und den Reichtum der Kirche betraf, sperrte sie sich doch nachdrücklich dagegen, die Marien- und Heiligenverehrung abzuschaffen. Ihr Leben lang hatte sie zur Gottesmutter und ihrer Namenspatronin, der heiligen Ursula, gebetet und Maria Magdalena, der Schutzheiligen der Huren, an ihrem Gedenktag eine Kerze gestiftet. Und daran würde sie auch weiterhin festhalten.
Inzwischen hatte sich der Menschenpulk um den Verkaufstisch der Lutherbücher ein wenig gelichtet. Bernhard zerknüllte die Schmähschrift, warf sie abfällig auf den Boden und schlug Ursel vor weiterzugehen. Als sie den Büchertisch passierten, an dem ein reger Verkauf stattfand, trat Bernhard an einen der Händler heran und erkundigte sich bei ihm höflich, ob die Geschäfte gut liefen.
Der Buchhändler lächelte zufrieden. »Das kann man wohl sagen«, erwiderte er stolz. »Mehrere hundert am Tag gehen über den Ladentisch. Wir werden schon bald nachdrucken müssen.«
In der Buchgasse herrschte ein derartiger Betrieb, dass Ursel und Bernhard nur im Schneckentempo vorankamen. Ursels Blick fiel auf eine Verkaufsschirn, die überladen war mit schweren Folianten, auf deren Einband goldene Lettern prangten. Interessiert trat sie an den Verkaufsstand, um die Bücher genauer in Augenschein zu nehmen. Bedauerlicherweise war der Titel in Latein verfasst, das Ursel nicht lesen konnte. Der Händler fragte sie zuvorkommend, ob er ihr behilflich sein könnte.
»Was heißt das?«, erkundigte sich die Hurenkönigin und wies auf die Goldprägung auf dem Einband.
»Das heißt ›Speculum beatae Mariae‹ – ein Buch der Lobpreisung Mariens«, erwiderte der grauhaarige Mann mit den runden Augengläsern freundlich. »Es ist größtenteils in Latein geschrieben, außer dem Anhang, eine Sammlung der Marienwunder, die der Autor aus dem einfachen Volke zusammengetragen hat. Ich kann Euch gerne eine kleine Passage aus dem Hauptteil übersetzen, meine Dame, wenn Ihr es wünscht?«
»Warum nicht?«, entgegnete die Hurenkönigin freundlich.
Bernhard, der hinter ihr stand, zog ungeduldig die Brauen in die Höhe, während der Buchhändler einen der schweren Folianten aufschlug und einige Seiten weiterblätterte, ehe er anfing, salbungsvoll zu skandieren: »Königin des Himmels, in dem sie inmitten der Engel thront, Königin der Erde, auf der sie beständig ihre Macht offenbart – sie, die sogar über die Dämonen der Hölle herrscht, ward geschaffen vor Anbeginn der Zeit. Gelobet sei Maria, Muttergottes und Herrscherin der Welt ...«
»Schön«, erwiderte Ursel. »Wer hat das geschrieben?«
Der Händler zuckte mit den Schultern. »Das vermag ich nicht zu sagen, meine Dame. Der Verfasser möchte anonym bleiben – und ist selbst mir nicht bekannt ...«
»Warum das?«, fragte die Hurenkönigin erstaunt.
»Auch das kann ich Euch nicht beantworten. Er wird seine Gründe haben, die sich dem Leser freilich nicht erschließen.« Er fuhr mit fast zärtlicher Geste über den Buchdeckel. »Es ist ein wunderbares Werk – vor allem für jene, die die Heilige Jungfrau verehren ...« Die Augen des Mannes glänzten verklärt.
Ursel, deren Interesse geweckt war, erkundigte sich, was es kosten solle.
Der Preis, den ihr der Händler nannte, war erstaunlich niedrig. »Der Verfasser möchte nichts daran verdienen, er hat die Druck- und Herstellungskosten selbst übernommen. Ihm ist einzig daran gelegen, dass sein Werk eine geneigte Leserschaft findet. Und das scheint mir durchaus der Fall zu sein, denn es verkauft sich außerordentlich gut«, erläuterte der Buchhändler erfreut.
»Würdest du es mir übersetzen?«, erkundigte sich Ursel bei Bernhard. Nachdem dieser zugestimmt hatte, erklärte sie dem Händler: »Ich möchte bitte eines.« Dann entnahm sie ihrer Geldbörse, die sie am Gürtel trug, die entsprechenden Münzen und legte sie auf den Verkaufstisch.
Der Händler verstaute sie in einer Geldkassette und überreichte der Hurenkönigin den Folianten.
Als sich Ursel und Bernhard gerade vom Verkaufstisch abwandten, um ihren Weg fortzusetzen, kamen zwei junge Männer in dunklen Gelehrtentalaren auf sie zu und stellten sich dem Paar in den Weg.
»Durch den Opfertod Christi ist das Erlösungswerk vollkommen und bedarf keiner Ergänzung!«, richtete einer der beiden in vorwurfsvollem Tonfall das Wort an die Hurenkönigin. »Christen brauchen keinerlei Fürsprache und Vermittlung, sei es durch Maria oder andere Heilige. Die Heiligenverehrung ist nichts anderes als Götzendienst«, schnaubte er verächtlich und durchbohrte Ursel förmlich mit seinen Blicken.
»Verschont mich mit Euren Belehrungen, junger Mann! In Glaubensangelegenheiten entscheide ich immer noch selbst«, beschied ihn die Hurenkönigin barsch und wandte sich brüsk zum Weitergehen.
»Aber der Marienkult ist ein einziger Irrglaube!«, ereiferte sich sein Begleiter. »Und dieses Machwerk, das Ihr eben erworben habt, ist die schlimmste Hetzschrift, die mir jemals untergekommen ist. Ihr solltet Euch schämen, es überhaupt in den Händen zu halten!«
Bernhard war entrüstet stehen geblieben. »Jetzt reicht es aber!«, brach es aus ihm heraus. »Man sollte dem Glauben anderer Menschen mit Achtung und Respekt begegnen, die Herren Besserwisser! – Auch wenn er von den eigenen Ansichten abweicht«, schmetterte er erzürnt. »Und jetzt muss ich die Herren mit allem Nachdruck ersuchen, die Dame nicht mehr weiter zu belästigen!«
Die jungen Männer trollten sich unwillig, nicht ohne Bernhard und die Hurenkönigin mit scheelen Blicken zu bedenken.
»So etwas!«, schimpfte Bernhard und schüttelte den Kopf »Zuerst die wild gewordenen Papisten, und jetzt auch noch diese Eiferer von der Gegenseite ... Was ist denn das für eine Buchmesse! Man könnte ja meinen, man ist im Irrenhaus und nicht unter intelligenten Menschen ...«
Ursel stimmte ihm aufgebracht zu und bedauerte es fast, dass sie den dicken Wälzer gekauft hatte, der in ihrem Arm immer schwerer zu werden schien. Bernhard, dem nicht entging, wie sie sich damit abmühte, bot ihr ritterlich an, das Buch für sie zu tragen, was Ursel gerne in Anspruch nahm. Sie lächelten einander an, hakten sich unter und gingen unverdrossen weiter.
Als sie vor dem Gasthaus »Zum goldenen Hirschen« anlangten, war ihr Ärger längst verraucht. Bernhard hielt Ursel zuvorkommend die Tür auf, und sie traten gemeinsam in die behagliche, hell erleuchtete Gaststube. Staunend bemerkte der Gelehrte, dass an den Tischen des weitläufigen Schankraums ein Großteil der humanistischen Intelligenz des Abendlandes vertreten war. Mit Ehrfurcht konnte er das markante Gesicht des berühmten Erasmus von Rotterdam in der Menge ausmachen, der in Begleitung seines Freundes, Sir Thomas Morus, und seines englischen Verlegers angeregt debattierte. Auch die gebildeten Frankfurter Patrizier Fürstenberger, Holzhausen und Stalburg waren anwesend und entboten Bernhard und der Hurenkönigin höfliche Grüße.
Ursel, die die Herren ausnahmslos als ehemalige Freier kannte, verzog die dezent geschminkten Lippen zu einem huldvollen Lächeln und folgte Bernhard mit graziös gelüfteter Schleppe zu dem Tisch, an dem Bernhards Verleger, Doktor Eckart Heller, sie bereits erwartete.
Formvollendet küsste er der Hurenkönigin die Hand und rückte ihr den Stuhl zurecht. Während er anschließend Bernhard begrüßte, den er als geschätzten Autor schon viele Jahre kannte und auf vertraute Art duzte, fiel sein Blick auf das Buch, das der Gelehrte unter dem Arm trug. »Ach, du hast dir also auch eines von diesen Marienbüchern gekauft«, sagte der Mann mit dem gepflegten grauen Bart und grinste schief. »Nachdem mir zu Ohren gekommen ist, dass es sich fast so gut verkauft wie die Lutherbücher, bin ich neugierig geworden und habe ebenfalls eines erworben ...« Er seufzte und musterte Bernhard ernst. »Aber ich muss dich warnen. Es ist das Werk eines Wahnsinnigen ...!«
Die Hurenkönigin und Bernhard schauten den Verleger beunruhigt an.
»Inwiefern?«, fragte Ursel angespannt.
»Nun, die Art, wie dieser anonyme Verfasser über die Gottesmutter schreibt ... treibt mir einen Schauder über den Rücken!«, erklärte Heller mit brüchiger Stimme. »Er verklärt und verherrlicht sie wie eine Göttin, für die – und das ist das Erschreckende daran – er bereit ist, sein Leben zu geben. Oder sogar zu töten«, sagte er stockend und wies den Kellner an, seine Gäste nach ihren Wünschen zu fragen und ihm nochmals Wein nachzuschenken.
Nachdem Ursel und Bernhard ihre Bestellungen aufgegeben hatten, wandte sich die Hurenkönigin mit beklommener Miene an den Gastgeber und bemerkte: »Das ist ja schrecklich ... Wenn ich das gewusst hätte! Denn ich muss zugeben, dass ich, und nicht Bernhard, das Buch erstanden habe. Es klang so schön, was der Buchhändler mir daraus vorgelesen hat. Aber wenn es solch ein Machwerk ist, dann will ich es gar nicht mehr haben ...«
»Woher hättet Ihr das auch wissen können, verehrte Zimmerin«, entgegnete Heller beschwichtigend. »Das Gefährliche an dieser Schrift ist, dass sie zum offenen Kampf gegen jene aufruft, die das Sakrileg begehen, die Himmelskönigin zu entthronen.« Der Verleger zog besorgt die Stirn in Falten. »Und es findet unter den Anhängern des alten Glaubens eine breite Leserschaft.«
»Oha – das hat nichts Gutes zu bedeuten!«, bemerkte Bernhard unheilvoll. »Wo die Gemüter in der Stadt seit Luthers Thesen doch ohnehin schon so erhitzt sind. – Das haben wir eben im Buchhändlerviertel am eigenen Leibe erfahren dürfen ...« Er berichtete Heller von den unerfreulichen Vorkommnissen bei ihrem Messerundgang.
Als der Weinkellner an den Tisch kam und Ursels und Bernhards Trinkbecher mit einem samtigen Burgunderwein füllte, schlug Heller vor, gemeinsam auf den Abend anzustoßen und sich angenehmeren Themen zuzuwenden.
Der Verleger lächelte verschmitzt, während sein Blick zwischen Bernhard und der Hurenkönigin hin- und herwanderte. »Ich bin sehr gespannt, welchen Vorschlag Ihr mir zu unterbreiten habt, verehrte Gildemeisterin. Bernhard hat mir ja schon angedeutet, dass es sich um eine gemeinsame Publikation handelt ...«
Ursel hüstelte. Die sonst so couragierte Hurenkönigin war ein wenig befangen, denn noch nie zuvor hatte sie mit einem Verleger gesprochen. – Sie, die im Vergleich zu Bernhard und seinem Editor ziemlich ungebildet war. Dennoch überwand sie ihre Scheu, indem sie sich darauf besann, was Bernhard ihr in den Momenten des Selbstzweifels immer entgegenhielt: Das Leben hatte sie klug gemacht – und zudem lag ihr das gemeinsame Vorhaben ungemein am Herzen.
»Wie Ihr sicherlich schon vernommen habt, mein lieber Doktor Heller, gehe ich nächstes Jahr in den Ruhestand«, begann sie mit wohlgesetzten Worten und fühlte, wie sie immer souveräner wurde. »Da ich von mir behaupten darf, auf ein erfülltes Leben zurückzublicken, und außer meiner langjährigen Tätigkeit als Frauenhauswirtin auch als Ermittlerin in einer Reihe von Mordfällen tätig war – für die ich seinerzeit von der Stadt Frankfurt sogar geehrt wurde und das Bürgerrecht erhielt –, bin ich zu dem Entschluss gekommen, gemeinsam mit meinem Gefährten Bernhard von Wanebach eine zweiteilige Kriminalchronik zu verfassen ...« Ursels dunkle Augen hinter den ovalen Augengläsern leuchteten enthusiastisch.
Eckart Heller, der schon viel von der berühmten Frankfurter Hurenkönigin gehört hatte, war angetan von der auch im reifen Alter noch sehr schönen Frau, ihrer dunklen, rauchigen Stimme, den lebendigen Augen und der Würde, die sie verströmte, und in diesem Moment konnte er Bernhard von Wanebach voll und ganz verstehen. Er hatte sich wegen Ursel Zimmer mit seiner Familie überworfen und von Anfang an stolz und unerschütterlich zu seiner Geliebten gestanden. – Im Grunde genommen beneidete er ihn sogar um diese kluge, warmherzige Frau, und als Geschäftsmann, der er war, witterte er in dem Vorhaben zudem noch ein lukratives Unternehmen.
»Wann könnt Ihr liefern?«, fragte er ganz sachlich. »Bis zur nächsten Herbstmesse sollte es präsentabel sein – zumindest der erste Band ...«
Ursel klatschte vor Freude in die Hände. »Heißt das, Ihr wollt es machen?«, erkundigte sie sich aufgekratzt.
»Genau das heißt es«, erwiderte Heller launig. »Kriminalchroniken sind in den letzten Jahren sehr gefragt. Mein Verlag hat damals den Anfang gemacht, mit der Chronik der Frankfurter Gelehrten Anna Stockarn über den mörderischen Arzt Leonhard Stefenelli, der auch als ›König Tod‹ bekannt wurde ... Das Buch verkaufte sich Anno 1510 wie Zunder und liegt bereits in der zwanzigsten Auflage vor ... Und Euer Buch, da bin ich mir sicher, wird sich mindestens genauso gut verkaufen ... bei Eurer Berühmtheit, liebe Zimmerin, und dem illustren Namen eines Bernhard von Wanebach ...«
»Das wäre schön«, sagte Ursel hoffnungsvoll. »Ich kenne übrigens Anna Stockarn und auch ihr Buch. – Bernhard hat es mir seinerzeit vorgelesen. Es hat mir sehr gut gefallen, und Anna ist eine reizende Person. Sie ist ganz schlicht und bescheiden, obwohl sie einer der reichsten Familien Frankfurts angehört und eine hochgeachtete, vortreffliche Gelehrte ist. Ich bewundere Menschen, die ihre Bescheidenheit beibehalten und nicht hochmütig werden, nur weil das Schicksal sie begünstigt. Das ist echte Größe und leider nur selten anzutreffen.«
»Wie wahr!«, stimmte der Publizist der Hurenkönigin zu.
»Ursel war damals selbst in den Fall Stefenelli involviert«, warf Bernhard ein, der mit Vergnügen beobachtete, wie mühelos es Ursel gelang, den Verleger für sich einzunehmen.
»Tatsächlich. – Das müsst Ihr mir jetzt aber genauer erzählen«, wandte sich Doktor Heller an die Hurenkönigin.
Ursel trank einen Schluck des vortrefflichen Weines. »Eine traurige Geschichte ...« Sie seufzte schwermütig. »Eine unserer Hübscherinnen, die junge und bildschöne Hildegard Dey, war eines der Opfer dieses bestialischen Arztes. – Alleine der städtischen Totenwäscherin Katharina Bacher ist es zu verdanken, dass der Mord überhaupt aufgedeckt wurde. Der Untersuchungsrichter und die Polizeibehörde waren nämlich stillschweigend davon ausgegangen, dass Hildegard ertrunken war«, erläuterte die Hurenkönigin grimmig. »Eine ganz vortreffliche Frau, diese Katharina Bacher! Sie wäre ja fast selbst zum Opfer dieses Wahnsinnigen geworden. Und ihren armen Vater, den Totengräber Heinrich Sahl, hat der verhängnisvolle Irrtum des Inquisitors sogar das Leben gekostet ... Ich darf gar nicht daran denken, sonst erfasst mich wieder die blanke Wut. – Noch nicht einmal entschuldigt haben sich diese Kuttenträger bei der Hinterbliebenen ...« Ursel zischte verächtlich und nahm einen tiefen Zug aus dem Trinkbecher.
Heller nickte ernst. »Das ist mir zu Ohren gekommen. Die heilige Kurie in Rom hat so manche Schandtat begangen«, sagte er und lachte bitter auf. »Deswegen strömen einem Martin Luther inzwischen auch derart die Massen zu. Den Leuten sind doch längst die Augen aufgegangen, und sie sind es leid, weiterhin für dumm gehalten und bis aufs letzte Hemd ausgenommen zu werden, damit die Herren Kleriker sich ein schönes Leben machen können. Es wird höchste Zeit, dass diesem ganzen Muff und Filz endlich der Garaus bereitet wird ...« Der Verleger hielt plötzlich inne und entschuldigte sich bei der Hurenkönigin für seinen Eifer.
»Das macht doch nichts«, entgegnete Ursel verständnisvoll. »Solcherlei Ansichten sind mir nicht fremd. Bernhard ist der gleichen Meinung, und ich selbst stehe der Kirche ja schon von Haus aus skeptisch gegenüber – bei meinem Gewerbe, das der Geistlichkeit schon immer ein Dorn im Auge war, auch wenn sie die Dirnensteuer, die der Magistrat an geistliche Stiftungen der Stadt weiterleitet, gerne in Anspruch nimmt.«
Als ein ganzer Trupp Kellner mit dampfenden Platten voller Wildbret, Fasan und Kapaun an den Tisch trat, unterbrachen die Hurenkönigin und der Verleger ihr Gespräch und fingen, ebenso wie Bernhard von Wanebach, genussvoll an zu tafeln.
»Lasst uns auf die Kriminalchronik anstoßen«, schlug der Verleger vor und hob seinen Trinkbecher. »Und nach dem Essen sprechen wir noch etwas eingehender darüber. Ihr müsst entschuldigen, aber nach mehr als zehn Jahren sind mir die Mordfälle nicht mehr so gegenwärtig. – Vorausgesetzt, es ist Euch recht?«, fügte er hinzu, als er den verstörten Gesichtsausdruck der Hurenkönigin bemerkte.
Ursel stieß vernehmlich den Atem aus und wechselte mit Bernhard einen beredten Blick. »Das ist es«, erwiderte sie schließlich. »Auch wenn es mir nicht leichtfällt, darüber zu sprechen. Die grausamen Morde an meinen Mädchen machen mir immer noch sehr zu schaffen«, gestand sie. »Mit der Kriminalchronik schreibe ich mir gewissermaßen eine Last von der Seele – wenn so etwas überhaupt möglich ist.« Sie ergriff zärtlich die Hand ihres Geliebten. »Und mein schlauer Bernhard hilft mir dabei.«
Heller musterte die Gildemeisterin nachdenklich. »Ich kann gut verstehen, dass Euch das nahegeht – nach allem, was man den Frauen angetan hat. Aber ich denke, dass es Euch guttun wird, darüber zu schreiben«, äußerte der Verleger zuversichtlich. »Obgleich ich selbst nicht der schreibenden Zunft angehöre, sondern nur Verleger bin, habe ich doch in den langen Jahren meiner Tätigkeit immer wieder erfahren, wie heilsam das Schreiben für den einen oder anderen Autor sein kann. Für manche ist es sogar weitaus mehr als das – nämlich die reinste Besessenheit. Die Schreibenden sind schon ein Völkchen für sich.« Er lächelte versonnen. »Ich habe in meiner Laufbahn schon viele große Geschichtenerzähler kennengelernt, und sie lassen mich beim Schreiben allesamt an Kinder denken, die vollkommen in ihr Spiel versunken sind.«
»Was für ein schöner Gedanke«, sagte Bernhard. »Das trifft es voll und ganz. – Auch wenn ich nur wissenschaftliche Abhandlungen schreibe und keine schöne Literatur, so vermag mich das Schreiben doch wundersam zu erfüllen. Wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, bin ich oft derart vertieft in meine Gedanken, dass ich gar nicht merke, wie die Zeit vergeht ...«
Nachdem der Kellner der kleinen Tischgesellschaft zum Dessert noch den ebenso köstlichen wie kostspieligen Frankfurter Mandelkäse kredenzt hatte, ließ Heller noch einmal die Trinkbecher auffüllen und erkundigte sich bei seinen Gästen, ob alles recht gewesen sei.
Ursel und Bernhard ergingen sich in Komplimenten über die wohlschmeckenden Speisen und bedankten sich bei dem Verleger für die schöne Einladung.
Als Heller die Hurenkönigin aufmunternd anlächelte, holte diese tief Luft und begann, von jenem Sommer anno 1511 zu sprechen, an dem das Unheil seinen Lauf nahm und die Hübscherin Rosi verschwand. Während sie stockend berichtete, wie Rosi am Gedenktag von Maria Magdalena ermordet und schrecklich verstümmelt im Main aufgefunden wurde, konnte es die Gildemeisterin nicht verhindern, dass ihr Tränen über die Wangen strömten. Ihre Schilderung war so lebendig und eindringlich, dass selbst der beherrschte Geschäftsmann Heller ergriffen war. Er hing förmlich an Ursels Lippen.
Während sie schilderte, wie sie dem Mörder langsam auf die Schliche gekommen war, war nicht nur Bernhard, der das Grauen noch einmal zu durchleben schien, sondern auch der Verleger schreckensbleich geworden.
»Kompliment, Gildemeisterin, Ihr seid eine brillante Erzählerin!«, entgegnete Heller voll Bewunderung. »Ihr versteht es, Eure Zuhörer in den Bann zu ziehen – und das wird Euch auch mit Euren Lesern gelingen. Da bin ich mir sicher. Ich kann Euch nur ans Herz legen: Schreibt so, wie Ihr sprecht, dann wird die Kriminalchronik ein großer Erfolg werden!«
Ursel blinzelte irritiert. »Aber ich rede doch nur so, wie ich es immer tue, wenn ich etwas erzähle. Ich überlege mir gar nicht, welche Worte ich wählen soll ... Wenn ich über die ermordeten Huren spreche oder die bestialische Freifrau ... dann sehe ich alles wieder so deutlich vor mir, als wäre es gerade erst geschehen und nicht vor elf Jahren. Es nimmt mich auch so mit, als wäre es mir eben widerfahren, so sehr bin ich im Geschehen drin ...« Doktor Heller legte der Hurenkönigin, die am ganzen Körper bebte, besänftigend eine Hand auf den Arm. »Genau das ist das große Geheimnis der Erzählkunst, liebe Zimmerin. Es ist das Eintauchen in die Menschen und Ereignisse. Das ist es, was eine lebendige Schilderung ausmacht.« Mit einem Mal blickte sich der Verleger verwundert um. »Großer Gott! Wir sind ja die letzten Gäste«, rief er aus und bemerkte, dass die Kellner bereits die Tische wischten. »Es muss schon sehr spät sein«, murmelte er und bat einen der Ober um die Rechnung. Als dieser erschien, erkundigte er sich nach der Uhrzeit.
»Die Rathausuhr hat gerade zur Mitternacht geschlagen«, antwortete der Mann mit der ledernen Schürze höflich.
Auch Bernhard und Ursel waren entgeistert, als sie das hörten.
Bevor sie sich gemeinsam erhoben, erkundigte sich der Verleger bei der Hurenkönigin, wo sie denn zu wohnen gedenke, wenn sie im nächsten Jahr in den Ruhestand gehe.
Über das markante Gesicht der Gildemeisterin glitt ein verschmitztes Lächeln. »Bernhard und ich haben vor, in Bernhards Landhaus auf dem Lohrberg überzusiedeln. Dort können wir in Ruhe an der Kriminalchronik schreiben, lange Spaziergänge unternehmen und ein wenig im Garten arbeiten, wenn uns der Sinn danach steht ...« Sie tätschelte dem Gelehrten liebevoll die Schulter.
Bernhard lächelte vergnügt. »So ist es, meine Liebe. – Doch du hast eines vergessen«, setzte er hinzu.
Als Ursel ihn daraufhin begriffsstutzig musterte, erklärte er: »Kinderhüten! – Wir haben Isolde doch angeboten, dass wir uns jederzeit um ihr Kleines kümmern, wenn die jungen Leute mal was vorhaben.« Und an seinen Verleger gerichtet, erläuterte er strahlend: »Meine Nichte Isolde hat doch letztes Jahr geheiratet und ist inzwischen guter Hoffnung. In etwa einem Monat wird sie das Kind zur Welt bringen, und Ursel und ich können es gar nicht erwarten, bis das Kleine endlich da ist ... Isolde ist für Ursel und mich fast wie eine Tochter, und wir freuen uns wie die Schneekönige über den Zuwachs!«
Doktor Heller gratulierte Bernhard und Ursel herzlich und bedankte sich bei ihnen für den gelungenen Abend.
Zufrieden und guter Dinge begaben sich die drei anschließend auf den Nachhauseweg.
***
Christoph Fischer drehte verdrossen seine Runde durch die menschenleere Frankfurter Altstadt. Noch gute sechs Stunden würde sein Dienst andauern, bis es endlich Tag werden würde und er nach Hause, in sein warmes Bett wanken könnte, um endlich wieder bei seiner geliebten Frau zu sein, die ihn wie immer mit offenen Armen empfangen würde. Dann würden sie sich lieben, und nach nur drei Stunden Schlaf musste er schon wieder aufstehen, um in der städtischen Junkerschule seinen Lateinunterricht aufzunehmen. Für den wurde er bedauerlicherweise so lausig bezahlt, dass er nebenbei noch als Nachtwächter arbeiten musste, um sich und seine junge Frau durchzubringen. Und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie Zuwachs bekommen würden. Bei aller Müdigkeit und Erschöpfung musste er unwillkürlich lächeln. Sei es drum, dachte er trotzig, und wenn sie einen ganzen Stall voll Kinder hätten und er sich noch mehr plagen müsste, so war er doch seit gut einem halben Jahr der glücklichste Mann der Welt, und keine zehn Pferde könnten ihn wieder zurück zu seiner geistlichen Laufbahn bringen, wo er lange genug ein sauertöpfisches Leben im Zölibat geführt hatte und nicht zu der Frau seines Herzens hatte stehen können. Nein, alles ist besser als das!
Vor genau drei Jahren, als er gerade sein Amt als Kaplan der Liebfrauenkirche angetreten hatte, war Edelgard ihm begegnet. Die junge Kaufmannstochter aus gutem Hause hatte ihn in der Sakristei ausgesucht, um eine Totenmesse für ihre verstorbene Großmutter in Auftrag zu geben. Er hatte in ihre klaren meergrünen Augen geblickt, hatte die Sommersprossen auf Nase und Wangen gesehen, die wie feiner Goldstaub auf ihrem seidigen Teint glitzerten – und das, was er niemals für möglich gehalten hatte, war eingetreten: Er hatte sich mit Haut und Haaren in die liebreizende Patriziertochter verliebt. Als zutiefst gläubiger Mensch, der die Lehren der Heiligen Römischen Kurie niemals in Frage gestellt hatte und seiner Tätigkeit stets mit Ehrgeiz und Freude nachgegangen war, hatte er anfangs heftig mit solcherlei ihm bislang unbekannten Gefühlswallungen gehadert. Nächtelang hatte er gebetet und sich selbst schwere Bußen auferlegt, doch es hatte ihn nicht losgelassen. Im Gegenteil, er war wie besessen von seinen verstörenden Empfindungen, den lüsternen Phantasien, die sich bei ihm unwillkürlich einstellten, wenn er nur an die junge Frau dachte. Und er dachte unentwegt an sie. – Auch ihr schien er nicht gleichgültig zu sein. Ihm fiel auf, dass sie fast täglich den Gottesdienst besuchte, und wenn sich ihre Blicke trafen, warf sie ihm ein derart bezauberndes Lächeln zu, dass er das Gefühl hatte, ihn treffe der Schlag.
In seiner Verzweiflung hatte er sich schließlich seinem Förderer und Mentor anvertraut, dem Dekan der Liebfrauenkirche, Johannes Cochläus, der sich bei der Kurie für ihn verwendet hatte und für ihn wie ein Vater war – ein gestrenger, aber guter Vater, der ihm stets mit großem Wohlwollen begegnete.
Der Herr Dekan war entsetzt über die Anwandlungen seines Schützlings und empfahl ihm den Rückzug ins Gebet, das Tragen eines Bußgürtels und kalte Waschungen.
Mehr als zwei Jahre hatte er mit sich gerungen, hatte sich mit aller Strenge auferlegt, beim Gottesdienst nicht mehr ihren Blick zu suchen, und sich verboten, überhaupt an sie zu denken. Doch als sie der Messe nur ein einziges Mal fernblieb, war er so todunglücklich, dass er sterben wollte.
Und dann hatten sie sich einander offenbart. In der Vorweihnachtszeit, während einer Kollekte für die Stadtarmen. Gemeinsam hatten sie warme Decken und andere Spenden in die Sakristei getragen, und da hatte ihm sein Engel, als sie alleine und unbeobachtet waren, zugeflüstert, wie sehr sie ihn liebe. Mit kehliger Stimme hatte er ihr zugeraunt, dass es ihm genauso ergehe, und wäre in diesem Moment nicht der Küster hereingekommen, wären sie einander in die Arme gefallen ...
Der stattliche Mann mit den lang wallenden braunen Haaren und dem feingeschnittenen Gelehrtengesicht, hielt inne und blickte versonnen auf den nächtlichen Römerberg, über den ein Windhauch strich und das bunte Herbstlaub zum Tanzen brachte.
Eines Tages hatte er dann von einem Priester namens Martin Luther gehört, einem streitbaren und mutigen Mann, der seine fünfundneunzig Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen hatte, in denen er unter anderem auch für die Heirat von Priestern eintrat. Als Mann der Tat hatte sich Luther nicht nur mit einer ehemaligen Nonne vermählt, sondern es gegenüber Kaiser und Reichsständen auch standhaft verweigert, seine Theologie zu widerrufen, was zur Folge hatte, dass der Kaiser die Reichsacht über ihn verhängte.
Christoph Fischer hatte sich den großen Mann aus Wittenberg zum Vorbild genommen und konsequent sein Leben verändert: Er hatte sein Amt aufgegeben und die Frau geheiratet, die er liebte. Dafür hatte er in Kauf genommen, dass sich sein Mentor erbittert von ihm abwandte und Edelgards Eltern, langjährige Gemeindemitglieder der Liebfrauenkirche, ihre Tochter fallenließen.
Während Fischer gleich darauf von der Neuen Kräme kommend den Weg über den Liebfrauenberg einschlug, hielt er beim Anblick der Kirche und des Pfarrhauses beklommen die Luft an. Den Teufel hatte er ihm an den Hals gehetzt, sein ehemals ihm so zugeneigter Förderer, und Fischer war ihm – gottlob! – seither nicht mehr begegnet. Erleichtert wollte Christoph gerade in den Holzgraben einbiegen, als er plötzlich gewahrte, dass vom Brunnen her eine Gestalt auf ihn zuwankte.
Bestimmt einer dieser staubigen Brüder, die in den übervollen Bettlerherbergen während der Herbstmesse kein Obdach mehr gefunden hatten!
»Wohin des Weges?«, rief er streng, erhob die Pechfackel und zückte drohend seine Lanze, denn es gehörte ebenfalls zu den Aufgaben eines Nachtwächters, das lichtscheue Gesindel aus der Stadt zu jagen. – Als er jedoch im Fackelschein das Gesicht von Johannes Cochläus erkannte, stockte ihm vor Schreck förmlich der Atem. Er hat wohl wieder getrunken, ging es Fischer, dem hinlänglich bekannt war, dass der Dekan gerne einen über den Durst trank, durch den Sinn, und er wollte schon das Weite suchen, als der Pfarrer ihn grob am Arm packte. Unwillig versuchte er, sich aus seinem Griff zu befreien, doch Cochläus umklammerte ihn wie ein Schraubstock.
»Was untersteht Ihr Euch!«, entfuhr es dem Nachtwächter aufgebracht, und er gab dem Betrunkenen einen Schubs.
»Ich verfluche dich, du elender Nestbeschmutzer!«, gellte die schrille Stimme des Dekans durch die nächtliche Stille. »Dich und deine vermaledeite Hure soll der Teufel holen ...!«
Hätte Cochläus nur ihn beleidigt, hätte es Fischer darauf beruhen lassen und wäre weiter seiner Wege gezogen. Dass er aber seine geliebte Frau als Hure verunglimpfte, konnte er nicht dulden. Er ließ die Lanze fallen und verpasste dem Pfarrer eine schallende Ohrfeige.
Das vom Alkohol gerötete Gesicht des Dekans war hassverzerrt. Er spie verächtlich vor seinem früheren Protegé aufs Pflaster und schrie: »Verrecken soll sie, die läufige Hündin, die dich immerzu umgarnt hat! Verrecken soll sie!«
Jetzt wurde es dem stattlichen jungen Mann zu bunt. Entgegen seiner sonst eher friedfertigen Art packte er den Störenfried kurzerhand am Kragen. »Schweig still, du Pharisäer!«, herrschte er ihn an. »Und wenn du es noch einmal wagst, auch nur ein Wort gegen meine Frau zu sagen, erschlage ich dich mit meiner Lanze wie einen räudigen Hund!«
Scheinbar hatte der Zorn des wehrhaften jungen Nachtwächters den Dekan in seine Grenzen gewiesen, denn er wandte sich plötzlich von Fischer ab und trottete dem Pfarrhaus zu.
Als Christoph Fischer wenig später auf wackligen Beinen den Holzgraben entlanghastete, vernahm er vom benachbarten Liebfrauenberg erneut laute Schreie. Es war unverkennbar die Stimme von Cochläus.
»Er war wie ein Sohn für mich, der Junge ... Sie hat ihn mir geraubt, diese Schlange! Hat immer so getan, als wär sie die keusche Susanne, das scheinheilige Luder, dabei hat sie’s faustdick hinter den Ohren ... Verrecken soll sie, diese Pfaffenhure! Verrecken soll sie!«
Die immer hasserfüllter und unflätiger ausgestoßenen Flüche des Pfarrers schmerzten Fischer förmlich in den Ohren und raubten ihm beinahe den Verstand. Hin- und hergerissen, ob er zum Liebfrauenberg zurückkehren sollte, um dem Schreihals das Maul zu stopfen, oder ob er das Weite suchen und davonlaufen sollte, entschied er sich schließlich für Letzteres und rannte und rannte, bis er weit genug weg war, um die Hasstiraden nicht mehr hören zu müssen.
Kapitel 2
Dienstag, 16. Oktober 1522
Auf dem finsteren Heuschober über dem Kuhstall war es wie immer um die Jahreszeit feuchtkalt. Die große Kälte aber mit dem strengen Frost, der einem die Glieder steif werden ließ, würde erst noch kommen. Michel Schuch, der seit nunmehr acht Jahren hier oben seine Schlafstatt hatte, wusste das nur zu gut. Da musste man schon noch ein Schafsfell um sich legen, um im Schlaf nicht zu erfrieren. Dennoch war Michel ganz froh über seine armselige Behausung – er hatte es in seinem jungen Leben weiß Gott schon schlechter getroffen. Immerhin ließ man ihn in Ruhe, hier oben war er gewissermaßen sein eigener Herr, zumindest bis die Melkmägde zu nachtschlafender Zeit in den Stall kamen, um die Kühe zu melken. Da konnte es dann zuweilen schon vorkommen, dass die Frauenzimmer ihn hänselten oder sich sonst wie über ihn lustig machten. Aber auch damit konnte sich Michel arrangieren, denn er hatte früh die Erfahrung machen müssen, dass es weitaus Schlimmeres gab, was einem widerfahren konnte, als ausgelacht zu werden.