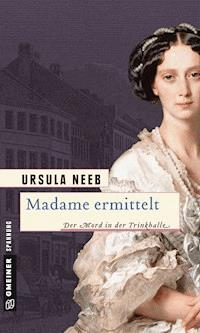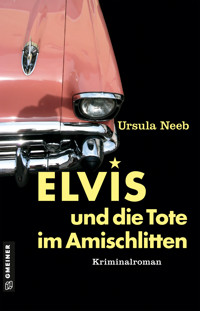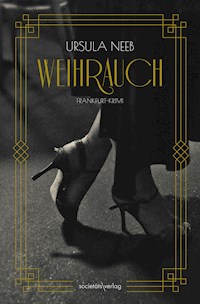7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Frankfurt 1511: Am Gedenktag von Maria Magdalena wird die Leiche der Hübscherin Roswitha entdeckt. Ursel Zimmer, die Vorsteherin der städtischen Hurengilde, findet heraus, wer der letzte Freier war. Doch als man seiner habhaft wird, beteuert der verzweifelte Mann, er habe nur einen Auftrag erfüllt. Er erwähnt einen geheimnisvollen Ring, der die Hurenkönigin zwar auf eine heiße Spur bringt, sie aber auch höchster Gefahr aussetzt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Am Gedenktag von Maria Magdalena wird in Frankfurt die Leiche der Hübscherin Roswitha aus dem Main gezogen. Der Körper der Toten weist schlimme Verletzungen auf und ist in ein Büßergewand gehüllt. Die Untersuchung der Leiche ergibt, dass Roswitha an Syphilis erkrankt war. Ursel Zimmer, die Vorsteherin der städtischen Hurengilde, findet heraus, wer Roswithas letzter Freier war. Die Stadt leitet eine Fahndung ein, doch Ursel ist sich plötzlich nicht mehr so sicher, ob man dem Richtigen auf der Spur ist. Und so scheut die Hurenkönigin keine Mittel und Wege, um den Mörder, der ihre Mädchen bedroht, zu finden – und entkommt schließlich selbst nur knapp dem Tod …
Die Autorin
Ursula Neeb hat Geschichte studiert und ist fasziniert von dem Leben im Mittelalter. Sie arbeitete beim Deutschen Filmmuseum und bei der FAZ, heute lebt sie mit ihren beiden Hunden im Taunus, wo sie auf langen Spaziergängen neue Geschichten ersinnt.
Ursula Neeb
Die Hurenkönigin
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2012© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2012Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: Stoffstruktur und Ornamente: Finepic®, München; Frau: akg-images / Erich LessingSatz und eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, BerlinISBN978-3-8437-0124-2
Für Markus Wild, der all meine Mägde, Wundermänner und Königinnen so famos begleitet hat.
»Wann sie ziehent in die messen, So lebens tag vnd nacht imm saus, Fragent baldt nach dem frawen hauß.«
Johann Haselbergk, 1533
»Die hohe Leidenschaft der Liebe verlangt eine noch höhere Standhaftigkeit im Dulden.«
Lehre aus der Zunft der Weiberknechte,13. Jahrhundert
Teil 1Die Büßerin
Maria Magdalena –Schutzpatronin der Huren
Ihr Gedenktag ist der 22. Juli.
Prolog
Um die missmutige Stimmung seiner schönen Herrin ein wenig zu heben, hatte er an diesem Abend die Laute herbeigeholt und sich zu ihren Füßen auf dem Boden niedergelassen.
»Was darf ich Euch aufspielen, Herrin?« Ergeben blickte der junge Mann mit dem schulterlangen kupferfarbenen Haar zu dem hohen Lehnstuhl auf.
Die Frau mit den engelhaften Gesichtszügen zuckte unwillig mit den Schultern und fuhr ihn an: »Was weiß denn ich? Spiel Er doch, was Er will!«
Während er sein Instrument stimmte, besann er sich kurz. Er würde eines seiner Lieblingslieder spielen, »Du süße, holde Herrin mein«. Es stammte aus der Feder des berühmten Minnesängers Ulrich von Lichtenstein, den er zutiefst bewunderte. Nachdem er die ersten Töne der melancholischen alten Weise angestimmt hatte, fing er mit wohltönender Stimme an zu singen:
»Sie war von hoher Art geboren,
sie war so schön und gut, so keusch und rein,
sie war in allen Tugenden vollkommen,
ihr Knecht wollt ich für immer sein …«
»Genug!«, unterbrach sie ihn gereizt. »Du langweilst mich. Ich möchte ein Bad nehmen und dann zu Bett gehen.«
Er verstummte augenblicklich, legte die Laute beiseite und erhob sich. »Sehr wohl, Herrin. Ich werde alles richten«, erwiderte er unterwürfig und verneigte sich, ehe er den Raum verließ.
Nachdem die Mägde kübelweise heißes und kaltes Wasser in die Badestube getragen hatten, verwandte er einige Sorgfalt darauf, dem Badewasser die richtige Temperatur zu geben. Wenn es nicht wohltemperiert war, setzte es Schläge. Schon manche Reitgerte hatte die Herrin an ihm zerschlagen, weil ihr das Bad nicht recht gewesen war. Aber das war bei weitem nicht das Schlimmste, was ihm in all den Jahren widerfahren war, seitdem er im Alter von zwölf Jahren den Frauendienst bei ihr angetreten hatte. Von Anfang an hatte ihm seine gestrenge Herrin die unglaublichsten Prüfungen auferlegt. Zur Belustigung ihrer Gäste musste er sich zuweilen als Kammerzofe oder als Hanswurst verkleiden. Manchmal, vor allem während der größten Sommerhitze, stand ihr gar der Sinn danach, dass er sich ein zotteliges Fellkleid überzog, auf allen vieren ging und sämtliche Gehorsamsübungen vollführte, die ein gut abgerichteter Jagdhund zu beherrschen hatte. Das Schrecklichste aber war, wenn er sich am Karfreitag unter die Aussätzigen mischen musste, denen es an diesem Tag erlaubt war, auf der Mainbrücke zu betteln.
In alledem sah er jedoch seine Bestimmung, und es gab nichts, was er nicht für sie getan hätte.
Immer wieder hielt er den Ellbogen in die Wanne und befand die Wassertemperatur schließlich für angemessen. Sie hatte eine so unglaublich zarte Haut, weich und empfindlich wie die eines Säuglings. Er goss ein ordentliches Quantum Rosenöl ins Wasser und ließ der Herrin durch eine der Mägde bestellen, das Bad sei gerichtet.
Als die Holde wenig später in der Badestube erschien, half er ihr beim Auskleiden und rückte die hölzerne Trittstiege vor den Zuber. Auf seinen Arm gestützt, stieg sie mit elfenhafter Anmut ins Bad und sank mit einem wohligen Seufzer ins Wasser. Er wusch den grazilen Körper seiner Herrin mit einem großen, weichen Meeresschwamm, den er bei einem Händler aus dem Orient erstanden hatte. Nach dem Bade trocknete er sie behutsam ab, kleidete sie in ein seidenes Nachtgewand und kämmte ihr das hüftlange goldene Haar mit einem Kamm aus Elfenbein. Anschließend geleitete er sie in ihr Schlafgemach, wo er ihr die Daunenkissen aufschüttelte und das Bett aufdeckte. Nachdem sie in das Bett geschlüpft war, deckte er sie zu. Ehe er sich aus dem Schlafgemach entfernte, küsste er ihre Hand und wünschte ihr eine gesegnete Nacht.
Später räumte er in der Badestube die Waschutensilien weg, beugte sich hinab und trank in großen Zügen von ihrem Badewasser. Zum Abschluss entfernte er mit zärtlicher Geste die einzelnen Haare aus dem Kamm und verwahrte sie sorgfältig in einer kostbaren Reliquienkapsel, die er am Gürtel trug.
1
Samstag, 16. Juli 1511
Die mechanische Räderuhr am Römerrathaus hatte gerade die zehnte Stunde geschlagen, als die »angemalte Rosi« mit einem Krug Wein in der Hand die Treppe hinaufstieg. Ihr rundes, stark geschminktes Gesicht glänzte, und die Augen waren gerötet. Sie hatte die Nase gestrichen voll von Freiern und dem Rest der Welt und wollte sich in ihrer Kammer nur noch in Ruhe besaufen.
In der vergangenen Nacht hatte sie kein Auge zugetan vor Gram – wegen Josef, diesem Drecksack! Seine Maulschellen brannten noch immer wie Feuer auf ihrem Gesicht, und ihre Oberlippe war geschwollen. Schlimmer als das aber war der Schmerz wegen seiner Untreue, der an ihr nagte wie Ratten am Aas. Sie hätte ihn umbringen können – ihn und dieses verdammte Weibsstück! Den ganzen gestrigen Abend hatte sie mit ansehen müssen, wie er mit der anderen herumschäkerte. Schließlich war Rosi der Kragen geplatzt, und sie hatte ihm unten in der Schankstube vor aller Augen eine handfeste Eifersuchtsszene geliefert. Daraufhin verpasste ihr Josef eine Backpfeife und schlüpfte als Krönung auch noch zu der verhassten Rivalin ins Bett. Rosi hatte gesoffen wie ein Loch, um endlich einschlafen zu können und das laute Gestöhne der beiden, das bis in ihre Kammer drang, nicht mehr hören zu müssen.
Am Morgen war sie dann so übel gelaunt und verkatert gewesen, dass sie am liebsten in den Main gesprungen wäre. Sie hatte alles und jeden gehasst. Bei den anderen Huren des Frauenhauses hatte sie tagsüber ordentlich Dampf abgelassen, so dass die Hurenkönigin sie mehrmals zusammenstauchte. Und bei den acht Freiern, die sie im Laufe des Tages hatte, hatte sie ihrer Wut erst recht freien Lauf gelassen. Unflätig beschimpft hatte sie die geilen Böcke, was dem einen oder anderen sogar Spaß zu machen schien.
Zum Glück war der Tag jetzt so gut wie gelaufen. In einer Stunde war Sperrstunde, und das Frauenhaus wurde geschlossen. Rosi hoffte inständig, dass sich kein Freier mehr zu ihr verlief. Scheiß doch auf die paar Kröten, sie konnte für heute jedenfalls keinen Schwanz mehr sehen!
Als sie die Galerie entlang auf ihr Zimmer zuging, hörte sie plötzlich Schritte auf der Treppe. Hastig eilte sie zur Tür, um noch rasch hineinzuschlüpfen, als sie die Stimme der Frauenhauswirtin Ursel Zimmer vernahm: »Rosi, da ist noch Kundschaft für dich!«
Verärgert wandte Rosi sich um. Hinter der Hurenkönigin kam ein Freier die Treppe herauf.
Auch das noch!, dachte sie beim Anblick des abgerissen wirkenden Mannes, der einen schweren Tornister auf dem Rücken trug und dessen hageres Gesicht von grauen Bartstoppeln übersät war.
»Kann den nicht eine andere übernehmen? Mir tut das Kreuz weh, und ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen«, sagte Rosi flehend zur Frauenhauswirtin und blinzelte sie aus müden Augenschlitzen an.
»Ich weiß doch, Kindchen. Ich hätte dich auch gerne geschont, aber er hat ausdrücklich nach dir verlangt.« Die Vorsteherin der Hurengilde, die auch mit über fünfzig Jahren noch eine schöne Frau war, legte mütterlich den Arm um Rosi. »Komm, nimm ihn dir noch zur Brust. Er ist auch bestimmt der Letzte für heute. Und morgen ist Sonntag, da kannst du dich ein bisschen ausruhen.«
Rosi, die der Vorsteherin sehr zugetan war, ließ ihren Widerstand fahren und schnaubte resigniert: »Na gut. Wenn’s denn unbedingt sein muss. – Und Ihr seid Euch sicher, dass Ihr wirklich zu mir wollt?«, wandte sie sich an den Freier.
»Ja«, murmelte der Mann und musterte Rosi verlegen. »Ihr seid doch die Hübscherin Roswitha?«
»Die bin ich«, erwiderte die Angesprochene ungnädig. Der Fremde konnte seinen Blick kaum von ihren üppigen, aus dem enggeschnürten Mieder quellenden Brüsten lösen.
»Warum denn ausgerechnet ich?«, raunzte Rosi ärgerlich. »Andere im Haus haben auch so was …«
»Ich möchte aber zu Euch, wenn’s recht ist«, lispelte der Landgänger, der kaum noch Zähne im Mund hatte. Er fügte mit listigem Lächeln hinzu: »Es soll auch Euer Schaden nicht sein!«
Rosi, der es laut Frauenhausordnung untersagt war, einen Mann abzuweisen, winkte den Zerlumpten mit der Bemerkung, ihr bleibe heute aber auch nichts erspart, in ihre Kammer und knallte missmutig die Tür hinter sich zu.
Während sich der Fremde den schweren Rucksack vom Rücken schnallte und seinen abgerissenen Umhang ablegte, verzog Rosi angewidert das Gesicht.
»Mensch, du stinkst ja wie ein Iltis«, fauchte sie, ergriff den Wasserkrug, der auf dem Tisch stand, und goss etwas Wasser in die Waschschüssel. Dann hielt sie ihm ein aufgeweichtes Stück Kernseife hin. »Wasch dich erst mal, du Dreckfink.«
Der Mann zog seine Hosen herunter und tat folgsam, wie ihm geheißen. Rosi hatte sich indessen aufs Bett gesetzt, ihr Mieder geöffnet und die vollen Brüste entblößt. Als sich der Mann wenig später zu ihr umwandte und ihre pralle Weiblichkeit erblickte, versteifte sich sogleich sein Glied.
Das wird schnell gehen bei dem, dachte sie routiniert und langte in den Tiegel mit Rindertalg, der auf der Truhe neben dem Bett stand.
»Soll ich ihn dir reiben, oder willst du ihn reinstecken?«, fragte sie den fahrenden Händler, der mit den Hosen um die Knöchel auf sie zustolperte. »Fünf Groschen fürs Reiben, das Bocken kostet doppelt so viel«, leierte sie herunter und blickte den Mann mit stumpfem Gesichtsausdruck an.
»Wennschon, dennschon«, grummelte der Hausierer atemlos. »Es ist schon ’ne Weile her, dass ich was mit ’ner Frau hatte.«
»Das kann ich mir denken. Gut, dann komm her. Und zieh ihn bloß vorher raus, ehe du abspritzt.« Rosi hob den Rock, spreizte die Beine und fettete mit geübten Fingern ihr Geschlecht ein, ehe sie das Glied des Mannes am Schaft packte und einführte.
Ihre Ahnung hatte sie nicht getäuscht. Nach wenigen Stößen war der Mann abgefertigt, zog sich ächzend die Hosen hoch und nestelte an seinem Brustbeutel, um sie zu bezahlen. Mit einem Stück Sackleinen wischte sich Rosi gähnend den Bauch ab und streckte ihm die andere Hand mit der Handfläche nach oben entgegen. Doch zu ihrem Erstaunen zückte der Fremde eine glänzende Silbermünze und fuchtelte damit neckisch in der Luft herum.
»Hör Sie mir jetzt einmal genau zu, ich soll Ihr nämlich was bestellen«, tönte er mit einem Mal so großspurig wie ein Landjunker und ließ sich neben ihr auf der Bettkante nieder. »Ich soll Ihr den Gulden geben und Ihr ausrichten, dass Sie sich heimlich davonschleichen und zur elften Stunde am Fahrtor sein soll. Dort wartet ein vornehmer Herr auf Sie, der nicht erkannt werden will. Deswegen soll Sie auch Ihr Maul halten und darf niemandem was davon erzählen. Der reiche Pfeffersack lässt Ihr bestellen, dass Sie nach getaner Arbeit noch einen Gulden kriegt. Hat Sie das kapiert und hält sich daran?« Der Hausierer schaute Rosi fragend an. Ihr fehlten zunächst die Worte, doch beim Anblick des Guldens hatte sie ganz glänzende Augen bekommen.
»Darauf kannst du einen lassen«, erwiderte sie und nahm freudig den Gulden in Empfang. »Du hast mir den Tag gerettet, Alter! Dafür hast du bei mir was gut.« Ihre Übellaunigkeit war mit einem Mal wie weggefegt, und sie strahlte den unscheinbaren Fremden an, als wäre er ihr Heilsbringer.
»Darauf komme ich gern zurück, wenn ich mal wieder in Frankfurt bin«, erwiderte der Landgänger geschmeichelt und schien bereits im Stillen zu erwägen, ob er von dem großzügigen Angebot nicht gleich Gebrauch machen sollte. Rosi, der seine Anwandlung nicht verborgen geblieben war, schubste ihn sachte von der Bettkante. »Nix da, mein Alter. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich will doch pünktlich sein. Und ich muss mich auch noch ein bisschen herrichten …« Sie schnürte das schwarze Samtmieder zu und schenkte sich einen Becher Wein ein.
Nachdem der Hausierer gegangen war, nahm sie ihre Schminkutensilien vom Wandbord. Im diffusen Licht der Talgkerze besah sie sich im Spiegel und war alles andere als zufrieden. Die vom häufigen Auftragen der blei- und quecksilberhaltigen Schminke großporige Gesichtshaut war gerötet. Sie tauchte ihren Finger in einen Tiegel mit weißer Paste, die aus Mehlstaub und Quecksilber bestand, und verteilte sie in einer dicken Schicht über die fleckigen Wangen und die Nase. Dann stippte sie den Zeigefinger in ein Glas mit leuchtend roter Mennige und bestrich damit die Wangenknochen, um so einen Hauch von Morgenröte auf ihr Gesicht zu zaubern. Anschließend tupfte sie sich etwas Kohlenstaub auf die verquollenen Augenlider und strich zum Abschluss noch einen scharlachroten Balsam auf die Lippen. Merklich zufriedener betrachtete sie ihr nun maskenhaft geschminktes Gesicht, betupfte den ausrasierten Stirnansatz mit Rosenöl, richtete mit flinkem Griff das aufgetürmte safranfarbene Haar und nahm das gelbe Schultertuch vom Kleiderhaken. Mit angehaltenem Atem drückte sie die Türklinke hinunter und spähte auf den Flur hinaus. Auf der Galerie war niemand zu sehen. Vereinzelt drangen Beischlafgeräusche aus den danebenliegenden Kammern, und von unten, wo Josef im Schankraum hinter der Theke stand und Wein ausschenkte, hörte sie das übliche Stimmengewirr und Scheppern der Würfelbecher. Die Luft schien rein zu sein. Sie zog ihr Schultertuch eng zusammen und trat vorsichtig auf den Gang hinaus. Falls ihr jemand begegnete und fragte, wo sie hingehe, würde sie einfach sagen, sie wolle ein wenig frische Luft schnappen.
Zu ihrer Erleichterung gelangte sie jedoch unbehelligt nach draußen. Es regnete leicht an diesem milden Sommerabend, und so hielt sich niemand in der Umgebung des Dempelbrunnens auf, wo sich die Huren bei schönem Wetter und an lauen Sommerabenden gern trafen. Mit fliegenden Schritten überquerte Rosi den Brunnenplatz und bog in die Alte Mainzergasse ein, erleichtert darüber, dass sie nun vom Frauenhaus aus nicht mehr zu sehen war.
Den Huren des städtischen Frauenhauses war es nämlich streng verboten, sich außerhalb des Bordells mit Freiern zu treffen. Der Magistrat der Stadt Frankfurt, dem das Frauenhaus gehörte, wollte verhindern, dass ihn die Hübscherinnen um die Einnahmen prellten. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Rosi zu einem heimlichen Stelldichein ging – Josef, ihr »lieber Mann«, hatte sie schon mehrfach an gut betuchte Privatfreier verkuppelt und dann den Löwenanteil ihres schwerverdienten Geldes in die eigene Tasche gesteckt. Das wird dieses Mal anders sein, dachte sie triumphierend. Von diesem Geld siehst du keinen roten Heller, du treuloser Schurke. Das gehört mir allein!
Rosi schlug das Herz bis zum Hals. Sie tastete nach dem Lederbeutel, den sie zwischen den Brüsten trug und in dem sie den Gulden verwahrte. Und danach würde sie noch einen kriegen. Ganze zwei Gulden – so viel hatte sie noch nie verdient! Selbst dann nicht, wenn Messe war und die reichen Kaufleute und Händler aus aller Herren Länder scharenweise ins Frauenhaus strömten. Mit zwei Gulden konnte sie endlich fortgehen und woanders ihr Glück versuchen. Da würde Josef blöd aus der Wäsche gucken, wenn die dumme Gans, die er jahrelang ausgenutzt und betrogen hatte, sich still und heimlich vom Acker machte! Auf ihrem weißgeschminkten Gesicht breitete sich ein grimmiges Lächeln aus.
Mit so viel Geld in der Tasche müsste sie eigentlich gar nicht mehr anschaffen gehen – zumindest eine Zeitlang nicht – und könnte sich mehr um ihren Kleinen kümmern, den sie bei der Wäscherin Luitgard in Pflege gegeben hatte. Gleich morgen früh würde sie den zweijährigen Christoph abholen und mit ihm auf einem Güterkahn mainaufwärts in den Spessart fahren, wo ihre Eltern lebten. Seit fünf Jahren, seit sie als Fünfzehnjährige nach Frankfurt gekommen war, um eine Arbeit zu finden, hatte sie die beiden nicht mehr gesehen. Ihre Eltern, einfache Köhlerleute aus dem Spessartdörfchen Heigenbrücken, ahnten nichts von ihrem schändlichen Gewerbe, und sie wussten auch nichts von ihrem Enkel. Von den zwei Gulden hätten sie alle vier das ganze Jahr hindurch ihr Auskommen, sie könnte sich um den Kleinen kümmern und ihrer Mutter bei der Hausarbeit zur Hand gehen. Die frische Luft würde dem Buben guttun, wo er doch so ein spitzes, bleiches Gesichtchen hatte, und sie müsste sich nicht mehr länger diesen widerlichen Kerlen hingeben. Und wer weiß, vielleicht fände sie da draußen auf dem Lande, wo die Menschen noch anständiger waren als hier in der Stadt, sogar ein gestandenes Mannsbild – einen verwitweten Bauern oder Handwerker, der es ehrlich mit ihr meinte und sie trotz des unehelichen Kindes heiraten würde.
Eigentlich hatte sie davon geträumt, mit Josef, der der Vater von Christoph war, aufs Land zu ziehen und einen kleinen Bauernhof zu betreiben. Sie hätten das Kind zu sich nehmen und heiraten und ein anständiges, gutes Leben führen können. Leider war dieser Traum nie Wirklichkeit geworden. Dafür war Josef, dieser Hallodri, einfach nicht der richtige Mann.
In solcherart Gedanken versunken, erreichte Rosi schließlich das Fahrtor an der Mainbrücke, die Frankfurt mit dem waldreichen Stadtteil Sachsenhausen verband, und blickte sich erwartungsvoll um. Weit und breit war niemand zu sehen, aber sie war auch noch etwas früh dran. Die Rathausuhr hatte noch nicht die elfte Stunde angeschlagen.
Stockfinster war es hier draußen am Mainkai. Der faulige Geruch des Flusses stieg ihr in die Nase, und auch der Regen war inzwischen stärker geworden. Rosi senkte den Kopf, damit ihre Schminke nicht verlief, und spürte plötzlich eine vage Furcht in sich aufsteigen. Zu ihren anderen Verabredungen außerhalb des Frauenhauses hatte Josef sie immer begleitet. Und er hatte sie auch abgeholt, wenn alles vorbei war. Aber er hatte außerdem ihren Hurenlohn kassiert, dachte sie mit einem Anflug von Verbitterung, und ihre Beklommenheit schwand.
Plötzlich hörte sie Pferdegetrappel, das immer näher kam, und im nächsten Augenblick ertönte vom nahe gelegenen Römerberg das Geläut zur elften Stunde. Ein Reiter galoppierte die langgezogene Fahrgasse herunter und brachte das Pferd vor ihr zum Stehen. In der Hand hielt er eine Fackel, in deren Schein sie feingeschnittene Gesichtszüge erkennen konnte.
»Seid Ihr die Hure Roswitha?«, erkundigte er sich ohne Umschweife bei der gelbgewandeten Frau.
»Die bin ich, mein Herr.« Rosi, die von dem vornehm gekleideten Reiter angenehm überrascht war, schenkte ihm ein verführerisches Lächeln. Was für ein hübsches Bürschchen, ging es ihr durch den Sinn, für den würd ich ja sogar umsonst die Beine breit machen!
Der junge Mann blickte sich aufmerksam nach allen Seiten um, stieg vom Pferd und wandte sich dem Brückentor zu. Sie sah, dass er einen großen Bartschlüssel zückte und damit das Tor aufschloss. Er drückte auf die Klinke, und der eisenbeschlagene Türflügel öffnete sich knirschend zur Brücke hin.
»Geh Sie doch schon mal durch«, murmelte er. »Wir müssen hinüber nach Sachsenhausen.«
Rosi trat über die Schwelle auf die steinerne Mainbrücke, die düster und menschenleer vor ihr lag. Tagsüber herrschte hier ein ständiges Kommen und Gehen. Hinter den Brückenpfeilern strömte träge der Main dahin, in der nächtlichen Dunkelheit glich er einem schwarzen Abgrund. Sie hörte, dass ihr Begleiter die Pforte wieder verriegelte, und wandte sich zu ihm um.
»Erstaunlich, dass Ihr über einen Torschlüssel verfügt. Da müsst Ihr ja ein ganz hoher Herr sein«, durchbrach sie die Stille.
Anstelle einer Erwiderung hievte sie der schlanke, großgewachsene Mann mit einer kraftvollen Bewegung aufs Pferd und schwang sich hinter sie. Sogleich setzte sich das Tier in Bewegung, und wenig später sah Rosi das Brückenkreuz mit dem goldenen Hahn auf der Spitze an sich vorüberziehen. Im nächsten Augenblick passierten sie auch schon den hohen Durchgang des Brückenturms, in dem die Stadt ihre Narren verwahrte. Rosi vermeinte von oben aus dem Turm irres Wimmern zu vernehmen, und ein kalter Schauder überlief sie. Schnell hatten sie den mächtigen Wachturm an der Sachsenhäuser Mainseite erreicht, dessen Portal der Fremde gleichermaßen entriegelte und, nachdem sie hindurch waren, wieder verschloss. Anschließend ging es in wildem Galopp durch den kleinen Stadtteil Sachsenhausen. Die Bewohner schienen schon allesamt zu schlafen, Rosi konnte hinter den dunklen Fensterhöhlen keinen Lichtstrahl ausmachen. Unversehens entrang sich ihr ein Seufzer, denn der Arm des jungen Reiters hielt sie mit eisernem Griff umklammert und schnürte ihr regelrecht die Luft ab. In Windeseile gelangten sie an die Affenpforte am anderen Ende der Stadtmauer, die aus Sachsenhausen hinausführte.
»Sagtet Ihr nicht, wir müssten nach Sachsenhausen?«, erkundigte sich Rosi, der allmählich mulmig wurde.
»Wir reiten in den Sachsenhäuser Forst«, erwiderte der Reiter, und seine Umklammerung wurde noch fester. Was für ein Grobian!
»Au, Ihr tut mir weh!«, begehrte sie auf, als sein Ellbogen ihre Brust quetschte. Er quittierte ihre Klage mit eisigem Schweigen und lockerte seinen Griff nicht im Geringsten. Am liebsten hätte Rosi sich aus der Umklammerung befreit und wäre vom Pferd gesprungen. Einer, der so grob war und so abweisend, der würde ihr doch nur blaue Flecken einbringen! Aber da war noch der zweite Gulden – und sie beschloss, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, und muckste sich nicht mehr, als sie über den Steg des Stadtgrabens ritten. Und dann waren sie auch schon im Wald.
Rosi wusste nicht, ob es an den finsteren Tannen lag oder an seinem angespannten Schweigen – er hatte sie auch noch kein einziges Mal berührt, wie das die anderen Kerle immer taten –, aber sie hatte plötzlich ein banges Gefühl. Etwas huschte hinter den Bäumen durchs Dickicht, und in der Nähe erklang der Ruf eines Käuzchens. Rosi stellten sich die Nackenhärchen auf. Erneut machte sie den Versuch, mit dem schweigsamen Reiter ins Gespräch zu kommen.
»Ich bin froh, dass Ihr bei mir seid. In dem Wald kann einem schon das Grausen kommen«, plapperte sie bemüht munter und legte ihm die Hand auf den Oberschenkel.
»Lass Sie das!«, fuhr er sie an und rammte ihr den Griff der Fackel in den Rücken. Rosi war vor Schreck wie gelähmt. Während sich der Regen auf ihrem Gesicht mit kaltem Angstschweiß mischte, spürte sie bis in die Haarspitzen hinein, dass etwas Böses von ihm ausging. In jäher Panik schrie sie verzweifelt um Hilfe und versuchte mit aller Kraft, sich aus seinem Griff zu winden. Doch es gelang ihr nicht, seine Hand krallte sich nur noch tiefer in ihren Oberarm, und er zischte wütend: »Sei still, du Miststück! Hier draußen kann dich sowieso keiner hören!«
2
Sonntag, 17. Juli 1511
Als Ursel Zimmer am Sonntagmorgen vom durchdringenden Läuten der Kirchenglocken geweckt wurde, fuhr sie hoch und rieb sich verschlafen die Augen. Es war höchste Zeit, aufzustehen, um sich für den sonntäglichen Kirchgang herzurichten. Gähnend sank sie jedoch wieder zurück auf ihr Daunenkissen und schmiegte sich an den Mann, der schlafend an ihrer Seite lag. Versonnen betrachtete sie sein markantes Gesicht mit der Denkerstirn, das umrahmt war von schulterlangem graumeliertem Haar.
Bernhard von Wanebach war die Liebe ihres Lebens. Es war für sie immer noch wie ein Wunder, dass ihr so etwas beschieden war.
Als sie ihm damals begegnete, im reifen Alter von vierzig Jahren, war sie bereits seit über zwei Jahrzehnten im Geschäft. Sie war immer noch eine der begehrtesten Huren in der Stadt gewesen, die es trefflich verstand, ihren Verehrern Leidenschaft vorzuspiegeln. Aber ihr Herz war dabei stets unberührt geblieben. Die Liebe war für sie nichts anderes gewesen als ein Handel, nicht mehr und nicht weniger. Und dann hatte sie diesen Mann getroffen und mit ihm eine so atemberaubende Nacht erlebt, dass sie anschließend weinte und ihm zuflüsterte, sie werde dereinst als glücklicher Mensch sterben.
Bernhard hatte sie zärtlich umfasst, und da wusste sie, dass es ihm ebenso erging. Noch am selben Tag hatte sie sich entschieden, ihr Gewerbe aufzugeben und nur noch als Frauenhauswirtin tätig zu sein.
Ursel weckte Bernhard mit einem Kuss. Er blinzelte schläfrig und zog sie in seine Arme. Wie immer konnte sie sich ihm nicht versagen, und sie liebten sich mit der Hingabe zweier Menschen, die einander mit Leib und Seele zugetan waren.
Nach dem Liebesspiel erhob sich Ursel atemlos aus dem Bett und kleidete sich an. »Ich muss mich jetzt aber noch ein bisschen schönmachen«, sagte sie, während sie ihr zerzaustes hennarotes Haar kämmte und hochsteckte. »Geh doch schon mal runter und sag den Mädchen, dass ich gleich komme. Ich brauche noch ein Weilchen.«
Nachdem Bernhard gegangen war, begutachtete sie sich im Spiegel und fing an, sich zu schminken. Ihr Gesicht war von einer Vielzahl an Fältchen durchzogen, man sah ihm an, dass sie gelebt hatte. Dennoch war das Antlitz der Hurenkönigin von eigenwilliger Schönheit. Der wohlgeformte Mund mit den sinnlichen Lippen kündete von Stolz und Lebensfreude, und die ausdrucksvollen, fast schwarzen Augen, die schon in mancherlei Abgründe geblickt hatten, schauten klug und offen in die Welt. Die so unverhofft erlebte Liebe hatte aus der ehemaligen Hure Ursel Zimmer eine glückliche Frau gemacht, die mitten im Leben stand.
Als sie wenig später die Schankstube im Erdgeschoss des Frauenhauses betrat, die den Huren auch als Aufenthaltsraum diente, saßen ihre Schäfchen schon alle am Tisch und aßen ihren Sonntagskuchen, den die Köchin den Huren an ihrem einzigen arbeitsfreien Tag immer kredenzte.
»Morgen, Mädchen!«, grüßte die Zimmerin in die Runde, ehe sie sich auf ihrem angestammten Platz an der Stirnseite des Tisches niederließ.
»Morgen, Meistersen«, antworteten die Huren im Chor.
Im Frauenhaus am Dempelbrunnen regierte die Gildemeisterin Ursel Zimmer wie eine Königin. Die lebenserfahrene Frau, die seit über zwanzig Jahren für die Belange der Huren eintrat, wurde von ihren Schützlingen geachtet und geliebt. Sie konnte ebenso herrisch wie großherzig sein und verstand es, den meist entwurzelten Frauen Halt und Geborgenheit zu geben. Auch wenn die Huren zuweilen über die Schrullen der Zimmerin fluchten, so hätte doch keine sie missen mögen.
»Du bist spät dran heute, Ursel«, mahnte die dunkelhaarige Hübscherin Ingrid. Sie hatte im Frauenhaus die vertrauensvolle Stellung der Lohnsetzerin inne und war Ursels Stellvertreterin. Da sie außerdem noch als Einzige unter den Huren lesen und schreiben konnte, nannte man sie auch die »schlaue Grid«. Die Frau mit den schräg geschnittenen grünen Augen war Ursels beste Freundin.
»Ein Stück Kuchen werde ich doch noch essen dürfen«, flachste die Hurenkönigin, schnitt sich ein dickes Stück Gugelhupf ab und biss herzhaft hinein. Sie ließ ihre Augen über die Tischgesellschaft schweifen. Plötzlich hielt sie inne und rief aus: »Die angemalte Rosi fehlt! Weiß jemand, wo sie ist?«
Die Huren zuckten nur mit den Schultern, keine hatte Rosi an diesem Morgen gesehen.
Die Hurenkönigin wandte sich an den Frauenhausknecht Josef, der genau wie die Köchin, die Scheuermagd und die Wäscherin mit am Tisch saß. »Geh sie mal holen! Sie liegt bestimmt noch im Bett.«
Der Mann mit dem muskulösen Oberkörper und den kurzgeschorenen schwarzen Haaren warf der Hurenkönigin einen mürrischen Blick zu. »Muss das denn sein, Meistersen? Ihr wisst doch, dass wir wieder Zorres hatten …«
»Wer weiß das nicht, Josef! Euer Gezanke hat man doch im ganzen Haus gehört. Aber du gehst jetzt nach ihr gucken und damit fertig!«, erwiderte die Zimmerin resolut. Der baumlange Frauenhausknecht erhob sich unwillig und schlurfte aus der Stube.
»Es geht mich zwar nichts an, mit wem du es treibst, Vogelsberger Änne«, sprach die Hurenkönigin unversehens eine junge Hure mit hellblonden Haaren an. »Du bist noch neu bei uns, aber du solltest wissen, dass Josef ein Kind mit der Rosi hat. Es wäre vielleicht gescheiter, in Zukunft die Finger von ihm zu lassen.«
Die Angesprochene errötete. »Das konnte ich ja nicht riechen«, murmelte sie verlegen.
»Deswegen sage ich es dir ja jetzt.« Die Zimmerin musterte die junge Hübscherin ungnädig. »Weiber, die nur Unfrieden stiften, können wir nicht gebrauchen.«
»Der ist doch mir nachgestiegen und nicht umgekehrt und …«, verteidigte sich die Hure.
Doch die Zimmerin unterbrach sie barsch: »Schluss jetzt!« Sie schlug mit der Hand auf den Tisch. »Zum Bocken gehören immer noch zwei!«
Im nächsten Moment kehrte Josef zurück. »Die Rosi ist nicht da! Ihr Zimmer ist leer«, erklärte er.
Die Stimmung der Hurenkönigin verdüsterte sich. »Wo kann sie denn nur sein?«, murmelte sie besorgt.
»Vielleicht ist sie ja bei ihrem Kleinen? Wir können ja nach der Kirche mal bei der Luitgard vorbeischauen«, schlug Ingrid vor und mahnte zum Aufbruch.
Bernhard von Wanebach bot Ursel seinen Arm an, und gemeinsam verließen sie, gefolgt von den Huren und den vier Bediensteten, das Frauenhaus am Dempelbrunnen und bogen in langer Prozession in die Alte Mainzergasse ein.
An diesem sommerlichen Sonntagmorgen waren viele Leute unterwegs. Zunfthandwerker im Sonntagsstaat machten sich mit ihren Ehefrauen und Kindern und in Begleitung der Lehrlinge und Gesellen auf den Weg zum Gottesdienst. Mitunter waren auch Kaufleute mit ihren Familien zu sehen, von denen es in dem ärmlichen Wohnbezirk am Fluss allerdings nicht so viele gab. In angemessenem Abstand folgten ihnen die sonntäglich herausgeputzten Mägde.
Wenn die gelbgewandeten Frauen an den Passanten vorübergingen, wurden sie mit verächtlichen Blicken bedacht. Selbst die Kinder glotzten sie hämisch an und tuschelten verstohlen.
Obgleich Ursel Zimmer die allgemeine Verachtung, die den Huren in der Öffentlichkeit entgegenschlug, gewohnt war, erbitterte sie das selbstgerechte Gebaren der Leute doch auch nach mehr als dreißig Dienstjahren noch maßlos. Als einfaches Mädchen aus dem Vogelsberg war sie damals nach Frankfurt gekommen, um dort eine Anstellung als Magd oder Näherin zu finden. Das hatte sich als schwierig erwiesen, da es weitaus mehr arbeitsuchende Mägde als Stellungen gab. Bald litt sie Hunger, und so blieb ihr in ihrer Not nur noch, sich im Frauenhaus zu verdingen, wollte sie nicht am Bettelstab gehen. So wie ihr, das wusste sie inzwischen, war es den meisten Huren ergangen. Bevor eine Frau sich entschied, das verachtete gelbe Gewand zu tragen, hatte sie zumeist eine entbehrungsreiche Zeit hinter sich. Doch davon hatten all diese wohlgenährten Stadtbürger natürlich keine Ahnung.
»Zu uns kommt nur, wer schon genug Dreck gefressen hat«, pflegte sie immer zu sagen, wenn ihr ein neues Mädchen sein Leid klagte.
Und so schritt die Hurenkönigin mit hocherhobenem Haupt an den ehrbaren Hausfrauen und braven Familienvätern vorüber, unter denen sie längst den einen oder anderen Freier ausgemacht hatte. Mit wachsender Besorgnis musste sie an Rosi denken, und auf ihre Stirn war eine tiefe Sorgenfalte getreten.
»Hoffentlich ist Rosi nichts passiert!«, raunte sie Bernhard zu.
»Was soll ihr schon passiert sein? Du wirst sehen, ihr Verschwinden wird sich bald aufklären«, suchte Bernhard seine Geliebte zu beruhigen. »Vielleicht war sie ja bei ihrem Buben, und wir treffen sie in der Kirche.«
Ursel schwieg. Unwillkürlich fiel ihr die Hure Hildegard Dey ein, die ein Jahr zuvor von einem wahnsinnigen Mörder, der sich für König Tod hielt, erwürgt worden war. Die grausamen Morde, die dank Katharina Bacher, der Tochter des städtischen Totengräbers, aufgeklärt werden konnten, hatten damals in Frankfurt und im ganzen Land für großen Aufruhr gesorgt. Danach hatte die Zimmerin noch eine ganze Zeitlang jeden Freier misstrauisch beäugt, ob nicht auch in ihm eine mörderische Bestie lauerte.
In solche Gedanken versunken, erreichte sie an Bernhards Seite schließlich die St.-Leonhard-Kirche, durch deren geöffnetes Portal die Gläubigen strömten.
Die Hurenkönigin trat ein, bekreuzigte sich und nahm Aufstellung vor den letzten zwei Bänken am Ende des Kirchenschiffs, die den städtischen Hübscherinnen als sogenannte »Hurenbänke« vorbehalten waren. Bernhard von Wanebach und die Bediensteten des Frauenhauses ließen sich in den Bänken weiter vorne nieder. Nachdem die Huren sich gesetzt hatten, nahm die Zimmerin ihren Platz am Ende der Reihe ein.
Nach den Eingangsgebeten und Gesängen betrat Pfarrer Simon Roddach die Kanzel. Schweigend maß er seine Kirchengemeinde mit einem so unheilvollen Blick, als stünde das Ende der Welt bevor – wobei die Hurenkönigin den Eindruck gewann, dass er auf den Hübscherinnen besonders lange verweilte. Endlich hob er mit Grabesstimme an zu sprechen.
»Liebe Brüder und Schwestern, eine schreckliche Heimsuchung hat unsere Heimatstadt ereilt: Monstrosus morbus – die Geschlechtspest – hält Einzug in Frankfurt! In der Badestube am Knäbleinsborn sind bereits zwei Bademägde erkrankt, und womöglich haben sich auch schon etliche Männer bei ihnen angesteckt. Es sind die schandbaren Frauen, die das Unglück über uns bringen!«
Ein bestürztes Raunen ging durch das Kirchenschiff, auf den Gesichtern der Gläubigen spiegelte sich Entsetzen. Auch die Hurenkönigin war wie vom Donner gerührt. Sie hatte schon von dieser Seuche gehört, die angeblich durch den Liebesakt übertragen wurde und die viele Menschen mehr fürchteten als den Aussatz oder den Schwarzen Tod. Fahrende Flugblatthändler hatten auf dem Römerberg berichtet, man mutmaße, Seeleute hätten die bislang unbekannte Krankheit aus der Neuen Welt eingeschleppt, denn sie trete vor allem in den großen Hafenstädten auf. Dort hatte die Lustseuche auch bereits die ersten Todesopfer gefordert.
Schon damals hatte ihr bei diesen Nachrichten der Atem gestockt. Sie mochte sich gar nicht ausmalen, was diese scheußliche Erkrankung in ihrem Gewerbe anrichten konnte, und daher hatte sie den Gedanken daran wieder verdrängt. Und jetzt stand das Übel schon vor der Haustür!
»Heilige Muttergottes, steh uns bei«, murmelte die Zimmerin und bekreuzigte sich. Auch unter den Huren herrschte Bestürzung. Immer mehr Gemeindemitglieder wandten sich zur Hurenbank um und durchbohrten die Huren geradezu mit ihren Blicken. Angst, aber auch blanker Hass spiegelte sich in ihren Augen. Ursel sträubten sich angesichts der Feindseligkeit sämtliche Nackenhaare.
Der Pfarrer indes, dem es ohnehin ein Dorn im Auge war, dass das Frauenhaus zu seinem Sprengel gehörte und die Huren das Recht hatten, in der St.-Leonhard-Kirche den Gottesdienst zu besuchen und die Beichte abzulegen, mühte sich nach Kräften, noch Öl in die Flammen zu gießen. »Mit dieser abscheulichen Lustseuche straft der Herrgott alle Frevler, die ungezügelt der Fleischeslust frönen!«, wetterte er mit sich überschlagender Stimme. »Wer in diesen schlimmen Zeiten seinen Trieb nicht zügeln kann und sich weiterhin mit wohlfeilen Metzen abgibt, der wird zum Mörder seiner ganzen Sippe!«
Die Hurenkönigin, die sonst so leicht nichts erschüttern konnte, war von den Hasstiraden wie vor den Kopf gestoßen. Auch die Gildeschwestern starrten fassungslos vor sich hin.
Pfarrer Roddach war bei seiner Predigt so in Rage geraten, dass ihm der Schweiß von der Stirn strömte. Er nestelte unter den Falten seines Priestergewandes ein weißes Tuch hervor und wischte sich damit übers Gesicht. Dann schlug er den Folianten auf, der vor ihm auf dem Pult lag, und verkündete mit sonorer Stimme: »Meine lieben Brüder und Schwestern, und so möchte ich euch heute eine Passage aus der Offenbarung des Johannes vorlesen. Sie möge euch allen ein Trost, aber auch eine Warnung sein.«
Er legte eine Pause ein und bedachte die gelbgewandeten Frauen im Hintergrund des Kirchenschiffs mit einem vernichtenden Blick. Drückende Stille breitete sich unter der Gemeinde aus, kaum jemand wagte laut zu atmen.
»Die große Hure Babylon.« Das hagere Gesicht des Geistlichen war zu einer Grimasse verzerrt, er spie die Worte aus, als besudelten sie seine Lippen. »Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei, und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name: Ich bin die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden; denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet!«
Im Laufe seiner Predigt war die Stimme des Pfarrers immer fanatischer geworden. Die letzten Sätze aber hatte er mit einer solchen Besessenheit von sich gegeben, als wäre er höchstpersönlich der Vollstrecker des Herrn.
Ursel Zimmer konnte nicht mehr länger an sich halten. Wie von Nadeln gestochen sprang sie auf und schrie: »Das müssen wir uns nicht anhören! Das ist ja die reinste Hasspredigt! Und so was will ein Mann Gottes sein – der reinste Volksverhetzer seid Ihr!« Sie wandte sich abrupt um und stürmte aus der Kirche.
Auch die Hübscherinnen hatten sich von ihren Plätzen erhoben und folgten ihr.
Bernhard von Wanebach trat aus der Kirchenbank. »Ihr solltet Euch schämen, Hochwürden, die freien Töchter unserer Stadt so zu verteufeln!«, tadelte er den Geistlichen und eilte, gefolgt vom Frauenhausknecht und den Dienstmägden, ebenfalls hinaus.
Vor der Kirche stand Ursel Zimmer im gleißenden Sonnenlicht und war kreidebleich vor Wut. Die Huren hatten sich um sie geschart und ließen ihrer Empörung freien Lauf.
»Das habt Ihr gut gemacht, Meistersen!«, bemerkte der Frauenhausknecht anerkennend.
Bernhard ging auf seine Geliebte zu und schloss sie in die Arme. »Was für ein verknöcherter kleiner Eiferer!«, schimpfte er verächtlich.
»Dieser scheinheilige Kuttenträger!«, fluchte die schlaue Grid und hakte sich bei der Freundin unter.
Die Hurenkönigin schnaubte. »So etwas müssen wir uns nicht gefallen lassen. Ich gehe morgen ins Rathaus und beschwere mich beim Bürgermeister über diesen Pfaffen.«
Als sich der Trupp schon in Bewegung gesetzt hatte, hielt die Hurenkönigin plötzlich inne und sagte: »Ach, ich wollte ja noch bei der Wäscherin vorbeischauen, ob die Rosi da ist. In der Kirche war sie jedenfalls nicht.«
»Lasst es gut sein, Meistersen, da mach ich mich jetzt hin«, sagte der Frauenhausknecht. »Ich wollte sowieso mal nach dem Kleinen sehen.«
»Gut, Josef, dann mach das«, entgegnete die Zimmerin. »Und bring die Rosi bloß wieder mit heim, damit man sich keine Sorgen mehr machen muss.«
Josef hob grüßend die Hand und bog in die Buchgasse ein.
Die Hurenkönigin blickte ihm sinnend nach. »Ich kann schon verstehen, warum der Josef bei euch Weibern so beliebt ist«, bemerkte sie. »Bei all seiner Muskelkraft ist er doch ein großer Bub geblieben, dem man kaum etwas übelnehmen kann.«
Als sich die Hübscherinnen dem Frauenhaus näherten, gewahrten sie an der Eingangstür einen großen dunklen Gegenstand, der sich beim Näherkommen als tote Katze entpuppte. Sie war direkt unter der roten Laterne, welche das Frauenhaus in der Nacht auch für Ortsfremde kenntlich machen sollte, an die Tür genagelt worden.
Die Frauen und auch die Gildemeisterin stießen bei dem Anblick laute Entsetzensschreie aus. Mit angewiderter Miene trat Bernhard an die Tür, um den Tierkadaver zu entfernen, doch plötzlich zuckte er zusammen.
»Da ist ein Zettel«, murmelte er und wies auf ein beschriftetes Stück Papier, das mit dem Nackenfell des Tieres auf das Holz genagelt war.
»Hic habitat peccatum«, las er leise vor und war aschfahl geworden.
»Was bedeutet das?«, krächzte die Hurenkönigin. Erschöpft stützte sie sich auf das Treppengeländer.
Bernhard fiel es augenscheinlich schwer, die Worte über die Lippen zu bringen. Mit bebender Stimme sagte er: »Das heißt: Hier wohnt die Sünde.«
Um die Mittagszeit verließ der Frauenhausknecht Josef Ott die Hinterhauswohnung der Wäscherin Luitgard Griebel in der Buchgasse und ging in Richtung Leonhardspforte, wo sich die Leonhardsschenke befand. Wie so häufig, wenn er seinen Sohn Christoph besucht hatte, war er niedergeschlagener Stimmung. Es schnitt ihm jedes Mal ins Herz, wie Christoph seine Ärmchen nach ihm ausstreckte, wenn ihn Josef aus dem Wäschekorb nahm, der als Wiege diente. Ein richtiger Kümmerling, dachte der Bauernsohn aus der Wetterau bedrückt. Mit diesem Ausdruck hatte sein Vater immer die schwächsten Ferkel bezeichnet.
In Momenten wie diesem verfluchte er, dass er keinen anständigen Beruf gelernt hatte, der es ihm ermöglicht hätte, eine Familie zu ernähren.
Die Tatsache, dass er Rosi nicht bei der Wäscherin angetroffen hatte, verhagelte ihm noch zusätzlich die Laune. Wo treibt sich denn das Weibsbild nur rum?, dachte er. Arbeitet sie neuerdings vielleicht in die eigene Tasche, oder hat sie einen anderen Kerl?
Wenn er ehrlich war, hätte er ihr das noch nicht einmal verdenken können – so oft, wie er sie schon betrogen hatte. Obgleich ihm Rosi alles andere als egal war – sie war die drallste Hure im ganzen Frauenhaus, und die Kerle waren alle ganz verrückt nach ihr –, konnte er sich doch nicht mit einer einzigen Frau zufriedengeben.
Er betrat die Schenke, um seine Schwermut mit Bier hinunterzuspülen. Als er sich beim Wirt einen Krug bestellte, richteten sich die Augen aller Schankgäste auf ihn, fast so, als hätte man gerade über ihn gesprochen.
»Wirst dich am besten schon mal nach einer anderen Arbeit umschauen. Eure Spelunke werden sie bestimmt auch bald zumachen!«, krähte ein beleibter, kahlköpfiger Mann durch die Wirtsstube und erntete damit hämisches Gelächter.
Josef, dem nicht der Sinn nach Ansprache stand, blickte verärgert zu ihm hinüber und erkannte den Bader aus der Badestube am Knäbleinsborn, der augenscheinlich schon einiges über den Durst getrunken hatte.
»Halt die Klappe, Ottmar, und lass mir meine Ruhe«, blaffte er den Betrunkenen an und ließ sich an einem freien Tisch in der Ecke nieder. Er konnte den Badestubenpächter sowieso nicht ausstehen, was zu einem Gutteil daran lag, dass Badestuben, in denen oft heimlich Prostitution betrieben wurde, für die Frauenhäuser eine unliebsame Konkurrenz darstellten. Außerdem war der Bader genau wie Josef nebenbei noch als Kuppler tätig, und gelegentlich lieferten sich die beiden Kontrahenten handfeste Auseinandersetzungen.
»Ich möchte nicht wissen, wie viele von euren Weibern schon die Geschlechtspest haben und sich trotzdem noch einen verpassen lassen«, pöbelte der gedrungene Bader. Offensichtlich war ihm daran gelegen, einen Streit vom Zaun zu brechen.
Josef, sowieso schon in gereizter Stimmung, hatte sich vom Stuhl erhoben und richtete sich nun bedrohlich auf.
»Dass die Weiber in eurem Drecksloch krank geworden sind, wundert mich nicht!«, polterte er. »Bei euch kann man doch schon die Krätze kriegen, wenn man bloß ein einfaches Bad nimmt, das weiß doch ein jeder! Unsere Mädels sind sauber und gesund. Und wer was anderes sagt, der kriegt eins auf die Fresse!«
Josef hatte die Fäuste geballt und warf nun auch den übrigen Schankgästen wütende Blicke zu, was dazu beitrug, dass den Spöttern ihre Schadenfreude augenblicklich abhandenkam. Denn keiner von den einfachen Mainfischern und Handwerksburschen hätte es gewagt, sich mit dem wehrhaften Frauenhausknecht anzulegen.
Nur Ottmar machte unbekümmert weiter: »Von wegen, da hab ich aber schon was ganz anderes gehört!«
»Jetzt reicht’s aber!« Wie ein Kampfhahn stolzierte Josef auf den Krakeeler zu. »Was willst du denn gehört haben?«