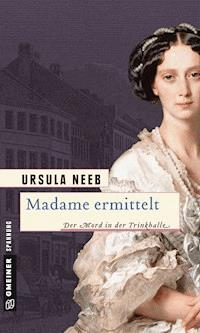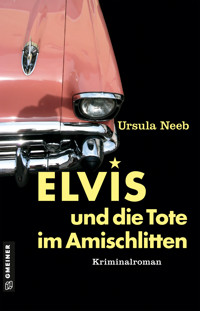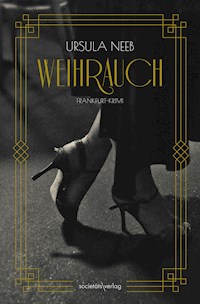5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die düster-faszinierenden Memoiren einer Mörderin im spannungsgeladenen Roman »Der Hölle Zorn« von Ursula Neeb. London, 1915: Verborgen vor der Welt, tief unten im Kellergewölbe des Bethlem Royal Hospital, verbringt der Irrenanstaltswärter Mathew seine Tage. Bei seiner Arbeit mit gefährlichen Serienmördern, die er keine Sekunde aus den Augen lassen darf, gehört zu seinen Lichtblicken das tägliche Schachspiel mit Lilli Wilson, einer charmanten älteren Dame. Warum sie als Insassin hier ist, gibt Mathew Rätsel auf … bis sie ihm ihr Tagebuch anvertraut: Das Grauen, das zwischen diesen Seiten lauert, fasziniert ihn auf unheimliche Weise. Ein dunkles Spiel entspinnt sich – zwischen grausamen Fantasien und einer furchtbaren Wahrheit, die nicht nur Mathews Leben, sondern ganz London einem Erdbeben gleich erschüttern wird … Mit erbarmungsloser Präzision enthüllt Ursula Neeb die Abgründe, die sich hinter der Fassade einer angesehenen viktorianischen Adelsfamilie verbergen – verwoben mit atemberaubenden neuen True-Crime-Erkenntnissen über die Identität des berüchtigtsten Serienmörders aller Zeiten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Schlussbemerkung
Fotoaufnahmen
Danksagung
Quellennachweis
Lesetipps
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Schlussbemerkung
Fotoaufnahmen
Danksagung
Quellennachweis
Lesetipps
Über dieses Buch:
London, 1915: Verborgen vor der Welt, tief unten im Kellergewölbe des Bethlem Royal Hospital, verbringt der Irrenanstaltswärter Mathew seine Tage. Bei seiner Arbeit mit gefährlichen Serienmördern, die er keine Sekunde aus den Augen lassen darf, gehört zu seinen Lichtblicken das tägliche Schachspiel mit Lilli Wilson, einer charmanten älteren Dame. Warum sie als Insassin hier ist, gibt Mathew Rätsel auf … bis sie ihm ihr Tagebuch anvertraut: Das Grauen, das zwischen diesen Seiten lauert, fasziniert ihn auf unheimliche Weise. Ein dunkles Spiel entspinnt sich – zwischen grausamen Fantasien und einer furchtbaren Wahrheit, die nicht nur Mathews Leben, sondern ganz London einem Erdbeben gleich erschüttern wird …
Mit erbarmungsloser Präzision zeichnet Ursula Neeb die Abgründe auf, die sich hinter der Fassade einer angesehenen viktorianischen Adelsfamilie verbergen – und enthüllt dabei atemberaubende neue Erkenntnisse über die Identität des berüchtigtsten Serienmörders aller Zeiten!
Über die Autorin:
Ursula Neeb wurde 1957 in Bad Nauheim geboren und studierte Geschichte, Kulturwissenschaft und Sozialpsychologie in Frankfurt am Main. Aus der Idee für ihre Doktorarbeit über verfemte Berufe im Mittelalter entstand ihr erster Roman. Nachdem Ursula Neeb viele Jahre für das Deutsche Filmmuseum und für die Frankfurter Allgemeine Zeitung tätig war, lebt sie seit 2005 als freie Autorin im Taunus und veröffentlichte bereits zahlreiche historische Kriminalromane in renommierten Verlagen. Ihre Faszination mit menschlichen Abgründen und Alfred-Hitchcock-Klassikern inspirierte sie zu ihrem Roman Der Hölle Zorn.
Die Autorin im Internet: www.facebook.com/ursula.neeb.1
***
Originalausgabe Mai 2019
Copyright © der Originalausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/TTstudio, ilolab, faestock und Valery Sydelnykov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96148-451-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Der Hölle Zorn an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Ursula Neeb
Der Hölle Zorn
Roman
dotbooks.
Für Silke Schimmelschmidt, die immer an mich und DER HÖLLE ZORN geglaubt hat – und Markus Wild, Jürgen Blümel und Gerold Hens, die meine schriftstellerische Arbeit von Anfang an begleitet und mit mir gehofft und gebangt haben.
»Es war, wie wenn nicht ein Mensch das getan hätte, sondern ein teuflischer Götze, ein Juggernaut, der mit seinen Wagenrädern über Menschenleiber dahinfährt.«
Robert Louis Stevenson, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, London 1886
***
»Kein Himmel kann je wüten wie Liebe, die zu Hass geworden,
noch keine Hölle rasen verschmähten Frauen gleich.«
William Congreve, The Mourning Bride, III, 8, London 1697
Prolog
Als die Kutsche an diesem trüben, regnerischen Novemberabend über die belebte Westminster-Brücke fuhr, gewahrte Sir John auf der anderen Uferseite, inmitten der Rauchwolken zahlloser Fabrikschlote, das weitläufige Gebäude des Londoner Irrenhauses. Vor einigen Jahren hatte er im Rahmen der Royal Society an einer Führung durch die Anstalt teilgenommen, die der Chefarzt Professor Hood für die Mitglieder veranstaltet hatte. Obgleich Sir John ein Mann der Wissenschaft war, und Professor Hood es trefflich verstanden hatte, die Zuhörer mit anschaulichen Erläuterungen in seinen Bann zu ziehen, hatte es ihn doch gegruselt, als sie durch den Trakt der unheilbaren Fälle geführt wurden. So erging es ihm auch jetzt, als die Kutsche vor der Hauptfront des mehr als 200 Meter langen Gebäudes, das eine der größten und ältesten Nervenkliniken der Welt beherbergte, vorfuhr.
»Es kann etwas dauern, Thomas«, beschied Sir John den Kutscher. »Ich habe mit dem Leiter der Anstalt eine Unterredung zu führen.«
»Ist recht, Sir«, entgegnete Thomas und bemühte sich, seine Betretenheit angesichts der schlechten Verfassung seines Herrn nicht zu offenkundig werden zu lassen. Das Aas, wie er Lady Wilson im Stillen zu nennen pflegte, setzt ihm ganz schön zu. Was ja auch kein Wunder war, denn alle Hausangestellten – er selbst nicht ausgenommen – waren schockiert über Lady Wilsons Gebaren. Die hat doch nicht alle Tassen im Schrank, wurde hinter vorgehaltener Hand gemunkelt – und das war wahrscheinlich auch der Grund für Sir John Wilsons Gespräch mit dem Irrenarzt.
Als Sir John über den weiß gekiesten Weg dem Haupteingang zustrebte, kam ihm aus dem Pförtnerhäuschen der Türhüter entgegen und erkundigte sich dienstbeflissen nach dem Grund seines Besuchs.
»Ich bin Professor Wilson und wünsche Professor Hood, der ein guter Freund von mir ist, in einer dringlichen Angelegenheit zu sprechen«, ließ ihn der Gynäkologe mit einiger Herablassung wissen.
»Sehr wohl, Sir, ich werde Professor Hood gleich verständigen«, erwiderte der Bedienstete devot. »Vorab möchte ich Sie aber bitten, sich in unser Besucherbuch einzutragen, das ist bei uns so Vorschrift …«
Sir John zog ungehalten die Brauen in die Höhe. »Mein Besuch ist rein privater Natur, von daher erübrigt sich ein derartiges Prozedere.«
Der Pförtner blinzelte verunsichert. »Da muss ich erst den Herrn Professor fragen …«
»Darum möchte ich doch sehr bitten«, erwiderte Sir John und musterte den Dienstmann indigniert. Dieser holte aus der Pförtnerloge einen riesigen Schlüsselbund und bat den Besucher, ihm zu folgen. Sie stiegen eine breite Marmortreppe hinauf zum Eingangsbereich, der im griechischen Stil gestaltet war und von acht korinthischen Säulen umgeben wurde. Der Pförtner entriegelte das imposante zweiflügelige Portal und führte Sir John in eine geräumige Vorhalle, in deren Zentrum sich eine Marmorskulptur befand, die den rasenden und melancholischen Wahnsinn darstellte, wie Sir John sich sogleich erinnerte. Vor allem der Anblick des rasenden Wahnsinns hatte ihn seinerzeit mit Grauen erfüllt, und er musste unwillkürlich an Lilli denken, die wohlverwahrt hinter verschlossenen Türen in narkotischem Schlaf lag. Hoffentlich, dachte er inständig und stakste auf weichen Knien hinter dem Pförtner her, der ihn zu einem Empfangszimmer geleitete und ihn aufforderte, Platz zu nehmen.
Da es Sir John wenig behagte, sich zu den drei Wartenden zu gesellen, die mit sorgenvollen Mienen über die Leiden ihrer Angehörigen sprachen, lüftete er vor der offenen Tür nur höflich seinen Zylinder und zog es vor, in der Halle zu warten.
Nachdem seine Geduld erheblich auf die Probe gestellt worden war und die anderen Besucher nacheinander von weiß gewandeten Pflegern aufgerufen worden waren, kam ihm in der marmornen Wandelhalle endlich der Anstaltsleiter entgegen und entschuldigte sich für seine Verspätung mit der Erklärung, er habe noch ein Gespräch mit einem Patienten gehabt.
Sir John war bekannt, dass der renommierte Psychiater genauso mit seiner Arbeit verheiratet war wie er – obgleich Hood im Gegensatz zu ihm bei aller Betriebsamkeit noch Zeit gefunden hatte, sechs Kinder in die Welt zu setzen –, also nahm er ihm die Verspätung nicht übel. Als der beleibte Mann mit den gewellten, grau melierten Haaren und dem Vollbart ihn zur Begrüßung umarmte, musste er schwer an sich halten, um an der Brust des Gemütsmenschen, welcher Professor Hood zweifellos war, nicht loszuheulen wie ein Pennäler. Was er jedoch wenig später, als sie einander in Hoods Arbeitszimmer gegenübersaßen, unweigerlich tat, als dieser ihn fragte, wo ihn der Schuh drücke.
Professor Hood war sichtlich erschüttert, den zu Arroganz neigenden Professor der Gynäkologie derart fassungslos zu erleben, und tat unwillkürlich das, was er bei weinenden Kindern und Patienten stets zu tun pflegte: Er legte Sir John besänftigend den Arm um die Schultern und reichte ihm ein Taschentuch.
Auch wenn sich Sir John für den Gefühlsausbruch schämte, obsiegte doch seine heillose Verzweiflung. Seit Lillis Geständnis herrschte in seinem Innern das absolute Chaos, nichts war mehr, wie es gewesen war – und das würde für immer so bleiben. Obwohl es ihm ein brennendes Bedürfnis war, dem erfahrenen Kenner der menschlichen Seele sein Herz auszuschütten, musste er sich doch diesen Wunsch versagen, da es die Umstände geboten, mit Lillis schrecklichem Geheimnis allein zurande zu kommen.
»Ich brauche deinen fachlichen Rat«, presste Sir John hervor und rang um Haltung, als er den Psychiater mit von Tränen geröteten Augen anblickte und ihn mit aller Eindringlichkeit bat, über die Angelegenheit strengstes Stillschweigen zu bewahren.
»Das versteht sich doch von selbst, erst recht, da es sich, wie du eben angedeutet hast, um eine Konsultation handelt«, sicherte ihm Professor Hood zu und betrachtete John, dessen Gesichtszüge vor Erregung bebten, ernst.
»Verzeih mir, wenn ich mich etwas kryptisch ausdrücke, aber es geht leider nicht anders.« John seufzte gequält. »Ich möchte auch keinen Namen nennen, aber es geht um jemanden, der im höchsten Maße geisteskrank ist, dabei aber so normal wirkt wie du und ich …«
»Das sind die Gefährlichsten«, äußerte der Psychiater. »Von dieser Gattung haben wir einige in unserer Kriminalabteilung.«
Sir John nickte betroffen. »Es handelt sich um eine Person, die völlig unberechenbar ist, die äußerst impulsiv und gewalttätig sein kann und daher eine große Gefahr für ihre Umwelt darstellt. Wie sollte man so einen Menschen am besten verwahren, ohne dass er Unheil anrichten kann?«
»Am besten natürlich, indem du ihn in unsere Anstalt einweist, denn wir verfügen über die besten Fachkräfte und Behandlungsmethoden für Geistesirre, selbst die unheilbaren und schwierigen Fälle werden bei uns optimal versorgt.«
»Davon bin ich überzeugt, mein lieber Reginald, aber das wird aus … Gründen der Diskretion leider nicht möglich sein.«
»Du machst mich neugierig«, brach es aus dem Psychiater heraus. »Sag bloß nicht, dass es jemanden aus der königlichen Familie betrifft?«
»Nein, es ist nicht der Duke of Clarence, falls du an ihn gedacht hast. Aber der Fall ist ähnlich heikel. Sagen wir mal, dass es sich um eine Patientin von mir handelt, die dem Adel angehört und daher größten Wert auf Diskretion legt. Ihre … Geisteskrankheit darf keinesfalls ruchbar werden. Sie soll auf dem Landsitz ihrer Familie gepflegt werden, und die Angehörigen baten mich um Rat, was ihre Verwahrung anbetrifft.«
Professor Hood glaubte ihm kein Wort. Da die Angelegenheit Sir John offensichtlich so naheging, musste es sich um einen Menschen aus seinem direkten Umfeld handeln – am Ende gar um seine Gattin, die der Psychiater auf Johns Bitte hin vor einigen Jahren einer Konsultation unterzogen hatte. Lady Wilson, die selbst unfruchtbar war, litt an einer an Hysterie grenzenden Abneigung gegen Schwangere – was für Sir John als namhaften Geburtshelfer, in dessen Praxis ständig Schwangere ein- und ausgingen, geradezu ruinös war. Hood erinnerte sich noch lebhaft an das Gespräch mit Lady Wilson, die sich als absolut therapieresistent erwiesen hatte. Alle Versuche, mit ihr über die Verhaltensauffälligkeit zu sprechen, waren an ihr abgeprallt wie an einem Eisenpanzer. Äußerst eloquent und gewieft – sie sprach unheimlich schnell, ohne Luft zu holen –, hatte sie ihn nach einer Stunde derart verwirrt, dass er das Gefühl hatte, er sei der Patient und nicht sie. Sie hatte ihn regelrecht erdrosselt mit ihrem Charme und ihrer schier atemberaubenden Überzeugungskraft, die keinen Zweifel aufkommen ließ, dass sie ganz und gar bei Sinnen war.
Dennoch hütete sich Professor Hood nun, diese Mutmaßung offen auszusprechen, um seinen Freund, der ohnehin schon das reinste Nervenbündel war, nicht zu kompromittieren.
»Nun, im Bethlem Royal Hospital sind wir seit einiger Zeit mit großem Erfolg dazu übergegangen, das Zwangssystem weitestgehend abzuschaffen. Vergitterte Fenster, Zwangsjacken und gepolsterte Zimmer verwenden wir nur noch vereinzelt bei den unheilbaren Fällen und natürlich in der Kriminalabteilung«, erläuterte der Psychiater. »Der mechanische Zwang findet nur im äußersten Notfall, bei Selbst- oder Fremdgefährdung,umh Anwendung.«
Sir John hatte ihm angespannt zugehört. »Das scheint jedoch in besagtem Fall vorzuliegen.«
»Nun, dann werden die Angehörigen nicht umhinkönnen, insbesondere bei Gewaltausbrüchen der Tobsüchtigen eine Zwangsjacke anzulegen und sie in einem gepolsterten Zimmer zu verwahren. Wobei die Wattierung aus besonders festem Gummi bestehen sollte, da Rasende dazu neigen, die Polsterung herunterzureißen, um sich an den harten Wänden den Schädel einzuschlagen. Wenn du möchtest, kann ich dir im Flügel der Unheilbaren eine solche Gummizelle zeigen und auch andere, veraltete Zwangsmaßnahmen, wie Ledermanschetten, mit denen Tobsüchtige ans Bett gefesselt werden, oder eben jene Segeltuchjacken, die Gewalttätige bewegungsunfähig machen. Meine Vorgänger hielten sie bei der Behandlung von Geisteskranken für unumgänglich«, erklärte Professor Hood stirnrunzelnd. »Sie erachteten die Prügelstrafe und den Zwang als beste Kur für widerspenstige Kranke. Die Nahrung sollte dürftig sein, die Kleidung grob, das Bett hart und die Behandlung streng und unnachgiebig. Wer nicht parierte, der kam ins Schwarze Loch.«
Fast wäre Sir John bei Letzterem ein zustimmendes »Jawohl!« herausgerutscht, da er der Überzeugung war, das sei der richtige Ort für ein Ungeheuer wie Lilli, doch er beschränkte sich auf ein eifriges Nicken.
»Eine zeitweilige einsame Absperrung kann mitunter tatsächlich einen beruhigenden Einfluss auf Rasende ausüben«, fuhr der Psychiater fort. »Aber dann nur in Zusammenhang mit einem warmen Bad und beruhigenden Medikamenten, die dem Patienten zuvor verabreicht wurden.«
»Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich dabei vor allem um bromhaltige Medikamente handelt?«, warf Sir John ein.
»In der Hauptsache Kaliumbromid«, bestätigte der Anstaltsleiter. »In entsprechend hoher Dosierung können wir damit den Patienten in einen künstlichen Winterschlaf versetzen, was zuweilen sehr heilsam für den Kranken und entlastend für unser Pflegepersonal ist. Es ermöglicht uns weitestgehend, auf den mechanischen Zwang zu verzichten.«
Professor Hood erhob sich und bot dem Freund an, ihm auf der Station der Unheilbaren die besagten Anschauungsobjekte zu zeigen. Sir John folgte dem Psychiater hinaus auf einen langen Flur, auf dem sich etwa zwanzig Kranke in hellgrauer Anstaltskleidung aufhielten. In der Mitte des Gangs befand sich ein großer Vogelbauer aus Messing, in dem prachtvolle Ringeltauben gehalten wurden. Sir John fiel auf, dass manche Patienten unablässig auf und ab gingen oder an die Wand gelehnt herumstanden und vor sich hin starrten. Nur die wenigsten unterhielten sich miteinander, die überwiegende Mehrheit verharrte in Schweigen und schien in ihrer eigenen Welt gefangen. Als die Kranken jedoch Professor Hood gewahrten, stürmten einige zu ihm hin, drückten ihm begeistert die Hand oder umarmten ihn. Es war augenscheinlich, dass sie ihn liebten. Der Professor lächelte milde und strich ihnen väterlich über die Köpfe.
»Ich habe nur äußerst selten erlebt, dass unsere Patienten das in sie gesetzte Vertrauen missbrauchen. Man muss sie nur behandeln wie Menschen und nicht wie Gefangene. Wenn es uns gelingt, einen Patienten zu klarem Bewusstsein zu bringen und ihm begreiflich zu machen, dass es von großer Bedeutung ist, sein Ehrenwort zu halten, so haben wir seinen geistigen Zustand bedeutend verbessert, denn die Wiederbelebung der Selbstachtung ist das erste untrügliche Zeichen einer Genesung«, wandte er sich an Sir Wilson und wies stolz auf die gitterlosen Fensterscheiben. »Im ganzen Jahr wurden nicht mehr als fünf Scheiben zertrümmert!«
»Alle Achtung«, pflichtete John ihm bei. »Doch du erwähntest vorhin, dass Fenstergitter in gewissen Abteilungen unverzichtbar seien?«
»Ja, im Patiententrakt der unheilbaren Fälle und in der Kriminalabteilung müssen wir bedauerlicherweise auf vergitterten Fenstern und verschlossenen Türen bestehen. Wenn du möchtest, gehen wir jetzt dorthin.«
Professor Hood entriegelte am Ende des Flurs eine Gittertür und trat mit John auf einen kleinen Hof, der von drei Gebäuden mit Säulengängen umgeben war. Der Professor ging auf die gepanzerte Tür des angrenzenden Flügels zu.
»Momentan befinden sich hier zehn Patienten.«
»Sind sie etwa auch … gemeingefährlich?«, fragte Sir John mit belegter Stimme.
»Keine Angst, mein Lieber, sie sind alle noch recht harmlos, wenn man von gelegentlichen Gewaltausbrüchen einmal absieht«, erklärte der Psychiater beschwichtigend. »Die wirklich gefährlichen Patienten befinden sich in der Kriminalabteilung, die wir zum Schluss auch noch aufsuchen werden.«
Dennoch stockte Sir John der Atem, als sie gleich darauf die Abteilung betraten, wo ihnen ein junger Patient im Sturmschritt entgegenkam und sie mit irrem, gehetztem Blick fragte, ob sie vom Home Office seien. Umgehend spurtete ein baumlanger Krankenwärter über den Flur, packte den jungen Mann am Arm und führte ihn weg.
»Der hat wieder einen Schub, Herr Professor«, meldete er.
»Ein hochintelligenter Cambridge-Student«, erklärte Hood seinem Begleiter, »der in einem Anfall von Paranoia versucht hat, mit einem Obstmesser seinen Zimmergenossen zu erstechen, weil er sich einbildete, der würde ihn im Auftrag des Innenministeriums ausspionieren. Gott sei Dank verletzte er ihn nur oberflächlich, sonst würde er jetzt in der Kriminalabteilung sitzen.«
Der Professor führte seinen Gast zu einem schwach erleuchteten Gewölbe am Ende des Flurs, das vom Fußboden bis zur Decke vollständig mit Gummi ausgepolstert war. In der Zelle befand sich keinerlei Mobiliar, mit Ausnahme einer Liege, die ebenso überpolstert war wie der Rest des Raums. Der Anstaltsleiter boxte demonstrativ gegen die Wand, was ein dumpfes Geräusch verursachte.
»Der Überzug ist ein äußerst stabiles Gummifabrikat und so zäh, dass es mit bloßen Händen nicht zu zerreißen ist.«
Auf dem Boden neben dem Bett lag eine Zwangsjacke. Der Professor demonstrierte, wie sie angewendet wurde.
»Wo kann man so etwas erstehen?«, erkundigte sich Sir John.
»In einer Segeltuchfabrik in der Nähe des Hafens, ich kann dir nachher die Adresse aufschreiben«, erbot sich der Psychiater. »Aber Vorsicht bei der Handhabung, man darf den Patienten nicht zu fest verschnüren. In der Vergangenheit hat es schon Todesfälle gegeben, weil die Kranken so eingeschnürt waren, dass sie nicht mehr atmen konnten.«
Im Anschluss traten die beiden Männer durch eine wuchtige Eisentür und stiegen in das Kellergewölbe hinab zur Kriminalabteilung.
»Hinter diesen dicken, ausbruchsicheren Mauern verwahren wir die wirklich gefährlichen Patienten«, sagte Hood und betätigte die Schelle an der gepanzerten Eingangstür. »Hier haben wir wahnsinnige Mörder und Gewaltverbrecher. Auch jener Laufbursche aus Oxford, der vor geraumer Zeit während einer Parade eine Pistole auf Queen Victoria abfeuerte, wird hier verwahrt.«
Gleich darauf waren hinter der Tür Schritte zu vernehmen, das Guckloch verdunkelte sich, und mit lautem Knirschen wurde von innen das Schloss entriegelt.
Ein kahlköpfiger Hüne mit prallem Bizeps unter der weißen Krankenwärterkleidung öffnete ihnen das Portal und begrüßte seinen Vorgesetzten höflich.
»Wir möchten gerne einen Blick in die Zellen werfen. Mein Freund, Professor Wilson, interessiert sich für die sachgerechte Unterbringung unserer Patienten«, informierte der Anstaltsleiter den Wärter, an dessen Gürtel ein schwerer Schlüsselbund angebracht war. »Hier ist alles wie in einem Gefängnis, und wir legen Wert darauf, dass die Patienten in sicherem Gewahrsam sind. Darum wird uns Charles, seines Zeichens Oberaufseher in der Männerabteilung, auch die Zellentüren aufsperren«, erklärte Professor Hood dem Besucher.
Sir Johns Blicke fielen auf die baumlangen Wärter, die vor jeder Zellentür postiert waren, und er fühlte sich in der Nähe der wehrhaften Männer ein Stück weit sicherer.
Der Psychiater, der seinem Blick gefolgt war, bemerkte lächelnd: »Sie bewachen hier Mörder und Totschläger, da bedarf es schon einiger Durchschlagskraft.«
»Zu wem darf ich die Herren denn bringen?«, fragte der Oberaufseher.
Hood sah Sir John fragend an, der kurz überlegte. »Mich interessiert insbesondere, wie der gefährlichste Geisteskranke von allen hier so sicher verwahrt wird, dass er keiner Fliege mehr etwas zuleide tun kann«, gab er schließlich zur Antwort.
»Dann müssen wir rüber in die Frauenabteilung«, beschied ihn der Psychiater. »Der gefährlichste Kranke, den wir in unserer Anstalt haben, ist nämlich eine Frau.«
»Hier befinden sich zurzeit zweiundzwanzig Patientinnen«, erläuterte Professor Hood, nachdem ihnen eine stattliche Matrone mit gestärkter weißer Haube die Panzertür geöffnet hatte. »Es sind allesamt Mörderinnen und Gewalttäterinnen, die größtenteils schon seit langer Zeit in unserer Kriminalabteilung untergebracht sind. Ada Miller, die ich dir gleich vorstellen werde, ist schon seit dreißig Jahren bei uns. Sie war die frühere Amme des Prinzen von Wales und hat in einem Anfall von Wahnsinn ihren sechs Kindern einem nach dem anderen den Hals durchgeschnitten. Der Fall war seinerzeit ein Riesenskandal in der Presse, du erinnerst dich vielleicht?«
Sir John nickte beklommen. »Die Blut-Amme von Soho«, murmelte er. »Die mit unglaublicher Kaltschnäuzigkeit ihre sechs Kinder abgeschlachtet hat.«
»Sie war gerade in der Küche beim Plätzchenbacken, als die Polizei gewaltsam in ihre Wohnung eindrang. In den Kinderzimmern lagen ihre hingemetzelten Kinder in riesigen Blutlachen. Als man Ada mit den Morden konfrontierte, erklärte sie nur, die Kinder seien ihr lästig geworden. Sie hätten sie regelrecht ausgesaugt und ständig etwas von ihr gewollt, das sei ihr eben zu viel geworden. Bevor sie in Handschellen gelegt wurde, bot sie den Polizisten frischgebackene Plätzchen an«, sagte der Psychiater mit ernster Miene. »Diese atemberaubende Kaltherzigkeit und das Fehlen jeglichen Schuldgefühls zogen sich durch den gesamten Prozess und sind Ada bis heute erhalten geblieben. Sie wirkt vollkommen ruhig und ausgeglichen, aber ich kann dich nur warnen: Hinter der Maske der Normalität verbirgt sich der schlimmste Berserker, der mir je untergekommen ist. Vor zwei Jahren hat sie einer Mit-Patientin nach einer Bridge-Partie, die sie verloren hatte, den Stiel eines Teelöffels ins Auge gerammt. Das Auge war nicht mehr zu retten, seitdem wird Ada rund um die Uhr von einem eigens für sie abgestellten Pfleger bewacht.«
Sir John wurde von einem heftigen Beben erfasst. Das, was Professor Hood da über die Kindermörderin berichtete, traf auch auf Lilli zu. Die gleiche Kaltschnäuzigkeit und das Nichtvorhandensein von Schuldgefühl – diese weiblichen Bestien schienen aus dem gleichen Holz geschnitzt zu sein.
»Was versetzt dich und dein Pflegepersonal überhaupt in die Lage, mit einem solchen Ungeheuer umgehen zu können?«, presste er hervor. »Denn jeden gesund empfindenden Menschen graust es doch vor so einem Scheusal.« Ihm waren vor Abscheu die Tränen in die Augen getreten.
Der Psychiater musterte ihn betroffen. »Es ist gewiss nicht leicht, aber im Umgang mit Unmenschen gibt es nur eine Devise: Man muss sie mit kaltem Chirurgenblick Schicht für Schicht sezieren. Dabei muss man sich ihre arktische Gefühlskälte zu eigen machen, um sie zu verstehen – doch wir Warmblütler sind diesen Reptilien gottlob überlegen. Wir können diese Emotionslosigkeit nämlich ablegen – sie dagegen nie. Sie sind vermutlich schon damit geboren worden, und das Schlimme ist, man merkt es ihnen zumeist gar nicht an. Höchstens gelegentlich, wenn die Maske der Normalität durch aggressive Wutanfälle Risse bekommt und der Berserker hindurchschimmert.«
»Wie recht du hast …«, krächzte Sir John und kämpfte verbissen dagegen an, erneut die Fassung zu verlieren.
»Da wären wir«, verkündete der Psychiater, als sie vor einer verriegelten Eisentür angekommen waren, vor der ein muskulöser, baumlanger Krankenwärter Wache hielt.
Der Chefarzt begrüßte den jungen Mann und stellte ihn als Mathew Morgan vor, einen seiner besten Leute.
»Seit Pfleger Mathew Ada betreut, hat es keinen einzigen Übergriff mehr gegeben. Ada frisst ihm förmlich aus der Hand, strickt Socken und Schals für ihn, und zuweilen spielen sie sogar eine Partie Bridge miteinander.«
»Dabei achte ich aber peinlichst darauf, dass keine harten Gegenstände herumliegen, mit denen sie mich attackieren könnte, wenn sie am Verlieren ist. Sie weiß auch genau, was ihr blüht, wenn sie wieder ihre berüchtigten Wutanfälle bekommt – nämlich Zwangsjacke und Winterschlaf, da fackle ich nicht lange«, bemerkte der Hüne mit der Statur eines Totschlägers abgeklärt.
Sir John war beeindruckt von der Resolutheit des Irrenhauswärters. Der wäre genau der Richtige für Lilli, ging es ihm durch den Sinn. Professor Hood erkundigte sich bei dem Pfleger nach Adas Befinden.
»Sie trinkt Tee, strickt und liest in der Bibel«, gab dieser zur Antwort.
»Ich möchte sie gerne mit Professor Wilson bekannt machen. Meinen Sie, das ließe sich machen?«
Der Hüne nickte. »Da sehe ich kein Problem, aber sie hat vorhin ihre Medizin bekommen, weil bald Nachtruhe ist, und da könnte sie schon etwas schläfrig sein.«
»Umso besser«, entgegnete der Psychiater. »Wir werden sie auch nicht lange behelligen.«
Der Pfleger entriegelte das Schloss und rief durch den Türspalt: »Besuch für dich, Ada! Professor Hood und sein Begleiter möchten dir einen guten Abend wünschen.« Er ließ die beiden in die Zelle treten, schloss von innen die Tür ab und bezog dort Stellung.
Sir John bekam unwillkürlich eine Gänsehaut, als er die alte Dame im Lehnstuhl sah, die ihr Strickzeug weglegte und ihnen freundlich zulächelte. Mit den silbergrauen Haaren, die sorgfältig zu einem Knoten hochgesteckt waren, den Grübchen auf den rosigen Wangen und den blauen Augen sah sie aus wie eine liebenswerte Großmutter, der eine unwissende Mutter jederzeit ihr Kind anvertrauen würde. Nachdem Professor Hood einige Bonmots mit ihr gewechselt hatte, die sie mit reizendem, glockenhellem Lachen quittierte, äußerte sie bedauernd, dass der Professor gar nicht mehr zum Bridge-Spielen vorbeikäme.
»Das liegt daran, weil Sie einfach nicht verlieren können, meine Liebe«, erwiderte der Anstaltsleiter mit vielsagendem Lächeln.
»Dann lassen Sie mich eben gewinnen«, entgegnete die Kindermörderin verschmitzt und erkundigte sich im gleichen Atemzug, ob seine Frau und die Kinder wohlauf seien.
»Danke der Nachfrage«, erklärte der Psychiater und konnte bei aller Professionalität nicht verhindern, dass seine Stimme bebte.
Sir John, der während der ganzen Zeit, die sie in der Zelle der Kindsmörderin zubrachten, das Gefühl hatte, ein Eisenpanzer laste auf seiner Brust und schnüre ihm den Atem ab, wurde plötzlich von heftigen Panikattacken erfasst. Unversehens spürte er einen stechenden Schmerz in der Herzgegend und ihm schwanden die Sinne …
Benommen öffnete Sir John die Augen und blickte in das besorgte Gesicht des Anstaltsleiters, der neben seiner Krankenliege saß.
»Was ist passiert?«, fragte er irritiert und gewahrte, dass sie sich im Arbeitszimmer des Psychiaters befanden.
»Du bist ohnmächtig geworden«, erklärte Professor Hood. »Zuerst dachte ich, du hättest einen Herzanfall. Doch als ich dich genauer untersuchte, stellte ich zu meiner großen Erleichterung fest, dass es nur ein Schwächeanfall war – hervorgerufen durch heillose Aufregung. Dein Herz raste, und der Blutdruck ging förmlich durch die Decke. Ich spritzte dir ein leichtes Sedativum, und allmählich beruhigtest du dich wieder.«
Sir John musste sogleich an Lilli denken und richtete sich alarmiert auf. »Wie lange ist das her?«
»Eine gute Stunde etwa.« Der Psychiater musterte Sir John ernst. »John, ich will dir nicht zu nahe treten, aber du musst etwas ganz Fürchterliches erlebt haben. Willst du dich mir nicht anvertrauen? Es würde dir mit Sicherheit guttun, dich bei einem anderen Menschen auszusprechen, und ich versichere dir, alles, was du mir sagst, untersteht der strengsten ärztlichen Schweigepflicht. Darauf kannst du dich verlassen.«
»Gibst du mir dein Ehrenwort?«, fragte Sir John mit belegter Stimme.
»Ich gebe dir mein Ehrenwort«, erwiderte Hood und bekräftigte sein Gelöbnis mit einem festen Händedruck.
Sir John musste schwer mit sich ringen, bis er die Worte über die Lippen brachte. »Es … es geht um meine Frau.« Seine Stimme war nicht mehr als ein Krächzen.
»Das dachte ich mir schon, mein Guter.« Der Psychiater ergriff eine Cognacflasche vom Beistelltisch, schenkte zwei Gläser voll und reichte eines an John weiter. »Nur Mut!«, ermunterte er den Freund beim Zuprosten und nahm einen tiefen Schluck.
Sir Johns Hand zitterte wie Espenlaub, als er das Glas zum Mund führte und in einem Zug leerte. »Sie … sie … bewahrt ganz … schreckliche Dinge auf …«, stammelte er, barg sein Gesicht in den Händen und brach in haltloses Schluchzen aus.
Kapitel 1
London, 4. November 1915
Es war schon später Abend, als der Krankenpfleger Mathew Morgan die Zellentür entriegelte, um seiner Patientin die Morphiumspritze für die Nacht zu geben. Die Tage der bis zum Gerippe abgemagerten Frau, das ahnte der erfahrene Pfleger, waren gezählt. Die Nase wurde immer spitzer, und die Haut um Mund und Nasenflügel war bereits so dünn wie Pergament und leichenblass – ein untrügliches Zeichen für den nahenden Tod. Mathew, der seit rund dreißig Jahren im Bethlem Royal Hospital seinen Dienst als Irrenhauswärter versah, hatte schon zu viele Menschen sterben sehen, als dass ihn der Tod noch erschüttern konnte. Außerdem waren die Patientinnen in der Kriminalabteilung der Irrenanstalt allesamt Mörderinnen, um die es nicht sonderlich schade war. Dennoch hatte er, als Ada Miller, eine seiner ältesten Patientinnen, vor zehn Jahren das Zeitliche gesegnet hatte, einen Kloß im Hals gespürt – obwohl sie eine grausame Kindsmörderin war, die ihre sechs Kinder abgeschlachtet und anschließend Plätzchen gebacken hatte. Aber er hatte sich in den vielen Jahren, in denen er ihr Krankenwärter gewesen war, einfach an sie gewöhnt wie an ein vertrautes altes Möbelstück. Mathew erinnerte sich daran, was ihm der Pfleger, der ihn seinerzeit eingearbeitet hatte, gesagt hatte: Das hier unten ist der reinste Reptilien-Zoo, doch lass dich nicht von ihren starren, trägen Augen täuschen, die kleinste Unachtsamkeit, und sie schnappen zu.
Das war ihm gottlob noch nicht widerfahren, weil er seine Patientinnen gut im Griff hatte, aber andere Kollegen hatten manche Blessuren davongetragen und anschließend den Dienst quittiert – oder Schlimmeres. Einer saß jetzt im Rollstuhl und hatte einen Tick, eine gestandene Schwester war von der London Bridge gesprungen, und ein junger Pfleger war durchgedreht und seither selbst Patient oben bei den Unheilbaren. Mathew besuchte ihn regelmäßig und brachte ihm immer Kuchen mit, den der an Katatonie Erkrankte in einem Bissen hinunterschlang, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn er ehrlich war, hatte die lange Zeit, die er hier unten in der Kriminalabteilung zugebracht hatte, auch bei ihm Spuren hinterlassen. Nach Feierabend brauchte er regelmäßig seine Flasche Gin, um sich die Tatsache von der Seele zu spülen, einen Großteil seines Lebens mit Ungeheuern zubringen zu müssen. Deswegen hatte ihn auch seine Frau verlassen, weil Mandy es nach 28 Jahren Ehe leid war, dass er sich Abend für Abend volllaufen ließ. Das war vor gut einem Jahr gewesen, und Mathew vermisste sie von Tag zu Tag mehr. Ebenso seine vier zum Teil schon erwachsenen Kinder, die ihm nach der Trennung der Eltern die kalte Schulter zeigten. Im Dienst rührte Mathew keinen Tropfen an, das hatte er sich zur eisernen Regel gemacht, und er beschränkte sich auch auf eine Flasche am Abend, um nicht ganz aus der Bahn zu geraten und am Ende noch seinen Job zu verlieren – der einzige Halt, der ihm noch geblieben war, und der ihn davor bewahrte, ganz und gar abzustürzen. Daher gab er auf der Arbeit auch sein Bestes und leistete sich, um nicht auch noch den letzten Rest an Selbstachtung zu verlieren, nicht den kleinsten Patzer.
»Alles klar, Lilli? Soll ich Ihnen noch mal die Einlage wechseln?«, erkundigte er sich bei der Frau mit den eingefallenen Wangen und dem strähnigen, schlohweißen Haar, die an Unterleibskrebs erkrankt war und unter starken Blutungen und Schmerzen litt.
»Nicht nötig«, wisperte die Todgeweihte und gab ihm ein Zeichen, näherzukommen, da sie ihm etwas zu sagen habe.
Mathew wusste, dass Lilli zu schwach war, um lauter zu sprechen, trat ans Bett und neigte den Kopf zu ihr hinunter.
»Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten«, flüsterte die alte Dame. »Unter der Matratze liegt die Ledermappe mit den Aufzeichnungen, an denen ich immer geschrieben habe. Ich möchte, dass Sie sie an sich nehmen.«
Mathew, der sich gut an die Mappe erinnern konnte, nickte. »Geht klar, Lilli. Soll ich sie an jemanden weiterleiten?«
Die Kranke verneinte. »Machen Sie damit, was Sie wollen. Ich nehme es Ihnen auch nicht übel, wenn Sie den Kram ungelesen ins Feuer werfen«, erklärte sie mit dem ihr eigenen Humor, den sie auch auf dem Sterbebett nicht verloren hatte.
»Ich werde mich darum kümmern, Lilli. Kann ich sonst noch was für Sie tun?«
»Geben Sie mir meine Morphiumspritze und nehmen Sie die Mappe an sich. Wer weiß, ob ich morgen noch lebe«, wisperte die Kranke, die das Sprechen offenbar sehr anstrengte.
Nachdem Mathew ihr das Morphium gespritzt und die Mappe unter der Matratze hervorgezogen und an sich genommen hatte, wünschte er ihr noch eine gute Nacht. Zu seiner Verwunderung reichte ihm Lilli die Hand. Sie fühlte sich eiskalt an.
»Danke, Mathew«, stieß sie mit einem grimmigen Lächeln hervor, »dass Sie mich so lange ertragen haben.«
»Ist doch mein Job, Lilli, habe ich gern gemacht«, murmelte er und spürte unversehens wieder diesen Kloß im Hals. Gleichzeitig stieg die Ahnung in ihm auf, dass er der Letzte sein würde, der Lilli lebend sah, und er empfand einen Anflug von Mitgefühl mit der Sterbenden, die in all den Jahren, die sie in der Kriminalabteilung für Frauen zugebracht hatte, niemals Besuch bekommen hatte.
Sind wir nicht wie ein altes Ehepaar?, ging ihm Lillis Ausspruch durch den Sinn, mit dem sie ihn manchmal aufgezogen hatte, wenn er pünktlich zum Fünf-Uhr-Tee das Schachbrett auf dem kleinen Tisch in ihrer Zelle platziert hatte. Die tägliche Schachpartie war zu einem Ritual zwischen ihnen geworden, das Mathew nicht missen mochte – obwohl er die meisten Partien gegen Lilli Wilson, die eine hervorragende Schachspielerin war, verloren hatte. In den 27 Jahren, die die inzwischen 65-Jährige im Bethlem Royal Hospital zugebracht hatte, waren der Irrenhauswärter und seine Patientin zusammen alt geworden. Als Lilli Wilson damals von ihrem Gatten in die Anstalt eingewiesen worden war, war Mathew noch ein junger Mann gewesen, gerade frisch verheiratet und Vaterfreuden entgegensehend. Er erinnerte sich noch gut an die elegante Dame mit dem unscheinbaren Dutzendgesicht, die sich ohne jegliche Gefühlsäußerung in ihr Schicksal gefügt hatte und auch in der langen Zeit in der Kriminalabteilung stets zurückhaltend und beherrscht gewesen war. Sie war auch eine der wenigen Patientinnen, mit denen er sich nicht geduzt hatte, da Lilli bei aller Vertrautheit doch stets auf Distanz bedacht war. Schlagartig wurde Mathew bewusst, wie wenig er eigentlich über sie wusste. Der verstorbene Anstaltsleiter Professor Hood hatte ihm gegenüber lediglich erwähnt, Lady Wilson sei höchstwahrscheinlich eine Mörderin und äußerst gefährlich.
Die Dame aus dem vornehmen Londoner Westend lebte in der Anstalt wie eine Gefangene. Die zahlreichen Briefe, die sie an ihren Ehemann schrieb, blieben unbeantwortet. Lady Wilson war überaus gebildet und sprach mehrere Sprachen, hatte Humor und konnte sehr charmant sein. Zuweilen fragte sich Mathew, warum sie überhaupt hier war. Lilli verbrachte ihre Zeit mit Lesen und schrieb an ihren Aufzeichnungen. Mathew hatte den Eindruck, dass ihr die Lebenserinnerungen – trotz ihrer Äußerung, sie nehme es ihm nicht übel, wenn er sie ins Feuer werfe – viel bedeuteten.
Da Mathew seine Patientin in den langen Jahren ihrer Bekanntschaft ans Herz gewachsen war, nahm er die Ledermappe nach Dienstschluss mit nach Hause. Als ihn in der trostlosen Dachmansarde, die er nach der Trennung von seiner Frau unweit der Anstalt bezogen hatte, einmal mehr der Katzenjammer überkam, ergriff er kurzerhand die Kladde und fing an zu lesen …
9. Mai 1855
Ich wurde als Mary Elizabeth Ann, genannt »Lilli”, am 10. Februar 1850 als Tochter von Richard und Anne Hughes in Swansea/Wales geboren.
Mein Vater war Zinnfabrikant und einer der reichsten Männer Englands. Ich war das einzige Kind meiner Eltern und damals fünf Jahre alt.
Meine Mutter litt seit Jahren an der Schwindsucht.
Den ganzen Morgen über waren ihre Hustenanfälle wieder so laut, dass sie vom Krankenzimmer am Ende des Flurs bis in mein Spielzimmer herüberdrangen. Ich hasste den rasselnden Husten meiner Mutter, der mir häufig genug die Nachtruhe raubte oder mich beim Spielen störte. Das ewige Hüsteln machte mich zuweilen so wütend, dass ich Spielsachen auf dem Boden zerschmetterte und zornig aufstampfte, damit endlich Ruhe einkehrte. Doch diesen Gefallen tat mir das »Hustengespenst« nicht, wie ich meine Mutter im Stillen zu nennen pflegte. Waren das hohle Rasseln und die pfeifenden Atemgeräusche, die über den weitläufigen Flur unseres Landhauses hallten, schon unangenehm genug, so waren die regelmäßigen Besuche im Krankenzimmer für mich indessen die reinste Hölle, und ich wehrte mich mit Händen und Füßen dagegen, der kranken Mutter einen Besuch abzustatten. Das eingefallene, wächserne Gesicht und der leidvolle Ausdruck ihrer großen, glasigen Augen, mit denen sie mich immer anblickte, waren mir zutiefst zuwider. Den Geruch nach Krankheit und Verfall, den sie aus jeder Pore verströmte, empfand ich als abstoßend. Es ekelte mich vor der Kranken, und ich hatte große Angst, mich bei ihr anzustecken – was jedoch nicht geschehen konnte, wie mir unser Hausarzt Doktor Bond und mein Vater immer wieder versicherten, da die Krankheitsform, unter der meine Mutter litt, nicht ansteckend sei. Trotzdem war ich peinlichst darauf bedacht, Abstand zu ihr zu halten, und vermied jegliche Berührung mit ihr, obgleich mein Gebaren Mutter sehr verletzte. Sie hätte ihr über alles geliebtes Kind gerne geküsst und in die Arme geschlossen.
»Du ekelst dich vor mir«, sagte sie einmal mit Tränen in den Augen zu mir, was ich ihr auch unverblümt bestätigte – sehr zum Leidwesen meines Vaters, der von meiner Schroffheit vor den Kopf gestoßen war. Dennoch hatte die allumfassende Nachsicht und Güte, mit denen er mir stets begegnete, rasch wieder die Oberhand gewonnen, und er murmelte nur entschuldigend, ich sei doch noch ein kleines Kind, und das sei eben meine Art, gegen das unsägliche Leid und den Schmerz der Mutter, die mein zartes Gemüt deutlich überforderten, zu protestieren. Doktor Bond hatte ihm zugestimmt, wenn auch etwas zögerlich. Ich mochte den Doktor nicht, er musterte mich immer so merkwürdig.
Einmal hatte er mich im Kinderzimmer aufgesucht und mir gesagt, ich solle mir doch einen Ruck geben und meiner Mutter wenigstens die Hand reichen, wenn ich sie das nächste Mal besuchte. Meine Mutter sei sehr krank, und es würde der Kranken guttun, wenn ich nicht ganz so abweisend sei. Daraufhin hatte ich einen Wutanfall und erzählte meinem Vater, der Doktor habe mich angeschrien, weil ich mich scheute, der Mutter nahezukommen, worauf mein Vater mit dem Arzt eine ernsthafte Unterredung führte, bei der es zu einem erbitterten Wortgefecht kam. Ich hörte alles mit, weil ich an der Tür des Arbeitszimmers lauschte.
»Mit Verlaub, Mister Hugh, aber Sie sind auf dem besten Wege, sich ein herzloses, egoistisches Geschöpf heranzuziehen. Das Kind ist jetzt schon ein rechter Satansbraten, der den Dienstboten das Leben schwermacht – und eine notorische Lügnerin noch dazu, wenn man bedenkt, wessen sie mich bezichtigt hat. Ich habe ganz ruhig und begütigend mit Lilli gesprochen und kein einziges Mal meine Stimme erhoben – obwohl es zuweilen durchaus ratsam sein könnte, ihr gegenüber mal ein Machtwort zu sprechen. Ich habe selbst vier Kinder, und manchmal ist eben eine gewisse Strenge unabdingbar«, vernahm ich die aufgebrachte Stimme des Arztes.
»Sie können meinethalben mit Ihren eigenen Kindern so streng sein, wie Sie wollen, aber mein Kind schreit niemand an«, erwidertee mein Vater daraufhin mit einer Schärfe, wie ich sie bei ihm noch nie zuvor erlebt hatte, und damit war der Disput beendet gewesen.
Als der Hustenanfall auch nach längerer Zeit nicht abebben wollte, eilte ich verdrossen zu meinem Bastelpult, auf dem sich neben vielerlei Buntstiften Malbücher, Farbbögen und Scherenschnitte stapelten, und ergriff ein Leimdöschen. Ich trat damit an das große Puppenhaus, eine detailgetreue Nachbildung unseres Anwesens, nahm eine mit einem weißen Nachthemd bekleidete Puppe aus dem Himmelbett, das in etwa dem Bett meiner Mutter entsprach, und strich mit dem Pinsel Leim auf ihren Mund. Ich hatte das schon häufiger getan, um das Hustengespenst zum Schweigen zu bringen. Zu meiner Verblüffung trat daraufhin tatsächlich Stille ein, die von Zeit zu Zeit lediglich von einem leisen Wehklagen unterbrochen wurde, das sich wie ein unterdrücktes Wimmern anhörte. Im nächsten Moment wurde die Tür des Kinderzimmers geöffnet und mein Vater trat ein. Obgleich ich seine bekümmerte Miene hinlänglich gewohnt war, weil sie seit der Erkrankung meiner Mutter häufig an ihm zu beobachten war, so bemerkte ich doch sofort, dass er heute noch bedrückter war als sonst. Sein schleppender Gang und der gebeugte Rücken muteten an, als trüge er eine schwere Last auf seinen Schultern, ganz zu schweigen von dem vergrämten Gesicht und den tränengeröteten Augen, die sich bei meinem Anblick zusehends verschleierten. Er kam auf mich zu, kauerte sich neben mich und drückte mich an sich.
»Deiner Mammy geht es sehr schlecht, mein Kind, und sie möchte dich noch einmal sehen … bevor sie …« Ihm versagte die Stimme, und es entrang sich ihm ein Schluchzen, während er mich noch enger an sich presste. »Du musst jetzt sehr, sehr tapfer sein, mein kleines Mädchen, denn Mammy liegt im Sterben«, brach es aus ihm heraus, und er kämpfte gegen die Tränen an.
»Heißt das, dass Mammy in den Himmel kommt?«, fragte ich, da ich mich daran erinnerte, dass Vater und auch der Gemeindepfarrer in letzter Zeit häufiger darüber gesprochen hatten.
Er bestätigte das mit belegter Stimme. »Doktor Bond hat gesagt, es geht mit ihr zu Ende und wir sollten von ihr Abschied nehmen.«
Außer Erleichterung, das lästige Hustengespenst endlich loszuwerden, empfand ich auch Unmut, mich von der Sterbenden verabschieden zu müssen.
»Ich will aber nicht zu ihr!«, erklärte ich trotzig. »Sie riecht nicht gut, und ich mag es auch nicht, wenn sie mich anfasst.«
Mein Vater war am Boden zerstört. »Lilli, ich flehe dich an, Mammy liebt dich über alles und will dich unbedingt noch einmal sehen! Du wirst doch deiner Mutter nicht ihren letzten Wunsch versagen …«
»Nein, ich will nicht!«, schrie ich und schleuderte wütend die Porzellanpuppe in dem Nachthemd auf die Eichendielen des Kinderzimmers, wo sie scheppernd zerbarst. »Dann wird mir nur wieder schlecht, und ich werde ohnmächtig«, beeilte ich mich hinzuzufügen, da mir das unlängst widerfahren war, als meine Mutter mit keuchenden Atemzügen versucht hatte, ein paar liebevolle Worte an mich zu richten, und plötzlich Blut in ihr weißes Damast-Taschentuch gehustet hatte. Ich hatte eine regelrechte Abscheu vor Blut, auch vor meinem eigenen, und schon die kleinste Verletzung führte unweigerlich dazu, dass ich ohnmächtig wurde. War mein Vater darüber außer sich vor Sorge, so beurteilte Doktor Bond meine Zustände deutlich abgeklärter und riet Vater dringend dazu, Ruhe zu bewahren und mich mit allem Nachdruck daran zu hindern, mich durch hektisches Atmen in eine Ohnmacht hineinzusteigern. Mitunter helfe bei derartigen Allüren auch ein Klaps auf die Wange, bemerkte der Arzt lapidar, was Vater jedoch entsetzte, und so wiederholten sich meine Schwächeanfälle – die allesamt darin mündeten, dass ich im Anschluss von Vater ein hübsches Geschenk zur Aufmunterung erhielt. So hatte Blut für mich neben dem Schrecken letztendlich auch sein Gutes.
Stellte es für die Dienstboten schon lange kein Geheimnis mehr dar, wer im Hause Hughes das Sagen hatte, so gewannen auch Besucher, Freunde und Verwandte rasch den Eindruck, dass ich das Zepter fest in meinen kleinen Händen hielt. Nahe Verwandte und meine Großeltern unterwarfen sich zwar meinem Regiment, doch nicht wenige Geschäftsfreunde und Bekannte, die meinen Vater als unnachgiebigen Kaufmann kannten, dessen bahnbrechender Erfolg ihn zu einem der reichsten Männer Englands gemacht hatte, mokierten sich hinter vorgehaltener Hand darüber, wie butterweich der harte Geschäftsmann in den Händen seiner Tochter wurde.
Da ich sehr wohl wusste, dass mir mein Vater keinen Wunsch abschlagen konnte, beschloss ich, mir die Situation zunutze zu machen. Es sah nämlich ganz danach aus, dass ich nicht umhinkam, mich von der todkranken Mutter zu verabschieden, was gleichzeitig mein letzter Besuch in dem muffigen Krankenzimmer sein würde – für den mir eine angemessene Belohnung zustand.
Ich blickte Vater mit meinen haselnussbraunen Augen treuherzig an. »Ich gehe zu Mammy, wenn ich dafür ein Pony kriege.«
Daddy seufzte erleichtert. Er hatte ohnehin geplant, mir zu Weihnachten meinen schon lange gehegten Herzenswunsch zu erfüllen, und willigte sofort ein.
»Ich liebe dich unsagbar«, flüsterte Mammy mit glühenden Wangen. Ihre Stimme war nicht mehr als ein leises Wispern, das von einem durchdringenden Summen unterlegt war, als habe sich ein riesiger Bienenschwarm in ihrem Brustkorb eingenistet.
»Ich liebe dich auch, Mammy«, erwiderte ich und ließ zu, dass sie meine Hand küsste, auch wenn es mich vor ihren feuchten Lippen schauderte. Ich blickte meinen Vater, der neben mir am Sterbebett saß, ungeduldig an. Ich hatte jetzt meine Pflicht erfüllt und Mutter gesagt, dass ich sie liebe, wie er es mir aufgetragen hatte. Doch Daddy, dem die Tränen über die Wangen strömten, war zu sehr in seinem Leid gefangen, um mein stummes Drängen, nur schnell wieder hinauszugelangen, wahrzunehmen. Ich schaute mich betreten um. Auch meine Großeltern und die anderen Verwandten, die sich um Mutters Bett versammelt hatten, waren in Tränen aufgelöst. Lediglich der Pfarrer und Doktor Bond, die ebenfalls vertreten waren, wirkten gefasster – und natürlich ich selbst.
In jenem Moment ahnte ich zum ersten Mal, dass ich anders war als die meisten Leute, und das lag nicht daran, dass ich das einzige Kind unter all den Erwachsenen war. Meine Augen blieben tränenlos, während die anderen weinten. Selbstverständlich war mir das Weinen nicht unbekannt. Ich weinte, wenn ich wütend war, weil ich meinen Willen nicht durchsetzen konnte und nicht bekam, was ich wollte, oder wenn ich krank war, Schmerzen hatte oder mir wehgetan hatte. Aber momentan empfand ich weder Schmerz noch Trauer und hoffte nur, dass alles schnell vorbei wäre und ich endlich wieder gehen konnte. Es lag mir schon auf der Zunge, Vater zu fragen, ob ich mich entfernen dürfe, doch entgegen meiner üblichen Impulsivität und Direktheit zügelte ich mich, nestelte das große Taschentuch aus meiner Kleidertasche, welches mir die Nanny vor dem Krankenbesuch zugesteckt hatte, und wischte mir die nicht vergossenen Tränen ab. Wenn ich schon nicht so war wie alle anderen, dann würde ich wenigstens so tun als ob – denn die mussten das ja nicht unbedingt merken.
Schließlich erbarmte sich eine meiner Tanten und begleitete mich hinaus, wo sie mich der Obhut der Kinderfrau anvertraute.
Wenig später verstarb meine Mutter. Sie war erst 28 Jahre alt.
Für mich war ihr Tod ein bedeutendes Ereignis, hatte es mir doch die Erkenntnis beschert, dass das, was in meinem Kopf vorging, anderen Gesetzen gehorchte als bei den meisten Menschen. Gleichzeitig entwickelte ich von diesem Zeitpunkt an ein Geschick darin, meine Andersartigkeit vor der Umwelt zu kaschieren.
12. Mai 1855
Bei Mutters Beerdigung, die drei Tage später in Anwesenheit einer großen Trauergesellschaft auf dem Friedhof von Swansea stattfand, zeigte ich die gleiche Erschütterung wie mein Vater und alle anderen nahestehenden Verwandten. Dieses Mal allerdings mit echten Tränen, da es mir trefflich gelang, mich in die Rolle des trauernden Töchterchens hineinzusteigern, wodurch ich mit Mitgefühl und Anteilnahme seitens der Erwachsenen nur so überschüttet wurde. Allenthalben waren Aussprüche zu vernehmen, wie: »Das arme Kind kann einem leidtun!«
Ich genoss die allgemeine Fürsorge und fühlte mich in meiner Rolle zunehmend wohl.
Am Tag darauf führte mich mein Vater zu den Pferdeställen und präsentierte mir zwei wunderhübsche Shetlandponys.
»Eines ist von mir und das andere von Großmutter Lillibeth, weil du so viel durchmachen musstest und so ein tapferes kleines Mädchen bist«, erläuterte er mit Rührung in der Stimme.
Ich jubelte und umhalste Daddy außer mir vor Freude. Noch am gleichen Tag und auch an den Folgetagen war ich unter der Obhut meiner Kinderfrau von früh bis spät mit nichts anderem beschäftigt, als auf meinen beiden Ponys zu reiten, denen ich aus Verehrung für Queen Victoria und ihren Prinzgemahl Albert die Vornamen »Vicky« und»Berti« gegeben hatte. Eine Woche später war ich jedoch schon gelangweilt von den possierlichen Tieren und lag meinem Vater ständig in den Ohren, einen Hund haben zu wollen, da man mit dem viel schöner spielen könne als mit den drögen Kleinpferden. Da Vater mir gegenüber ohnehin ein schlechtes Gewissen hatte, weil er so wenig Zeit mit mir verbringen konnte, wo ich doch gerade erst meine Mutter verloren hatte, las er mir jeden Wunsch von den Augen ab und schenkte mir einen Cockerspaniel-Welpen – was zur Folge hatte, dass es zwischen mir und meiner Nanny zum Eklat kam. Denn für mich war der kleine Hund von Anfang an nichts anderes als ein Spielzeug, das völlig meinen Launen ausgesetzt war. So schäumte ich den Welpen im Badezuber mit Lavendelseife ein, und wenn das Tier, das entsetzlich unter der Prozedur litt, sich meinem Griff zu entwinden suchte, um die Flucht zu ergreifen, packte ich den Hund und tauchte ihn kopfüber in die Wanne. Ich zog ihm Puppenkleider an und legte ihn in den Puppenwagen, und weil der ungezogene kleine Kerl immer wieder Reißaus nahm, schnitt ich ein Bettlaken in Streifen und schnürte ihn so fest zusammen, dass er sich nicht mehr rühren konnte.
»Bist jetzt mein Wickelkind«, sagte ich und legte das zusammengeschnürte Bündel in den Puppenwagen, wo ich eine Steppdecke über es breitete, sodass nur noch der von einerStrickmütze bedeckte Hundekopf zu sehen war. Das Tier winselte so jämmerlich, dass meiner Kinderfrau der Geduldsfaden riss. Sie tadelte mich in scharfem Tonfall als Tierquälerin, nahm kurzerhand das Tier aus dem Puppenwagen und befreite es von seiner Fesselung, worauf ich das ganze Haus zusammenschrie. Vor der versammelten Dienerschaft verkündete ich unter Tränen, dass meine Nanny mich geschlagen habe – was im Übrigen schon öfter vorgekommen sei. Völlig verschreckt und am ganzen Körper bebend suchte ich Zuflucht bei Miss Rupert, der ältlichen, moralinsauren Hauswirtschafterin, die das Personal mit strenger Hand leitete und der auch meine Kinderfrau unterstand.
»Stimmt das, Ernestine?«, bellte Miss Rupert in Richtung der jungen Frau, die erst vor Kurzem ihre Stellung angetreten hatte, da ihre beiden Vorgängerinnen rasch nacheinander den Dienst quittiert hatten. Bei der Einstellung von Ernestine Middleton, bei der Miss Rupert auch ein Wörtchen mitzureden gehabt hatte, hatte sie meinem Vater gegenüber zu bedenken gegeben, die junge Frau sei ja so sanft wie ein Lämmchen und dass ich möglicherweise eine festere Hand brauchte.
»Lilli hat es durch die Krankheit ihrer Mutter schon schwer genug und braucht vor allem Herzensgüte«, hatte Daddy schnippisch entgegnet und die schüchterne junge Frau mit den hellblonden Haaren eingestellt.
Da sie mir kaum etwas entgegenzusetzen hatte, verfuhr ich mit ihr wie mit ihren Vorgängerinnen und dem Großteil unseres Hauspersonals. Es bereitete mir ein diebisches Vergnügen, ihnen das Leben schwer zu machen. Obgleich ich noch ein Kind war, entwickelte ich damals bereits ein untrügliches Gespür für die Schwächen und Unzulänglichkeiten anderer Leute, um sie entsprechend zu manipulieren, damit ich sie an ihrem wunden Punkt treffen konnte. Zudem war ich eine notorische Lügnerin, die eine Begabung hatte, andere gegeneinander auszuspielen – und zwar so, dass sie es zumeist erst merkten, wenn der Eklat bereits vorüber war. Dadurch hatten wir einen erheblichen Verschleiß an Personal, vornehmlich an Kindermädchen. Was meine Nannys anbetraf, führte ich sogar eine geheime Strichliste. Jeder Strich hinter dem von mir mit ungelenken Buchstaben vermerkten Namen – denn trotz meines nicht gerade einfachen Charakters war ich ein überaus gelehriges Kind, welches bereits mit fünf Jahren lesen und schreiben konnte – bedeutete, dass ich die Gute vergrault hatte. Entweder kündigte sie gewissermaßen aus freien Stücken ihre Stellung, oder mein Vater setzte sie vor die Tür – was ein echter Volltreffer war, da dies in ihrer Referenz als Schandfleck vermerkt wurde, der eine weitere Einstellung in besseren Kreisen beträchtlich erschwerte. Auch unter den Haustieren, die Daddy mir schenkte, herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Im günstigsten Falle gelang es den Tieren, insbesondere den Hunden oder Katzen, bei passender Gelegenheit die Flucht zu ergreifen, um ihrem Quälgeist auf Nimmerwiedersehen zu entkommen. Andere Kleintiere, wie Zwergkaninchen oder Meerschweinchen, hatten nicht so viel Glück und gingen ein, weil sie das dauerhafte Tollschocken nicht ertrugen. Ähnlich turbulent verhielt es sich auch bei meinen ohnehin sehr spärlichen Freundschaften zu anderen Kindern, die mich allesamt eher langweilten. Außer ich brachte sie dazu, verbotene Dinge zu tun, wie etwa, sich in weißen Sonntagskleidern mit Schlamm zu bewerfen, sodass sie von ihren Eltern eine ordentliche Tracht Prügel bezogen, was mich außerordentlich erheiterte. Manchmal waren es auch schlimmere Dinge, die ich ihnen einbrockte. Ich schenkte ihnen teure Spielsachen und stellte es im Nachhinein mit reiner Unschuldsmiene so dar, dass sie diese entwendet hatten. Wenngleich die Rauschgoldengel dies tränenreich bestritten, so lastete doch der Makel des Verdachts auf ihnen, dafür hatte ich schon gesorgt. Mein Vater hielt mir ohnehin immer die Stange und nahm sogar in Kauf, sich mit den Eltern zu überwerfen. Mit der Zeit langweilten mich jedoch die Ränke und Zwistigkeiten, die ich sorgfältig einfädelte. Ich war sowieso ein Kind, das sich schnell langweilte. Es gab allerdings auch etwas, das mir großen Spaß bereitete, denn um sein Herzenskind zu beschäftigen und bei Laune zu halten, engagierte mein Vater eine kunstsinnige, erfahrene Dame vom Theater, die mir Tanz- und Schauspielunterricht erteilte. Ich war damals zwölf Jahre alt, und obgleich ich ein hässliches Kind mit einer plumpen Statur war, was mein unerschütterliches Selbstbewusstsein jedoch nicht trüben konnte, erwies ich mich vor allem in der Schauspielerei als herausragendes Talent. Meine Begabung lag vor allem darin, andere Leute zu imitieren. Darin war ich unübertroffen, und dank der Interventionen meines Vaters hatte ich auch die Möglichkeit, dies vor einem breiten Publikum unter Beweis zu stellen. Die Leute lachten Tränen und spendeten mir regen Beifall. Es lag auf der Hand, dass ich für eine Bühnenkarriere prädestiniert war – wäre ich nur etwas ansehnlicher gewesen, denn so, wie ich aussah, eignete ich mich bestenfalls als Lachnummer. Daher wurde nichts aus meinen hochfliegenden Plänen, da konnte auch das Geld meines Vaters nichts ausrichten. Wie hätte ich damals in meiner abgrundtiefen Enttäuschung auch ahnen können, dass mir meine Gabe, wenn auch sehr viel später, einmal von großem Nutzen sein würde. Denn jeder große Imitator muss zuvor sein Objekt gründlich studieren, um dessen Eigenheiten perfekt wiederzugeben. Er spielt nicht nur, jemand anderer zu sein, er muss förmlich in die fremde Haut schlüpfen, um den Charakter überzeugend darzustellen. Das alles gelang mir mit Leichtigkeit, da es mir aufgrund meiner Wesensverschiedenheit von »normalen« Leuten zur zweiten Natur geworden war, sie insgeheim zu beobachten, damit sich das böse Mädchen, welches ich schon zu diesem Zeitpunkt war, keinen Deut von ihnen unterschied – und heute darf ich mit Stolz behaupten, genau das war das Geheimnis meines späteren bahnbrechenden Erfolgs, der alles überdauern würde. Da mir aber wenig daran gelegen ist, erbauliche Anekdoten aus meiner Kindheit und Jugend aufzuschreiben, wie sie Lebenserinnerungen gemeinhin zu eigen sind, die dem geneigten Leser nicht selten ein gelangweiltes Gähnen entlocken, wende ich mich nun jenen Ereignissen zu, die dazu beitrugen, dass aus dem bösen Mädchen ein sehr böses Mädchen wurde.
10. Januar 1863
Im Alter von fünfzehn Jahren war meine Grundpersönlichkeit bereits voll ausgereift. Ich hatte zwar gelernt, äußerst charmant zu sein, wenn es mir von Nutzen war, grundlegende Gefühle wie Furcht, Trauer, Angst oder Freude waren mir jedoch fremd. Ich war sehr selbstbewusst und fühlte mich den meisten meiner Mitmenschen überlegen – doch ich ließ es mir nicht anmerken. Ganz im Gegenteil, ich machte mich so klein, wie es ging, und war eine Meisterin im Understatement, denn ich wollte auf keinen Fall von anderen durchschaut werden. Tarnung ist alles, war meine Devise seit der frühen Kindheit. Mir war absolut daran gelegen, so normal und unauffällig zu wirken wie Krethi und Plethi, und da ich ein brillantes Talent hatte, mich zu verstellen, und auch von meinem äußeren Erscheinungsbild eine unscheinbare graue Maus war, ahnte niemand, was für ein Ungeheuer hinter meiner harmlosen Fassade heranreifte.
Daddy konnte ich sowieso um den Finger wickeln, wie es mir gerade passte, und auch sonst bekam ich immer das, was ich wollte. Doch außer einer gewissen Genugtuung, meinen Willen durchgesetzt zu haben, konnte ich mich nicht wirklich darüber freuen. Eigentlich konnte ich mich über gar nichts freuen, auch nicht über die kostspieligen Geschenke, mit denen Daddy mich stets überhäufte. Denke ich heute an meine Kindheit und Jugend zurück, so dominierte eindeutig die Langeweile. Das galt im Übrigen für mein ganzes Leben. Erst durch mein Werk fand ich meine Erfüllung. Doch dazu komme ich später. Zunächst geht es um die Frau, die immer ein Meilenstein für mich sein wird und die das aus mir gemacht hat, was ich heute bin: meine Gouvernante Mary Beaver.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: