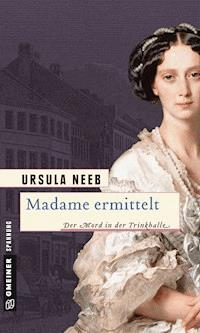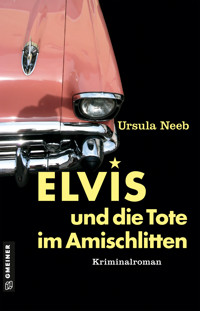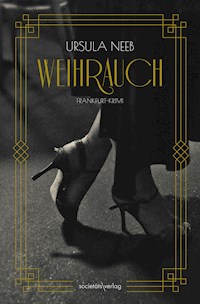8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oktober 1596: Das Antoniusfeuer breitet sich wie eine Epidemie aus. Auch die Heilerin Lovenita Metz, die mit ihrer Tochter zur Frankfurter Herbstmesse reist, ist besorgt. Auf der Messe trifft sie den sogenannten Propheten Albinus Mollerus, den Vater ihrer Tochter, der die Ängste schürt, indem er den Weltuntergang voraussagt. Er beschuldigt Lovenita, für den Ausbruch des Antoniusfeuers verantwortlich zu sein. Da taucht der Stadtphysikus Johannes Lonitzer auf und verliebt sich unsterblich in Lovenita. Er ist erpicht, die wahre Ursache der Krankheit herauszufinden. Wird er es schaffen, die Bevölkerung zu retten, und können er und Lovenita glücklich werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Frankfurt, Herbst 1596: Unter der Bevölkerung ist eine rätselhafte Krankheit ausgebrochen: das Antoniusfeuer, das die Erkrankten in den Wahnsinn treibt und ihnen die Gliedmaßen absterben lässt. Die Heilerin Lovenita Metz macht sich Sorgen. Gemeinsam mit ihrer fünfzehnjährigen Tochter Clara verkauft sie ihre selbst hergestellten Tränke und Tinkturen auf der Herbstmesse. Dort begegnet sie auch Claras Vater wieder, der sie vor Jahren betrog und auf sich allein gestellt zurückließ. Nur diesmal tritt er nicht als gewöhnlicher Apothekerlehrling Albin Müller auf, als den sie ihn kennenlernte, sondern als Albinus Mollerus – angeblich ein großer Visionär –, und er sagt das Ende der Welt voraus.
Als Lovenita ihm seine Bitte um Verzeihung abschlägt, dauert es nicht lang, und sie wird der Hexerei beschuldigt. Natürlich steckt Albinus dahinter, und tatsächlich schenken die Stadtbewohner ihm und seinen düsteren Vorhersagen Glauben. Als für Lovenita schon alles verloren zu sein scheint, taucht der Medicus Johannes Lonitzer auf, der nicht nur der Ursache für die Epidemie auf den Grund gehen und die Bevölkerung retten möchte, sondern auch um jeden Preis Lovenita zur Seite stehen will.
Die Autorin
Ursula Neeb hat Geschichte studiert. Aus der eigentlich geplanten Doktorarbeit entstand später ihr erster Roman Die Siechenmagd. Seitdem hat sie viele historische Romane veröffentlicht, unter anderem die Hurenkönigin-Reihe. Sie arbeitete außerdem beim Deutschen Filmmuseum und bei der FAZ. Heute lebt sie als Autorin mit ihren beiden Hunden in Seelenberg im Taunus.
Von der Autorin sind in unserem Hause bereits erschienen:
Das Geheimnis der TotenmagdDie HurenköniginDie Hurenkönigin und der VenusordenDie Rache der HurenköniginDer Teufel vom Hunsrück
Ursula Neeb
Die Feuerheilerin
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1404-4
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Stephen Mulcahey / arcangel images (Frau); © FinePic®, München (Himmel, Landschaft)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Dir und mir – dem Phönix aus der Asche – ist dieses Buch gewidmet.
»Der Wolf ist im Korne; wenn er euch frisst, müssen eure Seelen von Baum zu Baum fliegen, bis das Korn eingefahren ist.«
(Mittelalterlicher Warnspruch vor dem Antoniusfeuer)
Prolog
Graue Nebelschwaden hingen über den Flussauen des Rheins und dämpften alle Geräusche. Selbst der Nieselregen schwebte lautlos vom wolkenverhangenen Abendhimmel herab und hüllte alles in hauchdünne Schleier. Die Frau mit dem roten Kopftuch und dem bunten, orientalisch anmutenden Gewand, die am Flussufer Kräuter sammelte, hielt plötzlich inne und versank in der Betrachtung eines großen, kunstvoll gewebten Spinnennetzes, in dem die Regentropfen glitzerten. Violetta Metz, ihres Zeichens Heilerin und Wahrsagerin des Zigeunerclans der Kesselflicker, hatte einen Blick für die Schönheit der Natur. Versonnen betrachtete sie die wohlgenährte Kreuzspinne, die unbeweglich in dem filigranen Gebilde saß und auf Beute lauerte. Dein Tisch ist doch sowieso schon gut genug gedeckt, musst du dann auch noch die ganzen Glühwürmchen fressen, dachteVioletta ergrimmt und stellte mit Bedauern fest, dass sie in diesem Sommer, der den Namen weiß Gott nicht verdient hatte, noch kein einziges Glühwürmchen gesehen hatte. Die wundersamen Zaubertierchen, die Violettas Herz so erfreuten, muteten an wie ausgestorben. Selbst im dichten Ufergestrüpp, wo sich die kleinen Leuchtkäfer in der Dämmerung sonst besonders gerne tummelten, waren sie nicht auszumachen. Während Violettas Blick noch über das Dickicht schweifte, gewahrte sie mit einem Mal die Konturen einer Gestalt, die am Flussufer saß. Sie trat einen Schritt vor, um sich die Person genauer anzuschauen, und erkannte, dass es sich um eine junge Frau handelte, die einen Säugling auf dem Arm hielt. Sie weinte und starrte aufs Wasser. Bei ihrem Anblick wurde die Zigeunerin von einer plötzlichen Müdigkeit erfasst, die auf ihren Schultern lastete wie Blei – ein sicheres Zeichen für Violetta, dass sie Zugang zu der Seele eines Menschen hatte. Die Botschaft, die sie empfing, war jedoch kaum zu ertragen, denn die junge Frau wollte ihrem Leben ein Ende bereiten. Wie eine Schlafwandlerin ging Violetta auf die Frau zu, ließ sich neben ihr nieder und blickte sie unverwandt an. Die Tränen der jungen Mutter wurden immer verzweifelter, während sie die alterslose Frau mit den markanten, fremdländischen Gesichtszügen und dem farbigen Gewand ansah, die leise zu sprechen begann.
»Du bist nicht allein, ich bin bei dir und werde dir helfen«, sagte Violetta besänftigend. »Dir geht es gut, und du wirst weiterleben!«
Über das verhärmte Gesicht der jungen Frau huschte ein Lächeln. »Mir geht es gut, und ich werde weiterleben«, wiederholte sie wie in Trance.
»Du musst weiterleben, weil dein Kind dich braucht, und du wirst weiterleben!«, befahl ihr die Zigeunerin mit fester Stimme.
»Ich werde weiterleben«, murmelte die Frau, »weil mein Kind mich braucht …« Doch unversehens verstummte sie und gab dann einen verzweifelten Aufschrei von sich, der Violetta durch Mark und Bein ging.
»Aber ich will nicht mehr leben!«, stammelte sie. »Das war schon immer so und wird sich auch niemals ändern.«
Violetta war schon vielen Schwermütigen begegnet, was in dieser düsteren, von Seuchen und Hungersnöten geprägten Zeit auch nicht erstaunlich war. Manches Mal war es ihr sogar gelungen, einen Gemütskranken von seiner Melancholie zu befreien – aber im Falle der jungen Mutter, und das spürte sie bis ins Innerste, standen ihre Chancen schlecht. Die Seele der Unglücklichen war einfach zu umnachtet, und der Schatten der Schwermut, der ihr Gemüt verdunkelte, war zu groß, als dass sie ihn hätte lichten und die Lebensgeister hätte wecken können. Unversehens lastete auch auf der Seele der Heilerin eine abgrundtiefe Traurigkeit, die sie zu überwältigen drohte. Violetta, die solche todtraurigen Momente schon erlebt hatte, in denen sie mit ihrer Gabe an Grenzen stieß und ohnmächtig erkennen musste, dass dem Kranken nicht mehr zu helfen war, schüttelte sich wie ein nasser Hund, um die Beklemmung loszuwerden und wieder Klarheit zu erlangen. Doch die erfahrene Heilerin mochte die Hoffnung nicht aufgeben, denn mitunter glomm selbst bei den vermeintlich aussichtslosen Fällen noch ein Fünkchen Lebenslicht im Innern – sollte es sich so verhalten, würde sie es entfachen, dachte Violetta entschlossen. Hier ging es eindeutig darum, zwei Leben zu retten, war doch das Geschick des Kindes untrennbar mit dem der Mutter verbunden. Sie sah die Schwermütige offen an, und aus ihren Augen sprach ein solches Mitgefühl, dass es der Unglücklichen unwillkürlich das Herz öffnete. Die junge Frau fühlte eine tiefe innere Ruhe und Entspannung, die sie auf wundersame Weise in die Lage versetzte, über ihre Drangsal zu sprechen, was ihr bisher in ihrem leidvollen Leben gänzlich unmöglich gewesen war.
»Dieser Fluch wurde mir schon in die Wiege gelegt«, erklärte die Gemütskranke leise. Violetta erkannte erstaunt, dass sie unter der Dreckkruste, die ihr Gesicht überzog, eigentlich sehr schön war. Sie war blutjung, die Zigeunerin schätzte sie auf höchstens siebzehn Jahre. Der von Schwermut verschleierte Blick der jungen Mutter wurde allmählich klarer. Sie stellte sich Violetta als Theresa Guth vor, die jüngste Tochter eines wohlhabenden Mainzer Kaufmanns.
»Ich war ein sehr verschlossenes, zu Grübeleien neigendes Kind. Am fröhlichen Spiel anderer Kinder mochte ich kaum teilnehmen, ich hatte keine Freude an ihrem ausgelassenen Treiben. Die meiste Zeit stand ich unbeteiligt am Rande und zog mich in meine eigene Welt zurück. ›Ihre Melancholie wird sich schon lichten, wenn sie einen Bräutigam hat‹, pflegte meine Mutter immer zu sagen«, erklärte die junge Frau mit sarkastischem Auflachen. »Schön anzusehen, wie ich nun einmal war, fand sich auch bald ein Heiratskandidat aus begütertem Hause, der bei meinem Vater um meine Hand anhielt. Das war vor drei Jahren, ich war gerade dreizehn geworden …« Theresa seufzte. »Ich kannte Wolfgang, den Sohn eines reichen Mainzer Tuchhändlers, schon aus Kindertagen – und konnte diesen eitlen, selbstverliebten Gecken nicht ausstehen. Er sah zwar blendend aus und konnte sich gewählt ausdrücken, doch er hatte ein kaltes Herz, und für ihn zählten nur Geld und Erfolg, die er durch unsere Heirat zu mehren glaubte. Die Hochzeitsvorbereitungen liefen auf Hochtouren, als ich zum ersten Mal versuchte, mich selbst zu entleiben. Ich wollte mich auf dem Dachboden aufknüpfen – was jedoch leider fehlschlug.« Das Bedauern der jungen Frau war offenkundig. »Meine Familie bemühte sich daraufhin mit größter Diskretion um Hilfe und fand sie bei dem Dominikanerpater Aloisius aus Worms, der als einer der namhaftesten Exorzisten im ganzen Lande galt. Zunächst suchte der Pater mich mit salbungsvollen, trostreichen Predigten von meinen Obsessionen abzubringen, jedoch ohne den erhofften Erfolg. Ich dämmerte nur noch in dumpfer Apathie vor mich hin, was es den Menschen in meiner Umgebung unmöglich machte, normalen Umgang mit mir zu pflegen. Daraufhin unternahm Pater Aloisius mit mir eine Wallfahrt in die Eifel, zum Kloster des heiligen Cornelius, des Schutzpatrons der Gemütskranken und Fallsüchtigen, wo wir gemeinsam mit anderen Kranken vor dem Reliquienschrein des Heiligen beteten, gesegnete Corneliusbrote erhielten und geweihtes Wasser aus dem Trinkhorn des Heiligen tranken. Doch da auch das nichts nützte und mein Gemüt weiterhin umnachtet blieb, entschloss sich der Pater schließlich, eine Teufelsaustreibung an mir vorzunehmen. Diese war für mich um einiges schlimmer als meine Schwermut. Aber auch das half nichts.« Die Gesichtszüge der jungen Frau bebten. »Mein vortrefflicher Bräutigam war der Erste, der sich von mir abwandte, gefolgt von meiner Familie, die schweren Herzens akzeptierte, dass ihre wunderhübsche Tochter vollends zu den Sinneskranken gehörte«, erläuterte die junge Frau bitter. »Meine Eltern ließen mich aus der gesetzlichen Erbfolge streichen und verwahrten mich in einer abschließbaren Dachkammer. Meine Pflege und Versorgung überließen sie einer alten Magd, sie selbst gaben sich fortan nicht mehr mit mir ab. Daraufhin versuchte ich erneut, meinem unseligen Dasein ein Ende zu bereiten, und schlitzte mir mit der Kante eines Silberlöffels, den ich zuvor am Mauerwerk geschärft hatte, die Pulsadern auf. Dies war jedoch ebenso wenig von Erfolg gekrönt, denn die alte Hausmagd fand mich viel zu früh, in einer Blutlache, aber noch lebendig. Meine Familie steckte mich kurzerhand in den Mainzer Narrenturm, wie man es so macht mit Toren, die einem nur Verdruss bereiten. Das war vor gut zwei Jahren. Im Narrenturm gab ich mich vollends auf und wünschte mir nur noch den Tod. Etliche Male habe ich seither Hand an mich gelegt, doch die Turmwärter waren wachsam, und so wurde ich immer wieder ins Dasein zurückgezwungen.« Die junge Frau hielt inne und wischte sich die Tränen, die auf ihren schmutzverschmierten Wangen helle Schlieren hinterließen, aus den Augenwinkeln.
Die Zigeunerin legte ihr mitfühlend die Hand auf den Arm. »Wasch dir mal gründlich das Gesicht, mein Kind, du kannst ja vor Dreck kaum noch aus den Augen schauen«, sagte sie begütigend und bot der jungen Frau an, solange das Kleine zu halten.
»Die Wasserrationen im Narrenturm sind knapp bemessen und reichen gerade so, dass keiner der Narren verdurstet«, erläuterte Theresa, reichte den schlafenden Säugling behutsam an die Zigeunerin weiter und reinigte sich mit dem Flusswasser gründlich das Gesicht. Zum Vorschein kam ein Antlitz von elfenhafter Schönheit. Erst jetzt fiel Violetta auf, dass die junge Frau meergrüne Augen hatte. Es ist jammerschade um so ein junges, liebreizendes Geschöpf, ging es ihr durch den Sinn, und ihr Herz krampfte sich schmerzhaft zusammen. Ohne dass Violetta ihre Gedanken ausgesprochen hätte, knüpfte die junge Frau daran an und fragte mit tiefer Niedergeschlagenheit, warum Gott sie so strafe.
»Ich bin doch verloren in dieser Welt«, murmelte sie verzagt, »und das Leben ist mir eine einzige Last, selbst jetzt noch, da ich meinen kleinen Schatz habe …« Sie wies auf den Säugling im Arm der Zigeunerin, der friedlich schlummerte, und schluchzte auf. »Mein armes, armes Kind, was hast du nur für eine Rabenmutter«, brach es aus ihr heraus. »Ich habe die ganze Zeit mit mir gerungen, ob ich Undine mit in den Tod nehmen soll, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht.«
»Das ist auch gut so!«, sagte Violetta bestimmt und streichelte dem Säugling übers Händchen. Sogleich schlug die Kleine die Augen auf und blickte die Zigeunerin an. Die Augen des Kindes waren von kristallklarer Reinheit.
»Sie strahlt ja wie ein Glühwürmchen!«, murmelte die Zigeunerin und empfand plötzlich eine grenzenlose Zuneigung zu dem kleinen Wesen. »Undine heißt du«, raunte sie der Kleinen zu, »das passt ja, denn du hast die Augen einer Meerjungfrau.« Violetta war sich mit einem Mal sicher, dass dies das schönste und liebenswerteste Geschöpf war, dem sie jemals begegnet war.
»Die Kleine ist ein leuchtender Stern, der Licht in deine Dunkelheit bringen wird«, wandte sie sich an die Mutter. »Sie ist ein Geschenk des Himmels, durch die Liebe zu deinem Kind wirst du deinen Platz im Leben finden. Ich werde dir dabei helfen!« Violetta legte Theresa den Arm um die Schultern.
»Es gibt nichts, was ich mir sehnlicher wünsche, als meinem Kind eine gute Mutter zu sein«, bekundete Theresa, doch im nächsten Augenblick verdüsterten sich ihre Züge wieder. »Mein kleines Mädchen ist unter einem unglücklichen Stern geboren worden«, sagte sie gramvoll. »Sie hat im Narrenturm das Licht der Welt erblickt, einen trostloseren Ort für einen Säugling kann es nicht geben. Das dachten auch die Narrenwärter und haben mich und das Kind vor ein paar Tagen auf die Straße gesetzt. Seitdem kampiere ich mit der Kleinen unter freiem Himmel, ohne eine feste Bleibe. Was ist denn das für ein Leben für ein Kind!«
Eine Woge des Mitgefühls stieg in Violetta auf. »Aber das Schicksal hat ein Einsehen mit euch gehabt und es so gefügt, dass wir uns begegnet sind. Denn heute Nacht werdet ihr nicht draußen schlafen müssen. In meinem Planwagen findet ihr ein warmes, trockenes Plätzchen mit Kissen und Wolldecken und ein heißes Süppchen noch dazu!«, erklärte die Zigeunerin mit warmherzigem Lächeln. »Ich denke, wir sollten uns auch langsam dorthin aufmachen, ehe uns der Nieselregen noch ganz aufweicht.« Mitsamt der kleinen Undine auf dem Arm richtete sie sich langsam auf.
Die junge Mutter musterte sie versonnen. »Euch schickt der Himmel«, murmelte sie und streckte die Arme aus, um den Säugling, der in ein schmuddeliges Leinentuch gewickelt war, wieder an sich zu nehmen. Die erfahrene Menschenkennerin wertete die Geste als eindeutige Lebensbejahung und freute sich im Stillen darüber. Während die beiden Frauen mit dem Wickelkind dem Zigeunerlager zustrebten, welches nach Violettas Bekunden nur einen kurzen Fußmarsch vom Rheinufer entfernt war, erkundigte sich die Zigeunerin nach dem Alter des Mädchens.
»Undine wurde am 22. Dezember des letzten Jahres geboren, sie ist jetzt etwas über ein halbes Jahr alt«, erläuterte Theresa. Violetta merkte auf, als sie das Geburtsdatum des Kindes vernahm.
»Das ist der Tag der Wintersonnenwende – ein ganz bedeutendes Datum«, konstatierte sie beeindruckt und fragte die junge Frau, wer der Vater des Mädchens sei. In Theresas Augen trat ein warmer Glanz.
»Undines Vater war ein verwegener Wilderer und Bogenschütze. Ich kannte nur seinen Spitznamen, da es unter Räubern und Wilddieben üblich ist, einander nur mit den Geheimnamen anzusprechen. Man nannte ihn Goldfinger-Balthasar. Die Narrentürme werden ja auch als Gefängnistürme genutzt, in eigens dafür vorgesehenen Kerkern werden Diebe und Verbrecher verwahrt. Und weil Balthasar bei den Verhören verstockt blieb und die Namen seiner Kumpane nicht preisgeben wollte, steckten ihn die Gewaltdiener kurzerhand zu den Unsinnigen in den Narrenflügel, in der Hoffnung, dass ihn das aberwitzige Schreien und Wehklagen der Irrsinnigen weichkochen würde. Dort sind wir uns begegnet.« Theresa lächelte. »Wir haben uns nur angeschaut und wussten, dass es die große Liebe war. Es war die glücklichste Zeit meines Lebens, die Liebe zu Balthasar hat mich gesund gemacht. Alle Widerwärtigkeiten, denen man im Narrenturm ausgesetzt ist, konnten uns nichts anhaben, wir genossen jeden Augenblick, den wir gemeinsam erleben durften, wussten wir doch von Anfang an, wie begrenzt unsere Zeit war. Als Wiederholungstäter hatte Balthasar die Todesstrafe zu erwarten …« Theresa konnte vor Schmerz nicht weitersprechen. Violetta verstand und schloss sie in die Arme.
»Unser Glück währte nur eine Woche, dann haben sie ihn abgeholt«, stieß Theresa hervor. »Ich habe ihn nie wiedergesehen, er wurde kurze Zeit später an den Galgen geknüpft. Ich habe seinen Tod bis heute nicht verwunden und frage mich immer wieder, warum das Schicksal so grausam zu uns war. Erst schenkt es uns die Liebe, um uns bald darauf wieder aufs Schmerzlichste zu entzweien …«
»Das ist fürwahr ein hartes Geschick, ein solcher Schlag hätte auch gefestigtere Gemüter ins Straucheln gebracht«, erwiderte Violetta. »Ich verstehe dein Hadern, Theresa, aber eure Liebe ist nicht tot – sie lebt in Undine fort. Eure wunderbare Tochter ist ein Kind der Liebe, das solltest du niemals vergessen.«
Die junge Frau nickte bewegt und presste den Säugling an ihre Brust.
»Alleine dafür lohnt es sich zu leben!«, sagte die Zigeunerin nachdrücklich.
»Das ist wohl wahr«, entgegnete Theresa bedrückt. »Ich hoffe nur, ich vergesse es nicht, wenn die große Leere wieder über mich kommt. Ich bete zum Himmel, dass das niemals geschehen möge!«
Es war schon späte Nacht, als die Männer, Frauen und Kinder des Zigeunerclans der Kesselflicker die Suche nach der vermissten jungen Frau abbrachen, die seit nunmehr einem Monat mit ihrer kleinen Tochter unter ihnen geweilt hatte und von allen wegen ihrer elfenhaften Grazie »Elfchen« genannt wurde. Niedergeschlagen strebten sie dem Lager unweit des Baches Usa zu. Vor allem Violetta war über das Verschwinden der jungen Mutter zu Tode betrübt – obgleich sie damit gerechnet hatte, denn gerade in den letzten Tagen war die Gemütskranke wieder derart verzagt gewesen, dass selbst ihr Kind sie nicht aus ihrem Jammertal hatte herausholen können. Teilnahmslos hatte Theresa die Kleine an die Brust genommen, wenn sie hungrig gewesen war, und ebenso gleichgültig legte sie sie zurück in den mit Decken ausgepolsterten Weidenkorb, der dem Kind als Wiege diente. Nichts schien ihr verdüstertes Gemüt zu erreichen, geschweige denn, es aufzuhellen. Weder Violettas aufmunternde Worte noch der zu Herzen gehende Gesang und die Violinenklänge am abendlichen Lagerfeuer noch das Lächeln ihres Kindes. Violetta erinnerte sich daran, dass Theresa sie vor geraumer Zeit forschend angesehen und sie gefragt hatte, ob sie selbst Kinder habe. Mit tiefem Bedauern hatte Violetta verneint und erklärt, dass ihr Schoß nicht gebären könne und dass es keinen schlimmeren Fluch für eine Zigeunerin gebe, als unfruchtbar zu sein. Frauen wie sie würden normalerweise vom Stamm verstoßen. Alleine ihre Gabe, zu heilen, die schon zahlreichen Stammesmitgliedern geholfen habe, bewahre sie davor. Du brauchst keine eigenen Kinder, du bist die Mutter aller – diese wunderbaren und tröstlichen Worte der alten Stammesmutter Esma, die gleichzeitig ihre Großmutter war, hatte sie Theresa mit wehmütigem Lächeln anvertraut – und Theresa bekräftigte die Worte mit einer für sie ungewohnten Nachdrücklichkeit und küsste Violetta sogar die Hand.
»Du liebst sie sehr?«, fragte Theresa sie dann mit Blick auf Undine, weniger eine Frage als eine Feststellung.
»Von ganzem Herzen«, antwortete Violetta und fügte hinzu, dass sie Theresa indessen nicht minder liebe. Theresa murmelte versonnen, dass sie ihr Kind auf Erden keinem besseren Menschen anvertrauen könne als Violetta. Sie nickte nur, als Violetta ihr mit einiger Entrüstung entgegenhielt, selbst der gütigste Mensch der Welt könne wahre Mutterliebe nicht ersetzen, dessen müsse sie sich stets bewusst sein.
»Das weiß ich«, erwiderte sie, »doch das Traurige ist, dass ich in den Phasen der Schwermut nur eine große Leere in mir fühle und unfähig bin, etwas zu empfinden – außer einem grenzenlosen Lebensüberdruss. Ich bin nicht in der Lage, meinem Kind das zu geben, was es am nötigsten braucht: eine Mutter, die es bedingungslos liebt. Du glaubst ja gar nicht, wie sehr ich mich dafür hasse und mir wünsche, ich wäre nie geboren worden!«
Violetta hatte gespürt, wie schlecht es Theresa in den letzten Tagen gegangen war, doch sie war außerstande gewesen, ihr zu helfen. Es blieb ihr nur, zu Sara la Kali zu beten, der Schutzpatronin und Großen Mutter der Zigeuner, und die Schwarze Jungfrau um Beistand für Theresas gepeinigte Seele zu bitten.
Doch dann war das Elfchen plötzlich verschwunden. Ganz so als hätte der Erdboden es verschluckt. Theresa hatte Violetta noch am Vormittag zu den Streuobstwiesen auf einer Anhöhe begleitet. Mit Argusaugen wachten die Einheimischen darüber, dass sich die beiden Frauen, von denen eine unschwer als »Ägypterin« zu erkennen war, wie Zigeunerinnen im Volksmund genannt wurden, bloß nicht am Fallobst vergriffen. Was Violetta und Theresa auch tunlichst vermieden. Stattdessen füllten sie, zur Verwirrung der Dörfler, ihre großen Tragekörbe mit Erde, vornehmlich der frischaufgeworfenen Erde von Maulwurfshaufen, die Violetta zu Heilzwecken benötigte. Der fruchtbare Lehmboden der Wetterau, den Violetta im Lager sorgfältig siebte und reinigte, eignete sich vortrefflich für Wundauflagen und Umschläge bei Verbrennungen.
»Fresst ihr Hühnerdiebe jetzt auch noch Dreck?«, rief ihnen ein vierschrötiger Bauernlümmel zu, und Violetta fragte ihn, ob er noch nie davon gehört habe, dass es manchen Leuten sogar gelinge, aus Dreck Gold zu machen. Nachdem sie im Lager angekommen waren, lief Theresa mit einem Eimer zum Bach, um Wasser zu holen – und kehrte nicht mehr zurück. Als ihr das Warten zu lang wurde, war Violetta mit bangen Ahnungen aufgebrochen und hatte die nähere Umgebung vergeblich nach der jungen Frau abgesucht. Auch die anschließende Suche der Clanmitglieder im Umfeld des Dorfes und in der Ortschaft, wo sie sich bei den Einheimischen nach Theresa erkundigten, hatte keinerlei Hinweise ergeben.
Niedergeschlagen und erschöpft kehrte Violetta um Mitternacht zu ihrem Planwagen zurück, wo eine der Alten das schlafende Kind hütete, und brach bei dem friedvollen Anblick des Säuglings in Tränen aus.
Am nächsten Morgen flehte Violetta die Stammesmutter an, die Suche nach Theresa fortzusetzen, doch diese sprach sich dagegen aus und drängte stattdessen zum Aufbruch. Obgleich Violetta von klein auf gelernt hatte, den Entscheidungen der Phuri dai mit uneingeschränkter Achtung zu begegnen, begehrte sie jetzt dagegen auf. Die zahnlose alte Frau, die das faltige Antlitz einer Schildkröte besaß und fünfzehn Kindern das Leben geschenkt sowie Dutzende Enkel und Urenkel heranwachsen gesehen hatte, musterte die aufsässige Enkeltochter mit einer Mischung aus Nachsicht und Strenge. Sie hatte Violetta den geheimen Namen »Pachita« gegeben, welcher in der Zigeunersprache »Löwin« bedeutete.
»Du kannst nichts erzwingen, Pachita, das weißt du doch. Sie ist weg. Das war ihre Entscheidung, und die solltest du akzeptieren, so schwer es dir auch fällt. ›Halt treu fest, lass leicht los‹, lautet eine alte Zigeunerweisheit. Du hast lange genug an ihr festgehalten und deine ganze Kraft auf sie konzentriert, weil du ihr helfen wolltest. Das war vergebliche Liebesmüh, denn ihr ist nicht zu helfen. Sie war für den Stamm und besonders für dich eine große Belastung, und so hart das auch klingt: Es ist gut, dass sie weg ist. Jetzt ist es an der Zeit, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Und wenn du ihr wirklich einen Gefallen tun willst, dann kümmere dich um ihr Kind. Das ist jetzt deine Aufgabe – und wenn ich mich nicht täusche, gibt es doch nichts, was du lieber tätest?« Die Alte kniff Violetta neckisch in die Wange und gab den Männern den Befehl, die Pferde anzuspannen.
»Phuri dai, wartet bitte noch!«, rief Violetta. Die alte Frau, die sich bereits zum Gehen gewandt hatte, drehte sich unwirsch zu ihr um. »Was willst du denn noch, du Klette?« Die Heilerin trat an sie heran und konnte es nicht verhindern, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen.
»Glaubt Ihr, dass sie … noch am Leben ist? Ich bin momentan nämlich zu verwirrt, um es fühlen zu können …«
»Was bist du denn für eine Seherin!«, krächzte die Alte spöttisch. Im nächsten Moment gellten die lauten Schreie des Säuglings aus dem Planwagen. »Ist das nicht Antwort genug?«, bemerkte die Stammesmutter mit listigem Lächeln und ließ ihre verblüffte Enkelin stehen. Violetta war sich mit einem Mal sicher, den ansonsten so ruhigen und ausgeglichenen Säugling zum ersten Mal mit solcher Vehemenz schreien zu hören. Sie eilte in den Planwagen, um nach der Kleinen zu schauen. Sobald sie sich über den Weidenkorb beugte, verstummte das Kind. Ein Lächeln breitete sich über das Gesicht der kleinen Undine, und sie reckte Violetta freudig die Arme entgegen. Violetta war es, als ginge an diesem trüben, regnerischen Morgen die Sonne auf, und sie spürte ein unbändiges Glücksgefühl, während sie Undine aus der Wiege nahm und an ihre Brust drückte.
»Mein Glückskind«, murmelte sie und war dem Schicksal unendlich dankbar, dass sie das wunderbare kleine Wesen in den Armen halten durfte.
1. TEIL – Das Feuer
Montag, 12. Oktober, bis Donnerstag, 15. Oktober 1596
Wenn der Kornwolf durch das Feld streift, entsteht das Mutterkorn. (Volkstümliche Überlieferung)
1
An jenem kalten, verregneten Oktobermorgen, der von Sturmböen und Hagelschauern durchsetzt war, stand die Freifrau Paloma von Malkendorf am Fenster und blickte angespannt hinunter auf den Hof, wo ihr Gemahl gerade in die Kutsche stieg, um zu seinen Ländereien im benachbarten Dorf Bornheim zu fahren.
Seine Miene war eisig, und er würdigte seine Gattin am Fenster keines Blickes, geschweige denn, dass er ihr zum Abschied zugewinkt hätte. Auch sie hatte geflissentlich darauf verzichtet, ihren Gemahl zur Kutsche zu begleiten und ihm eine gute Reise zu wünschen, wie es sich für eine liebende Ehefrau gehört hätte. Nach den hässlichen Zerwürfnissen der vergangenen Nacht, die freilich auch den Domestiken nicht entgangen waren, so laut und vulgär, wie er sie beschimpft hatte, saßen sich die Eheleute beim Frühstück mit versteinerten Gesichtern am Esstisch gegenüber. Kein Wort hatten sie gewechselt, er hatte verbissen seinen Haferbrei gelöffelt, sie hatte ihren noch nicht einmal angerührt und nur an ihrem Wasser genippt, um ihre staubtrockene Kehle zu befeuchten, doch selbst das hatte sie kaum heruntergekriegt, denn ihr Hals war wie zugeschnürt. Schalt er sie sonst immer für ihren mehr als mäßigen Appetit – sie picke wie ein Vögelchen und sei sowieso eine dürre Bohnenstange, an deren spitzen Knochen sich ein Mann nur blaue Flecken hole –, so unterließ er dies heute und strafte sie mit Missachtung. Die ihr indessen deutlich lieber war als seine Wutausbrüche und ständige Bevormundung. Hoffentlich bist du bald weg, hatte sie gedacht und mit kühler Gleichgültigkeit an ihm vorbei durch die bleiverglasten Fensterscheiben in den trüben Morgenhimmel geblickt, wo heftige Windböen die dunkelgrauen Wolken vor sich her trieben. Genauso trist sah es in ihrem Inneren aus. Seit nunmehr drei Jahren waren sie verheiratet, und sie hatte ihm noch immer keine Kinder geboren. Geliebt hatte sie ihn ja von Anfang an nicht, diesen grobschlächtigen Landjunker, der schon in jungen Jahren einen Stiernacken hatte und die Manieren eines Bauernlümmels, fern jeglicher Lebensart, die sie als eine geborene von Urberg in ihrem zwar verarmten, aber distinguierten Elternhaus gewohnt gewesen war. Den nahezu leeren Schatullen der alten Sachsenhäuser Adelsfamilie war es auch geschuldet, dass ihre Eltern, vornehmlich der Vater, der Heirat mit dem gutsituierten Landjunker bereitwillig zugestimmt hatten. Die einzige Mitgift, die Paloma vorzuweisen hatte, waren ein paar geknüpfte Wandteppiche und ein silbernes Teeservice aus besseren Tagen gewesen. Die Anmut und Grazie jedoch, die ihr gewissermaßen in die Wiege gelegt worden waren, hatten den freiherrlichen Bräutigam so sehr entzückt, dass ihn ihre Mittellosigkeit nicht weiter gestört hatte, sie hatte ihn gar angestachelt, Paloma und ihre Familie mit Geschenken zu überhäufen. Nicht nur die Kleider- und Schmucktruhen seiner Angebeteten, sondern auch die ihrer Mutter und ihrer vier Schwestern füllten sich erheblich, auch die Speisekammer im Palais Urberg war dank des freigiebigen Schwiegersohns in spe bestens bestückt, und, was gerade den Hausherrn besonders beglückte, der Freiherr übernahm sogar einen Teil der Schulden, welche seit Jahren auf den Ländereien der Herren von Urberg lasteten. Hatte sich Paloma anfangs ebenso wie ihre Familienmitglieder gefreut, ein köstliches Stück Wildbret auf dem Teller zu haben, so war ihr inzwischen längst der Appetit vergangen. Seit einiger Zeit hasste sie ihn sogar, diesen Bauernlümmel, wie sie ihren Gatten im Stillen zu nennen pflegte, und es ekelte sie regelrecht vor ihm, wenn er ihr körperlich nahe kam. Was leider viel zu häufig geschah, obgleich sich alles in ihr verkrampfte, wenn er gewaltsam seine Lendenlust an ihr stillte, um sie anschließend ein gefühlskaltes Miststück zu schelten, bei dem es einem ja vergehen könne. Kein Wunder, dass du keine Kinder kriegen kannst, wo andere Weiber eine Vulva haben, hast du eine Eisgrotte, hatte er in der vergangenen Nacht hinter ihr her gebrüllt. Sie hatte sich in Grund und Boden geschämt vor den Domestiken, die, vom Lärm aufgeschreckt, aus ihren Dachkammern auf die Treppe geeilt waren. Sogar ein paar Stallknechte waren aus ihren Unterkünften bei den Stallungen auf den Hof hinausgestürzt, weil die wüsten Schreie sie aus dem Schlaf gerissen hatten – und das war ihr besonders unangenehm. Denn er war auch darunter gewesen. Vom Fenster aus hatte sie deutlich seine hochgewachsene, schlanke Gestalt ausmachen können, und es hatte ihr einen Stich ins Herz versetzt, dass sie nicht … Schluss jetzt! Am besten gar nicht daran denken, rief sich die Freifrau zur Räson und wartete, bis die Kutsche den hohen steinernen Torbogen des Gutshofs passiert hatte, ehe sie energisch nach der Hausmagd läutete. Denn ihr Gemahl, das wusste sie aus Erfahrung, würde vor Mitternacht nicht zurück sein und dann volltrunken in sein Bett fallen. Einen besseren Zeitpunkt als jetzt konnte es also gar nicht geben!
»Renata, du holst mir jetzt sofort diese Ägypterin herbei!«, befahl sie der eintretenden Magd in herrischem Ton. Die Magd fuhr bei der Bezeichnung »Ägypterin« zusammen, als wäre ihr der böse Feind erschienen.
»Meint Ihr die Wundärztin, die der Kleinen aus den Gärten gestern die verbrühten Füße kuriert hat?«, fragte sie beklommen. Die Kunde von der wundersamen Heilung eines kleinen Mädchens aus der Nachbarschaft, das sich beim Spielen unweit der Feuerstelle mit kochendem Wasser die Füße verbrüht hatte, hatte sich in der Region um das Eschenheimer Tor verbreitet wie ein Lauffeuer. Die fahrende Wurzelkrämerin, welche allenthalben die »Ägypterin« genannt wurde, befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks mit ihrem Planwagen auf der Anreise zur Frankfurter Messe. Sie hatte sich in der ländlichen Region, die auch »zu den Gärten« genannt wurde, da dort landwirtschaftliche Betriebe mit großen Wirtschaftshöfen, Scheunen und Obstgärten vorherrschten, nach einem geeigneten Lagerplatz umgesehen.
Wie die meisten Leute fürchtete auch die Gesindemagd die fremdländischen Menschen aus dem fernen Ägypten, die in dem Ruf standen, Hexen und Zauberer zu sein, oder, was nicht besser war, Betrüger und Diebe. Die »Wunderheilung«, wie das Ereignis bald von den Landarbeitern genannt wurde, erfüllte die Leute mit Ehrfurcht und die Eltern des Kindes gar mit tiefer Dankbarkeit, welche sie der Heilerin bekundeten, indem sie ihr ein Huhn schenkten. Doch der Argwohn der Anwohner gegen die fremde Vagabundin war selbst nach der guten Tat nicht vollständig verschwunden, viel zu tief wurzelte er in ihren Köpfen. Daher war die Gesindemagd von der Anordnung ihrer Herrin nicht gerade begeistert, sie verkniff sich jedoch die Frage, was die Freifrau denn von der Ägypterin wolle, da ihr die hochmütige Dame sowieso nur eine patzige Antwort gegeben hätte. Die Freifrau war wegen ihrer kalten Überheblichkeit noch weniger beliebt beim Gesinde des freiherrlichen Gutshofes als der polternde Herr, der sich zuweilen wenigstens nicht zu fein war, seine Untergebenen wie Menschen zu behandeln – was der Freifrau nicht mal im Traum eingefallen wäre.
»Worauf wartest du denn noch, du dummes Ding? Muss ich dir erst Fersengeld geben!« Die barsche Bemerkung der Herrin riss sie aus ihren Gedanken, und die junge Magd stürmte aus dem Zimmer. Trotz ihrer augenscheinlichen Betriebsamkeit rief ihr die Freifrau noch hinterher, sie solle sich gefälligst beeilen und auch der Ägypterin Beine machen, sie habe ihre Zeit nämlich nicht gestohlen wie gewisse andere Leute.
Nachdem sie vom Fenster aus beobachtet hatte, wie die Magd durch den Torbogen davongestoben war, ließ sich Paloma auf dem gepolsterten Hocker vor einem goldgerahmten Spiegel nieder, nahm einen kunstvoll dekorierten Hornkamm von der Ablage – ein Geschenk ihres Mannes – und kämmte sich mit selbstverliebter Miene das lange blonde Haar.
Am Vorabend, als ihr die Gattin des Gutsverwalters von der Wundertat der Ägypterin berichtet hatte, die die schweren Verbrühungen des Bauernmädchens angeblich gelindert haben sollte, indem sie die Füße des Kindes in einen Schlammkübel steckte, hatte die Freifrau nur gelangweilt mit den Schultern gezuckt. Paloma hatte in ihrer Kindheit reichlich Umgang mit Menschen von Adel gepflegt, daher interessierte sie sich nur mäßig für den Klatsch der Landbevölkerung. Sie bedauerte es zutiefst, dass es in dieser Einöde keine Menschenseele gab, mit der eine Adelsdame wie sie auf Augenhöhe hätte verkehren können. Ihr ungehobelter Gatte und seine Verwandtschaft kamen jedenfalls nicht in Frage! Die Familienfeiern auf Gut Malkendorf waren für Paloma, die über eine weitverzweigte Sippe im ganzen Land verfügte, immer sterbenslangweilig. So war sie auch am gestrigen Abend mit den Gedanken ganz woanders gewesen, als die Klatschbase ihr von der Wunderheilung des Bauernkindes erzählt hatte. Während die Gattin des Gutsverwalters anschließend davon berichtete, dass die Ägypterin der Mutter des Mädchens, die schon einen ganzen Stall von Kindern in die Welt gesetzt und die vierzig bereits überschritten hatte, zum Abschied noch empfohlen habe, sich in ihrem Zustand doch ein wenig zu schonen und die harte Arbeit anderen zu überlassen, hatte Paloma ein Gähnen nicht unterdrücken können. Sie hegte die Hoffnung, die Landpomeranze würde nun endlich die Feinfühligkeit besitzen, sich auf den Nachhauseweg zu begeben, doch der Sermon ging weiter. Als sie dann erwähnte, die Bäuerin sei aus allen Wolken gefallen und habe es gar nicht glauben wollen, dass sie schon wieder schwanger sein sollte, wo sie doch erst vor knapp einem Monat ihre stille Woche gehabt hätte, war die Freifrau plötzlich hellhörig geworden.
»Und stellt Euch vor, verehrte Freifrau, die alte Hebamme hat die Bäuerin dann später untersucht, und sie hat eindeutig bestätigt, was die Ägypterin der Bäuerin ins Gesicht gesagt hatte: Die Martha ist schon wieder guter Hoffnung – und das nun zum zwölften Mal! Die Ärmste hat geheult wie ein Schlosshund, als die Alte ihr das gesagt hat, und das bestimmt nicht nur vor lauter Freude …«
Die Freifrau war unversehens vom Tisch aufgesprungen, hatte die Gattin des Gutsverwalters an den Handgelenken gepackt und ihr ins pausbäckige Gesicht geschrien:
»Ihr wollt mir doch nicht etwa weismachen, die Ägypterin hätte es der Bauersfrau angesehen, dass sie schwanger ist, und das, noch bevor es der Frau, die ja schon elf Kinder geboren hat, selbst aufgefallen ist!«
Die Frau des Verwalters, die sich lächerlicherweise einbildete, etwas Besseres zu sein, weil das freiherrliche Paar nicht umhinkam, den Verwalter nebst Gemahlin gelegentlich als Gäste zu empfangen, wich unwillkürlich vor der zierlichen Adelsdame zurück, die trotz ihres Engelsgesichts im Ruf stand, ein arges Biest zu sein. Genau so sei es gewesen, beteuerte die Verwaltersgattin.
»Die Ägypterin hat die Gabe der Hellsichtigkeit und kann in den Leuten lesen wie in einem offenen Buch. Angeblich kann sie einem auch die Zukunft vorhersagen. Wenn mein lieber Ehemann nicht so dagegen wäre, würde ich doch glatt mal ihre Dienste in Anspruch nehmen!«, gluckste die Matrone. »Ach, was Ihr nicht sagt«, erwiderte die Freifrau, und just in diesem Moment hatte sie den Entschluss gefasst, sich die seherischen Fähigkeiten der Weissagerin zunutze zu machen. Denn es gab da eine Frage, die ihr ungeheuer auf der Seele brannte.
Um die neunte Morgenstunde lag Lovenita Metz noch in ihrem Planwagen auf dem Strohsack, der gefüllt war mit Wiesenkräutern, und schlief tief und fest. Die Heilung des kleinen Mädchens hatte sie viel Kraft gekostet. Wie stets nach einer Heilung oder nachdem sie einen Menschen »gelesen« hatte, hatte sie einen mächtigen Hunger verspürt, den sie mit einer köstlichen Hühnersuppe mit Hirse, Steckrüben und anderen Wurzelgemüsen stillte. Danach hatte Lovenita am Lagerfeuer ein paar Becher Wein geleert, die ihr geholfen hatten, die überanstrengten Sinne zu entspannen, und sich anschließend mit ihrer fünfzehnjährigen Tochter Clara zu Bett begeben, wo sie noch immer schlief wie ein Stein. Sie hatte von dem kleinen Mädchen geträumt, denn die aufwühlenden Ereignisse des Abends waren viel zu lebendig in ihr, als dass der Schlaf sie hätte verdrängen können. Erneut vernahm sie die gellenden Schmerzensschreie des Kindes, und der Wunsch, der Kleinen zu helfen, war so übermächtig in ihr, dass der Druck auf ihrer Brust kaum noch zu ertragen war. Wie ein Pfeil war sie in den Planwagen geschnellt, hatte den Sack mit der pulverisierten Heilerde gepackt und war damit zu dem Kind gehastet. In einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, wies sie die Eltern an, sofort kaltes Wasser und einen großen Holzbottich herbeizuholen. Mit fliegenden Fingern vermischte sie die Erde mit Wasser, bis ein glatter Brei entstand, dann packte sie das schreiende Kind unter den Achseln und stellte es in den Bottich mit dem kühlenden Heilerdeschlamm, der dem Kind bis zu den Knien reichte. »Hüpf und spring, so fest du kannst!«, raunte sie dem Kind zu und klatschte im Takt dazu in die Hände. »Und schrei den Schmerz heraus!« Ohne dass sie irgendetwas hätte sagen müssen, klatschten die Eltern mit, und nach und nach stimmten alle Landarbeiter mit ein, die sich um das verletzte Kind geschart hatten. Keiner der Anwesenden hätte später sagen können, wie lange es gedauert hatte, bis die Tränen des Mädchens endlich versiegten und es noch ein wenig verstört, aber augenscheinlich schmerzfrei, nach seiner Mutter krähte und Anstalten traf, aus dem Bottich zu klettern. Auf Lovenitas Weisung hin spülten die Eltern dem Mädchen behutsam den Lehm von den Beinen – und trauten ihren Augen nicht: Auf den Füßen des Kindes war nicht eine einzige Brandblase zu sehen. Die schlammige Erde in dem Bottich war jedoch so warm, als sei sie erhitzt worden – was ja auch geschehen war, denn sie hatte die Hitze der Verbrühung aufgenommen. Die Füße des Kindes waren zwar leicht gerötet, aber die Haut zeigte sonst keinerlei Spuren einer Verbrennung. Die Eltern hatten Tränen in den Augen, als sie sich bei Lovenita bedankten.
»Ihr habt ein Wunder vollbracht«, murmelte die Mutter und küsste Lovenita ehrfürchtig die Hand. Lovenita glaubte nicht an Magie und war der festen Überzeugung, dass alles seine natürlichen Ursachen hatte. So entgegnete sie, das sei kein Wunder gewesen, die Erde habe das Kind geheilt. Das Wichtige sei, dass man sie unmittelbar nach der Verbrennung anwende, eine halbe Stunde später verabreicht, lindere sie zwar noch die Schmerzen, könne aber die Spuren der Verbrennung auf der Haut nicht mehr verhindern. Als die Bäuerin mit dem wettergegerbten Gesicht und den flachsblonden Haaren ihr nahe kam, spürte Lovenita das neu aufkeimende Leben in ihrem nicht mehr jungen, von der harten Arbeit und den vielen Geburten ausgezehrten Körper und empfahl ihr mitleidig mehr Schonung. Noch während sie dies aussprach, fühlte sie auch, dass die Frau alles andere als glücklich darüber war, in ihrem fortgeschrittenen Alter die Strapazen einer weiteren Schwangerschaft in Kauf nehmen zu müssen – Lovenita kannte das von anderen Frauen, die zahlreiche Kinder geboren hatten und von dem häufigen Gebären ausgebrannt und erschöpft waren, wofür ihre Männer jedoch wenig Verständnis zeigten.
Danach hatten sich Lovenita und ihre Tochter in der Umgebung des Bauernhofs einen geeigneten Platz zum Übernachten gesucht. Beim abendlichen Lagerfeuer hatte Lovenita noch zu Clara gesagt, dass dies ein guter Ort sei und sie hier auch während der Messe Nachtlager halten könnten, da es ruhiger und sicherer sei als in der überfüllten Frankfurter Innenstadt. Clara hatte ihr gähnend zugestimmt, dann waren sie zu Bett gegangen. Ihr treuer Beschützer, der schwarzweiße Bolddog-Rüde Morro, den Mutter und Tochter über alles liebten, hatte sich wie immer an Lovenitas Füße gelegt, und dann waren sie eingeschlafen.
Das laute Bellen des Hundes riss Lovenita und Clara jäh aus dem Schlaf. Irgendjemand schlich um den Planwagen herum. Lovenita schnellte von ihrem Strohsack hoch.
»Wer ist denn da?«, rief sie verschlafen und ein wenig gereizt.
»Ich bin die Dienerin der Freifrau von Malkendorf«, erklang eine verängstigte Frauenstimme. »Meine Herrin wünscht Euch in einer dringlichen Angelegenheit zu sprechen.«
»Moment, ich muss mir erst was überziehen«, erwiderte Lovenita, beruhigte den Hund, breitete sich ein wollenes Tuch über die Schultern und kroch schlaftrunken ans andere Ende des Wagens, um die verschnürte Segeltuchplane zu öffnen.
»Guten Morgen!«, grüßte sie die junge Gesindemagd, die draußen vor dem Planwagen stand und sie aus großen Augen anblickte. Sie wiederholte ihr Anliegen und fügte ein wenig betreten hinzu, am besten wäre es, wenn sie gleich aufbrechen würden, denn es sei noch ein halbstündiger Fußmarsch bis zum Gutshof und der Freifrau pressiere es auch ziemlich. Lovenita entgegnete unwirsch, sie müsse sich erst die Haare kämmen und den Schlaf aus den Augen waschen, so viel Zeit müsse sein. Die Magd kniff unwillig die Lippen zusammen. Lovenita spürte, wie sehr sie unter Druck stand. Daher beeilte sie sich mit der Morgentoilette und verzichtete sogar auf den Becher Milch, den sie nach dem Aufstehen immer zu sich nahm.
»Schau schon mal im Felleisen nach, ob wir auch alles dabeihaben«, wies sie ihre Tochter an, die es von klein auf gewohnt war, der Mutter beim Kräutersammeln und Bereiten der Salben und Tinkturen, aber auch beim Verarzten der Kranken zu assistieren.
»Soll ich auch ein Fläschchen von unseren Gemütstropfen einpacken?«, fragte Clara die Mutter, die gerade damit beschäftigt war, ihr schulterlanges kastanienbraunes Haar zu kämmen, zu einem Knoten zu winden und hochzustecken.
»Unbedingt«, entgegnete Lovenita, »wir wissen ja nicht, was die Freifrau von uns will und wo sie der Schuh drückt, von daher kann es auf keinen Fall schaden, sie dabeizuhaben.«
Von all ihren selbstgemachten Tränken und Tinkturen verkauften sich die aus Schafgarbe und Johanniskraut hergestellten Gemütstropfen am besten. Die von Pest und Hungersnöten geplagten Menschen bedurften der Gemütsaufhellung, welche der Pflanzenextrakt bei längerer, regelmäßiger Einnahme zweifellos bewirkte.
»Vergiss deine Medizin nicht«, ermahnte Lovenita ihre Tochter, und die Fünfzehnjährige träufelte sich sogleich einige Tropfen aus einer Phiole auf einen Holzlöffel und nahm sie ein. Für ihre Tochter, die seit früher Kindheit unter Schwermut litt, hatte Lovenita das Medikament entwickelt. Wenngleich das junge Mädchen zuweilen immer noch entrückt und teilnahmslos anmutete, so bewirkten die Tropfen immerhin, dass ihm nicht länger eine bleierne Schwere jeglichen Lebensmut raubte. Die permanente Einbindung Claras in das Gewerbe der Mutter tat ihr Übriges, und so war sie zwar lange nicht so unbeschwert wie die meisten jungen Leute ihres Alters, aber einigermaßen »geerdet«, wie Lovenita es auszudrücken pflegte. Sie hatte einen Platz im Leben gefunden.
Wenig später stiegen Lovenita und Clara aus dem Planwagen, und Lovenita bemerkte den erstaunten Blick der Gesindemagd auf Clara. Knapp und entschieden erläuterte sie, dass die Begleitung ihrer Tochter für sie unverzichtbar sei.
Während des Marsches entlang der windgepeitschten Viehweiden und Stoppelfelder, schwieg die Magd verbissen. Die Gesellschaft der Ägypterin und ihrer halbwüchsigen Tochter war ihr sichtlich unangenehm. War ihr die Mutter mit ihren rötlichen Haaren, dem sommersprossigen Gesicht und den grünen Katzenaugen, die alles zu durchdringen schienen, schon reichlich unheimlich, so war ihr das stille, in sich gekehrte Mädchen mit der bleichen Haut erst recht suspekt. Die Schweigsamkeit des Mädchens dünkte der einfältigen Renata, die in ihrem Leben nie über den Tellerrand des heimischen Frankfurt hinausgeblickt hatte, wie Verschlagenheit. Das sind beides Hexen, ging es ihr durch den Sinn. Da sie sich nicht bekreuzigen konnte, weil es viel zu auffällig gewesen wäre und nur die Aufmerksamkeit ihrer dämonischen Begleiterinnen auf sich gezogen hätte, sandte sie im Stillen Stoßgebete an den Herrgott im Himmel, ihr als aufrechter Protestantin beizustehen. Lovenita und Clara, denen die Ressentiments der Sesshaften gegen Fahrende nichts Neues waren, vermieden es gleichermaßen, das Wort an die Magd zu richten, und hingen ihren Gedanken nach. Lovenita fragte sich, was für ein Ansinnen die Adelsdame wohl an sie stellen mochte, und hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch. Aus langjähriger Erfahrung wusste sie, dass gerade Standespersonen häufig sehr ungehalten reagierten, wenn sie aus dem Munde der Wahrsagerin nicht das hörten, was sie sich erhofft hatten. Vor allem, wenn es dabei um Herzensangelegenheiten ging. Es erforderte stets ein erhebliches Fingerspitzengefühl, die Ratsuchenden mit der Wahrheit zu konfrontieren, die weitaus bitterer schmeckte als jede zuckersüße Lüge. Ihrer Illusionen beraubt, bedurften die Betroffenen aufbauender Worte, die sie wieder aufrichteten und ihre fehlgeleiteten Bestrebungen in neue, hoffnungsvollere Bahnen lenkten. Nur Kindern und Narren ist es erlaubt, unverblümt die Wahrheit zu sagen – und selbst sie kann das manchmal das Leben kosten, erinnerte sich Lovenita an die Worte ihrer Ziehmutter und Lehrerin, der Zigeunerin Violetta, die sie in jungen Jahren in der Kraft des Blickes unterwiesen hatte. Damals hatte sie ihr von einem Hofnarren an einem französischen Herrscherhof berichtet, den der Regent hinrichten ließ, nachdem er ihm auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin die Wahrheit ins Gesicht gesagt hatte. Die Worte aus dem Munde einer Seherin sind oft brüsk, direkt und manchmal auch verletzend, hatte Violetta zu bedenken gegeben. Wenn wir aber beim Wahrsagen Gefahr laufen, großen Schaden beim Ratsuchenden anzurichten und uns am Ende selbst gefährden, ist es besser, zu schweigen.
Lovenita erinnerte sich mit einem Mal an das düstere Kapitel ihrer Vergangenheit und gelobte sich wie so oft, den Fehler, für den sie so schwer hatte büßen müssen, nie wieder zu machen. Sie wünschte sich inständig, die vornehme Dame möge nur ein körperliches Gebrechen haben, welches sie in ihrer Eigenschaft als Wundärztin behandeln konnte, und nicht etwa ihre seherischen Fähigkeiten in Anspruch nehmen wollen. Bekümmert musterte Lovenita ihre Tochter, die an diesem Morgen ziemlich niedergeschlagen wirkte. Spontan ergriff sie Claras Hand und erkundigte sich leise bei ihr, ob es ihr nicht gut gehe.
»Doch, doch, Mama, es ist alles in Ordnung«, wiegelte die Fünfzehnjährige ab und mühte sich um ein Lächeln, welches derart gequält wirkte, dass es Lovenitas Besorgnis noch verstärkte. Sie hat wieder ihre Zustände, konstatierte sie alarmiert und fluchte innerlich über die Ohnmacht, die sie angesichts von Claras Gemütsleiden stets empfand. Denn aus bitterer Erfahrung wusste sie, dass kaum etwas den dichten Kokon, der Claras Gemüt in solchen Phasen umhüllte, zu durchdringen vermochte. Man musste sie dann einfach in Ruhe lassen und geduldig darauf warten, dass sich der dunkle Schleier wieder lichtete. Die meisten Außenstehenden begriffen das nicht und hielten die in solchen Momenten völlig abwesend wirkende junge Frau für nicht ganz bei Sinnen, was Lovenita sehr erbitterte. Von daher stand ihr Unterfangen heute Morgen unter keinem glücklichen Stern, und Lovenita hätte es am liebsten verschoben, doch sie mochte die Freifrau, die wohl dringend ihre Hilfe benötigte, nicht vor den Kopf stoßen. Sie streifte die stupsnasige blonde Magd, die mit verbissener Miene und in scharfem Tempo neben ihnen her schritt, mit einem verdrossenen Seitenblick. Allein die Missgunst, die von ihr ausging, verhagelte Lovenita schon gehörig die Laune.
Als sie wenig später den Gutshof erreichten, fiel Lovenitas Blick auf das farbige Familienwappen, welches über dem hohen steinernen Torbogen in Stein gemeißelt war. Es zeigte eine schrägstehende Axt. Die Axt war das Symbol des Krieges und der sinnlosen Zerstörung. Für die Zigeuner, bei denen Lovenita aufgewachsen war, hatte sie aber noch eine andere Bedeutung: Sie galt als das Zeichen der Taube. Während Nicht-Zigeuner Tauben als Friedenssymbol betrachteten oder gar als Materialisation des Heiligen Geistes, so stellten sie für Zigeuner die Verkörperung der Grausamkeit dar. Tauben waren die einzigen Vögel, die einander aus reinem Vergnügen töteten, obgleich sie auf den ersten Blick so sanft und harmlos anmuteten. Kein gutes Zeichen, ging es Lovenita durch den Sinn. Von früher Kindheit an hatte sie gelernt, auf ihre Umgebung zu achten, denn eine unabdingbare Voraussetzung für das Gedankenlesen war der geschärfte Blick für die Wirklichkeit. Am liebsten hätte sie kehrtgemacht. Da die Freifrau sie aber schon erwartete und es außerdem ein Unding gewesen wäre, so kurz vor der Tür umzukehren, gab sie sich einen Ruck und folgte der Dienstmagd durch den Torbogen – wenngleich ihr Bauchgefühl etwas anderes sagte.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.