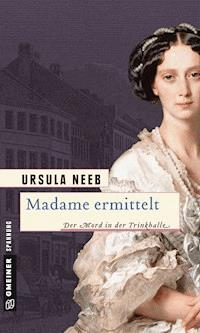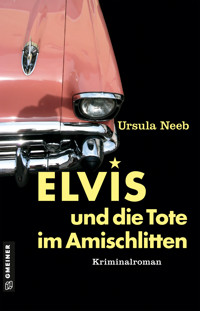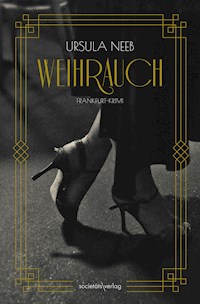8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mutige junge Frau in einer Welt voller Verrat und Aberglaube Grafschaft Hanau-Münzenberg, 1524: Das Glück der Hirtin Gertrud Dey, die sich in den fahrenden Händler Franz Schott verliebt hat, scheint perfekt. Zusammen mit Franz treibt sie die Schafe durch die Wetterau zu abgelegenen Höfen, wo sie die Gebrechen der armen Landbevölkerung heilt. Dem ortsansässigen Henker, ebenfalls heilkundig, ist Gertrud ein Dorn im Auge. Er streut das Gerücht, sie sei mit dem Teufel im Bunde. Als mehrere Kinder sterben, angeblich, weil Gertrud ihre Milch verhext hat, muss die Schäferin um ihr Leben bangen. Und auch ihre Liebe zu Franz wird auf eine harte Probe gestellt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Hirtin und der Hexenjäger
Die Autorin
Ursula Neeb hat Geschichte studiert. Aus der eigentlich geplanten Doktorarbeit entstand später ihr erster Roman »Die Siechenmagd«. Sie arbeitete beim Deutschen Filmmuseum und bei der FAZ. Heute lebt sie als Autorin mit ihren beiden Hunden in Seelenberg im Taunus.Von Ursula Neeb sind in unserem Hause bereits erschienen: Das Geheimnis der Totenmagd · Der Teufel vom Hunsrück · Die Feuerheilerin · Die Hurenkönigin · Die Hurenkönigin und der Venusorden · Die Rache der Hurenkönigin
Das Buch
Das Schicksal meinte es nicht immer gut mit ihr, trotzdem hat die Hirtin Gertrud Dey das Lachen nicht verlernt. Sie zieht frohen Mutes mit ihrer Schafherde über die sanften grünen Hügel der Wetterau und sammelt unterwegs Kräuter, mit denen sie die Gebrechen ihrer Mitmenschen heilt. Als sie einen schwer verletzten Hausierer bei sich aufnimmt, um seine Wunden zu versorgen, verliebt Gertrud sich in den jungen Mann. Doch nicht alle gönnen ihr das Glück: Der Henker Leonhard Beuth, ebenfalls heilkundig, beschuldigt sie der Hexerei, um die unliebsame Konkurrentin aus dem Weg zu räumen. Und er schreckt vor keinem Greuel zurück, um Gertrud in seine Gewalt zu bringen …
Ursula Neeb
Die Hirtin und der Hexenjäger
Historischer Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage März 2019© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © akg-images (Stadt, Gemälde von Anton Radl [1774–1852]); © Malgorzata Maj / arcangel images (Frau); © Stephen DeVries / getty images (Schaf)E-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1820-2
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
1. Teil
Die Injurie
1
2
3
4
5
6
7
2. Teil
Der Umschwung
8
9
10
11
12
13
13. April 1525 – Gründonnerstag
15. April 1525 – Karsamstag
16. April 1525 – Ostersonntag
Dienstag, 18. April 1525
Mittwoch, 19. April 1525
Epilog
Anhang
Schlussbemerkung der Autorin
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Im Gedenken an die Männer und Frauen, die im 16. und 17. Jahrhundert in der Grafschaft Hanau-Münzenberg Opfer der Hexenverfolgung wurden.
In Erinnerung an meine Großmutter Gertrud Neeb, geb. Sahl (1911 – 2005)
Meinem Lesefreund Raphael Miese mit herzlicher Widmung.
Motto
»Wer eine Grube macht, der wird hineinfallen;und wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen.«
Sprüche Salomos, Kapitel 26, Vers 27
Prolog
Wegwarte
Cichorium intybus – alte Heil- und Liebespflanze, die gegen Schwermut hilft; die getrockneten Blüten, in einem Säckchen unterm Kopfkissen aufbewahrt, bescheren angeblich Liebesglück. Seit dem 17. Jahrhundert wird aus den pulverisierten Wurzeln der Wegwarte ein Kaffeeersatz gewonnen.
Gertruds Herz überschlug sich vor Freude und Aufregung, als sie am Erntedankfest des Jahres 1514 hinter ihrem Lehrmeister, dem Schäfer Gernot Becker aus Wöllstadt, in die altehrwürdige Gildestube der Wetterauer Rinder-, Schaf- und Schweinehirten trat, wo sie ein Dutzend Viehhirten mit wettergegerbten Gesichtern bereits erwartete. Alle Augen richteten sich sogleich auf sie, und in ihren Blicken lag eine Skepsis, die beredter war als alle Worte: Eine Frau als Viehhirtin ist ein Unding!
Die Wangen der Siebzehnjährigen glühten vor Erregung, und ihre Knie waren weich wie Wachs. Doch die junge Frau wich den Blicken der Hirten nicht aus, ihr Lächeln war freundlich, ohne keck oder anmaßend zu sein, sie neigte vor den Gildebrüdern respektvoll das Haupt und sprach den uralten Hirtengruß: »Niemandem treu oder hold!«
»Niemandem treu oder hold!«, erwiderten die rauen Gesellen im Chor, und ihre düsteren Mienen hellten sich ein wenig auf. Ihre Gesichter verrieten, dass sie von der natürlichen Anmut der Aspirantin durchaus angetan waren. Das ungebändigte kastanienbraune Haar fiel ihr offen über die Schultern. Gertruds Augen hatten die Farbe der grünen Wiesen, ihre sonnengebräunte Haut war gesprenkelt von Sommersprossen, sie war von hohem Wuchs und hatte Hände, die zupacken konnten.
Der alte Gildemeister stellte sie den Hirten als Gertrud Möbs aus dem benachbarten Ilbenstadt vor.
»Gertrud ist die älteste Tochter von Konrad Möbs und seiner Frau Klara, armen Kleinbauern ohne Grundbesitz, die sich zusammen mit ihren acht Kindern von früh bis spät abrackern müssen, um nicht zu verhungern. Deswegen ist Gertrud von klein auf harte Stall- und Feldarbeit gewohnt gewesen.« Gernot Becker wies auf die muskulösen Oberarme der jungen Frau. »Die sind von der schweren Landarbeit gestählt, und Gertrud kann schaffen wie ein Mannsbild. Sie zeigte sich den ganzen Sommer über, in dem sie mich begleitet hat, als tüchtige Gehilfin bei der Schafschur, beim Schlachten und beim Eintreiben der Tiere.« Der Gildemeister musterte die wilden Gesellen, die ihm missmutig zuhörten, herausfordernd. »Außerdem ist Gertrud wehrhaft und tapfer. Sie kennt keine Furcht vor der Dunkelheit und hat ein Naturell, das die Einsamkeit des Hirtenberufs gut ertragen kann. Daher verbürge ich mich für die Jungfer und möchte sie euch anempfehlen, auf dass sie in unseren Kreis der Wetterauer Vieh- und Schafhirten Aufnahme finden möge.« Ein verhaltenes Grummeln war seitens der Hirten zu vernehmen.
»In den Hirtenbruderschaften im ganzen Land wird man sich darüber lustig machen, dass wir eine Frau in der Innung haben«, mokierte sich ein baumlanger Rinderhirt aus Heldenbergen und erntete dafür von seinen Gildebrüdern rege Zustimmung.
»Frauen sind für die Hausarbeit und zum Kinderkriegen da und nicht für den harten und gefährlichen Hirtenberuf!«, raunzte ein Schäfer aus Muschenheim mit einem langen roten Vollbart aufgebracht.
»Erst recht, wenn sie so hübsch und proper sind«, johlte ein anderer Gildebruder anzüglich. »Manch ein Kerl könnte nämlich auf dumme Gedanken kommen, wenn so ein ansehnliches Weibsbild nachts allein auf der Weide kampiert.« Von allen Seiten erklang grölendes Gelächter. Die Wangen der jungen Frau wurden noch eine Spur röter. Doch wie sich rasch herausstellte, handelte es sich dabei keineswegs um Schamesröte.
»Das soll sich mal einer wagen!«, stieß Gertrud hervor, als sich der Lärm etwas gelegt hatte, und ihre grünen Augen sprühten Funken. »Dem ramm ich mein Messer in den Wanst oder hetz meinen Hund auf ihn!« Ihre entschlossene Miene und der Tonfall ließen keinen Zweifel aufkommen, dass sie es ernst meinte.
Der Gildemeister tätschelte ihr anerkennend die Schulter. »Das Mädel hat mehr Mumm als die meisten Mannsbilder«, erklärte er grinsend. »Genau wie ihre Hündin Tiffi. Die ist zwar etwas kleiner als die meisten Hütehunde, aber sie hat die Schafe voll im Griff.«
Während die meisten Hirten noch mürrisch dreinblickten und nichts darauf entgegneten, meldete sich ein junger Schäfer aus Ober-Mörlen zu Wort und erklärte frei heraus, dass sich das doch alles ganz gut anhöre. Der dunkelhaarige Mann mit den markanten Gesichtszügen lächelte Gertrud aufmunternd zu und schlug vor, sie solle doch selbst erklären, was ihr der Schäferberuf bedeute. Die junge Frau errötete, bedachte den Schäfer mit einem befangenen Lächeln und blickte den Gildemeister fragend an.
»Warum nicht?«, erklärte dieser und erteilte Gertrud das Wort. Die Siebzehnjährige holte tief Luft, da sie es nicht gewohnt war, vor so vielen Leuten zu sprechen. Trotz Aufgeregtheit und zitternder Knie bemühte sie sich um Haltung, als sie näher an den Tisch mit den Gildebrüdern herantrat, die sie beäugten, als sei sie ein Schaf mit fünf Beinen. Bei denen hast du nicht den Hauch einer Chance, aber gib trotzdem dein Bestes, ermahnte sich Gertrud, die eisern für sich entschieden hatte, sich von nichts und niemandem den Schneid abkaufen zu lassen.
»Wenn man wie ich als Tochter unfreier Bauern aufwächst, die jahrein, jahraus vom herrschaftlichen Zinseintreiber gegängelt und geknechtet werden, und man sich für jeden Bissen Brot von früh bis spät bis zum Umfallen abplagen muss, dann ist es eine Wonne, weitab vom Gehöft mit der Schafherde über sanfte grüne Hügel zu ziehen, die sich in der Ferne mit dem Horizont vereinen«, erklärte sie frohgemut. »Wo man sich den wachsamen Augen des Gutsvorstehers entziehen kann und nicht mehr länger das ewige Greinen der Geschwister mit anhören muss, die nachts vor Hunger nicht schlafen können. Man wacht einsam unterm Sternenhimmel über die Herde, trutzt den Unbilden des Wetters und bestaunt die Schönheit der Natur. Ich liebe die Schäferei aus ganzem Herzen und sehe sie als meine Berufung an, obwohl ich weiß, dass unser Gewerbe den Menschen als verfemt gilt. Schäfer und Hirten sind in den Augen der ehrbaren Zünfte unehrliche Leute, die mit Dieben über einen Kamm geschoren werden. Uns wird angedichtet, den Schafen heimlich die Wolle auszuraufen, um sie unter der Hand zu verkaufen. Angeblich schlachten wir die fetten Tiere unserer Dienstherren und behaupten dann, die Wölfe hätten sie gerissen. Außerdem gelten wir als wunderlich, verschroben und verstünden uns auf Zauberei. Doch das ist mir alles egal, ich möchte Schäferin werden, das ist und bleibt mein Herzenswunsch«, endete Gertrud, von der längst jegliche Befangenheit gewichen war, mit Inbrunst.
Ob es ihrer dunklen, wohltönenden Stimme, der Lebendigkeit ihrer Schilderung oder der großen Überzeugungskraft geschuldet war, mit der die junge Frau ihr Anliegen vorgetragen hatte? Jedenfalls fingen die ersten Gildebrüder an zu applaudieren, wenn auch zunächst noch etwas verhalten, und es dauerte nicht lange, bis auch die letzten Zauderer mit einstimmten, sodass die Gildestube schließlich von brandendem Beifall erfüllt war. Gertrud traten vor Freude und Ergriffenheit Tränen in die Augen, und sie verneigte sich in tiefer Dankbarkeit vor der Hirtengilde. Auch der Gildemeister war bewegt von Gertruds Ansprache, und es schien ihn zu verblüffen, wie es ihr gelungen war, die abweisenden Viehhirten für sich einzunehmen. Er trat vor die Runde und richtete das Wort an sie. »Zu allen Zeiten waren Hirten stolze, freie Menschen, die zwar im Dienste von Grundherren standen, aber ihre Eigenständigkeit stets bewahrten.« Er wandte sich zu Gertrud um, die bescheiden hinter ihn getreten war, und zog sie an seine Seite. »Daher bin ich der Überzeugung, du gereichst dem Hirtenstand zur Zierde, Gertrud Möbs – und aus dir wird eine gute Schäferin werden!«
Für Gertrud gab es nicht den geringsten Zweifel, dass sie sich bereits bei ihrer ersten Begegnung am Erntedankfest in der Gildestube der Hirteninnung Hals über Kopf in Fabian Dey verliebt hatte, den jungen Schäfer, der sich so beherzt für sie eingesetzt hatte. Er war groß, von schlanker, sehniger Statur und sah mit seinen schulterlangen dunklen Haaren und dem markanten, sonnengebräunten Gesicht wie ein Freibeuter aus. Außerdem war er mutig und eigenwillig und sagte immer geradeheraus, was er dachte – selbst, wenn er mit seiner Meinung alleine dastand. Damit schaffte sich Fabian nicht immer Freunde, doch man zollte ihm Respekt, denn trotz seiner mitunter etwas schroffen Art war Fabian ein verlässlicher Kamerad mit einem Herz aus Gold.
So hatte der Zwanzigjährige keinen Hehl daraus gemacht, dass es auch für ihn Liebe auf den ersten Blick gewesen war, als er Gertrud beim Gildetreffen begegnet war, und schon vierzehn Tage später hatte er bei ihren Eltern um ihre Hand angehalten.
Als das Paar am heiligen Dreikönigstag des Jahres 1515 in der Basilika zu Ilbenstadt getraut wurde, war Gertrud bereits im zweiten Monat schwanger, da die jungen Leute viel zu vernarrt ineinander gewesen waren, um sich dem anderen bis zur Hochzeit zu versagen. Zwar waren die Brauteltern und auch die in ähnlich bescheidenen Verhältnissen lebenden Eltern des Bräutigams nicht in der Lage, eine glanzvolle Hochzeitsfeier auszurichten, bei der ausschweifend geschlemmt und gezecht wurde. Doch die Hochzeitsfeier blieb allen Gästen trotz ihrer Bescheidenheit als rauschendes Fest in Erinnerung, was vor allem an den jungen Brautleuten lag, deren Glückseligkeit auf die Anwesenden abfärbte. Es wurde getanzt und gelacht bis in die frühen Morgenstunden, und alle waren frohgemut und ausgelassen. Auch die Innungsbrüder der Hirtengilde blieben bis zum Morgengrauen und waren allesamt davon überzeugt, niemals ein liebenswerteres und glücklicheres Paar gesehen zu haben als Gertrud und Fabian.
Die Liebenden wurden fortan von dem Gefühl überwältigt, das Füllhorn des Lebens entlade sich über ihnen in all seiner Üppigkeit, und wann immer sie einander liebten und glaubten, glücklicher könnten sie gar nicht mehr sein, waren sie schon beim nächsten Kuss, bei der nächsten Umarmung noch trunkener vor Wonne und wähnten sich im Paradies, da ihr Glück weder Grenzen noch ein Ende zu kennen schien.
In den frühen Morgenstunden des 25. Mai 1515 – der Sommer stand vor der Tür und kündigte sich gerade in den letzten Tagen durch große Hitze an, wie man sie eigentlich erst in den sogenannten Hundstagen im Hochsommer erlebte – verabschiedeten sich Gertrud und Fabian mit innigen Küssen voneinander. Dem jungen Paar fiel es schwer, voneinander Abschied zu nehmen, obgleich sie sich schon am Abend wiedersehen würden. Seitdem die beiden im Frühjahr ihre Hirtentätigkeit aufgenommen hatten, trennten sie sich tagsüber, um mit ihrer Schafherde über die jeweilige Gemarkung ihrer Dienstherren zu ziehen. Am Abend trafen sie sich an jener Stelle, wo die Ländereien aneinandergrenzten. Inmitten der sanften grünen Hügel der Wetterau, zwischen den Dörfern Ober-Mörlen und Nieder-Weisel, von wo aus man in der Ferne die imposante Burg Münzenberg sehen konnte, hatte das verliebte junge Paar einen Lieblingsplatz gefunden, wo sie ihr Nachtlager zu halten pflegten. Es handelte sich um einen alten verzauberten Ort, an dem sich ein großer Findling befand, der von drei mächtigen Linden umgeben war. Die frühen Völker, so hieß es, hätten dort in fernen, längst vergangenen Zeiten dem Donnergott gehuldigt, und der Fels sowie der Lindenhain verströmten noch die alte heidnische Magie. Gertrud und Fabian fühlten sich glücklich an dem Ort, und er war ihnen zu einer Art Heim geworden, an dem sie sich sicher und geborgen fühlten, gleich einer Stube unterm Sternenhimmel. Während ihre beiden Hütehunde über die Schafe wachten, waren die Nächte für die Liebenden kurz, weil das Feuer des Begehrens sie nicht zur Ruhe kommen ließ. Gertrud war bereits im fünften Monat schwanger, und das Kind in ihrem Leib bewegte sich immer häufiger. Die jungen Eltern freuten sich unsagbar auf das Kind und streichelten und liebkosten es durch den Mutterleib, wenn es am Strampeln war.
»Oh, lass es doch bald Abend sein«, flüsterte Gertrud Fabian zu, ehe sich ihre Lippen zu einem letzten Kuss vereinten.
Fabian ergriff seinen Hirtenstab, zog sich den wollenen Umhang über die Schultern, da es am frühen Morgen noch recht frisch war, und trieb gemeinsam mit seinem Wolfshund die Herde an. Solange Gertrud ihn sehen konnte, blickte sie ihm nach. Von Zeit zu Zeit blieb Fabian stehen, drehte sich zu ihr um und winkte ihr zu. Erst als er hinter einem Hügel verschwunden war, begann Gertrud ihr Tagwerk, kleidete sich an, kämmte sich das lange kastanienbraune Haar, benetzte sich die Handflächen mit Morgentau und wischte sich den letzten Rest Müdigkeit aus dem Gesicht. Die Strahlen der aufgehenden Morgensonne wärmten ihren vorgewölbten Bauch, die junge Frau breitete liebevoll die Hände um das Wesen in seinem Innern und erbat wie stets zum Tagesanbruch den Schutz der Gottesmutter für ihr ungeborenes Kind, für Fabian, ihre Eltern und Geschwister und sich selbst und dankte der Heiligen Jungfrau für das Glück, mit dem der Himmel sie so überreich beschenkt hatte. Dann ergriff sie ihren Hirtenstab und zog mit der Schafherde über die Wiesen in Richtung Münzenberg. Sie würde Münzenberg in weitem Bogen umrunden und dann über die gleiche Route wieder zu ihrem Nachtlager zurückkehren, was etwa einem Tagesmarsch von acht Stunden entsprach, sodass sie um die siebte Abendstunde wieder zurück sein würde.
Schon am Vormittag war es drückend schwül, und Gertrud musste sich häufiger als sonst hinsetzen, um sich auszuruhen. Der Schweiß stand ihr auf der Stirn, der Rücken tat weh, und zum ersten Mal seit ihrer Schwangerschaft fühlte sie sich entkräftet und mitgenommen. Dabei hatte sie so vollmundig verkündet, ihre Hirtentätigkeit bereite ihr überhaupt keine Mühe, und sie könne hüten bis kurz vor der Niederkunft. Doch heute, an diesem heißen Frühsommertag, sehnte sie sich im Stillen nach Ruhe, nach einem weichen Strohsack, auf dem sie ihre müden Beine ausstrecken und ein kurzes Schläfchen halten konnte.
Um die Mittagszeit beschloss sie, unweit der Ortschaft Rockenberg am Ufer des Flusses Wetter unter der Schatten spendenden Krone einer Weide eine kleine Rast einzulegen. Sie schob sich den braunen Leinenrock bis über die Knie und hängte ihre Beine in das klare plätschernde Wasser. Dann beugte sie sich vor, schöpfte Wasser in ihre gewölbten Handflächen, trank in durstigen Zügen und wusch sich das erhitzte Gesicht und den Nacken. Was für eine Wohltat! Auch ihre Hündin Tiffi stillte ihren Durst und leistete ihrer Herrin Gesellschaft. Gertrud holte ein Stück Schafskäse aus ihrem Rucksack, warf Tiffi einen Bissen hin, ließ sich am Ufer nieder und verzehrte den selbst gemachten Käse mit einem Stück Roggenbrot. Das Kind in ihrem Bauch strampelte, sie legte ihre Hände an den Leib, hielt mit dem Kleinen Zwiesprache und konnte es kaum noch erwarten, das geliebte Wesen endlich in den Armen zu halten. Nur noch vier Monate, dann erblickst du das Licht der Welt, mein Glückskind! Solcherart hing die Schäferin ihren Gedanken nach, freute sich auf die Geburt ihres ersten Kindes und dachte an den gemeinsamen Abend mit Fabian. Sie würden aneinandergeschmiegt auf dem Schaffell am kleinen Lagerfeuer sitzen, warmen Hirsebrei mit Wiesenkräutern essen, frisch gemolkene Schafmilch dazu trinken, sich küssen und herzen, einander von ihrem Tag berichten und das Fest der Liebe feiern. Gertrud, die bislang nichts anderes gekannt hatte als das harte Leben einer Bauerntochter, das nur aus Fronarbeit bestand und voller Entbehrungen war, konnte ihr Glück noch immer kaum fassen. Sie war dem Schicksal unendlich dankbar und wähnte sich als die glücklichste Frau auf Erden. Sie dachte an die Statur der kostbaren alten Löwenmadonna in der Ilbenstädter Basilika, der sie vor ihrer Hochzeit eine Kerze gestiftet und in der sie für eine glückliche Ehe gebetet hatte. Ich werde dir bis zu meinem letzten Atemzug dankbar sein, heilige Muttergottes, dass ich so etwas Wunderbares erleben darf, sinnierte die Schäferin, als sie mit einem Mal aus der Ferne verhaltenes Donnergrollen vernahm. Sie richtete sich auf und trat vom schattigen Flussufer auf die Wiese, um den Himmel in Augenschein zu nehmen, denn sie, die der Natur ganz und gar ausgesetzt war, musste ein nahendes Unwetter unbedingt rechtzeitig erkennen. Schwül und stickig war es ja den ganzen Tag schon gewesen. Am Rande des südwestlichen Horizonts waren dicke schwarze Unwetterwolken zu sehen – direkt über den Ortschaften Nieder-Mörlen, Nauheim und Schwalheim, die Region, in der Fabian mit seiner Schafherde unterwegs war. Dem fernen Donnergrollen und den zuckenden Blitzen nach zu urteilen, die am südwestlichen Himmel auszumachen waren, entlud sich der Regen gerade über dieser Gegend. Hoffentlich hat Fabian einen guten Unterschlupf gefunden, dachte Gertrud besorgt. Aus Erfahrung wusste sie, dass das auf dem freien Feld nicht immer einfach war, denn außer Bäumen, die jedoch bei Gewitter unbedingt zu meiden waren, gab es nur selten einen Unterstand. Schlimmstenfalls mussten sich Viehhirten bei Gewitter flach auf den Boden legen, möglichst in eine Mulde oder Kuhle, damit sie dem Blitz nicht ausgesetzt waren, die Augen schließen, ein Stoßgebet sprechen und warten, bis das Unwetter vorübergezogen war. Das hatte sie selbst im vergangenen Sommer schon mehrfach erlebt. Gertruds Herz zog sich vor Mitgefühl zusammen, als sie daran dachte, wie klamm ihr Liebster sein würde, wenn er am Abend zu ihr zurückkehrte. Oder er hat Glück, und die Sonne scheint wieder und trocknet ihn, dachte sie hoffnungsvoll und wünschte sich inständig, das Unwetter möge Fabian verschonen.
Um die Nachmittagszeit war der Himmel wieder wolkenfrei, das Unwetter hatte sich entladen, und die Sonne brannte erbarmungslos. Unter der Krone eines Apfelbaums, unweit des kleinen Dorfes Oppershofen, suchte Gertrud Schutz vor den sengenden Sonnenstrahlen. Sie setzte sich ins Gras, lehnte sich an den Stamm und flocht weiter an einem Blumenkranz aus leuchtend blauen Wegwarteblüten, die sie unterwegs in einem Korb gesammelt hatte. Von klein auf hatte sich Gertrud für Pflanzen und Kräuter interessiert und sie mit ihren Geschwistern gesammelt, da ihre Mutter die kargen Mahlzeiten häufig mit ihnen ergänzte oder Tinkturen und Umschläge für Krankheiten und Verletzungen aus ihnen zubereitete. So hatte es sich Gertrud auch beim Schafhüten zur Gewohnheit gemacht, heilsame Kräuter zu sammeln, die sie trocknete und in Leinensäcken aufbewahrte. Außerdem vertrieb sie sich gerne die Zeit damit, aus den duftenden Kräutern und Blumen der Weiden Blütenkränze zu flechten, die sie als Kopfschmuck trug. Während Gertrud noch ganz vertieft in ihre Beschäftigung war, wurde sie plötzlich von lautem, ausgelassenem Lachen aufgeschreckt und gewahrte in der Nähe eine Horde Kinder, die Fangen spielte. Als die Kinder die Schäferin bemerkten, flüsterten und kicherten sie verstohlen. Gertrud lächelte ihnen zu, doch sie wichen verschämt ihrem Blick aus.
»Und wenn die Schäfer geschlemmt haben, da treten’s hinter die Hecke. Da reißen’s den Schafen die Wolle aus und stecken’s in ihre Säcke; dann gehen sie gebeugt und lahm, damit es keiner sehen kann!«, krähte ein hoch aufgeschossener Junge mit frechem Grinsen, begleitet von dem grölenden Gelächter der anderen Kinder.
Gertrud lächelte gutmütig. »Ich kenne noch was anderes, was man über uns Schäfer sagt«, erklärte sie verschmitzt.
»Sag es!«, riefen die Kinder übermütig und eilten zu der Schäferin hin.
»Ein Rettich und ein Rüb, ein Müller und ein Dieb, ein Schäfer und ein Schinder – welches ist mehr oder minder?«, skandierte die Schäferin mit rollenden Augen, worauf die Kinder vor Vergnügen glucksten.
»Mein Papa ist Leineweber, kennst du da auch einen Vers?«, fragte ein kleines Mädchen treuherzig. Der Schäferin kam zwar sogleich ein entsprechender Spottvers in den Sinn, der im Volksmund über die Berufsgruppen grassierte, doch sie mochte das Mädchen nicht kränken und schwieg.
»Der Leineweber schlachtet alle Jahr zwei Schwein, das eine ist gestohlen, und das andere ist nicht sein!«, polterte an Gertruds Stelle der schlaksige Lausbub und machte dem kleinen Mädchen eine lange Nase.
»Das stimmt ja gar nicht«, begehrte die Kleine auf, »mein Papa ist kein Dieb!«
»Das ist doch nur ein Scherz«, versuchte sie Gertrud zu trösten, doch der Frechdachs setzte noch einen drauf.
»Die Leineweber kriegen alle Jahr ein Kind, das wird allemal am Vollmond blind«, lästerte er weiter.
»Was ist denn dein Vater von Beruf?«, fragte ihn Gertrud unvermittelt.
»Das geht dich gar nix an«, erwiderte er keck.
»Der hilft dem Müller in der Mühle und schleppt die Säcke«, sagte eines der anderen Kinder.
»Ach, so ist das!«, entgegnete Gertrud mit gespielter Entrüstung. »Die Müller ham die dicksten Schwein‹, sie mästen’s aus der Bauern Säcke …« Alle Kinder, mit Ausnahme des Wortführers, kriegten sich daraufhin vor Lachen kaum ein. So hatte Gertrud einstweilen das Lästermaul zum Schweigen gebracht. Der Schelm zog ein langes Gesicht und grollte.
»Komm, sei doch nicht beleidigt«, wandte sich Gertrud an den Jungen und knuffte ihn versöhnlich. »Wer austeilt, muss auch einstecken können.« Er musterte sie abschätzig und fragte: »Kriegst du ein Kind?«
Gertrud nickte erfreut, worauf die Kinder sie mit allerlei Fragen bestürmten: Wer der Vater sei, ob sie denn verheiratet wäre, wie viele Kinder sie schon habe, wo ihr Mann sei und aus welchem Ort sie komme. Die Schäferin stand geduldig Rede und Antwort und erkundigte sich ihrerseits nach Namen und Alter der Kinder. So war es Gertrud schon nach kurzer Zeit durch ihre offene Art gelungen, das Zutrauen der Kinder zu erlangen. Sie ließen sich neben der Schäferin nieder, betrachteten sie mit großen Augen und fühlten sich in ihrer Gesellschaft offenbar sehr wohl. Auch der Frechdachs war zahm geworden und sah Gertrud andächtig dabei zu, wie sie an dem Blumenkranz flocht. »Das sind Wegwarten«, stellte er fest und fragte Gertrud, ob er noch mehr für sie pflücken solle.
»Wenn du willst«, sagte die Schäferin freundlich, »dann können wir von denen, die übrig bleiben, noch Kränze für euch alle flechten.«
»Ich will aber keinen Blumenkranz, ich bin doch kein Mädchen!«, protestierte er aufmüpfig. Gertrud strich ihm fröhlich über den stoppeligen Kopf. »Das weiß ich doch, aber vielleicht willst du ja trotzdem beim Flechten helfen und deinen Kranz einem Mädchen schenken, das du gernhast.«
Er errötete, während ihn die anderen Kinder mit der Erwähnung verschiedener Mädchennamen aufzogen. Nach einer Weile des Herumalberns stoben die Kinder davon, um Blumen für die Kränze zu pflücken. Eines nach dem anderen kehrte mit einem bunten, duftenden Strauß zurück, die sie vor der Schäferin platzierten. Dann kauerten sie sich an Gertruds Seite, flochten Blumenkränze und unterhielten sich mit ihr. Die Schäferin, die mit einer Vielzahl jüngerer Geschwister aufgewachsen war, genoss die Gegenwart der Kinder.
»Sehr schön«, lobte Gertrud und fragte die Kinder, ob sie wüssten, woher die Wegwarte ihren Namen habe. Als keines darauf etwas zu entgegnen wusste, erzählte sie ihnen mit wohltönender Stimme eine Geschichte: »Es war einmal eine wunderhübsche Prinzessin, deren Bräutigam, ein edler Ritter, zu einem Kreuzzug nach Jerusalem aufbrach. Die Prinzessin war darüber so traurig, dass sie am liebsten gestorben wäre. Doch sie gab die Hoffnung nicht auf, dass ihr Geliebter eines Tages zu ihr zurückkehren würde. Mit all ihren Kammerzofen hielt die Prinzessin jeden Tag erneut am Wegesrande nach ihm Ausschau. Und so erbarmte sich der liebe Gott im Himmel dieser sehnsüchtigen Schar und verwandelte sie alle in Blumen. Die Prinzessin wurde eine weiße, die Zofen blaue Wegwarten. Und da stehen sie auch heute noch und schauen schon am frühen Morgen gen Osten. Sie drehen ihre Blütenköpfe immer mit dem Lauf der Sonne. Sobald die Sonne untergegangen ist, lassen sie ihre Köpfe enttäuscht bis zum nächsten Morgen hängen und recken sich dann wieder der Sonne entgegen. Deswegen nennt man die Wegwarte im Volksmund auch ›Sonnenbraut‹.« Die Kinder, die der Schäferin gebannt zugehört hatten, applaudierten begeistert. Gertrud liebte es, Geschichten zu erzählen. Schon als Kind hatte sie ihren Geschwistern an langen Winterabenden mit Märchen die Zeit vertrieben. Einige Kinder betrachteten die blauen Blüten versonnen und rochen an ihnen.
»Riechen tun sie nach nix«, erklärte der schlaksige Frechdachs, den die anderen Kinder »Dürr-Rapp« nannten, und fragte Gertrud, ob man sie essen könne.
»Probier doch mal«, entgegnete die Schäferin und führte demonstrativ eine Blüte zum Mund. Der Junge und die anderen Kinder, die es ihr gleichtaten, verzogen angewidert die Gesichter und spien auf den Boden. »Die schmecken ja gallebitter«, murrte das Schlitzohr, »hoffentlich sind sie nicht giftig …«
»Keine Sorge«, beruhigte ihn Gertrud, »sonst hätte ich sie euch weder in die Hand noch in den Mund nehmen lassen und würde sie auch nicht zu Blumenkränzen winden, denn Finger weg von Giftpflanzen! Aber die Wegwarte ist eine alte Heilpflanze. Sie hat eine stärkende Wirkung auf Leber und Galle. Man verwendet sie auch zusammen mit Klette und Erdrauch bei Hautkrankheiten und Ekzemen. Außerdem hilft ein Sud von getrockneten Wegwarte- und Schafgarbenblüten gegen Melancholie und Liebeskummer.«
Im Nu war die Zeit vergangen, und ein Blick auf den Stand der Sonne verriet der Schäferin, dass es bereits später Nachmittag war. Als sie den Kindern erklärte, sie müsse nun in Richtung Ober-Mörlen aufbrechen, wo sie sich am Abend mit ihrem Mann treffe, schlugen die Kinder vor, Gertrud und ihre Herde ein kleines Stück zu begleiten. Die Schäferin und die Mädchen trugen Blumenkränze auf den Haaren, alle waren guter Dinge, hielten einander an den Händen, hüpften frohgemut ihres Weges und sangen alte Volksweisen.
Als Gertrud am Abend an den Findling mit den drei Linden zurückkehrte, berührte die Sonne bereits den Horizont. Demnach musste es auf die achte Abendstunde zugehen, sie hatte sich also ziemlich verspätet. Dennoch war zu ihrem Erstaunen von Fabian und seiner Herde weit und breit nichts zu sehen. Bei der Hirtentätigkeit konnte es immer mal vorkommen, dass man sich in der Zeit verschätzte. Meistens trafen Gertrud und Fabian jedoch gleichzeitig ein, oder der eine eilte dem anderen ein Stück weit entgegen, wenn das Blöken der Schafe aus der Nähe zu vernehmen war. Gertrud hielt den Atem an und lauschte, ob aus der Richtung, aus der sie Fabian erwartete, schon etwas zu hören war, doch von den grünen Hügeln drang kein Laut zu ihr herüber. Sonderbar, dachte die Schäferin und hatte mit einem Mal ein mulmiges Gefühl in der Magengrube – umso stärker, wenn sie an das schlimme Unwetter dachte, das sich um die Mittagszeit über der Mörlener Gegend entladen hatte. Gertrud ignorierte ihren knurrenden Magen, die ausgedörrte Kehle und ihre müden, schweren Beine, gab der Hündin Tiffi den Befehl, die Stellung zu halten und die Herde zu bewachen, und hastete über die Felder in Richtung Nieder-Mörlen davon. Brennend vor Sehnsucht und mit wachsender Bangigkeit, die ihr Herz immer schwerer werden ließ, eilte sie über die Wiesen bis zum nächsten Hügel, doch auch von dort aus war Fabian nirgendwo auszumachen. Es wurde bereits dunkel, als sich die Schäferin erschöpft auf das Gras sinken ließ, sich ihrer Niedergeschlagenheit ergab und weinte. Inzwischen war sie sicher, dass irgendetwas passiert sein musste – hoffentlich nichts Schlimmes, flehte sie inständig, doch ihr Bauchgefühl sagte das Gegenteil. Was soll ich nur machen? Ich kann ohne dich nicht sein und muss unbedingt herausfinden, was dir widerfahren ist, überschlugen sich Gertruds Gedanken. Das Kind in ihrem Bauch strampelte so heftig, dass sie vor Schmerzen aufstöhnte. Besänftigend breitete sie die Hände um ihren Leib. Der feuchte Wiesentau, der ihre Füße und Beine benetzte, ließ sie frösteln, und die Schäferin beschloss, wenn auch schweren Herzens, den Rückmarsch anzutreten. Am Abend hatte es sich abgekühlt, und über die Wiesen fegte ein rauer, kalter Wind. Obgleich die Schäferin durch ihre Arbeit in der freien Natur entsprechend abgehärtet war, schlotterte sie plötzlich vor Kälte. Ein scharfer stechender Schmerz durchfuhr ihren Unterleib, sodass es ihr schwindlig wurde und sie sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Mach langsam, ermahnte sie sich selbst, damit ihr Kind keinen Schaden nahm. Die Vernunft gebot ihr, zu ihrem Lagerplatz zurückzukehren, sich in ein Schaffell zu wickeln, einen Happen zu essen, etwas zu trinken und sich des Kindes Willens zu schonen und auszuruhen.
Nachdem sich Gertrud im Schutze der Bäume und des Felsens ein wenig aufgewärmt und gestärkt hatte, entzündete sie an der mit Feldsteinen begrenzten Stelle ein kleines Feuer, vor dem sie sich in ein Schaffell gehüllt niederließ und in die nächtliche Stille lauschte. Immer wieder murmelte sie mit wild pochendem Herzen Stoßgebete für ihren geliebten Mann und flehte zu Gott, dass sie bald wieder vereint sein würden. Doch weder die himmlischen noch die irdischen Mächte ließen sich erweichen. Erschöpft schlief sie irgendwann an der Feuerstelle ein, doch ein Geräusch riss sie jäh aus ihren finsteren Träumen. Benommen richtete sie sich auf dem Schaffell auf. Fabian!, hallte es durch ihre Sinne, und Gertrud war sogleich hellwach. Der Morgen begann schon zu grauen, und Stimmengemurmel hallte über die Weide, das immer näher kam. Ist Fabian vielleicht in Begleitung, sinnierte die Schäferin und rief laut seinen Namen.
»Gertrud«, erklang vernehmlich eine Männerstimme – doch es war nicht die Stimme von Fabian. »Wo bist du denn?«
»Hier bei den Bäumen, ich komme zu euch«, rief Gertrud, erhob sich hektisch und stürzte zu den Männern hin. Im Schein der Fackeln, die die drei Gestalten mit den langen Umhängen in den Händen trugen, erkannte Gertrud den Gildemeister der Hirteninnung und zwei andere Schäfer. Bei dem jüngeren handelte es sich um Fritz Krusche, den Trauzeugen und besten Freund von Fabian. Als die Schäferin den gramvollen Gesichtsausdruck des Freundes bemerkte und mit entsetztem Blick feststellte, dass die Mienen der beiden anderen genauso düster waren, entrang sich ihr ein banger Aufschrei. »Was ist passiert?«, fragte sie mit brüchiger Stimme, während ihr vor Aufregung die Zähne klapperten. Fritz gab ein unterdrücktes Schluchzen von sich und schloss Gertrud in die Arme. Sie spürte, dass er am ganzen Körper zitterte. Gertrud packte ihn an den Schultern und schüttelte ihn. »Was ist mit Fabian?«, schrie sie außer sich. Doch der baumlange Bursche mit dem wettergegerbten Gesicht war außerstande, Gertrud zu antworten. Seine Gesichtszüge bebten, und er fing haltlos an zu weinen. Die Erkenntnis, dass sich ein schreckliches Unglück ereignet hatte, erschütterte die Schäferin bis ins Mark. Als gleich darauf der Gildemeister zu Gertrud trat, schützend den Arm um sie legte und ihr mit tränenerstickter Stimme zu erklären versuchte, dass Fabian gestern Mittag auf den Schafwiesen von Dorheim vom Blitz getroffen worden sei, starrte ihn die Schäferin nur aus großen, schreckensgeweiteten Augen an und war wie vom Donner gerührt. »Ich … ich warte auf dich … für immer und ewig …«, flüsterte sie, während jegliche Farbe aus ihrem Gesicht wich. Sie sank auf dem Boden in sich zusammen wie eine leere, leblose Hülle und gab einen verzweifelten Aufschrei von sich, der den Hirten schier das Herz brach.
1. Teil Die Injurie
In|ju|rie,die; Unrecht, Beleidigung, üble Nachrede
1
Spitzwegerich
Plantágo lanceoláta – alte Heilpflanze, enthält Gerbstoffe und Kieselsäure. Aufgrund seiner blutstillenden und antiseptischen Eigenschaften wird der Presssaft in der Wundheilung eingesetzt; eine Paste aus den zerkleinerten Blättern dient als Wundauflage.
Ein eisiger Wind fegte über die schneebedeckten Felder der Wetterau, sodass der Hausierer Franz Schott, der am Donnerstagmorgen des 23. März 1525 mit seinem hundert Pfund schweren Tornister auf der Landstraße nach Muschenheim unterwegs war, vor Kälte kaum noch seine Hände spürte. Es war bald Ostern, doch vom Frühling gab es noch immer kein Zeichen. Wenn er das Geld – obwohl es meistens nur ein paar Groschen waren – nicht so bitter nötig gehabt hätte, um etwas zwischen die Zähne zu kriegen, wäre er noch in seinem Winterquartier in Dortelweil geblieben. Da man bei dieser Witterung noch nicht im Freien kampieren konnte, ohne zu erfrieren, musste er von seinem sauer verdienten Lohn auch noch etwas für eine Unterkunft abzweigen. Aber er hatte in der letzten Saison so schlecht verkauft, dass er nicht mehr länger pausieren konnte. Das kann nur besser werden, sagte er sich mit unerschütterlichem Optimismus, denn getreu seiner Devise, die er sich trotz aller Niederlagen zum Lebensmotto gemacht hatte: Aufgeben gilt nicht! Außerdem war ihm in der engen, unbeheizten Dachkammer, die er über Winter im Hause von Schwester und Schwager bewohnte, allmählich die Decke auf den Kopf gefallen, und er mochte auch seiner Schwester, die als Frau eines Zimmermanns nicht gerade auf Rosen gebettet war und zudem noch fünf Kinder zu ernähren hatte, nicht länger zur Last fallen – zumal sie ihm sehr am Herzen lag, war sie doch die einzige Familienangehörige, die ihm noch geblieben war. Denn der fünfundzwanzigjährige Franz hatte in seinem Leben schon genug Pech gehabt. Vor fünf Jahren hatte er seine Jugendliebe Maria, die Tochter eines Kleinbauern aus Karben, geheiratet und mit ihr gemeinsam den Bauernhof ihrer verstorbenen Eltern bewirtschaftet. Im Zuge der sich in ganz Hessen häufenden Missernten und Viehseuchen stand der Hof am Rande des Ruins, und die jungen Eheleute und ihre inzwischen drei kleinen Kinder wären fast den Hungertod gestorben wie so viele andere Kleinbauern auch. Aus bitterer Not hatte Franz damals beschlossen, das wenige ihnen noch gebliebene Vieh zu verkaufen und gemeinsam als Hausierer über die Lande zu ziehen. Doch das unbehauste Leben von Landgängern, die mit ihren schweren Warenkörben auf den Rücken über das platte Land zogen, um den Dorfbewohnern Güter des täglichen Lebensbedarfs zu verkaufen, war für die zarte Maria und die drei kleinen Kinder einfach zu hart gewesen. Vor einem Jahr hatte ihn Maria verlassen und war mit den Kindern zu einem verwitweten Bäckermeister nach Karben gezogen, der ihr schon vor ihrer Ehe Avancen gemacht hatte. Unterstützt von ihrem neuen Gefährten, war es Maria gelungen, den Dorfpriester davon zu überzeugen, ihre Ehe zu annullieren, da Franz den Hof ihrer Eltern durch Misswirtschaft in den Ruin getrieben und sie und die Kinder ihrer Existenzgrundlage beraubt habe. Maria, die wenig später den wohlhabenden Bäckermeister geheiratet hatte, war inzwischen wieder guter Hoffnung, wie Franz zu Ohren gekommen war. Franz, der an dem Verlust des Hofes unschuldig war, fühlte sich von Maria arglistig betrogen und war grenzenlos enttäuscht von der Frau, die er aufrichtig geliebt hatte. Schmerzlicher als alles war für ihn jedoch die Trennung von seinen Kindern, und er haderte mit sich, dass sie an seiner Seite Hunger leiden mussten und er nicht in der Lage gewesen war, angemessen für sie zu sorgen. Franz war ein großer, dunkelhaariger Mann mit markanten Gesichtszügen und samtigen braunen Augen. Er wusste, dass er bei Frauen gut ankam. Seitdem er alleine über die Lande zog, hatte es zahlreiche Frauen gegeben, die ihm schöne Augen gemacht hatten. Mit der ein oder anderen von ihnen hatte er sich auf ein flüchtiges Abenteuer eingelassen, aber er war stets davor zurückgeschreckt, sich enger zu binden. Allen Schicksalsschlägen zum Trotz musste es irgendetwas in seinem Inneren geben, das ihn davor bewahrte, sich an den nächsten Baum zu knüpfen, und ihn stattdessen durchhalten ließ – wenn auch eher kläglich. So hatte Franz auch an diesem Morgen, als er auf der harten Pritsche der Fremdenherberge im benachbarten Lich aufwachte, die zerschlissene, verlauste Kolter hochgeschlagen, die ekelerregend nach Moder und den Ausdünstungen zahlloser Vorgänger stank, sich schlotternd vor Kälte in der zugigen Kammer angekleidet, seinen Tornister gepackt und sich auf den Weg gemacht. Mit knurrendem Magen – für die heiße Milchsuppe fehlte ihm das Geld – und ohne sich das Gesicht und die Hände zu waschen, denn das Wasser in dem Holzbottich unter der verrosteten Pumpe neben der Eingangstür war gefroren.
Das erste Haus, dem sich Franz hinter der Biegung der Landstraße näherte, war ein windschiefes, baufälliges Fachwerkhaus. Das verblichene Wappen mit dem Schaftstiefel, das über der Eingangstür angebracht war, verriet dem Hausierer, dass hier ein Schuhmacher mit seiner Familie lebte. In den heutigen schlechten Zeiten laufen die meisten Leute im Sommer barfuß, um ihr einziges Paar Schuhe zu schonen, weil sie kein Geld für den Schuster haben, ging es Franz durch den Sinn, und er hegte Zweifel, ob sich hier etwas verdienen ließe. Trotzdem betätigte er den Türklopfer an der wurmstichigen Haustür und wartete. Es dauerte nicht lange, da waren von drinnen Schritte zu vernehmen, und eine junge Frau mit einer schlichten weißen Haube öffnete die Tür.
»Gott zum Gruße«, verneigte sich Franz höflich und sagte, obgleich er noch hundemüde war, sein übliches Sprüchlein auf: »Ich habe alles dabei, was Ihr im Haushalt gut gebrauchen könnt. Zunder, Öle, heilsame Wurzeln und Wundtinkturen, Wachskugeln, Talgpuder gegen Flohbisse, Läusekämme, Besen, allerlei aus Holz geschnitzte Figuren, Christus- und Heiligenbilder, bunte Bänder und Spitzen, Messer, Rosenkränze, geweihte Buchsbaumsträuße und Gebetbücher.«
Die Augen der Frau mit dem ausgemergelten, spitznasigen Gesicht glänzten. Es war offensichtlich, dass sie über die Ablenkung ganz froh war und die Waren gerne in Augenschein genommen hätte. Alles anschauen und antatschen und dann doch nichts kaufen, musste Franz bei ihrem Anblick unwillkürlich denken, weil er so etwas bei armen Leuten häufiger erlebte. Vornehmlich Frauenpersonen besahen sich die Sachen gerne, um sie dann schweren Herzens wieder zurückzulegen, weil jeder Kreuzer, den sie auf der hohen Kante hatten, fürs tägliche Brot gebraucht wurde.
»Dann kommt doch rein, da sind auch mein Mann, die Kinder und meine zwei Schwestern, die gucken bestimmt auch gerne mit«, sagte die Frau des Dorfschusters, ließ Franz eintreten und führte ihn in eine kleine, ebenerdige Stube. Auf dem festgestampften Lehmboden kauerte eine Schar Kinder. Am Tisch saß der Hausherr, ein etwa dreißigjähriger Mann mit schwarzen Bartstoppeln, strähnigen Haaren und schlechten Zähnen. Rechts und links von ihm löffelten zwei junge Mädchen ihre Milchsuppe und blickten den Hausierer, der hinter der Hausfrau in die Stube trat, mit großen Augen an.
»Der Landgänger will uns seine Sachen zeigen«, wandte sich die Frau an ihren Ehemann und wies Franz an, den Tornister auf dem Boden abzustellen.
»Ei, Dietlinde, warum hast du den Kerl überhaupt reingelassen?«, murrte der Schuster ärgerlich. »Du weißt doch genau, dass wir kein Geld haben, oder meinst du, der lässt sich mit Hosenknöpfen bezahlen …«
»Ach, Bertel, sei doch nicht so. Angucken kostet ja nix, lass uns doch den Spaß, man hat ja sonst nicht viel Abwechslung«, versuchte die Frau ihren Mann milde zu stimmen. Die interessierten Blicke ihrer Schwestern und der Kinder, die sich mit unverhohlener Neugier auf den prallen Tornister des Hausierers hefteten, schienen ihr recht zu geben.
»Ach, macht doch, was ihr wollt«, raunzte der Schuster übellaunig. »Nachher ist das Geheul wieder groß, wenn wir nix von dem Kram kaufen können.«
Franz öffnete unbeirrt den Tornister und breitete verschiedene Waren auf dem Fußboden aus. Im Nu war er umringt von den Kindern und den drei Frauen, die alles anfassen und begutachten wollten. Der Hausierer, der bemerkte, was es ihnen für eine Freude bereitete, ließ sie gewähren. Die Hausfrau und ihre Schwestern liebäugelten mit den bunten Bändern und Spitzen, legten sie sich prüfend an die Kleider und die Hauben und gerieten eifrig ins Fachsimpeln, wie man sich damit die Sonntagskleider verschönern könne. Die kleinen Kinder spielten mit den hölzernen Tierfiguren – Pferden, Hasen, Bären und Kühen, die Franz an den langen Winterabenden geschnitzt hatte – und jauchzten vor Vergnügen. Über das verhärmte Gesicht des Hausherrn glitt ein mildes Lächeln, als er ihnen beim Spielen zusah. Er räusperte sich betreten und fragte den Landgänger, was denn eine der Tierfiguren koste.
»Einen Groschen«, antwortete Franz.
Der Schuster schluckte, doch plötzlich schien er eine Idee zu haben. Er musterte die abgetragenen Schuhe des Hausierers und lächelte listig. »Wenn ich mir Eure Schuhe ansehe, dann denk ich mir, eine neue Besohlung könnte bestimmt nicht schaden. Deswegen schlage ich Euch vor, Ihr gebt meiner Frau ein Stück Spitzenborte und den Kindern ein Holzpferdchen, denn bald ist ja Ostern, und da sollen sie sich doch ein bisschen freuen können, und ich besohle dafür Eure Schuhe. Was haltet Ihr davon?«
Franz überlegte. Es war eine angenehme Vorstellung, keine nassen Füße mehr zu haben, weil weder Schnee noch Feuchtigkeit durch die durchlöcherten Sohlen drangen. Andererseits hätte er die paar Groschen gut gebrauchen können, die ihm das Stück Borte und das Holzpferd eingebracht hätten, denn sein Magen knurrte schon jetzt bis zum Gotterbarmen, und seine Taschen waren leer. Die ganze Zeit schon hatte er den Kanten Brot auf dem Tisch mit begehrlichen Blicken gestreift, nun kam ihm eine Idee.
»Dann gebt mir noch eine heiße Milchsuppe mit einer dicken Scheibe Brot dazu, und ich bin zufrieden«, schlug er dem Hausherrn vor, worin dieser mit schiefem Grinsen einwilligte.
Während die Hausfrau wenig später einen Teller mit dampfender Milchsuppe vor Franz auf den Tisch stellte und ihm eine dicke Scheibe Roggenbrot dazulegte, war der Schuhmacher mit den durchgelaufenen Bundschuhen des Hausierers in seine Werkstatt geeilt. Zuvor hatte Franz sorgsam ein ansehnliches Stück von der Spitzenborte abgetrennt und den vor Glück strahlenden Kindern das Holzpferd überlassen. Während er die anderen Waren wieder in den Tornister packte, hatte er sich spontan entschieden, den armen Leuten noch ein buntes Heiligenbildchen mit dem Konterfei des heiligen Antonius von Padua dazuzugeben, dem Schutzpatron der Eheleute und Kinder. Franz brockte sich das harte Brot in die Suppe und schlang sie gierig herunter. Als er mit dem Essen fertig war, erkundigte er sich bei den Frauen, wer in dem imposanten Steinhaus wohne, das er ein Stück weit entfernt vom Stubenfenster aus sehen konnte. Da steinerne Häuser – anders als Fachwerkhäuser oder einfache Holzhäuser – nur für wohlhabende Leute erschwinglich waren, mutmaßte Franz, dort ließe sich möglicherweise ein gutes Geschäft machen. Doch die Reaktion der drei Frauen, die bei seiner Frage erschrocken zusammenzuckten und sich allesamt hastig bekreuzigten, befremdete ihn.
»Dort wohnt der Beuth, der gräfliche Scharfrichter«, erklärte die Hausfrau mit erbitterter Miene. »Der arbeitet nebenbei noch als Wundarzt und verdient sich mit seinen selbst gebrauten Henkerstropfen ein ordentliches Zubrot. Der ist geizig bis ins Mark und hat für Hungerleider und andere Leute, denen es schlechter geht als ihm, keinen roten Heller übrig. Deswegen kann ich Euch nur abraten, zu dem hinzugehen. Dort kriegt Ihr bestenfalls einen Tritt, oder er hetzt seinen Hund auf Euch.«
Der Gesichtsausdruck des Hausierers verdüsterte sich. Er hatte schon häufiger die Erfahrung machen müssen, dass Bessergestellte arge Pfennigfuchser sein konnten, die Fahrenden mit Abneigung begegneten. »Danke für Euren Hinweis, daran werde ich mich halten.«