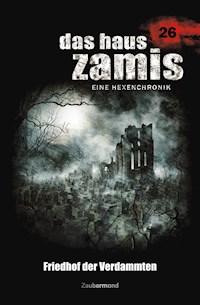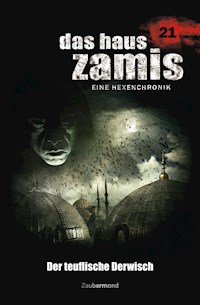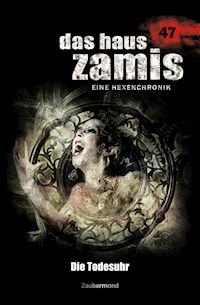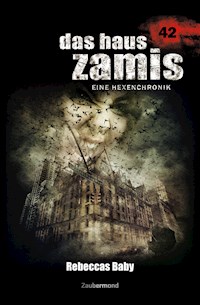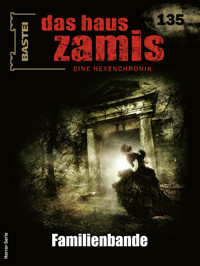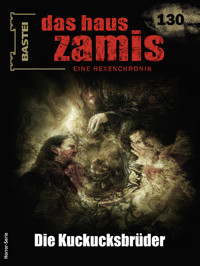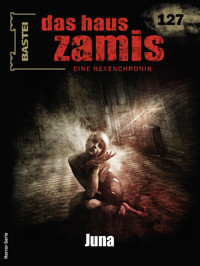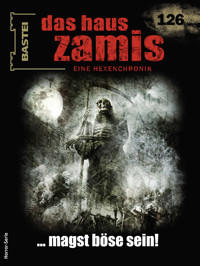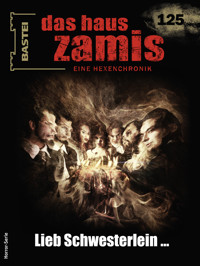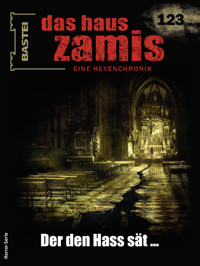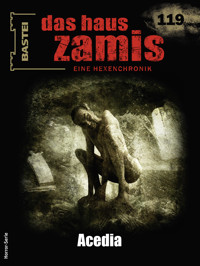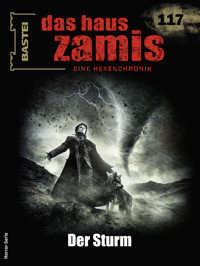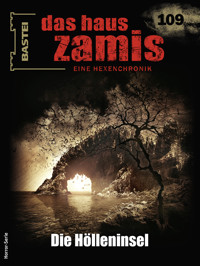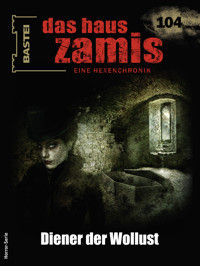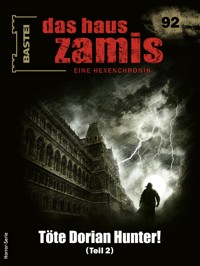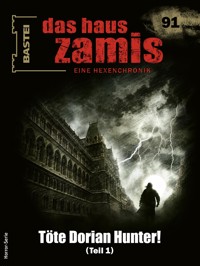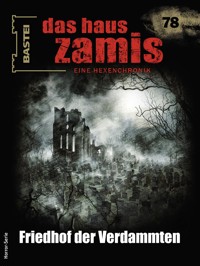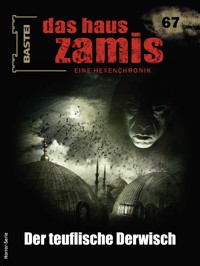1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Maddrax
- Sprache: Deutsch
Pilâtre de Rozier gelingt es, durch das Portal im Zentrum des Victoriasees in die Parallelwelt vorzustoßen. Er will seinen Sohn zurückholen und ihn, sollte er inzwischen von dem Dunklen Keim befallen sein, mit einem der Kristallsplitter heilen.
Doch das Vorhaben erweist sich komplizierter und gefahrvoller als gedacht und gipfelt in einem dramatischen Vater-Sohn-Konflikt, der schon lange zwischen Pilâtre und Victorius schwelte. Denn die grundsätzliche Frage lautet: Will Victorius überhaupt zurück in seine alte Welt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah...
In Feindesland
Leserseite
Vorschau
Impressum
Am 8. Februar 2012 trifft der Komet »Christopher-Floyd« – in Wahrheit eine Arche Außerirdischer – die Erde. Ein Leichentuch aus Staub legt sich für Jahrhunderte um den Planeten. Nach der Eiszeit bevölkern Mutationen die Länder und die degenerierte Menschheit befindet sich im Krieg mit den Daa'muren, die als Gestaltwandler ein leichtes Spiel haben. In dieses Szenario verschlägt es den Piloten Matthew Drax, »Maddrax« genannt, dessen Staffel durch einen Zeitstrahl vom Mars ins Jahr 2516 versetzt wird. Zusammen mit der telepathisch begabten Kriegerin Aruula erkundet er diese ihm fremde Erde, und es gelingt ihm, die lebende Arche, den »Wandler«, gegen dessen kosmischen Feind zu verteidigen, woraufhin sich der Wandler mit den Daa'muren ins All zurückzieht...
Während es Matt und Aruula in ein anderes Sonnensystem verschlägt, hat der Kampf gegen den Streiter dramatische Folgen: Der Mond nähert sich der Erde! Als Matt und Aruula endlich einen Weg in die Heimat finden, haben sie nur wenig Zeit, die Katastrophe abzuwenden. Zwar gelingt es, den Mond in seine Umlaufbahn zurückzuversetzen, doch dies verursacht eine Schwächung des Raum-Zeit-Kontinuums, das in der Folge an besonderen Punkten aufbricht – dort wo die Nachfahren der Menschheit, die Archivare, in der Zeit zurückgereist sind, um technische Artefakte der Vergangenheit zu sammeln. Nun tauchen an den Bruchstellen Areale verschiedener Parallelwelten auf.
Zusammen mit dem Pflanzenwesen GRÜN gelingt es unseren Helden, mittels eines Tachyon-Prionen-Organismus die Risse zu versiegeln – bis eine Bruchstelle kollabiert, die nicht auf die Archivare zurückgeht, GRÜN und den Organismus beinahe tötet und ein gewaltiges Areal um den Victoriasee in die Gegenwart versetzt. Kaiser Pilâtre de Rozier, der dort regiert, hat den Austausch beobachtet – und dass das Luftschiff seines Sohnes Victorius darin verschwand, während der See durch eine gewaltige Stadt ersetzt wurde. Matt und Aruula stellen fest, dass die Menschen aus dem Areal einen »bösen Keim« verbreiten; dieselbe Kraft, mit der sich auch Aruula über den Kontakt mit GRÜN infiziert hat. Als der Anführer der Dunklen, Shadar, ihr die telepathischen Kräfte rauben will, befreit er sie ungewollt von dem Keim.
Nun wollen Matt und Aruula den Tachyonen-Organismus einsetzen, um das Portal zu öffnen, doch das Wesen ist aus der Stasiskugel verschwunden! Sie vermuten Colonel Kormak dahinter, doch der kann die Schuld auf seine Assistentin Vasraa abwälzen und sie anschließend »entsorgen»... so denkt er jedenfalls. In Wahrheit überlebt sie aber und sinnt auf Rache.
Inzwischen wird die Wolkenstadt Château-à-l'Hauteur von den Dunklen angegriffen; nur Pilâtre entkommt mit einer Roziere. Da treffen die befreundeten Daa'muren Grao und Ira ein. Sie haben durch das Portal den Todesschrei eines Wandlers empfangen und machten sich auf die gefahrvolle Reise nach Afra.
Ira hat unterwegs eine Präsenz des Wandlers gespürt, der sie nun nachgehen und auf einen Daa'muren treffen, der einen Kristall mit dem Geist seines Sohnes hütet. Beim Kampf mit einem Dunklen zerbricht der Kristall – und sie stellen fest, dass die Splitter den Dunklen Keim aus einem Infizierten saugen können! Pilâtre will nun schnellstens hinüber in die Parallelwelt, doch er muss sich gedulden; erst gilt es, mehr Kristalle zu bergen. Dazu machen sich Matt, Aruula und die Daa'muren zum Kratersee auf...
In Feindesland
von Michael M. Thurner
Sie löste sich aus dem Schatten der Nacht. Routiniert glich sie das Schwanken der Holzplanken unter ihren Füßen aus.
Es waren nur wenige Leute auf den Straßen. Das Kläffen eines Doggars war zu hören, irgendwo weinte jemand, aus einem der Häuser erklang freudiges Gestöhne. Es war die Melodie der Dunkelheit, die sie nur zu gut kannte.
Links von ihr öffnete sich knarrend ein Tor. Ein heißer Luftschwall drang ins Freie. Er war gesättigt vom Geruch nach Fett, nach Alkohol, nach rauchigem Feuer und nach Sünde. Gelächter, zornige Stimmen, rührseliger Gesang bildeten den dazugehörigen Klangteppich.
Das »Quartier Chaud« spuckte einen Gast aus; einen Mann, dessen Gesichtszüge grob wirkten wie das unfertige Werk eines Holzschnitzers. Der Mann torkelte in ihre Richtung. Bevor er sie erreichte, wandte er sich einem Baum zu und ließ einen Strahl ab. Sie wartete geduldig, bis er sein Geschäft verrichtet hatte.
Er verschloss das Hosentor und entdeckte sie. Ein schiefes Grinsen tauchte in dem schiefen Gesicht auf. Er torkelte weiter, kam auf sie zu.
»Hübschschsch!«, lallte er. »Eine... eine Bordsteinsch...schwalbe, die auf mich wartet. Du wartescht doch auf mich, oder?«
»Natürlich«, sagte sie, hängte sich bei dem Betrunkenen ein und zog ihn mit sich. Weg aus dem Licht zweier trübseliger Funzeln und hin zu einem Straßenteil, hinter dessen Gebüschzeile sich normalerweise Pärchen vergnügten.
Der Mann redete pausenlos auf sie ein, und sie schenkte ihm zwischendurch ein Lächeln. So lange, bis sie einen geeigneten, gut versteckten Ort erreichten und sie dem Druck in ihr nachgeben konnte.
»Machma jetzscht was?«, fragte er und entblößte ein fehlerhaftes Gebiss.
»Ja, wir machen jetzt etwas«, antwortete Zirlonga und entließ das Dunkle in ihr. Es strömte aus ihren Augen und bildete hauchdünne Nebelschwaden, die sich mit der Schwärze der Nacht verbanden. Die dunkle Energie ging auf ihr erstes Opfer über, drang in den Mann ein und begann, ihn zu... bekehren.
Zirlonga war zufrieden. Die Eroberung der Stadt Le-Troisième-Port-du-Ciél hatte begonnen.
Zehn Schritte bis zur Tür, Wende, zehn Schritte zurück bis zum Tisch. Eine erneute Wende, weitere zehn Schritte.
Jean-François Pilâtre de Rozier schnaufte erbost durch die Nase. So weit war sein Reich also zusammengeschrumpft. Ein Reich, das einstmals so riesig gewesen war, dass Läufer mehrere Monde verbracht hatten, um bis ins letzte Dorf seines Herrschaftsgebiets zu gelangen. Zehn Schritte durchmaß es nun, und wenn er den Schreibtisch umrundet hätte, wären es vierzehn geworden.
»Wein!«, rief er. »Ich will mehr Wein!«
Die Türe öffnete sich, ein Mann in farbenfroher Uniform trat ein. Er beugte ehrerbietig sein Haupt, nahm die umgeworfene goldene Karaffe an sich und verschwand wieder. Ein anderer Untergebener – oder sollte de Rozier ihn Wächter nennen? – nahm den Platz vor der Tür ein. Er warf dem Kaiser einen ängstlichen Blick zu, bevor er eine Habacht-Stellung einnahm.
Die Tür schloss sich. De Rozier war wieder alleine mit sich und seinem Zorn.
Die Sorge um seinen Sohn brannte ihm unter den Nägeln. Er musste weg von hier und in diese andere Welt gelangen! Wie sollte Victorius alleine überleben unter all diesen Wesen, die das Böse in sich trugen, es wie eine Krankheit weitergaben und derart dafür sorgten, dass sich die Dunkelheit wie eine üble Krankheit vermehrte?
Stattdessen saß er hier in Orléans-à-l'Hauteur fest, hatte Matthew Drax und den anderen versprochen, auf ihre Rückkehr vom Kratersee zu warten. Aber er konnte nicht warten!
Der Offizier kehrte zurück und stelle die gefüllte Karaffe vor de Rozier ab. Der goss den Wein in seinen Humpen und trank in einem Zug aus.
Der Soldat wollte sich entfernen, doch er hinderte ihn daran. »Du bleibst gefälligst hier!«
»Herr, ich muss zurück auf meinen Posten.«
»Dein Posten ist hier. Wo könntest du mich besser im Auge behalten? Das ist doch dein Auftrag, nicht wahr? Darauf zu achten, dass ich die Stadt nicht mit einer Roziere verlasse, oder?«
»Herr, bitte...«
Der Mann tat Pilâtre fast leid. Er stand seinem Kaiser gegenüber, der einen gottgleichen Status besaß und seit Jahrzehnten regierte, ohne auch nur einen Tag älter zu werden.
»Hast du Kinder, Soldat?«, fragte Pilâtre de Rozier.
»Zwei Söhne und eine Tochter, Herr.«
»Und du liebst sie?«
»Mehr als mein Leben, Herr.«
»Dann kannst du meinen Schmerz verstehen. Ich werde daran gehindert, meinem ältesten Sohn zu helfen. Weil ich dafür in die andere Welt hinüberwechseln müsste.«
Die Wache wand sich. »Selbstverständlich verstehe ich Euch, Herr. Aber... aber ohne Euch wären wir verloren. Wir brauchen Eure Führung, um diese schreckliche Seuche zu bekämpfen.«
»Was würdest du an meiner Stelle tun, wenn du entscheiden müsstest zwischen dem eigenen Fleisch und Blut und dem Volk?«
»Ich... ich würde desertieren und mich aufmachen, meinen Sohn zu retten, Herr.«
»Dann verstehst du mich, Soldat?«
»Mit jeder Faser meines Leibes, Majestät.«
»Dann verschaffe mir die Gelegenheit, von hier zu verschwinden und meinem Sohn zu folgen.«
»Das kann ich nicht, Herr.«
»Und warum kannst du das nicht, Kerl?«, brüllte Pilâtre den Soldaten an.
»Weil... weil Ihr der Kaiser seid, Herr. Weil nur Ihr uns beschützen und in eine hellere Zukunft führen könnt.«
Pilâtre unterdrückte seinen Zorn und zog sich auf das zurück, was in den alten Schriften als Ratio bezeichnet wurde.
»Wie heißt du, Soldat?«, fragte er.
»Kyraan, Herr. Kyraan von Tsambaali. Wollt Ihr... wollt Ihr mich für meine Worte bestrafen, Herr?«
»Es gibt nicht viele Menschen, die so offen gesprochen hätten wie du, Kyraan von Tsambaali. Seinem Kaiser widerspricht man nicht. Und ja, ich werde dich bestrafen.«
»Mon dieu! Majestät, ich habe doch bloß –«
»Du hast es gewagt, deinem Kaiser die Wahrheit ins Gesicht zu sagen«, unterbrach ihn Pilâtre. »Dafür werde ich dich bei nächster Gelegenheit befördern. Du wirst bei strategischen Sitzungen neben mir Platz nehmen, du wirst mich beraten, meine Entscheidungen mittragen. Und ich garantiere dir: Du wirst jede einzelne davon bedauern. Denn du wirst dasselbe Schicksal wie ich erleiden und Urteile über das Leben von anderen Menschen sprechen müssen. Und nun geh, Kyraan von Tsambaali, und bring mir mehr Wein.«
Der Soldat nickte und verließ mit Tränen in den Augen den Raum.
Stunden später
Festhalten wollten sie ihn. Ihn daran hindern, das zu tun, was er für richtig hielt. De Rozier schnaubte. Sie würden sich noch wundern, allen voran Alfons Croiseur, der Statthalter von Orléans-à-l'Hauteur, der sich erdreistet hatte, seinen Kaiser unter Hausarrest zu stellen!
Das kleine Schauspiel, das er den Soldaten während der heißen Tagesstunden geliefert hatte, würde sie auf eine falsche Fährte locken. Er hatte noch drei weitere Karaffen mit Wein bestellt, den guten Tropfen aber den Topfpflanzen in seinen Gemächern überlassen. Sie mussten annehmen, er würde zu betrunken sein, um etwas zu unternehmen. Doch er hatte nicht vor, sich seinem Schicksal zu ergeben.
Er packte seine Sachen zusammen, darunter einige der Kristallsplitter, die Drax und Aruula aus dem entlegenen Dorf mitgebracht hatten und die das bislang einzige Heilmittel gegen den Dunklen Keim darstellten.* Dann lauschte er an der Tür zu seinen Gemächern. Draußen auf dem Gang war alles ruhig.
De Rozier trat an das große Fenster auf der Rückseite des Raumes. Haken und Scharniere hatte er mit Butter geschmiert. Sie gaben keinerlei Geräusch von sich, als er die Flügel auseinanderschob.
Kurz dachte er an seinen Enkel Pilou, den er hier in Orléans-à-l'Hauteur zurücklassen musste. Es war undenkbar gewesen, ihn über sein Vorhaben zu informieren; Pilou hätte sich ihm sofort anschließen wollen, obwohl er selbst gerade erst von der teuflischen Infektion genesen war.
Mit einem Seil befestigte de Rozier den Leinensack mit seiner Ausrüstung um die Schultern, stieg über das Sofa hoch zum Fenster und durch die Öffnung. Ein weiteres Tau wartete hier auf ihn. Es war um einen der vielen holzgeschnitzten Gargoyle-Köpfe geschlungen, die das Regierungsgebäude verzierten.
Ein Ruck ging durch de Roziers Körper, als er sein gesamtes Gewicht dem Tau anvertraute. Es begann zu pendeln, als er sich hinab hangelte. Der Boden war gute fünfzehn Meter entfernt; ein Sturz aus dieser Höhe würde ihm sämtliche Knochen im Leib und vielleicht das Genick brechen.
Seine Arme schmerzten bald ob der ungewohnten Anstrengung, die Finger rieben sich trotz der Lederhandschuhe blutig. Aber zur Umkehr würde ihm die Kraft fehlen.
Schräg über ihm ragten die gewaltigen ovalen Schemen der Trägerballons in der mondlosen Dunkelheit auf, die am Rand der Stadt festgemacht waren. Sie dienten der Stabilisierung der Wolkenstadt.
Auch sein Ziel verfügte über einen Ballon, allerdings nicht länglich aufragend, sondern in der Waagerechten und mit einer Gondel darunter: eine der kleinen Rozieren, die für Botenflüge neben dem Regierungssitz vertäut waren. Sie waren nicht für längere Flüge gedacht, aber de Rozier konnte nicht wählerisch sein. Für den Flug zum Portal im Zentrum der Dunklen Stadt musste das kleine Fluggerät ausreichen.
Wenn er es denn erreichen konnte!
De Rozier kletterte so lange in die Tiefe, bis er mit seinen beschuhten Füßen den Doppelknoten spürte, den er ins Ende des Seils geschlungen hatte. Auf halber Strecke, noch immer gut sieben Meter über dem Boden. Nun musste er das Seil in Schwingungen versetzen, um den Tragballon der nächstgelegenen Roziere zu erreichen. Wenn es ihm gelang, sich an der Vertäuung festzukrallen, konnte er zur Gondel hinab klettern.
Er schlang Schlaufen um die Handgelenke und entlastete damit seine Finger ein wenig, während er das Körpergewicht ein ums andere Mal verlagerte, den Körper nach hinten durchstreckte und dann wieder nach vorne.
Die Pendelbewegung wurde größer und größer. Vor ihm, an ihrem Endpunkt, tauchte der Ballon der Roziere auf.
De Rozier unterdrückte ein Lachen. Der Kaiser von Afra, womöglich der mächtigste Mensch dieses Kontinents, schwang sich wie ein Affe durch die Lüfte und musste sich auf sein Glück verlassen, das Seil rechtzeitig loszulassen, um den Ballonkörper nicht zu verfehlen und zu Tode zu stürzen...
Ein letztes Mal Schwung holen. Die Handgelenke befreien. Den vorderen Totpunkt abwarten, die Beine anziehen, gegen den Schmerz in den Bauchmuskeln ankämpfen – und loslassen.
Kurz fühlte es sich an, als würde er fliegen wie ein Vogel, als gäbe es keine Schwerkraft mehr. Dann aber machte sich das Gefühl der Panik in ihm breit – als er erkannte, dass seine Flugkurve zu kurz war! Der Ballon glitt unerreichbar an ihm vorbei, als er abwärts stürzte.
Doch dann spürten seine ausgestreckten Hände kurz Widerstand. Der Rand der Gondel aus geflochtenen Schilfblättern!
Er krümmte die Finger, als er daran entlang rutschte in diesen entscheidenden Bruchteilen einer Sekunde, versuchte irgendwo Halt zu finden – und hatte Erfolg.
Ein mörderischer Ruck. Schmerz in den Schultern, im Hals, im Nacken, am Bauch. De Rozier hielt eisern fest. Er hatte den unteren Rand der Gondel erwischt und hing dort nur noch kraft seiner Finger und seines Willens.
Nach oben! Er musste einen Klimmzug machen, um eine der Querstreben zu erwischen und sich an Bord zu ziehen!
Drei. Zwei. Eins. Jetzt!
Nichts. Sein Körper gehorchte nicht. Seine Finger waren klamm, die Kräfte ließen stetig nach. Der Wunsch, einfach loszulassen, wuchs. Er hatte sich überschätzt.
Vielleicht überstand er ja den Sturz mit leichten Blessuren; es mochten noch fünf, sechs Meter bis zum Grund sein. Aber zweifellos würde man ihn finden und sich zusammenreimen, was er vorgehabt hatte. Einen zweiten Versuch konnte er vergessen. Und damit die Hoffnung, Victorius beistehen zu können...
Da fühlte de Rozier etwas an seinem tauben rechten Handgelenk. Etwas, das sich wie fremde Finger anfühlte!
Jemand hatte ihn gepackt und zog ihn mit ungewöhnlicher Kraft in die Höhe. In die Sicherheit der Rozierengondel.
Sterne tanzten vor de Roziers Augen. Er benötigte einige Sekunden, bis er wieder einigermaßen klar sehen konnte. Vor ihm hockte ein Mann, laut schnaufend und mit einem Gesicht, das selbst in der Dunkelheit rot vor Anstrengung wirkte.
»Der Kaiser ist, mit Verlaub, ein rechter Idiot«, japste Kyraan von Tsambaali zwischen zwei tiefen Atemzügen. »Wenn ich nicht das Seil am offenen Fenster bemerkt und Euch hier unten erwartet hätte, wärt Ihr nunmehr tot.«
Kyraan reichte ihm die Hand. De Rozier zog sich daran hoch und blieb wackelig auf den Beinen stehen.
»Aus Sorge um Euren Sohn geht Ihr ein Wagnis ein, das Euch das Leben hätte kosten können«, fuhr der Soldat fort. »Das verdient meinen Respekt, auch wenn ich das Handeln Eurer Majestät nicht gutheißen kann. Aber ich verstehe Euch aus der Sicht des Vaters. Und deshalb werde ich nun wieder in mein Quartier gehen und so tun, als wäre nichts geschehen und als hätte ich nichts gesehen.«
Kyraan wandte sich ab und ging in Richtung der Hängeleiter, über die er an Bord der Roziere gelangt war.
»Das werden sie dir nie vergessen, Soldat«, sagte de Rozier. »Weder der Kaiser noch der Idiot – und schon gar nicht der Vater. Sie werden dir ewig in Dankbarkeit verbunden sein.«
»Bringt Euren Sohn wohlbehalten zurück, Herr«, sagte der Soldat und kletterte ohne ein weiteres Wort des Abschieds die Hängeleiter hinab.
In der Parallelwelt
Le-Troisième-Port-du-Ciél war eine schöne Stadt. Azurblau und karmesinrot waren die beherrschenden Farben. Sie bedeckten die Gebäude genauso wie die Gehplanken der Wolkenstadt und die Ballons, die sie in der Luft hielten. Da und dort hatte man Dächer mit Goldfarbe überzogen und Türmchen mit Efeu umrankt. Um jedermann, der an der Stadt anlegte, davon in Kenntnis zu setzen, dass eine hochrangige Persönlichkeit des Kaiserreichs anwesend war. Selbst jetzt, da man in Feindesland verankert war, achtete man die Traditionen.
Die Stadt war ein klein wenig anders gebaut als die übrigen Wolkenstädte des Kaiserreichs. Die Gebäude der Reichen und Vornehmen waren nicht ins Zentrum verortet worden, sondern an einen der schmalen Ränder. Denn der Stadtkorpus war oval geformt, nicht rund.