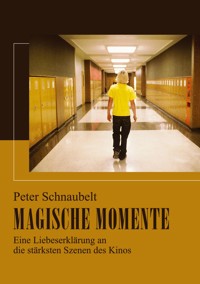
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Peter Schnaubelt entdeckte seine Leidenschaft für das Medium Film als Jugendlicher bei Vorstellungen von "Winnetou" und "Godzilla" in einem Kleinstadtkino der Siebzigerjahre. Als Initialzündung für seine Begeisterung fungierte der Fernsehtrailer zu Spielbergs "Der weiße Hai", der für ihn in einem Alter, als an einen Kinobesuch des Streifens noch nicht einmal zu denken war, ein ganzes Universum an Möglichkeiten des Geschichtenerzählens und des Sehens auftat. In seinem Buch "Magische Momente" taucht Schnaubelt nun tief in seinen ganz individuellen Kinokosmos ein. Er hat Essays zu den subjektiv stärksten Szenen quer durch die Filmgeschichte gesammelt; darunter finden sich Klassiker ebenso wie persönliche Entdeckungen, intellektuelles Drama und große Romantik, furchterregender Horror und berührendes Coming-of-Age. Schnaubelts brillante Analysen wecken mit entlarvender Klarsicht, liebevoller Ironie und fühlbarem Enthusiasmus Erinnerungen an bereits Gesehenes und Neugier auf Neuers; sie sind Hommage an große Filmmomente und nichts weniger als Liebeserklärungen an prägende Gänsehautmomente des Kinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Schnaubelt wurde 1964 in Krems/Donau geboren. Er studierte an der Universität Wien das Lehramt für Englisch und Geschichte und unterrichtet seitdem an einem Gymnasium im niederösterreichischen Waldviertel. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie journalistische Beiträge zu Themen der Literatur und des Films. In Magische Momente macht sich der Autor auf die Spurensuche nach seiner persönlichen cineastischen Sozialisation und hat in diesem Sinne eine haltlos subjektive Liebeserklärung an für ihn besonders prägende Filmszenen zusammengestellt, eine in die Form von leidenschaftlichen Essays gegossene Hommage an die Magie des Kinos.
Weitere Informationen auf: www.magische-filmmomente.at
Inhaltsverzeichnis
Aufblende – Eine Initialzündung
Labore der Gewalt
Die Zeit des Sterbens und die Zeit davor
Aus dem Regen in die Hölle
Mutterliebe
Leben, um zu sterben
Sprache, die aus dem Innersten kommt
Der Mensch als Tier
Wohlgewählte Worte
Das Grauen
Pointenpfeile
Die Einsamkeit der Seele
Auftauchen ins Leben
Viel zitiert
Elektrizität
Im Kugelhagel
Loslassen können
Das Konstrukt des Geschlechtlichen
Sehnsuchtsmelodie
Die Verleugnung des eigenen Selbst
Spähen in Schattenwelten
Freeze Frame der Legenden
Frühling für Hitler
Schuld und Sühne
Väter und Söhne
Die Ballade vom traurigen Trinker
Es war einmal …
Die Sprache von Tränen
Rosenregen
Die Maske fällt
Trilogie des Bösen
Schwarze Pädagogik
Den Tag nützen
Tiles to tango
Chronik eines angekündigten Todes
Der letzte der alten Könige
Urvertrauen
Ordnung und Chaos
Heroische Herzen
Auf falscher Fährte
Die Dekonstruktion der Zeichen
Die Prüfung der Unschuld
Nie geboren
Auf der Suche nach den verlorenen Kindern
Bilder der Erlösung
Die Beschaffenheit der Dinge
Das Spiel der Lebenden mit den Toten
The Head in the Fridge
Die Hölle in uns
Heroische Herzen
Der traurige Clown
Sich selbst treu geblieben
Harte Kerle, weiches Herz
Viva la diva
Bette Davis’ Eyes
Einstürzende Altbauten
Der Mann mit der Peitsche
Der gar nicht diskrete Charme des ganz banalen Bösen
Lieder von der unerfüllten Liebe
Schätze
Ein Leben und die ganze Welt
Die Dunkelheit um uns, die Dunkelheit in uns
Beide Seiten
Froschregen
Der Kuss der Küsse
Filmrollen voll reinsten Vergnügens
Berührungen
Des Menschen Wolf
Einfach cool
Winter des Lebens
Von der lyrischen Schönheit des alltäglichen Lebens
Glauben an die Liebe
Einsame Tiere
Zu ebener Erde und im ersten Stock
In den Abgrund blicken
Erstarrtes Lächeln
Die Hölle in uns
Der beste Papa von allen
Chronik eines einfachen Lebens
Dreiecksbeziehungen
Dem Himmel so nah
Wahre Helden
Die Umkehrung der Schöpfung
Erwachsen über Nacht
Wahre Freundschaft
Das Gerüst einer Saga
Mit einem Blick
Die Wahrheit im Spiegel
Agent of Chaos
Ein Mensch will er sein
Verstörungen
Mensch und Monster
Bad bad guys
Sisyphos als kleiner Mann
Das Tor zum Wahnsinn
Quid pro quo
Tote Menschen sehen
Bis in den Tod und darüber hinaus
Ziel des Zählwerks
Sturz in den Wahnsinn
Abgründe der Rache
Verbotene Schritte
Abblende – Berühmte letzte Worte
Abspann – Die Filme
Aufblende – Eine Initialzündung
Jaws
Soweit ich mich erinnern kann, gab es vor Steven Spielbergs Jaws keinen Film, zu dem ein Trailer im Werbefernsehen lief. Als der Streifen nach Österreich kam, hatte ich gerade erst ein zweistelliges Alter erreicht und dachte nicht einmal in meinen wildesten Vorstellungen daran, ihn im Kino sehen zu können. Meine Möglichkeiten waren damals ziemlich eingeschränkt und bezogen sich in erster Linie auf die Sonntagnachmittagsvorstellungen im Bahnhofskino der Kleinstadt, in der ich aufwuchs. Diese orientierten sich in der Programmgestaltung an Kindern und Jugendlichen. Zu sehen gab es – zumindest im Rückblick – primär die japanischen Godzilla-Streifen, die in hiesigen Breiten noch nicht den heutigen Kultstatus genossen, und die populären deutschen Karl May-Verfilmungen um den edlen Winnetou und seinen Blutsbruder Old Shatterhand. Wenn der Riesensaurier in als solche deutlich erkennbaren Kulissen eines Mini-Tokio wütete, war das für mich Spannung pur; und wenn Stewart Granger als grau melierter Old Surehand, die Flinte betont lässig in der Armbeuge und ohne richtig zu zielen, die Gangster von einem Zugdach schoss, war ich im Anschluss an die Vorstellung noch stundenlang mit dem Nachspielen der Szene beschäftigt.
Was Jaws betraf, genügte vorerst der Trailer, um meine rege Fantasie anzukurbeln. Ich saß damals manchmal stundenlang vor dem Fernsehapparat, nicht wegen der Programme, sondern wegen der Werbeblöcke dazwischen. Wobei es ungewiss war, ob der Trailer an diesem Abend überhaupt laufen würde. Wenn es dann wirklich so weit war, wenn zu der Kamerafahrt durch Unterwasserpflanzen dieses herrlich schaurige Thema von John Williams einsetzte und dann in immer rasanteren Schnitten ein Stakkato der Spannung erzeugt wurde, ohne dass das für den Titel verantwortliche Ungeheuer auch nur einmal zu sehen war, war dies einer der entscheidenden Momente, aus denen meine Liebe zum Film und zum Kino geboren wurde.
Spielberg stellte mit seinem Film das Genre des Spannungskinos auf den Kopf wie sonst nur Hitchcock zuvor und schuf den ersten Blockbuster der Kinogeschichte – und ja, damals war ein solcher meist noch eine innovative und spannende Angelegenheit. Es ist erstaunlich, wie perfekt Jaws auch heute noch als Provokation dessen funktioniert, was jederzeit aus den Tiefen des Meeres wie aus jenen unseres Unterbewusstseins aufsteigen und unser Leben, wie wir es im Griff zu haben glauben, von einem Augenblick auf den anderen infrage zu stellen vermag.
Da ist die legendäre Eröffnungsszene, in der eine nackte blonde junge Frau bei ihrem Mondscheinbad attackiert und im Wasser herumgewirbelt wird, wobei der Angreifer noch gänzlich unsichtbar bleibt. Da bricht Panik am Strand aus, als eine Haiflosse gesichtet wird, die Schwimmer versuchen, aus dem Wasser zu kommen, und scheren sich dabei nicht um Kinder und andere Badende, eine Szene, die Todd Field in seinem psychologischen Filmdrama Little Children (2006) auf grandiose Weise reflektiert, wenn er einen Pädophilen im Freibad in einen Pool mit Kindern steigen lässt. Da gibt es ironischen „comic relief“, wenn der Seebär Robert Shaw und der Meeresbiologe Richard Dreyfuss auf dem Boot, mit dem sie sich gemeinsam mit Roy Scheider alias Polizeichef Martin Brody zur Haijagd aufgemacht haben, in einer Art Wettbewerb einander ihre Wunden präsentieren. Doch die Stimmung schwenkt um, als Shaw mit glänzenden Augen und unheimlicher Ruhe in der Stimme vom Sinken der USS Indianapolis während des Zweiten Weltkriegs und den darauffolgenden Haiattacken auf die Überlebenden erzählt. Wenn dann der Kampf der drei Männer gegen den Hai ausbricht, wenn die Musik unsere Emotionen aufpeitscht und das Ungetüm den Käfig demoliert und dann das ganze Boot, wenn Robert Shaw ihm ins offene Maul rutscht und Brody schließlich auf dem Mast des sinkenden Schiffes liegt und auf das Ungetüm schießt, das ihm durchs Wasser entgegenpflügt, sind die einzelnen Momente längst zu grandiosem Gänsehautkino verschmolzen, das besser, packender, effektiver wohl nicht inszeniert werden könnte.
Im Finale des Films explodiert der monströse Hai, weil Brody es schafft, die Druckluftflasche, die das Ungetüm zwischen den Zähnen hat, zu treffen. In meiner Kindheit genügten einige kurze Ausschnitte im Fernsehtrailer für eine Initialzündung, die in mir als Zuschauer stattfand: für den Urknall meiner lebenslangen Liebe zu den bewegten Bildern, von denen ich, das war mir klar, mehr, viel mehr, wollen würde. Davon erzählt diese kleine Zusammenstellung einiger meiner persönlichen und in diesem Sinne unter ganz subjektiven Kriterien ausgewählten Lieblingsszenen.
Jaws (Der weiße Hai, USA 1975)
Labore der Gewalt
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls
Bennys Video
Der siebente Kontinent
Funny Games/Funny Games U. S.
Ein alter Mann telefoniert mit seiner Tochter, man hört nur seine Seite der Unterhaltung. Der Mann lebt allein, das Verhältnis zur Tochter ist kein inniges. Im Hintergrund läuft der Fernseher mit leisem Ton, ein Aufflackern der Außenwelt ohne Einfluss auf das stille Drama, das sich zwischen dem Vater und seiner Tochter abspielt. Der Mann hat den Eindruck, seiner Tochter lästig zu sein, mehrmals fordert er sie zum Auflegen auf, aber dann, meint er, würde sie ein schlechtes Gewissen haben. Vater und Tochter sind aufeinander eingespielt, wenn es um die Rituale des Einander-Verletzens geht und darum, die eigene Verletzlichkeit zu verbergen. Trotzdem bricht immer wieder Verbitterung durch: „Tut mir leid, dass ich existiere!“ Auf eingefahrenen Wegen gibt ein Wort das andere, die Sehnsucht nach Nähe, nach Bestätigung und Sinnhaftigkeit dessen, was vom Leben geblieben ist, sieht sich zwischen Grantigkeit und Weinerlichkeit, Resignation und den kurzen Momenten von Aggressivität gefangen. Allein wenn die Enkeltochter Sissi am Apparat ist, scheint der alte Mann wie ausgewechselt, auf einmal wirkt er lebhaft und froh. In der Konfrontation mit seiner Tochter friert sein Lächeln aber sofort wieder ein.
Der Schauspieler Otto Grünmandl verkörpert diesen alten Mann ohne Illusionen und Zukunft in dem Film 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls und darin in einer dieser langen Szenen, die nicht nur für die in ihrer spezifischen Lebenssituation gefangenen Charaktere, sondern auch für uns Zuschauer:innen eine Form von Folter darstellen und sich durch das gesamte Werk des österreichischen Regisseurs Michael Haneke ziehen.
In Der siebente Kontinent ist es das lange Sterben einer Mittelstandsfamilie, Georg, Anna und Evi (Dieter Berner, Birgit Doll und Leni Tanzer), die den gemeinsamen Freitod beschließen und auch tatsächlich bis zur finalen Konsequenz durchziehen. Die Geschäfte sind abgewickelt, das Auto ist verkauft und ein letztes Frühstücksmahl mit Sekt und Wurstplatte angerichtet, dann werden die Bilder im Haus abgenommen, die Kleider zerschnitten, Kinderzeichnungen zerrissen, Möbel zersägt und Geld die Toilette hinuntergespült. Berge von Schutt sind, was der Familie früher etwas bedeutet hat. Die Fische aus dem umgestoßenen Aquarium liegen auf dem Boden und japsen nach Luft, das Wasser mit all den darin aufgelösten Tabletten schmeckt bitter. Georg schreibt die Sterbezeiten seiner Tochter und dann seiner Frau an die Wand. Im Rauschen des Fernsehapparates liegt schließlich auch er auf dem Bett und stirbt seinen langsamen Tod.
Hanekes filmische Narrative verhandeln die Rolle, die Gewalt in unserer Gesellschaft spielt, einfache Antworten bezüglich ihrer Ursachen geben sie freilich nicht; sie verweigern sich einer klaren, erklärenden Auflösung. Ohne Schnitt hält die Kamera minutenlang auf Szenen der Brutalität, die so alltäglich, geradezu nebenbei passiert, dass man kaum glauben mag, was man da zu sehen bekommt.
In Bennys Video ermordet der titelgebende Teenager (Arno Frisch agiert in der ihm eigenen Zurückhaltung und dennoch mit zuweilen extremer Direktheit) das Mädchen (Ingrid Stassner), das er in seiner Stammvideothek kennengelernt und in die elterliche Luxuswohnung eingeladen hat, mit einem Bolzenschussgerät. Wir verfolgen die Szene über den Fernsehschirm, auf dem sich Benny zuvor immer wieder die Tötung eines Schweins angesehen hat. Das schwer verletzte Mädchen kriecht über den Boden, sie weint und schluchzt, zum Teil spielt sich das außerhalb des Bildausschnittes des TV-Gerätes ab. Dass sie Ruhe geben solle, ruft Benny mehrmals, dann lädt er die Waffe nach, es fällt ein Schuss und daraufhin abermals Schreien und Flehen des Mädchens und Bennys genervte Bitte, doch endlich still zu sein. Neuerliches Laden, ein letzter Schuss, dann gibt es keinen Laut mehr. Benny trinkt Wasser und isst Joghurt, er wirkt dabei sehr gefasst und weiß mit seiner Tat offenbar nichts anzufangen.
Die Sinnfrage stellen sich Hanekes Mörder nicht, kein Spot fällt auf die Hintergründe ihres Handelns. Auch das perfide Katz- und Mausspiel, das die beiden Burschen in Funny Games mit der Familie in ihrem Ferienhaus am See treiben, richtet sich nicht nach den Regeln des Spannungskinos. Haneke bricht mit gewohnten Konventionen, nicht zuletzt, wenn sich die Delinquenten nicht um die sogenannte Vierte Wand kümmern und mitunter direkt in die Kamera und somit uns anblicken und ihre Handlungen selbst auf zynische Weise kommentieren. Arno Frisch und Frank Giering sind die zwei jungen Männer in der ursprünglichen Fassung des Stoffes aus 1997, Michael Pitt und Brady Corbet in der bildidenten amerikanischen Version zehn Jahre später, Susanne Lothar und Ulrich Mühe stehen im ersten Film Naomi Watts und Tim Roth im zweiten gegenüber – brillante Darstellungen allesamt. „Ich versuche Wege zu finden, um Gewalt als das darzustellen, was sie immer ist, als nicht konsumierbar“, sagte Haneke einmal. Die lakonische Hand des Regisseurs, die Banalität des Tötens und des Sterbens – ein höhnischer Kommentar auf mögliche Erwartungen von Zuschauer:innen, die von Genrefilmen üblicherweise brav bedient werden: etwa wenn bei einem Auszählspiel das nächste Opfer eruiert werden soll und jenes Familienmitglied stirbt, von dem man es am wenigsten erwarten würde, nämlich das Kind (Stefan Clapczynski/Devon Gearhart); oder wenn die Mutter endlich wieder auf die Beine kommt, entdeckt, dass ihr Mann doch nicht tot ist, und sich auf die Suche nach Hilfe macht – nur um auf die sich nähernden Scheinwerfer zuzulaufen, die sich alsbald als der Wagen der Mörder entpuppen.
Die 71 Fragmente stellen eine sachlich-kühle Chronologie der Abfolge von Ereignissen dar, die dem Amoklauf eines Studenten vorausgehen. Dieser erschießt zu Weihnachten 1983 in einer Bankfiliale drei Menschen und dann sich selbst. Hanekes distanzierte Darstellungsweise der Sequenzen, die durch Schwarz-Weiß-Bilder voneinander getrennt sind und deren Zusammenhang sich den Betrachter:innen erst allmählich erschließt, sorgt bei diesen für nachhaltige Verunsicherung, aber auch anhaltende Faszination. Eine Angestellte der Bank, ein Waffendieb, ein kinderloses Ehepaar, ein Flüchtlingsbub und eben auch der Pensionist aus der Telefonszene werden in Ausschnitten aus ihren Alltagsverrichtungen in der Zeit vor der Katastrophe gezeigt, mit der sie auf teils sehr lose, deshalb aber nicht weniger schicksalhafte Weise verbunden sind. Ihnen gemein sind die soziale Isolation und die schier unerträgliche Einsamkeit, die sie gefangen hält wie unsichtbare Ketten.
So verhält es sich auch im Falle des alten Mannes am Telefon. Wie unter einem Vergrößerungsglas verfolgt die Kamera das Spiel der Emotionen in seinem Gesicht und der Stimme. Eine Art laborhafte Versuchsanordnung ist das, die schreckliche Isolation, die Einsamkeit und Trostlosigkeit dieses Menschen werden zwar registriert, bleiben aber in Distanz wie die Fernsehnachrichten oder auch die Tochter am anderen Ende der Telefonleitung. Die fragmentarischen Szenen des Films treiben auf die sinnlose Amoktat am Ende zu, die Gewalt findet aber auch schon vorher statt, in der alltäglichen Sprachlosigkeit zwischen Eheleuten, der seelischen Verkümmerung eines Straßenkindes und eben auch zwischen einem Vater und seiner Tochter, die ihn nur aus schlechtem Gewissen angerufen hat.
71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls
(Österreich/Deutschland 1994)
Bennys Video (Österreich/Schweiz 1992)
Der siebente Kontinent (Österreich 1989)
Funny Games/Funny Games U. S. (Österreich 1997;
USA/GB/Frankreich/Österreich 2007)
Aus dem Regen in die Hölle
A Clockwork Orange
Singin’ in the Rain
In der romantischen Komödie Shakespeare in Love (1998) wünscht sich Judi Dench als Königin Elizabeth I. von ihrem Dichterbarden mehr Szenen mit bissigen kleinen Hunden – sie ist der großen Dramen müde und möchte auf lustige Weise unterhalten werden. Für Donald O’Connor in der Rolle von Gene Kellys Sidekick Cosmo Brown in dem Filmmusical Singin’ in the Rain wäre dies keinesfalls von Schwierigkeit gewesen – er erledigt mit Leichtigkeit genau das, was sein Song mit dem Titel „Make ’Em Laugh“ verspricht. Darin philosophiert er über die verschiedenen Typen von Menschen und die unterschiedlichsten Arten, sie zum Lachen zu bringen.
Zu Beginn sitzt er noch brav am Klavier, doch gleich darauf springt er schon auf und beginnt einen Parcours an Tanz und Stepp und Akrobatik, der vergleichbar mit der grandiosen Körperbeherrschung der großen Stummfilmkomiker wie Chaplin, Harold Lloyd und Buster Keaton ist und wahrlich seinesgleichen sucht. Ganz in ihrem Sinne schlägt O’Connor anstelle von hoher Kultur die Platzierung von Bananenschalen zwecks lacheffektvollen Ausrutschens vor. Was er mit seinem Hut, mit von Arbeitern herumgetragenen Holzbrettern, einem Sofa und einer Stoffpuppe darauf aufführt, wurde mit nur ganz wenigen Schnitten gedreht und ist nicht nur deshalb schier unglaublich. Er demonstriert tausend Arten, sich auf den Boden zu werfen, schlägt sich selbst k. o. und läuft sogar die Wände hoch – bis er durch eine bricht; und erreicht dabei natürlich auf einzigartige Weise sein Ziel, uns zum Lachen zu bringen.
Solche Leichtigkeit und Eleganz, hier jedoch mehr in Richtung Lächeln, finden wir auch in einer anderen, der berühmtesten Szene des Films. Da ist jemand total verliebt, er tanzt auf der Gasse und kümmert sich keinen Deut darum, dass es in Strömen regnet. Er stapft durch Pfützen, lässt den Schirm rotieren und stellt sich unter den Wasserstrahl aus einer Regenrinne. Eine Art Schwebezustand des reinen Glücks ist das, ein Tanz in einer Welt, die abgehoben ist von der schnöden Wirklichkeit. Gene Kelly bewegt sich in der ihm so eigenen leichtfüßigen Weise durch eine Revue an eingängigen Musicalnummern rund um die Turbulenzen, die das Aufkommen des Tonfilms in Hollywood verursacht – eine Thematik, die Damien Chazelle im Bombast von Babylon (Babylon – Rausch der Ekstase, 2022) jüngst in Grund und Boden stampfte. Gene Kellys tänzerische Präzision hingegen wird gebrochen durch die liebevolle Ironie und den spielerischen Übermut der Inszenierung; was sich hier auf der Leinwand vor uns abspielt, ist getragen von unbändiger, lustvoller Freude am Tanz und am Leben an sich.
Um so etwas wie Lust geht es auch in Stanley Kubricks A Clockwork Orange, doch hier ist alles ganz anders geartet. Es ist „the old in-out“, wie es Alex (Malcolm McDowell), der Anführer einer Jugendbande, in seinen sarkastischen Kommentaren aus dem Off bezeichnet. Aus purer Langeweile und der Lust an Zerstörung und Gewalt dringt Alex zusammen mit seinen Ganovenkumpeln in einer regnerischen Nacht unter dem Vorwand eines Unfalls in die Villa eines Schriftstellers ein. Er schneidet den Hosenanzug von dessen wehrloser Frau in aller Seelenruhe mit einer Schere auf, währenddessen stimmt er „I’m singin’ in the rain“ an und schlägt ihren Mann im Takt des Liedes zum Krüppel. Er knebelt und vergewaltigt die entblößte Frau und grölt „I’m ready for love“, und dazu wippt die phallusartige Plastiknase seiner Augenmaske. Mit ihren schwarzen Melonen, den Schlagstöcken, ihren riesigen Penishülsen und den schweren Stiefeln wirken Alex und seine Kumpane wie gestapomäßig-verzerrte Chaplinkarikaturen. Das Leid seiner Opfer scheint Alex nicht zu berühren, er setzt seine brutalen Akte mit der gleichen unbekümmerten Selbstverständlichkeit, mit der Gene Kelly durch den Regen tanzt. Es genügt, dass ein Polizist die Hände in die Hüften stützt und streng schaut, und schon sieht sich Kellys schelmischer Übermut gebremst. Eine solche Autorität würde Alex im Rausch der Gewalt wohl nicht einmal zur Kenntnis nehmen.
Später wird Kubrick Alex in einer psychiatrischen Anstalt einer Gehirnwäsche unterziehen, bei der er ohne Unterlass Bildern von jener abartigen Art ausgesetzt wird, die er bislang selbst produziert hat. Wiederholt wird Alex eine Lösung in die Augen getropft, die dabei durch Klammern aufgespreizt sind, er kann den Blick nicht abwenden von dem, was sich vor ihm auf der Leinwand abspielt. Auch diese Momente sind in die Filmgeschichte eingegangen, in ihrem Gegensatz zwischen der Brutalität des Gezeigten und der heiteren Musik erscheint uns die regenmusikalische Folterszene aber noch stärker.
Kubricks Inszenierung nimmt Anleihen beim klassischen Ballett und dem Ausdruckstanz, wie auf einer Bühne bewegen sich die Figuren durch ihren perversen Reigen. Sie unterhalten sich in einer Kunstsprache mit eigenem Vokabular, ihre Mimik und die Gesten wirken auf uns outriert, die ganze Szenerie atmet eine Art von Künstlichkeit, wie sie mit den klassischen Musicalverfilmungen Hollywoods vergleichbar ist, unter denen Singin’ in the Rain eine der gelungensten ist. Auch Kubricks Bilderfolgen vermitteln eine Art von traumhaft-fantastischer Qualität, doch befinden wir uns hier zweifellos in einem Albtraum. Gene Kellys Verliebtheit trägt ihn direkt in den siebenten Himmel, Kubricks Orgie der Gewalt hingegen ist ein „highway to hell“.
A Clockwork Orange (Uhrwerk Orange, GB/USA 1979)
Singin’ in the Rain (Du sollst mein Glücksstern sein, USA 1952)
Mutterliebe
Alien-Tetralogie
Eine Frau, Ellen Ripley, ist in ihrem Leben an einem Punkt angekommen, an dem sie keinen Ausweg mehr sieht. Sie hat keine Kraft mehr, sich gegen ihr Schicksal aufzulehnen, sie hat sich den Kopf geschoren und sieht aus wie die Insassin eines Gefangenenlagers – und das ist sie auch, gestrandet auf einem Planeten, auf dem Gewaltverbrecher kaserniert sind. Jetzt ist Ripley nur noch müde, sie muss erkennen, dass all die geradezu übermenschlichen Anstrengungen, die sie den Aliens in wiederholten Auseinandersetzungen entgegensetzte, umsonst waren.
In einem hochdramatischen Moment wird sie von einem der Monster in die Enge getrieben und hat den Tod schon vor Augen. Es kommt ihr ganz nah, doch es lässt ihr das Leben. Ripley schwant daraufhin Unheilvolles. Mithilfe eines Scans verschafft sie sich Klarheit, dass sie mit einem außerirdischen Embryo schwanger ist. Dass sie bei der Geburt des Monsters sterben wird, ist ihr natürlich klar. Alles, was ihr in der Klimax von Alien 3 noch vor Augen steht, ist, die Brut, die sie in sich trägt, zu vernichten.
In der Natur gibt es Heuschrecken, die in Seen springen, weil die Würmer, die sie im Leib haben, in der nächsten Lebensphase Wasser brauchen. Ähnlich wie diese Parasiten, die die Kontrolle über ihren Wirt übernehmen, gehen die Aliens im Film vor, doch Ripley stemmt sich gegen dieses Schicksal in einem letzten Akt der Selbstbestimmung, in der einsamen Entscheidung, das Monster, das in ihr heranwächst, mit in den Tod zu nehmen. Sie lässt sich von einem Gerüst aus in das rot glühende Flammenlodern eines Hochofens fallen. Sie stürzt aus großer Höhe und hat die Arme ausgebreitet wie eine Gekreuzigte. Regisseur David Fincher inszeniert diesen Sturz in den Tod in Zeitlupe, als schier endlose Sequenz des Sterbens. Dabei gebiert Ripley das Alien. Ihr Brustkorb zerbirst, das Monster bricht aus ihr hervor, und in diesem Moment schließen sich Ripleys Hände darum. Sie hält das kleine, geifernde, zischende Alien fest, um ein Entkommen im letzten Augenblick zu verhindern, gleichzeitig aber hält sie es wie eine Mutter ihr Kind und streicht über seinen Kopf wie über den eines Neugeborenen: mit so etwas wie Resignation, mit so etwas wie Liebe.
Die wesentlichsten Szenen aus den in unterschiedlicher Qualität gelungenen mittlerweile vier Alien-Filmen, in denen Ripley auftritt, stehen in kausalem Zusammenhang mit diesem Opfertod aus dem dritten Teil. Schon in Ridley Scotts Alien, dem stilprägenden Ersteintrag in die Ästhetik der Saga und die inhärente Serienlogik, muss Ripley miterleben, wie zum ersten Mal eines der außerirdischen Monster aus dem Brustkorb eines Crewmitgliedes birst. Ein Facehugger aus einem Alien-Ei hat sich John Hurt aufs Gesicht geheftet und ihm unbemerkt seine todbringende Brut eingeflößt. Das hässliche Ding ist dann abgefallen und Hurt hat sich mit Heißhunger an den Esstisch gesetzt, in diesem Moment kommt die Szene mit den von innen nach außen brechenden Knochen, dem spritzenden Blut und dem geifernden Baby-Alien ganz und gar unerwartet und mit geradezu unerhörter Vehemenz. Als sie in Alien 3 selbst schwanger ist, weiß Ripley demnach, was ihr blüht, ihr Schicksal steht ihr glasklar vor Augen.
Das Dahingemetzel der gesamten Besatzung stellt das Gerüst der Geschichte sämtlicher Teile dar, so auch in James Camerons Aliens. Darin muss Ripley erfahren, dass ihr das gemeinsame Leben mit ihrer Tochter durch Jahrzehnte im Hyperschlaf gestohlen wurde, konsequenterweise ist ihr die Rettung eines kleinen Mädchens als einzige Überlebende einer von den außerirdischen Ungeheuern heimgesuchten Planetenstation ein Anliegen. Camerons Beitrag ist der bei Weitem martialischste der ganzen Reihe, die Tagline „This time it’s war“ sagt alles. Mit einer kruden Mischung aus Maschinengewehr, Pumpgun und Flammenwerfer zieht Ripley gegen die Alien-Queen ins Feld. Im Kampf Frau gegen Frau, Mutter gegen Mutter, steht sie im Finale des Films ganz allein der Eier legenden Königin gegenüber und zerstört deren monströse Brut in einer Orgie aus Kugelsalven und Flammenstößen.
Es gibt eine Reihe von Szenen aus den anderen Alien-Filmen, die im Gedächtnis bleiben, allesamt einzigartige Höhepunkte des futuristischen Horrorkinos. In einem besonders schaurigen Moment im vierten, in vielerlei Belangen weitaus schwächeren Teil Alien Resurrection sieht sich die geklonte Ripley mit missglückten Versionen ihrer selbst konfrontiert – sie wurde sozusagen zur Mutter ihrer selbst.
Abgestorbene, nicht lebensfähige Klone in allen Stadien der Entwicklung befinden sich in diversen Behältnissen in einem Labor, mit gefletschten Zähnen, Wasserköpfen, verkrümmtem Rückgrat und groben Wundnähten, starren ihr aus toten Augen und verzerrten Fratzen entgegen und sind schaurige Zeugnisse der frankensteinartigen Experimente, die mit ihrem Erbgut vorgenommen wurden. Ein Ripleymonster, festgeschnallt und an allerlei Schläuchen hängend, mit einem monströsen Klauenarm und einem blutigen Einschnitt in der Brust, fleht sie unter unerträglichen Schmerzen an, sie von ihrem Leid zu erlösen: „Kill me!“
Dieser Anblick geht nicht nur Ripley nahe, sondern auch uns, unter Tränen verwüstet sie das Labor, das registrieren wir mit Erleichterung wie zwei Folgen zuvor ihr Wüten im Brutraum der Alien-Queen.
So weit kommt es in Alien 3 nicht, hier bietet sich Ripley nicht einmal die geringste Möglichkeit eines Auswegs. Sie hat den sicheren Tod bei der Geburt vor Augen, und ihr bleibt nur der Selbstmord, will sie ein weiteres Ausbreiten der Spezies verhindern. Doch es ist nicht Angst, die sie einhüllt, als bestünde die Welt aus nichts anderem mehr, es ist keine Form von Furcht, die ihr so übermächtig erscheint, dass jeder Gedanke an ein Entkommen aus dieser irrwitzigen Situation ihrer Schwangerschaft mit einem außerirdischen Embryo undenkbar wird. Hingegen hat sich Ripley großer Ruhe bemächtigt. Hier trifft ein geläuterter Mensch, eine Frau, die nichts mehr erschrecken kann, eine ganz eigene, eigenständige Entscheidung.
In einem späteren Director’s Cut begnügte sich Regisseur David Fincher, der bei seinem ersten Filmprojekt mit einem ständig geänderten Drehbuch und Einmischungen durch das Studio zu kämpfen und dennoch eine faszinierende und unverwechselbare Arbeit abgeliefert hatte, mit Ripleys Tod, die Geburtsszene aber schnitt er wieder heraus. Eine unverständliche Entscheidung, denn sie gibt der Alien-Reihe einen Moment des Verständnisses der psychologischen Tiefe ihrer Protagonistin, der schließlich nichts weniger als ersten Actionheldin der Filmgeschichte.
Alien (Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt,
GB/USA 1979)
Aliens (Aliens – Die Rückkehr, USA 1986)
Alien 3 (USA 1992)
Alien Resurrection (Alien – Die Wiedergeburt, USA 1997)
Leben, um zu sterben
Amour
Eine Geschichte von der Liebe und dem Tod, erzählt von William Shakespeare in seinem Sonnet mit der Nummer 73. Ein Geliebter, der in sich schon den Tod spürt, herbstliche Blätter, und schließlich die Dämmerung zur Nacht, in der ihn der Schlaf zu überwältigen drohe: „Death’s second self.“ Und aus der unbedingten Vorstellung, bald sterben zu müssen, folgert die Beschwörung der Liebe zur Jugend: „This thou perceiv’st, which makes thy love more strong,/To love that well, which thou must leave ere long.“
Eine andere Geschichte, doch auch sie handelt von den beiden genannten grundlegenden Parametern des Menschseins. Michael Hanekes Amour ist eine Studie vom Abschiednehmen und der Bereitschaft, für den geliebten Menschen zum Äußersten zu gehen. „Comes the darkness and the frost, I get lost, I grow old“, singt Frank Sinatra in „Stay With Me“, einem Lied vom Erkalten von dem, was das Leben lebenswert macht. Und er setzt fort: „I grow weary, and I know I have sinned/And I go seeking shelter and I cry in the wind.“ Es gibt Szenen in dem Film, die genau dieses Hadern mit dem Unvergänglichen verhandeln, auf kühle, fast distanzierte, dennoch auf menschlich zutiefst berührende Weise.
Der Streifen gelangte durch die Auszeichnungen mit der Goldenen Palme in Cannes, einem Golden Globe und einem Oscar zu allerhöchsten Ehren und internationaler Bekanntheit, wie sie das kammerspielartige Drama sonst wohl nicht erfahren hätte. Amour besticht durch die stringente Geradlinigkeit seiner Bildkompositionen, Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant sind großartig als gut situiertes Pariser Ehepaar, Anne und Georges, das dem Ende entgegenblicken muss. Anne erleidet einen Schlaganfall und ist halbseitig gelähmt, sie will nicht mehr essen und trinken und kann sich kaum mehr artikulieren. Ihr Mann pflegt sie aufopfernd, kommt mit ihrem Leiden aber nicht zurecht: ihre endlosen Rufe nach Hilfe, ihr Klagen, ihr Wimmern. Da beginnt Georges, ihr die Geschichte eines Sommers seiner Kindheit zu erzählen, eine lange Sequenz ohne Schnitt ist das, sie im Bett, er an ihrer Seite, ihre Hände in den seinen. Streicheln, die Beruhigung des Atmens, dann liegt sie wieder völlig emotionslos vor ihm, wie eine Fremde. Da packt Georges plötzlich ein Kissen und drückt es auf ihr Gesicht, er wirft sich mit seinem ganzen Gewicht auf sie, ein Tötungsakt, der einem Liebesakt entspricht; und erst, als sie sich nicht mehr rührt, lässt er von ihr ab. Der Verfall des Körperlichen, auch des Geistes. „Ich schreibe das ganz bestimmt aus Verzweiflung über meinen Körper und über die Zukunft mit diesem Körper.“ – Franz Kafka war bei dieser Selbstbetrachtung erst 27.
Dass er im Grunde genommen nur leben würde, um letztendlich zu sterben, beklagt Jonny Lang in seiner herzzerreißenden Bluesballade „Dying to live“, und darüber hinaus sein Leid bei dem Gedanken, dass es niemanden wirklich kümmern würde, ob er denn lebe oder sterbe. Und dann die alles entscheidende Frage, warum sich überhaupt noch am Leben festzuhalten: „Why am I dying to live/If I’m just living to die?“ Eine trotzige Antwort: „So I’ll keep fighting to live, Till there’s no reason to fight/And I’ll keep trying to see, Until the end is in sight.” Und das Resümee: „You know I’m dying to live/Until I’m ready to die.“
Die Szenen aus Amour können wir in diesem Sinne als Momente vom Bereitsein zu gehen sehen, aber auch als solche, für einander Sorge zu tragen, selbst in allerletzter Konsequenz.
Amour (Liebe, Frankreich/Deutschland/Österreich 2012)
Sprache, die aus dem Innersten kommt
And Then We Danced
In diesem betörenden Filmpoem des schwedischen Regisseurs georgischer Herkunft Levan Akin dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um den traditionellen georgischen Tanz mit seinen streng festgelegten Regeln, was die Abläufe von Bewegungen betrifft, und dem, was der hinreißende Tänzer und Schauspieler Levan Gelbakhiani in seiner ganz individuellen Spielart daraus macht. Gelbakhianis Wandlungsfähigkeit bewegt sich zwischen der fast naiven Unschuld und introvertierten Ernsthaftigkeit eines Menschen, der reinen Herzens ist, über ausgelassene Glückseligkeit in Momenten, in denen ihm dieses Herz übergeht, bis hin zu großer physischer Sinnlichkeit, wenn er sich mit nacktem Oberkörper im Tanz wiegt. Es ist verblüffend, dass er in einer Szene sehr jung und knabenhaft wirkt, und in der nächsten desillusioniert von den Erfahrungen, die ihm das Leben vor die Füße wirft. Auf ungemein authentische Weise verkörpert dieser wunderbare Darsteller einen jungen Mann namens Merab, für den das Tanzen die Welt bedeutet, der aber an den Gegebenheiten der staatlichen Ausbildungsstätte, an der er täglich bis zur Erschöpfung trainiert, diesem Korsett, das ihm die Luft zum Atmen raubt, zu scheitern droht.
Dass der georgische Tanz den Geist der Nation ausdrücke, formuliert der gestrenge Ausbildner nicht nur einmal, der Ausdruck des Maskulinen ohne Raum für Schwächen, und dass die Tänzer dabei steif wie Nägel sein müssten; sein Ton ist dabei barsch, seine Anweisungen hören sich an wie militärischer Drill. Harte Trommelschläge bilden den musikalischen Hintergrund zu den ruckartigen Bewegungen der Arme und dem Aufstampfen der Beine; alles mutet wie martialisches Marschieren an, kein Fließen, keine Weichheit, keine tieferen Gefühle sind zugelassen.
Es ist genau dieser Aspekt, der Merab zu schaffen macht und weswegen er vom Ausbildner beim Training immer wieder gemaßregelt und bloßgestellt wird. Die patriarchalischen Strukturen der georgischen Gesellschaft werden in diesem Umfeld nicht reflektiert, sie scheinen unweigerlich festgeschrieben. Auch Mary (Ana Javakishvili), Merabs Tanzpartnerin und seine beste Freundin, sowie die Partnerinnen der anderen Tänzer müssen sich diesem Bild unterordnen, sie hätten, wird ihnen eingeschärft, jungfräuliche Unschuld auszustrahlen.
Merabs dramatisches Aufbegehren gegen diese eine Seite der zweischneidigen Medaille, die das Tanzen für ihn bedeutet, seinen Ausbruch aus dem Gefängnis, zu dem sein Leben in immer unerträglicherer Weise wird, zelebriert Regisseur Akin als Hohelied der Eigenart und Einzigartigkeit, der Vielfalt und der Selbstbestimmung des menschlichen Individuums – und auch als jenes der schwulen Liebe. Die Produktion und Realisierung des Films mit den ungeheuren Schwierigkeiten, mit denen das Team beim Dreh in Tiflis zu kämpfen hatte, spiegeln auch außerhalb der filmischen Erzählung genau diese Aspekte des Kampfes gegen die Windmühlen gesellschaftspolitischen Unbills wider. Zur Ruhigstellung der Behörden wurde diesen die Geschichte eines Franzosen vorgelegt, der sich in die georgische Kultur verliebt hätte. Doch trotz der Ablenkung vom wahren Inhalt des Films kam es zu massiven Bedrohungen und dadurch zu ständigen Verschiebungen der Drehorte und nicht zuletzt im Umfeld von Kinovorführungen des Films in Georgien zu tumultartigen Ausschreitungen; der Name des brillanten Choreografen der finalen Tanzszene des Films wird im Abspann nicht genannt – dieser müsste laut Regisseur Akin sonst um seinen Job bangen.
Vor diese Frage der Möglichkeit der Liebe und vielleicht sogar Beziehung zwischen zwei schwulen Männern angesichts der homophoben Einstellung eines Großteils der georgischen Gesellschaft sieht sich Merab gestellt, als einer der Tänzer aufgrund von Gerüchten über seine Homosexualität aus der Truppe verbannt wird und in der Person von Irakli (Bachi Valishvili) Ersatz zu ihnen stößt. Irakli ist anfangs Merabs Rivale, wird aber alsbald zum Objekt seiner sehnsüchtigen Blicke und seines Sehnens nach Nähe. Es genügt, mit Irakli in dessen Zimmer zu sein, ohne dass mehr als Reden zwischen ihnen passiert, und in Merab geht eine merkliche Veränderung vor sich. Wir sehen den zuvor stets ernsten jungen Mann auf einmal lächeln, ja strahlen.
Merab hat in seinem Leben eine Situation erreicht, die der französische Philosoph und Schriftsteller Roland Barthes in seiner Theorie der Fotografie mit dem Ausdruck „punctum“ bezeichnet. Es ist etwas Verstörendes, mit dem ein Kunstwerk den Betrachter besticht, etwas, das ihm ins Auge springt und – wenngleich an ihr verhaftet – die Oberfläche aufreißt. Dieses verstörende Element wird für Merab durch Irakli verkörpert. Allein seine Existenz und im weiteren Verlauf des Narrativs seine menschliche Zuneigung sprengen für Merab jene Grenzen in dem – um Barthes Terminologie zu verwenden – Kunstwerk, das sein Leben darstellt, die Merab bislang für bedrückend, wenngleich unabänderlich gehalten hat. Akin inszeniert Szenen des nächtlichen Treffens von Merab und Irakli hinter einem Felsen, als hätten die beiden als Figuren in Shakespeares Zauberwald vom Baum der Erkenntnis genascht und, in einer Umkehrung der Paradieserzählung, dadurch ihren ganz persönlichen Garten Eden entdeckt. Sie sitzen beisammen, Merab legt den Kopf auf Iraklis Schulter, es folgen ein Kuss und Sex in einer Leidenschaft, die die beiden wohl noch nie erlebt haben. Zumindest Merab, so viel ist klar, hat jenen Punkt der Erkenntnis über sich selbst und sein wahres Ich erreicht, an dem es für ihn kein Zurück mehr gibt. Die Intensität, mit der er dabei mit seinen oft widersprüchlichen Gefühlen ringt, ist herzzerreißend anzusehen in Levan Gelbakhianis schmerzhaft direktem, ungeschminkt-ehrlichem Spiel.
Als Irakli verstummt, stürzt Merab ins Bodenlose; die Wut, auf eine solche Art tief in seiner Seele verletzt worden zu sein, macht ihm so sehr zu schaffen, dass er sich beim Training auch körperlich verletzt. Mary versorgt seinen Knöchel gerade mit kaltem Wasser, als sich Irakli meldet: Er sei bei seinem kranken Vater und habe kein Guthaben für sein Handy mehr gehabt. Merabs Erleichterung lässt ihn strahlen und offenbart seine Sehnsucht, als Liebender leben zu können und seinerseits geliebt zu werden; für einen Moment sind sogar die Schmerzen vergessen.
Merab setzt sein Training in den folgenden Tagen trotz seines verletzten Fußes fort, sein Ziel ist das Vortanzen um eine Stelle im Nationalensemble, das auch Tourneen im Ausland absolviert; nicht klein beizugeben, scheint für ihn wie der Kampf ums Überleben zu sein, er findet darin aber keinen inneren Frieden. Nur mit dem Ohrring, den Irakli einmal verloren und den er an sich genommen hat, in seiner Faust, gelingt es Merab, ein wenig Ruhe und Schlaf zu finden.
Regisseur Akin gestaltet den endgültigen Bruch zwischen den beiden Männern in einer penibel durchdachten und fließendelegant inszenierten Plansequenz. Merab bewegt sich darin zweimal durch die Wohnung, in der die Hochzeit seines Bruders gefeiert wird, eine den Brautleuten aufgezwungene Angelegenheit. Es ist ein Weg hin zu Irakli mit all den Hoffnungen, die Merab dabei in sich trägt, und es ist dann der Weg fort von ihm, der ihn zu einer folgenschweren Entscheidung treibt. Die traditionellen Speisen, die Musik – ein Mikrokosmos des Landes. Die verschiedenen Räume der Wohnung beherbergen die unterschiedlichen Gruppen, die die Bevölkerung Georgiens wohl ausmachen, die Alten und die Jungen, die Mittellosen wie Merabs Mutter und Großmutter ebenso wie den wohlhabenden Teil der Bevölkerung, repräsentiert durch die Familie der Braut, die Konservativen und jene, die insgeheim Geschmack an westlicher Lebensart gefunden haben. In einem Raum, dessen Tür er schließen kann und in dem Irakli und er sich doch nicht sicher sein können, unbeobachtet zu bleiben, entdeckt Merab schließlich den Geliebten am Telefon. Sie stehen einander gegenüber, als wäre der eine das Spiegelbild des anderen, und doch ist es ihnen unmöglich, noch weiter aufeinander zuzugehen. Es ist, ganz im Gegenteil, eine Szene der endgültigen Trennung. Dass sein Vater im Sterben liege und er wieder zu seiner Mutter ziehen würde, berichtet Irakli und rückt dann mit dem Eigentlichen heraus: Er sei verlobt und würde heiraten. Sicherheit für den Preis von Selbstverleugnung und Anpassung – nach Iraklis Abgang betrachten wir Merab von hinten, schluchzend sitzt er auf dem Bett, seine Schultern beben, er droht zusammenzubrechen. Doch dann geht eine Änderung in ihm vor. Er rafft sich auf, er zieht sein Sakko wieder an, er tritt aus dem eher düsteren Raum ins grelle Licht. Er lockert beim Gehen die Krawatte, sie scheint ihn zu ersticken wie vieles in diesem Umfeld. Die Kamera durchquert mit ihm abermals die Wohnung, es ist ein Abschied ohne Worte, Merab fühlt Blicke auf sich, ist in die Unterhaltungen der anderen aber bereits nicht mehr involviert, er hat nichts mehr mit ihnen gemein.
Die Kamera bleibt zurück, als Merab die Wohnung verlässt. Sie streift die Frauen am Buffet und die tanzende Braut und gelangt zu einem offenen Fenster. Unten im Hof sehen wir Merab ins Freie treten. Es ist offensichtlich, dass er auf eine Entscheidung zustrebt, die aus ihm einen neuen Menschen machen wird.
Davor schiebt Regisseur Akin noch eine wunderbar zarte Szene ein, in der zwei Brüder, die bislang so manches Problem miteinander hatten, einander ihre Liebe zeigen. Zu Hause schläft Merab in seinem Bett und wird durch leises Singen geweckt. Sein Bruder liegt ganz nah bei ihm, ihre beiden Köpfe, die Gesichter einander zugewandt, füllen das Bild. Der Bruder hat frische Wunden im Gesicht. Er habe sich um Merabs Ehre geschlagen, erzählt er, dieser sei von Hochzeitsgästen als Schwuler beschimpft worden – und die leise Frage: „Did I take a beating in vain?“ Die Augen der Brüder hängen aneinander, da ist ein festes Band zwischen ihnen. Merab vergräbt sein Gesicht an dem des Bruders, dieser streichelt seine Haare: Dass er als fetter, betrunkener georgischer Mann enden würde, der für seinen Schwiegervater arbeite, meint der Bruder, und dass er keine Probleme damit habe. Aber Merab, darauf pocht er, müsse das Land verlassen: „You have no future here.“
Im Tanz, der eine ganz andere Sprache sein kann als jene des Machismo und der Härte, findet Merab in der finalen, grandios choreografierten Szene des Films Worte, die ihm nicht mehr von einer Kultur oder Gesellschaft vorgegeben werden, sondern die seine ganz eigenen sind – sie kommen aus seinem Innersten in dieser Szene für die Ewigkeit. In diesem Sinne werden Merabs Bewegungen vor der Kommission, die über seine Aufnahme in die Nationaltruppe entscheiden soll, zum Akt der Selbstbehauptung. Gekleidet in einem traditionellen dunkelroten Gewand, beginnt er mit den einstudierten Schritten, aber schon nach kurzer Zeit dringt Blut durch den Verband an seinem Fuß. Ihm wird geheißen, das Vortanzen zu beenden, man habe genug gesehen. Doch es ist Merab selbst, der über den Zeitpunkt seines Abgangs entscheidet. So wie Billy Elliot im gleichnamigen Film und Musical nicht den klassischen Schwanensee tanzt, sondern jene Interpretation, die seiner wilden, aufgerührten Seele entspricht, wird Merabs Geschmeidigkeit, mit der er die Schritte und Sprünge zu seinen eigenen verbiegt und sie als Sprache seiner Seele aus dem Regelwerk des Tanzes schält, zu seiner Stärke. Merab drückt den Traditionen, nach deren Vorgaben er sein bisheriges Leben lang getanzt und auch gelebt hat, seinen eigenen Stempel auf. Seine weichen Gesten und modernen Moves brechen die vorgegebenen Figuren auf, sie sprengen sie ab wie eine Puppenhaut, und hervor tritt Merab, der Schmetterling, der ein Liebesspiel mit dem eigenen Ich vollführt und einen Tanz mit der Strahlkraft der Sonne heraufbeschwört, deren Gegenlicht durch die großen Fenster dringt und sich in den Spiegeln bricht. Merab hebt ab wie einst Gene Kelly im Regen und treibt dieses Gefühl der Losgelöstheit von irdischer Schwere sogar noch weiter – zu einem wahren Rausch der Sinne, einer Katharsis, der Reinigung von allem, was ihn beengt, was seinen Rücken gekrümmt und ihn auf den Boden gedrückt hat, zu seiner Erlösung. Wenn er neckisch die Schöße des Gewandes lüftet, das er beim Vortanzen getragen hat, wenn er es beim Verlassen des Raumes auszieht und achtlos zu Boden fallen lässt, ist das der Abgang eines jungen Mannes, der zu neuen Ufern aufbricht, um den Platz und die ihm eigene Rolle, die er darin spielt, zu entdecken.
And Then We Danced (Als wir tanzten,
Schweden/Georgien 2019)
Der Mensch als Tier
Animals
Es ist ein Triptychon der Angst in unterschiedlichen Ausformungen, das der belgische Regisseur und Drehbuchautor Nabil Ben Yadir mit seinem Film Animals auf bestürzend drastische Weise ausformuliert. Zwei Familienfeiern und dazwischen ein feiger Mord. Im ersten der drei Teile des Films ist es eine Geburtstagsfeier, in der der junge schwule Muslim Brahim Nervosität und Verunsicherung empfindet; das Flackern der Empfindungen, von der Sehnsucht über Unbehagen und Furcht bis hin zu nackter Panik in den Augen von Soufiane Chilah ist uns ein ständiger Begleiter. Obwohl von seiner Familie umgeben, streicht er durch das Haus und den Garten wie einer von Gus Van Sants verlorenen Figuren, die einfach nicht wirklich zu den Szenerien zu gehören scheinen, in denen sie sich bewegen. Seine Homosexualität stellt unter seinen Angehörigen ein Tabuthema dar, nur ganz wenige wissen darüber Bescheid, und selbst diese scheinen nicht auf seiner Seite zu sein. Das Bildformat von 4:3 versinnbildlicht Brahims Gefühl des Eingesperrt-Seins.
Im dritten Kapitel des Films ist es eine Hochzeitsfeier, wie als Spiegelbild zum ersten steht darin ein eher schmächtiger junger Mann mit blonden kurz geschorenen Haaren, Loïc (Gianni Guettaf), anscheinend außen vor, ist im Kreis seiner Familie mehr Beobachter als Akteur. Er war das über lange Zeit unauffälligste Glied in einer Gruppe von vier Männern, die im Mittelbild des Triptychons Brahim zu Tode gebracht haben. Brahim hat sich auf die Suche nach seinem Freund gemacht; obwohl zur Geburtstagsfeier erwartet, ist dieser nicht aufgetaucht. Dabei macht er den Fehler, zu vier Männern ins Auto zu steigen. Auch einer von ihnen hat Geburtstag, die Flasche kreist ständig, untereinander sind sie mehr Rivalen als Freunde; im unablässigen Rangkampf, wer der Härtere, Stärkere von ihnen sei, ein „echter Mann“ eben, fallen ständig Bezeichnungen wie Schwuchtel sowie Schwanzlutscher, und sie konzentrieren sich bald alle auf den stillen Brahim. Als sie ihn im Auto dazu zwingen, den Knopf des Schalthebels in den Mund zu nehmen, hält die Kamera unerbittlich auf das Bild.
An einer Tankstelle gelingt Brahim die Flucht aus dem Auto, er läuft davon und sucht Schutz in der Dunkelheit. Doch bald wird er von den vier Männern entdeckt, sie packen ihn an Armen und Beinen, schlagen ihn und ziehen ihn auf der verlassenen nächtlichen Straße nackt aus; schließlich verfrachten sie ihn in den Kofferraum des Wagens. Die Kamera befindet sich mit ihm in dieser Enge, sie lässt sein Gesicht nicht mehr aus dem Blick. Das Auto fährt offenbar von der Straße ab und rumpelt über eine Wiese oder ein freies Feld. Dass er sich nicht von der Stelle bewegen solle, wird ihm drohend durch die Heckscheibe mitgeteilt; dann entfernen sich die Männer vom Wagen, zuerst hören wir noch gedämpfte Stimmen, dann herrscht Stille. Minutenlang haben wir nun Brahims blutiges Gesicht vor uns, seine Verzweiflung, die zitternden Lippen, die gemarterten Augen, die stummen Worte, die die Lippen formen; hier gibt es keinen Schnitt, keine Verfälschung, aus diesem Grund tun die Szene und die folgenden auch so weh. Nach einiger Zeit kommt so etwas wie Hoffnung in Brahim auf, er ringt mit sich selbst, ob er bleiben oder den Versuch einer Flucht wagen soll. Doch darauf haben seine Peiniger in ihrem üblen Spiel offenbar nur gewartet. Kaum kommt Brahim aus seiner Starre und ein wenig in Bewegung, sind sie auch schon zurück.
Was nun vor sich geht, sehen wir im Bildformat von 16:9, wie eine Instagram-Story. Tatsächlich filmen und fotografieren die vier Männer Brahim, einander und ihre Taten die ganze Zeit und bis zum bitteren Ende. Taschenlampen fungieren als Spots in der Dunkelheit, als sie Brahim über die Wiese jagen. Sie schlagen ihn auf den Rücken und ins Gesicht, sie treten und beschimpfen ihn, sie packen ihn an den Haaren: Er ist ihr Opfer, er hat keine Chance, sie posieren mit ihm fürs Handy wie mit einer Jagdtrophäe, er solle „Cheese“ sagen, verhöhnen sie ihn. Eines von Brahims Augen ist mittlerweile zugeschwollen, sein Gesicht und sein Körper sind blutüberströmt, als er auf einmal vor Schmerzen aufbrüllt; erst als einer der vier Männer einen blutigen Ast vor die Handykamera hält, erkennen wir, dass er damit vergewaltigt wurde. Schreie sind das Letzte, was Brahim von sich gibt, hilflose Gestik geht ins Leere, als er in einem letzten Aufbäumen versucht, sich doch noch zu verteidigen. Sie lassen einen großen Stein auf seinen Rücken fallen, dann zielen sie damit auf ihn, im Vordergrund Brahims zitternde Hände.
Dass sie ihm zwei Minuten geben würden, um das Weite zu suchen, schüren sie in ihrem Hohn nochmals Hoffnung in dem nackten, blutenden Bündel unter ihren Füßen. Welch letzte Kraft es Brahim kostet, ein letztes Mal auf die Beine zu kommen! Er stolpert davon, sie laufen ihm nach, eine Art perverses Ballett, bis einer von ihnen ihn unter allgemeinem Gelächter huckepack auf die Schulter nimmt. Dann drischt ein anderer mit einem Stein auf seine Hand. Brahim liegt wie leblos auf dem Rücken und Loïc, der Schmächtigste und Stillste der Gruppe, das „Weichei“, sitzt auf ihm und schlägt wie von Sinnen auf ihn ein, schlägt ihn mit seinen Fäusten tot. „Jetzt bist du erwachsen geworden!“, jubeln die anderen. „Ich bin stark!“, brüllt Loïc geradezu euphorisch und trommelt sich blutige Muster auf die Brust seines Sweaters.
Wie benebelt ob des Ungeheuren, das wir mitansehen mussten, bleiben wir zurück. Wir folgen Loïc in der Morgendämmerung nach Hause und sehen, wie er sich den Anzug anzieht und zur Hochzeitsgesellschaft stößt. Das Bildformat hat wieder auf 4:3 gewechselt, die Gefühle des im Grunde genommen unsicheren Burschen ähneln jenen seines Opfers zu Beginn der Geschichte. Die sogenannte Männlichkeit, wie sie völlig außer Kontrolle gerät – der Film basiert auf einem realen Mordfall aus dem Jahr 2012, der offiziell als erster homophober Mord Belgiens gilt. Die Drastik, mit der Regisseur Yadir ihn darstellt, ist kaum auszuhalten, er lotet in seiner konsequenten Inszenierung die Grenzen des Zeigbaren aus. Wahrscheinlich genau deshalb gibt Yadir der Gewalt, von der wir tagtäglich aus den Medien erfahren, ein ganz reales, realistisches Gesicht von einem jungen Mann, der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war, und von den Tätern als rasende Raubtiere.
Animals (Belgien/Frankreich 2021)
Wohlgewählte Worte
Anonymus
Romeo and Juliet
Shakespeare in Love
William Shakespeare’s Romeo + Juliet
Wenn Romeo und seine Julia, die jungen Liebenden aus zwei verfeindeten Familien, im Scherz miteinander streiten, ob es denn die Nachtigall oder doch vielleicht die Lerche gewesen sei, die sie geweckt habe, ist das ein entscheidender Moment in Shakespeares Tragödie aus 1597 – als würde der Fluss der Zeit den Atem anhalten, als wäre den beiden ihre Hochzeitsnacht als kurzer Aufschub des Glücks im alsbald wieder so schlimmen Verlauf des Schicksals vergönnt. Sie erwachen nach ihrer ersten gemeinsamen Liebesnacht, ohne ahnen zu können, dass es ihre einzige bleiben wird.
In Franco Zeffirellis klassischer Inszenierung von 1968 wird Leonard Whitings Romeo vom Gesang der Vögel geweckt, er schlägt die Augen auf, und ein Lächeln umspielt seine Züge, denn da liegt Olivia Hussey als Julia in seinen Armen. Dass der Tag noch nicht herangebrochen sei, gibt Julia zu wissen vor: „It was the nightingale, and not the lark.“ Da ist sehr viel Zartheit zwischen den beiden, große Sanftheit und berührend-unschuldige Zärtlichkeit.
„Liebende schaffen sich ein Universum, in dem sie letztlich allein sind, der einzige Stern von unerträglicher Helligkeit“, schreibt der deutsche Autor Bodo Kirchhoff in seinem großen Lebensroman Die Liebe in groben Zügen (2012). In einem solch abgeschotteten Universum der größten denkbaren Nähe befinden sich Romeo und Julia, nichts von außen wollen sie an sich heranlassen, und die Emotionen sind so übergroß, dass dies ihnen für diese kurzen Augenblicke, die ihnen die Ewigkeit bedeuten, auch gelingt. Dennoch ist trotz der Liebesschwüre und der Küsse klar, dass Romeo das Weite suchen muss, schließlich hat der Konflikt zwischen den Familien bereits den Tod von Mercutio und Tybalt nach sich gezogen, und Nino Rotas Musik wallt auf wie die Gefühle des Paares, das sich in dieser bittersüßen Szene noch zu erkennen weigert, worauf die Geschichte unweigerlich hinausläuft.
Über dreißig Jahre später gibt es in Baz Luhrmanns Version des Stoffes dieses Aufblitzen von Erkenntnis, eine Art unheilvolle Vorahnung, als Romeo (Leonardo DiCaprio) von Julias (Claire Danes) Balkon in den Pool gefallen ist und dort wie tot treibt. Zuvor läuft dieselbe Szene unter ganz anderen Vorzeichen ab, in einem mit Heiligenfiguren und Ikonen religiös aufgeladenen Umfeld eines poppig-bunten Los Angeles kurz vor der Jahrtausendwende. Luhrmanns Inszenierung ist ein Transfer auf die Ebene der Fusion der Fremdheit des klassischen Textes mit den Codes des Gegenwärtigen. Gekämpft und getötet wird mit Pistolen statt mit Degen, an Stelle eines Lederwamses zieht sich Romeo weiße Boxershorts und ein Hawaiihemd über, das Dekor von Julias Jungmädchenzimmer ist barock überladen, moderne Rhythmen umschmeicheln die nackten Körper. Romeos Erwachen findet hier wie im Schock statt, in der Erinnerung an Tybalts Tod reißt er die Augen auf. Die Vögel zwitschern nur noch im Hintergrund, im Text finden sie keine Erwähnung mehr, es wurde stärker gekürzt als bei Zeffirelli. Die Vertrautheit zwischen den beiden Liebenden findet unter einem Laken statt, hier sind sie ganz für sich; wie ein Zelt liegt es über ihrer kleinen Welt und schottet sie von der rohen Wirklichkeit ab. Sie stemmen sich gegen diese Realität mit all ihrer jugendlichen Kraft und werden doch an ihr zerrieben.
Shakespeare in Love schließlich, John Maddens herrlich ironische und dann auch wieder wunderbar traurige Referenz auf das Stück und seine fiktive Entstehungsgeschichte, zeigt diese Liebesnacht als reales Erlebnis von William Shakespeare, der sich im elisabethanischen London mehr schlecht als recht als Dichterling durchschlägt. Aus dem Umstand, dass zu dieser Zeit Frauen das Schauspielen verboten war, entwickeln sich allerlei vergnügliche Verwechslungen. William (Joseph Fiennes in der Rolle, für die er geradezu geboren scheint) verliebt sich in die junge Adelige Viola de Lesseps (Oscar für Gwyneth Paltrow), die gegen ihren Willen mit einem versnobten Lord (Colin Firth) verheiratet werden soll, sich als Schauspieler verkleidet und bei den Proben zu Shakespeares neuestem Stück mit dem abstrusen Titel „Romeo and Ethel, the Pirate’s Daughter“ in der männlichen Hauptrolle auftritt. Kein Wunder, dass aus dieser Konstellation einige Verwirrung entsteht, doch als zumindest zwischen William und Viola klar ist, für wen sie denn da heftige Gefühle entwickelt haben, erleben sie eine Liebesnacht, die so wild ausfällt, dass die Amme vor dem Zimmer nur durch heftiges Stühlerücken so manche Lautentwicklung vor dem Rest der Dienerschaft geheim halten kann.
Dass sie eben herausgefunden habe, dass es Dinge gebe, die besser seien als ein Theaterstück, meint Viola im Laufe dieser Nacht zu ihrem Will: „Even your play.“ Beim Aufwachen inspiriert ein Dialog über Mondlicht versus Sonnenschein beziehungsweise den Weckruf des Hahnes im Gegensatz zu anderen Vermutungen Shakespeares Verseschmieden: „Believe me, love, it was the owl.“ Viola wird zu Williams Muse, der Rest des Stücks fließt geradezu aus seiner Feder.
Davon, dass dergestalt kreatives Schaffen vom Künstler mitunter als Art von Heimsuchung empfunden werden kann, erzählt Roland Emmerichs Anonymus





























