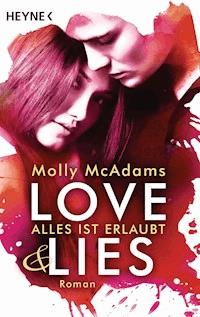6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Schon als Teenager ist Mandy in Nick verliebt, den Spross einer angesehenen Südstaatenfamilie. Dieser serviert das Mädchen aus einfachen Verhältnissen jedoch eiskalt ab. Als sich die beiden Jahre später wiedersehen, kehren sich die Rollen um. Nun buhlt der reiche Südstaatenjunge um ihre Gunst. Sein Glück: Mandy hat genug vom ehelichen Blümchensex und hungert nach wilder Leidenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Amelie C.
MANDYSVERLANGEN
Erotischer Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: © getty-images/Niko Guido
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
Datenkonvertierung E-Book:
Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1599-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
Im Zimmer roch es nach Sex. Eine Weile lang waren das rhythmische Knarren des Bettes und das Keuchen des Paares, das sich darauf wälzte, die einzigen Geräusche im Raum. Dann glitt der Mann mit einer geschmeidigen Bewegung von seiner Partnerin und bedeutete ihr, sich hinzuknien.
Sie gehorchte sofort, drehte sich herum und zog die Knie an, sodass ihm ihr pralles, wohlgeformtes Hinterteil entgegenragte. Er lächelte lüstern, als er die beiden Halbkugeln vor sich strahlen sah. Langsam streckte er die Hand aus, streichelte das feste Fleisch, kniff sanft hinein und presste sein Gesicht gegen die Pracht.
Sie wimmerte, bewegte sich unruhig unter seinen geschickten Fingern, die jetzt zwischen die beiden Halbkugeln wanderten und sich in die kleine, faltige Rosette stahlen. Mit der anderen Hand suchte er die heiße Spalte, die ihn feucht und vor Ungeduld zuckend erwartete.
»Mach endlich!« Stöhnend reckte sich die Frau den tastenden Fingern entgegen. »Oh, Carlo, Carlo, du machst mich verrückt.«
»Das will ich auch, meine Süße.« Er lachte ein raues, kehliges Lachen, das ihr sofort in ihre heiße Muschi fuhr und das Kribbeln darin verstärkte. »Ich will dich vor Lust schreien hören.«
Langsam teilte er die intimen Lippen, ließ seinen kundigen Zeigefinger in die vor ungebändigter Lust nasse Höhle eintauchen und verrieb den duftenden Nektar auf ihrem Damm. Dann wanderte der Finger wieder zurück, nahm erneut Feuchte auf, mit der er die Rosette einseifte, um auch dort einen Finger einzuführen.
Die Frau stöhnte. Sie liebte das irre Gefühl, hinten ganz gefüllt zu sein und gleichzeitig Carlos Finger an ihrer Spalte zu spüren. Ihre leuchtend rote Klitoris vibrierte vor Lust. Leonie wünschte sich sehnlichst, dass Carlo endlich den harten Knopf streicheln möge, um ihr damit noch intensivere Gefühle zu verschaffen.
Als er es endlich tat, stieß sie einen spitzen Schrei aus, dann hielt sie ganz still, um den ungeheuren Kitzel zu genießen, der sich immer weiter steigerte, bis sie glaubte, jeden Moment zu explodieren.
Aber Carlo war noch nicht bereit, ihr diese Erlösung zu gewähren. Er zog seine Hand zurück, beugte sich vor und griff nach ihren Brüsten, die sich bereitwillig in seine Hände schmiegten.
Ihre Nippel waren hart wie Kirschkerne. Er nahm sie zwischen seine Fingerspitzen, zwirbelte sie, zupfte daran, zog sie lang und ließ sie zurückschnellen, um dann mit sanften, kreisenden Bewegungen die empfindlichen Warzenhöfe zu massieren.
Leonie stöhnte leise unter den Liebkosungen. Ihr Becken bewegte sich unruhig hin und her, ihre Pobacken streiften dabei über die glänzende Eichel seines erigierten Gliedes, das genau auf ihre hintere Öffnung zielte.
Carlo sog wohlig die lustgeschwängerte Luft ein, während seine Finger die üppigen Brüste kneteten. Er genoss es, wie die zarte Haut der Hinterbacken seine Eichel reizte. Es war ein feines Kribbeln, das sich nur ganz allmählich seinen Weg durch den Schaft zu seinen Hoden bahnte. Aber mit jeder Berührung wuchs dieses Kribbeln und wurde schließlich zu einem Kitzel, der Carlo nach intensiveren Stimulationen gieren ließ.
Mit beiden Händen packte er die Hüften seiner Partnerin, zwang mit dem Knie ihre Schenkel weit auseinander und rammte ihr seinen kampfbereiten Speer in die feuchte Spalte, die ihn erfreut aufnahm.
Die heißen Wände schmiegten sich um den harten, geschwollenen Schaft, massierten ihn, saugten daran, als wollten sie ihn austrinken. Er spürte, wie der Gang sich verengte und die Kontraktionen heftiger wurden, während er langsam in die feuchte Hitze stieß.
Seine Hände hielten noch immer Leonies Hüften fest, sodass er das Tempo bestimmen konnte, mit dem er sie ficken wollte. Es sollte im langsamen Rhythmus geschehen, um ihr Verlangen noch zu steigern. Doch dann hielt auch er es nicht mehr länger aus. Er beugte sich vor, umfasste erneut Leonies prächtige Brüste und knetete sie, während er immer wilder zustieß.
Ihr Orgasmus kündigte sich in heftigen Konvulsionen an. Es war, als wollte ihr Schoß seinen Penis auspressen. Carlo stöhnte vor Gier, während er unkontrolliert an den harten Warzen zupfte und sie zwirbelte.
Immer fester saugte der Schlund an ihm, wollte sich den harten Penis gänzlich einverleiben. Es gab nichts mehr, was Carlo diesem unersättlichen Hunger entgegensetzen konnte. Noch ein Stoß, dann explodierte seine Lust in einem einzigen, gewaltigen Rausch und überschwemmte Leonies heiße Grotte mit einem Schwall warmen Saftes, der ihre Lust zu einem gewaltigen Höhepunkt führte.
Sie schrie, während es in ihrer Muschi zuckte. Gierig wollte diese Carlos Penis immer noch nicht loslassen, umfing ihn mit aller Kraft, während Leonie sich erneut unter heftigen Kontraktionen wand, die einen zweiten und dann noch einen dritten Orgasmus herbeiführten. Erst als auch die letzte Welle durch ihren Körper gerast war, entspannte sich ihre Vagina und Leonie sackte bäuchlings auf die Matratze nieder.
Sie keuchte laut, ihre Haut war mit einem dünnen Schweißfilm überzogen. Carlo betrachtete indessen aufmerksam seinen Penis, der bei diesem Ritt etwas in Mitleidenschaft gezogen worden war. Unter dem Wulst hatte sich die Haut aufgescheuert. Es war nur eine kleine Stelle, aber heute wollte er lieber keinen neuen Ritt mehr wagen, sonst würde sein Johnny am nächsten Tag nicht mehr einsatzfähig sein.
Himmel, diese Frau war wie ein Vulkan! Sie schien überhaupt nicht genug Sex bekommen zu können. Vier Mal hatte er es ihr heute schon besorgt, aber sie wollte immer noch mehr, gurrte und schnurrte um ihn herum wie eine rollige Katze, wild darauf versessen, ihn aufs Neue aufzugeilen.
Unwillkürlich rückte Carlo ein Stück von ihr weg, als Leonie sich aufrichtete. Aber sie hatte nicht vor, ihn zu einer neuen Runde anzufeuern. Und sie plante auch nicht, ihn für seine Einsatzbereitschaft zu loben. Stattdessen versetzte sie ihm einen derben Boxhieb in die Nieren, was Carlo mehr aus Schreck als aus Schmerz aufschreien ließ.
»Spinnst du?«, fuhr er sie an.
»Nein, du spinnst!«, fauchte sie zurück. Von dem liebestollen Kätzchen war jetzt nichts mehr zu sehen. Vor ihm saß eine wütende Tigerin, die ihn aus grünlich schillernden Augen anblitzte. »Wir haben ausgemacht, dass du nicht mit blankem Degen kämpfen sollst«, fuhr sie ihn an. »Und was tust du Idiot? Oh, Mann, ich muss das Zeug unbedingt loswerden!«
Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett und verschwand im Badezimmer. Carlo rieb sich derweil die schmerzende Seite. Verdammt, Leonie war selbst schuld, wenn er nicht dazu kam, seinen Lümmel einzupacken. Bei ihrer Gier und Ungeduld konnte kein Mann an solche Dinge denken. Sie hätte ihn eben nicht so heiß machen dürfen oder besser noch, selbst vorsorgen sollen.
Wozu gab es die Pille? Ach, zur Hölle mit diesem ganzen Weiberkram! Er focht nun mal am liebsten mit blankem Schwert, und ihr gefiel es auch besser. Sie sollte jetzt bloß nicht so tun und das Gegenteil behaupten!
Aus dem Bad drangen gurgelnde Geräusche, Wasser plätscherte, dann blieb es eine Weile still. Als Leonie zurückkehrte, hatte sie sich ein dünnes T-Shirt übergezogen, das ihr gerade bis zur Taille reichte. Beim Anblick des rasierten Venushügels begann Carlos Lümmel, leicht zu zucken, aber Leonies Miene verriet, dass ihr nicht nach Sex zumute war.
Sie setzte sich aufs Bett, überkreuzte die Beine, sodass Carlo freien Blick auf ihre klaffende Scham hatte, und griff nach der Flasche, die auf dem Nachttisch stand.
»Trinken wir darauf, dass der Schuss nicht getroffen hat.« Sie setzte die Flasche an die Lippen und trank ungeniert. Fasziniert beobachtete Carlo, wie die rote Flüssigkeit als schmaler Faden aus ihrem Mundwinkel zum Kinn rann und von dort auf das Shirt tropfte.
»Hier.« Sie reichte ihm die Flasche, aber er war nicht durstig. Er hatte sein lädiertes Familiensilber schon wieder vergessen, drückte Leonie in die Kissen zurück, schob ihr das Shirt hoch und ließ etwas von der Flüssigkeit auf ihre Brüste tropfen. Anschließend verteilte er das süßliche Zeug auf ihren Nippel, um es danach genüsslich wieder abzulecken.
Sie begann sich unter den Liebkosungen wohlig zu räkeln. Lächelnd ließ sie es zu, dass Carlo die Flasche erneut kippte, sodass der Inhalt nun zwischen ihren Brüsten hindurch in Richtung Schoß lief. Mit der Spitze seines Zeigefingers zog er eine Linie von der Mulde zwischen ihren Brüsten hinunter zu ihrem Nabel, ließ dort ein paar Tropfen in die schattige Senke laufen und führte den Flaschenhals dann weiter zu dem glatten Venushügel.
Bereitwillig spreizte Leonie die Schenkel, damit die Flüssigkeit auch über ihre Klitoris und in die Spalte rinnen konnte.
Carlo ließ sich Zeit. Zuerst schraubte er die Flasche fest zu, dann stellte er sie auf den Nachttisch und vertiefte sich erst dann in den Anblick seines Kunstwerks.
Sein Johnny war bereits zu einem beachtlichen Stamm herangewachsen, der zwischen seinen Schenkeln aufragte. Carlo rieb ihn zärtlich, während er sich hinkniete und begann, den süßlichen Alkohol von Leonies nacktem Körper zu lecken.
Hingebungsvoll reinigte er Millimeter für Millimeter ihrer Haut, verweilte schließlich bei dem kleinen Nabel und tauchte seine Zungenspitze in die Mulde, um die würzige Flüssigkeit herauszuschlecken.
Als er den Schamhügel erreichte, entfuhr Leonie ein wollüstiger Seufzer. Weit spreizte sie die Schenkel, um Carlos Zunge freien Zugang in jeden noch so verborgenen Winkel ihres Körpers zu gewähren. Aber er nahm sich erst einmal den Venushügel vor, um ihn in aller Gründlichkeit von dem sämig süßen Trank zu reinigen.
Vor Sehnsucht nach intensiveren Reizen begann Leonie leise zu wimmern, aber Carlo stellte ihre Geduld auf eine harte Probe. Erst als sie vor Ungeduld die Zähne aufeinanderschlug, erbarmte er sich und widmete seine Aufmerksamkeit ihrem nassen Kätzchen, das heftig zuckte, als er mit der Zungenspitze gegen den harten Knopf stippte.
Behutsam leckte er die Spalte entlang, schob die feuchte Spitze in die zuckende Öffnung und kostete genussvoll von dem warmen Nektar ihrer Lust, der sich mit dem Geschmack des Drinks vermischte.
Langsam, immer auf und ab streichend, schleckte er ihre Spalte aus, zupfte mit den Lippen an den empfindlichen Blättern und kitzelte die harte Knospe, die ihm entgegenwuchs.
Er sog sie in seinen Mund, ließ seine Zunge darauf tanzen, bis Leonie sich vor Lust unter ihm wand, und kehrte dann zu der muskelumschlossenen Öffnung zurück, um seine Zunge hineinzustoßen und sie von innen zu lecken.
Sie schmeckte köstlich. Carlo hatte noch nie eine Frau gehabt, die sich so reich verströmte und die so süß schmeckte wie Leonie. Immer heftiger reizte er ihr feuchtes, zuckendes Fleisch, um den Strom süßen Saftes anzuregen und ihn mit der Zunge aufzufangen.
Die Kontraktionen wurden rhythmisch, wollten die neckende Zunge melken.
Carlo genoss es, den nahenden Höhepunkt seiner Geliebten auf diese Weise zu fühlen und die süße Schärfe zu schmecken, die der Explosion vorausging. Als es so weit war, ergoss sich ein heißer Strahl über seine Zunge.
Gierig trank er den Nektar, leckte die zuckende Schale aus, bis Leonies Körper erschlaffte und sie sich mit einem entspannten Seufzer in die Laken schmiegte.
Er ließ ihr ein paar Minuten Zeit, sich von der Eruption zu erholen, dann kniete er sich mit gespreizten Schenkeln über sie, sodass sein mächtiger Phallus wie ein Pfahl vor ihr aufragte.
Leonie lächelte zärtlich.
»Gib mir bitte die Flasche.«
Carlo beugte sich zur Seite, um ihr das Gewünschte zu reichen. Leonie legte den Daumen über die Öffnung, um die Flüssigkeit besser dosieren zu können, umfasste mit der anderen Hand Carlos pralles Glied und schob die Vorhaut zurück.
Gezielt ließ sie ein paar Tropfen der roten Flüssigkeit über die glänzende Eichel rinnen, verteilte sie darauf und schüttete nach, um die Nässe dann mit massierenden Bewegungen auf dem Schaft und den Hoden zu verreiben.
Damit der Drink nicht zu schnell verlief, streckte Carlo sich nun auf dem Laken aus und spreizte leicht die Schenkel, damit Leonie dazwischen knien und sich ganz der Reinigung seines Lümmels widmen konnte, was sie mit großer Sorgfalt und Hingabe tat.
Zunächst leckte sie den empfindlichen Damm zwischen seiner hinteren Öffnung und den Hoden sauber, lutschte dann genießerisch die beiden Lustbälle ab und arbeitete sich von dort den Schaft empor, bis hinauf zur Eichel, die besonders dankbar auf Leonies Zungenspiel reagierte.
Zunächst leckte sie nur darüber, um die klebrig samtige Spitze dann mit sanften Bissen zu necken, bis Carlo vor Behagen schnurrte wie ein satter Kater. Sein Becken bewegte sich unruhig vor und zurück, als wollte er in Leonies Mund stoßen, den sie ihm aber noch verwehrte. Erst als seine Züge sich anspannten und seine lustvolle Qual widerspiegelten, beschloss sie, ihn noch mehr zu verwöhnen.
Nach einem zärtlichen Kuss auf die Spitze, schob sie ihre Lippen über die geschwollene, feste Kuppel, saugte sie erst tief in ihren Mund hinein und malte dann mit der Zungenspitze kleine Kreise darauf.
Dann ließ sie den inzwischen prallharten Speer ein Stück herausgleiten, damit sie mit der Zungenspitze die winzigen Lippen liebkosen und den goldgelben Met-Tropfen aus der Öffnung schlecken konnte.
Carlo stöhnte vor Lust, als ihre Zunge ihn drängte, um noch mehr von dem köstlichen Nektar zu schlürfen. Sein Glied reckte sich, schien in Leonies Hand zu erstarren und sich dann ihrer Zungenspitze entgegenzustrecken, als wollte es sie auffordern, noch tiefer einzudringen. Im nächsten Moment schoss sein warmer Samen in Leonies Rachen.
Sie schluckte, schmeckte entzückt das cremig salzige Aroma, das sich in ihrem Mund ausbreitete. Behutsam saugte sie an der zuckenden Spitze, damit ihr ja kein Tröpfchen der Leckerei entging, bis der prachtvolle Schlegel erschlaffte und aus der warmen, feuchten Geborgenheit ihrer Mundhöhle glitt.
»Ahh.« Wohlig streckte sich Carlo und zog Leonie in seine Arme, um sie zu küssen. Es war immer noch ein befremdliches, aber zugleich aufregendes Erlebnis für ihn, sich selbst zu schmecken.
Neugierig ließ er seine Zunge über ihre glatten, regelmäßigen Zähne gleiten, erforschte die Zartheit ihres Mundes und spielte mit ihrer Zunge, die willig darauf einging.
Doch diesmal weckte der Kuss kein neues Verlangen in ihnen. Sie waren von ihren diversen Spielen so ermattet, dass sie eng umschlungen, Lippen an Lippen in einen tiefen Schlaf glitten.
Vor den Fenstern neigte sich der prächtige Sonnentag dem Ende zu. Die letzten Strahlen erloschen in einem grandiosen Feuerwerk aus Rottönen, dem schließlich die Schwärze der Nacht folgte. Das Paar bemerkte nichts davon.
Das Zimmer glich einem Schlachtfeld. Ein zufälliger Betrachter hätte wahrscheinlich einen Einbruch vermutet. Eindringlinge, die wie die Vandalen durch den Raum getobt waren und das Unterste zuoberst gekehrt hatten. Aber Menschen, die Rudy schon länger kannten, so wie Mandy, wussten, dass hier rein gar nichts passiert war. Das Zimmer sah immer so aus. Wäre es aufgeräumt und sauber gewesen, hätte Mandy sich Sorgen gemacht. Aber so, genau so war alles in schönster »Ordnung«.
Mit den Füßen schob Mandy die Papiertüten, Pappschachteln von Kung-Fu-Fine-Diners mit schimmelnden Essensresten und müffelnde Wäschestücke aus dem Weg, während sie zu dem breiten Bett ging, das unter dem Fenster stand. Aus dem Wust von Decken, Kissen, Kleidungsstücken, Illustrierten und anderem Krimskrams lugte eine braune Lockenflut hervor, die sich malerisch inmitten der Unordnung kringelte.
Mandy stieg über einen Teller mit eingetrockneten Essensresten und nahm behutsam auf der Bettkante Platz. Eine Weile saß sie nur da, starrte auf die Lockenflut ihrer Freundin auf dem Kissen, dann streckte sie die Hand aus und schob vorsichtig das Laken herunter. Ein bildhübsches, im Schlaf rührend kindlich wirkendes Gesicht kam zum Vorschein, dessen Wangen rosig schimmerten. Lange schwarze Wimpern beschatteten die zarte Haut, ein Lächeln umspielte die vollen, leicht geöffneten Lippen. Ein Bild, gemalt wie von Botticelli.
Mandys Herz war an diesen Anblick gewöhnt. Deshalb hielt sich ihr Mitleid in Grenzen, als sie die Decken nun mit einem energischen Ruck ganz wegzog und der Schläferin einen Klaps auf den wohlgerundeten, nackten Po verpasste.
Rudy fuhr mit einem Schrei aus ihren Träumen, setzte sich auf und starrte Mandy entgeistert an.
»Spinnst du?« Die Spitzen ihrer kleinen festen Brüste hatten sich vor Schreck aufgerichtet. Unwillkürlich strich Rudy mit den Fingerspitzen der linken Hand darüber, sodass sie noch härter wurden und deutlich abstanden. »Bist du verrückt geworden, mich derart zu erschrecken. Weißt du nicht, was die Indianer über den Schlaf sagen? Dass die Seele Zeit braucht, um in den Körper zurückzukehren …«
»Deine Seele traut sich gar nicht, deinen Körper zu verlassen, weil sie genau weiß, dass du sie sogar im Schlaf verschlampen würdest.« Mandy grinste spöttisch. »Unsere weisen Ureinwohner sind von vernünftigen Menschenwesen ausgegangen, die ihren Geist dazu benutzen, etwas aus ihrem Leben zu machen. So etwas wie dich haben sie sich nicht einmal vorstellen können.«
Rudy schob die Unterlippe vor. Sie brauchte eine Weile, um das eben Gehörte zu begreifen. So früh am Morgen arbeitete ihr Gehirn noch auf Sparflamme. Mandy behauptete zwar, das täte es immer, aber das bestritt Rudy vehement. Ab und zu hatte auch sie Lichtblicke!
»Das war, glaube ich, nicht sehr nett, was du gerade gesagt hast«, resümierte sie schließlich, nachdem sie einige Zeit über Mandys Worte nachgedacht hatte.
Ihr Blick wanderte zu dem Radiowecker, dessen grüne Digitalanzeige unter einem Berg Unterwäsche leuchtete. Die Uhr hatte versucht, Rudy vor mehr als zwei Stunden aus dem Schlaf zu klingeln, ihr Bemühen aber schließlich erfolglos aufgeben müssen.
»Oh, ich habe verschlafen.« Die Erkenntnis rief bei Rudy keine größeren Emotionen hervor. »Schade, ich wollte noch einkaufen, bevor ich in den Shop gehe.«
»Du solltest längst im Shop sein«, erinnerte Mandy sie sanft. »Meine Süße, das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass du zu spät zur Arbeit kommst. Wie lange, glaubst du, wirst du den Job noch behalten, wenn du so weitermachst?«
»Ach, komm!« Rudy schwang die Beine aus dem Bett und erhob sich. Nackt tapste sie durchs Zimmer und begann, ihre verstreut herumliegenden Kleidungsstücke zusammenzusuchen. »Die sind doch froh, wenn überhaupt jemand in ihrem vergammelten Laden arbeitet.«
Mandy fiel wieder einmal auf, wie hübsch ihre Freundin eigentlich war. Sie besaß einen schlanken, wohlgeformten Körper, dessen Anblick jeden Mann auf lüsterne Gedanken bringen musste, und eine Haut, die an Marzipan erinnerte. Schade nur, dass Rudy all diese Reize wenig pflegte und auch noch unter ausgeleierten Klamotten versteckte!
»Ob ich nun eine Stunde früher oder später da antanze spielt überhaupt keine Rolle, weil sowieso keine Gäste kommen.« Sie richtete sich auf und grinste Mandy unbekümmert an. »Weißt du, die paar Gewohnheitssäufer, die die Hocker an der klebrigen Bar plattsitzen, bedienen sich notfalls auch selbst. Sind doch sowieso so gut wie zu Hause in dem Laden.«
Mandy stieß einen ungeduldigen Seufzer aus, enthielt sich aber jeglichen Kommentars. Stattdessen packte sie Rudy an den Schultern und schob die Freundin kurzerhand Richtung Badezimmer.
»Du verlotterst immer mehr, weißt du das?«, warf sie ihr vor. »Anständige Menschen duschen, bevor sie am Morgen das Haus verlassen. Du auch, verstanden? Duschen, Zähne putzen, Haare kämmen, das ganze Programm. Danach kannst du von mir aus machen, was du willst.«
»Mensch, du kommst mir vor wie meine Mutter«, maulte Rudy lustlos, aber sie gehorchte und verließ mit einem Arm voller Kleidungsstücke das Zimmer. Gleich darauf verkündete ein Rauschen, dass Rudy den Wasserhahn zumindest aufgedreht hatte.
Als sie fünf Minuten später, noch klatschnass und die Zahnbürste im Mund, wieder aus dem Badezimmer kam, war Mandy gerade dabei, frische Wäsche zurechtzulegen.
»Weißt du, früher, als du diesen Weißkittel noch nicht gekannt hast, warst du irgendwie lockerer drauf«, stellte Rudy fest, während sie Mandy die Kleider abnahm. »Nicht so schrecklich korrekt, so, so …« Sie suchte nach einem passenden Vergleich. »Ach, ich weiß nicht.« Resigniert zuckte sie mit den Schultern. »Eben anders. Mir hast du jedenfalls früher besser gefallen.«
Sie verstummte erneut, doch plötzlich leuchteten ihre großen, braunen Augen.
»Südstaatlerisch!«, platzte Rudy heraus. »Ja, du bist so südstaatlerisch. Mann, ich dachte, das hättest du längst abgelegt.«
Mandy war bei Rudys Worten zusammengezuckt. Obwohl sie nach außen hin stets bemüht war, beherrscht zu wirken und sich ihre Gefühle nicht allzu deutlich anmerken zu lassen, fiel es ihr in diesem Moment unglaublich schwer.
Die Erwähnung ihrer Herkunft hatte ihr einen schmerzhaften Stich versetzt. Nicht, dass sie ihre Vergangenheit verleugnen wollte. Es gab schließlich nichts, wofür sie sich schämen musste. Aber irgendwie hatte sie immer geglaubt, anders zu sein als die Mädchen aus Louisiana, speziell die aus Jacquody Orleans, die wahrscheinlich heute noch in weißen Kleidern herumliefen und »unter sich« bleiben wollten.
Nein, so hatte sie nie sein wollen. Dass ausgerechnet ihre Freundin Rudy jetzt derartige Vergleiche zog, traf Mandy tief.
Sie warf den Kopf in den Nacken, bereit, sich zu verteidigen.
»Na und?« Ihre Augen schienen Funken zu sprühen. »Ich bin Südstaatlerin! Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht.«
Rudy hatte offenbar keine Lust, das Thema zu vertiefen.
»Ich meine ja nur«, murmelte sie undeutlich, die Zahnbürste immer noch im Mund, und verschwand wieder im Badezimmer.
Während Rudy hinter der geschlossenen Tür in Jeans und T-Shirt schlüpfte, sich dabei achtlos die Zähne schrubbte und sich tatsächlich auch die langen Locken bürstete, war Mandy draußen vollauf damit beschäftigt, ihr aufgewühltes Inneres wieder unter Kontrolle zu bringen.
Was hatte Rudy denn schon gesagt, versuchte sie, sich selbst einzureden. Das war doch nur eine dahingeworfene Bemerkung. Völlig unüberlegt, denn Rudy konnte gar nicht überlegen, jawohl, ha, ha!
Doch es nützte nichts. Nachdem sie die Freundin eine Viertelstunde später vor dem schmierig aussehenden Fast-FoodLaden mit dem klangvollen Namen Best Lunch abgesetzt hatte und weiterfuhr, kehrten die Erinnerungen mit aller Macht zurück.
Schon ihr Name war eine Zumutung, das fand sie auch heute noch. Ihr Vater und seine Träumereien! Er hatte all seinen Kindern so alberne Namen wie Winter, January, Aspenglow oder wie in ihrem Fall Mandolyn gegeben, in der Hoffnung, dass allein schon dies seine Kinder dazu animieren würde, mehr aus ihrem Leben zu machen als er aus seinem.
Clifford Jonas hatte versucht, mit dem mäßigen Gehalt, das ihm der Staat Louisiana als Polizeibeamten zahlte, eine elfköpfige Familie über die Runden zu bringen. Da das natürlich vorn und hinten nicht funktionierte, hatte seine Frau Betty, einstmals eine vielversprechende Schönheit mit wundervoller Sopranstimme, angefangen, das Fehlende als Bedienung in einer Snackbar dazuzuverdienen. Clifford hatte stets betont, dass dies nur eine vorübergehende Regelung sei.
Eine Mutter von neun Kindern habe zu Hause genug zu tun und sei vollauf ausgelastet. Aber als Mandy mit siebzehn von zu Hause wegging, hatte ihre Mutter immer noch in dieser Snackbar gearbeitet.
Im Geiste sah sie das Haus ihrer Eltern vor sich. Ein langgestreckter einstöckiger Bau mit einem Wellblechdach, unter dem es im Sommer unerträglich heiß wurde, und der üblichen Veranda davor, auf der die unvermeidliche Hollywoodschaukel und Cliffs Schaukelstuhl standen.
Der »Garten«, ein mageres Stück Land hinter dem Haus, auf dem Betty mühsam ein paar Küchenkräuter zog, und der große sandige Hof, auf dem Mandy mit ihren Geschwistern gespielt hatte, waren der gesamte Besitz der Familie Jonas.
Sie waren weit davon entfernt gewesen, wohlhabend zu sein, und Mandy erinnerte sich noch genau daran, wie sie als Kind um die schicke schneeweiße Villa der Claytons geschlichen war. Im Herzen trug sie dabei den brennenden Wunsch, dort leben zu dürfen anstatt in dem windschiefen Holzbau ihrer Eltern, von dem die rosa Farbe in großen Stücken abblätterte. Die Fassade hatte ausgesehen, als ob das Haus die Blattern hätte.
Die bröckelnde Farbe und der Name »Clayton« hatten ihre Kindheit geprägt. Sie symbolisierten alles, was Mandolyns damaliges Leben ausgemacht hatte.
Den Claytons gehörte halb Jacquody. Albert Clayton hatte bereits in jungen Jahren den Posten des Bürgermeisters inne. Als Mandys Erinnerungsvermögen einsetzte, hatte er es bereits zum Senator gebracht und regierte die Region aus seinem weißen Säulenhaus heraus. Er war eine Art unantastbare Eminenz, und sein Wort war Gesetz.
Die Villa war eine der typischen hochherrschaftlichen Plantagenvillen, wie sie rechts und links entlang des Flusses standen. Wunderschöne Paläste mit hohen Säulen, französischen Fenstern und beeindruckenden Freitreppen, welche sich elegant vom Erdgeschoss bis unters Dach hinaufschwangen.
Die Anwesen lagen bis heute auf grünen Rasenflächen inmitten von parkähnlichen Gärten. Hier mühten sich keine dürren Petersilienstängel darum, am Leben zu bleiben. Es blühte und grünte so üppig wie im Paradies dank der Bewässerungsanlagen, die hektoliterweise Nass auf die Pracht sprühen. Und es gab genügend fleißige Hände, die den Park, das Haus und die Kinder in Schuss hielten.
Hinter dem Haus fiel das Gelände sanft ab bis hinunter an das Ufer des Mississippi, der hier sanft und majestätisch am herrschenden Snobismus und der lasziven Langeweile entlangfloß. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben und als könne jeden Moment eine französisch sprechende Dame erscheinen, die jeden Besucher mit kühlem Blick unter schweren Lidern unbarmherzig musterte.
Mandolyn erinnerte sich jedenfalls noch sehr gut an diese Blicke. Sie waren von Noleen auf sie abgeschossen worden. Zwar hatte Noleen kein fließend weißes Organdykleid getragen, aber ihre Haltung und ihre Erscheinung waren immer noch die der Gattin eines reichen Plantagenbesitzers, die sich ihres Standes sehr wohl bewusst ist.
Mehr als einmal hatte Noleen die kleine Mandy in den Büschen erwischt, die das Anwesen vor allzu neugierigen Blicken schützten, und einen der Gärtner beauftragt, das lästige Kind zu vertreiben. Das Gefühl tiefer Demütigung hatte sich in Mandys Gedächtnis eingebrannt, ebenso wie die hochmütigen Blicke der drei Clayton-Kinder, die man nur an Sonn- und Feiertagen zu Gesicht bekam.
Wie Porzellanpüppchen standen sie dann neben ihren Eltern. Nick, der Älteste, im schwarzen Anzug mit Seidenkrawatte. Seine Schwestern Abigale und Blanche in gelben Rüschenkleidern, die bei jeder Bewegung leise raschelten.
Mandy und ihre Geschwister hatten niemals Rüschenkleider oder dunkle Anzüge besessen. Sie hatten auch nicht die vornehme St. Alicia School in Ponchtuola besucht, sondern die ganz normale staatliche McGreenwood School. Aber sie waren fröhlich gewesen, hatten sich beim Spielen Arme und Beine am mannshohen Bambusgras zerschnitten, das an den Ufern des Flusses wuchs. Sie hatten Jagd auf Wasserschlangen gemacht, winzige Bambusblattboote gebaut und waren abends vor Dreck starrend, aber glücklich und todmüde nach Hause gegangen, um fröhlich eine Mahlzeit einzunehmen, bei der man nicht andauernd darauf achten musste, dass man das Besteck richtig hielt.
Ja, sie hatten trotz der ewigen Finanzprobleme ihrer Eltern eine glückliche Kindheit verlebt. Und nun, während Mandy in ihrem Wagen saß, den Blick starr durch die Windschutzscheibe auf die Fassade des mehrstöckigen Gebäudes gerichtet, in dem sich ihre Agentur befand, wurde ihr bewusst, dass auch das neidvolle Schielen auf die reichen Clayton-Kinder Teil ihres Glücks gewesen war.
Sie lächelte unwillkürlich, als ihr jener Sommernachmittag ins Gedächtnis kam, an dem sie Blanche Clayton einen Knallfrosch vor die Füße geworfen hatte und die arme Blanche vor Schreck in den Fluss gefallen war. Blanche war zwar mitsamt ihrem schicken Rüschenkleid schnell wieder ans Ufer geklettert, aber die Flüche und Verwünschungen, die sie Mandy hinterhergerufen hatte, hatten das Bild der kleinen, feinen Lady gründlich zunichte gemacht.
Schluss jetzt mit den Erinnerungen! Mandy zog den Zündschlüssel ab, griff nach der Aktentasche, die auf dem Beifahrersitz lag, und stieg aus.
Stacy-Joan, ihre Sekretärin, blickte erstaunt auf, als Mandy kurz darauf das helle, geräumige Vorzimmer betrat. Ein Lächeln flog über Stacys Züge. Ihre Augen leuchteten in dem frischen, schokoladenbraunen Gesicht, dessen Teint makellos war.
»Hallo, ich habe dich erst gegen Mittag erwartet.«
Mandy stellte die Tasche achtlos auf den Empfangstresen und ging zum Kaffeeautomaten. Wie immer funktionierte er erst, nachdem sie ihm einen Tritt versetzt hatte.
»Clem hat überraschend seinen Dienst mit einem Kollegen getauscht.« Sie nahm den Becher aus dem Automaten, trat noch einmal gegen das Gehäuse und wartete darauf, dass auch der zweite Becher in die Halterung fiel. »Wir haben den Besuch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.«
»Schade für dich, aber gut für Clarence Hallgar.« Dankbar griff Stacy-Joan nach dem Becher, den Mandy ihr reichte, und nippte vorsichtig daran. »Er möchte die Figurensammlung, die er von seiner Mutter geerbt hat, gegen Bruch und Diebstahl versichern lassen.«
Mandy musste unwillkürlich lächeln, als sie das hörte. Clarence Hallgar war Ende fünfzig, ledig und nie über die Grenzen der County herausgekommen. Seine Mutter hatte ihn derart unter ihrer Fuchtel gehalten, dass er ohne Frydas Erlaubnis nicht mal in ein Sandwich gebissen hätte.
Jeden Samstagmorgen, punkt neun Uhr, hatte Clarence die Lieblinge seiner Mutter, fünfundzwanzig extrem kitschige Porzellanfiguren, in den Garten getragen, diese dort auf einen Klapptisch gestellt und sie dann Stück für Stück mit einer milden Seifenlauge abgewaschen. Den gesamten Vormittag hatte er damit verbracht, die Figuren zu baden und trocken zu wischen, und sich damit zum Gespött der Dorfjugend gemacht. Der Spottname »Chinadoll« war so im Laufe der Jahre zu Clarences zweitem Vornamen geworden. Eigentlich hatten alle erwartet, dass er sich nach dem Tode seiner Mutter von den auferlegten Zwängen, vor allem aber von ihrer Kitschsammlung, trennen würde. Bisher war jedoch nichts dergleichen geschehen. Clarence wohnte immer noch in dem hellblauen Häuschen am Ende der Witchfield Street und schleppte Samstagmorgens punkt neun Uhr das Figurenensemble in den Garten, um es dort sorgfältig zu reinigen.
In den sechs Jahren, die Mandy nun in Summersprings lebte, hatte sie vor allem eines begriffen: Manche Dinge änderten sich nie – egal ob in Jacquody/Louisiana oder in Summersprings/Colorado. Die Menschen tickten überall gleich.
Stacy grinste, während sie ihrer Chefin die entsprechenden Formulare reichte. »Wahrscheinlich will Clarence aus der Sammlung noch ein bisschen Geld herausschlagen«, vermutete sie gleichmütig. »Erst versichert er die Dinger gegen Bruch, dann schlägt er sie kaputt und kassiert.«
Mandy erwiderte das Grinsen, wurde aber sofort wieder ernst.
»Ich glaube nicht.« Sie dachte kurz nach. »Die Großeltern von Clarence haben die Sammlung unter den abenteuerlichsten Umständen ins Land gebracht, um sie und sich selbst vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass Clarence sie so einfach zerdeppert.« Sie schwieg, dachte noch einmal kurz nach und beschloss dann. »Ich werde trotzdem eine dementsprechende Klausel einfügen.«
»Ein weiser Entschluss.« Stacy hob gekonnt die linke Braue. »Nur besonders verschlagene Wölfe kommen in einem sauberen Schafsfell daher.«
»Lassen wir das.« Mandy zog sich ihren Terminplan heran. »Am besten wird es sein, wenn ich zuerst zu Clarence fahre und den Vertrag mache. Sei so gut und ruf Larry an, dass ich gegen Mittag vorbeikomme, um mit ihm wegen der Farm zu verhandeln.« Sie unterbrach sich und schüttelte den Kopf. »Es ist wirklich traurig. Ich hatte so gehofft, dass Larry es doch noch schafft und seine Schulden bezahlt.«
»Seine Ehe.« Stacy-Joan seufzte. Sie warf einen raschen Blick zur Tür, als fürchtete sie, ihr Gespräch könnte belauscht werden. »Conny ist nicht bei ihren Eltern, wie hier alle glauben. Sie ist mit einem Stuntman durchgebrannt. Du weißt schon, mit einem dieser Kerle, die beim Frühjahrsrodeo eine Wahnsinnsshow abgezogen haben. Sie hat einfach ihre Klamotten in einen Koffer geschmissen und ist auf und davon. Jetzt sitzt Larry mit den Kindern allein da und erzählt jedem, dass Conny in Utah bei ihrer kranken Schwester ist. Er schämt sich wegen der Angelegenheit fürchterlich.«
Stacy seufzte erneut. Ihr hübsches Gesicht sah traurig aus.
»Ohne Conny schafft Larry es aber nicht. Deshalb will er die Farm verkaufen, bevor sie gar nichts mehr wert ist. Das Geld, das der Verkauf bringt, wird vielleicht reichen, um die Schulden zu bezahlen.«
»Was für ein Drama!« Mandy schüttelte den Kopf. Den Menschen hier in der Region ging es allenthalben nicht gut. Der Bankencrash hatte sie über Nacht ihrer Existenzen beraubt. Viele konnten seitdem die Hypothekenzinsen nicht mehr zahlen, ihre Häuser, Farmen und Weiden wurden versteigert, und die Familien verloren ihre Heimat.
Wer überlebte, waren die großen Haie, die trotz der Weltwirtschaftskrise weiterhin die kleinen Fische fraßen. Nein, eigentlich waren sie jetzt sogar noch schlimmer. Für die Landbevölkerung hieß das, dass ihre überschuldeten Äcker und Wiesen von Fast-Food-Ketten und anderen Konzernen ersteigert wurden, die sich im ganzen mittleren Westen breitmachten.
Sich vorzustellen, dass auch hier in Summersprings demnächst so ein Hamburgerriese das Stadtbild beherrschte, tat weh. Mandy nahm sich vor, alles zu tun, um das Land und letztlich auch sich selbst vor solch einem Schicksal zu bewahren.
»Das kannst du wohl sagen«, stimmte Stacy-Joan ihr zu, wobei sie sich allerdings nicht auf Mandys Vorsatz bezog. »Hier geht’s bergab, Baby. Es fängt immer so an. Als Nächstes kommt die Arbeitslosigkeit, dann der Suff, und dann bleibt nichts als Hoffnungslosigkeit. Oh Mann, ich hoffe, ich bin verschwunden, wenn es hier so richtig zur Sache geht.«
»Stacy, hör auf, böse Stimmung zu machen«, ermahnte Mandy ihre Sekretärin, und diesmal klang ihr strenger Tonfall echt. »Sieh lieber zu, dass du mir meine Termine machst. Denk immer daran, solange du alles richtig organisierst, kann ich genug Geld für uns beide verdienen.«
Stacy grinste ihr ansteckendes Grinsen und verzog sich an ihren Computer, während Mandy in ihr Büro ging, um die tägliche Post und ihre E-Mails durchzusehen.
Ein langer, arbeitsreicher Tag kündigte sich an. Aber Mandy liebte stressige Tage. Sie rieb sich zufrieden die Hände, schaltete dann den Computer ein und stürzte sich voller Tatendrang in ihre täglichen Pflichten.
2. Kapitel
In Westmark Tennessee saß Nicholas Clayton vor seiner ersten dampfenden Tasse Kaffee und studierte die Kostenabrechnung seiner Bank, die ihm seine Haushälterin an diesem Morgen, neben diversen anderen Briefen, neben sein Frühstücksgedeck gelegt hatte.
Ihm gegenüber saß in seidigem Rosa und hauchdünnem Chiffon, Leonie Vernon, die Nick zu diesem Zeitpunkt noch fest entschlossen war, in näherer Zukunft zu ehelichen.
Leonie war eine Schönheit. Nick erinnerte sie stets ein wenig an jene anmutigen Perserkatzen, die so hochmütig und unnahbar erscheinen wie sonst kein anderes Lebewesen auf der Welt. Leonies Zurückhaltung erstreckte sich Gott sei Dank nur auf Fremde. Dem Mann, den sie liebte, offenbarte sie ihre feurige, ungestüme Seite, sodass Nick manchmal fürchtete, sie könnte ihn während des Liebesakts mit Haut und Haaren verspeisen.
Natürlich verspeiste sie ihn nicht. Sie wäre auch dumm gewesen, hätte sie es getan, denn von seinem Geld ließ es sich vortrefflich leben. Und mit einem süßen und wilden Lover in petto ließ sich das Leben mit dem etwas spröden Nicholas sogar sehr angenehm gestalten.
In der letzten Zeit kriselte es allerdings trotz der großzügigen finanziellen Zuwendungen, die Nick seiner Verlobten zugestand, ein wenig zwischen dem Paar. Leonie langweilte sich an seiner Seite, seit ihr Liebhaber Carlo nach Italien verschwunden war, angeblich um seine kranke Mutter zu besuchen.
Leonie war quengelig wie ein Kleinkind, das zahnte, launisch wie eine Wetterfahne und überschäumend wie geschüttelter Champagner.
An diesem Morgen war ihre Laune auf dem absoluten Nullpunkt angelangt. Das lag an dem kleinen Plastikstäbchen, das sie kurz zuvor im Badezimmer benutzt hatte. Was die drei Pluszeichen in der Anzeige bedeuteten, hatte Leonie sofort begriffen. Und dass Nick nichts damit zu tun hatte, ebenfalls.
Sie war zwar nicht gerade die Intelligenteste, aber sie konnte dennoch ein paar einfache Fakten miteinander in Verbindung bringen. Daher machte sie sich angesichts des positiven Schwangerschaftstests keine Illusionen. Sie hatte ein Riesenproblem, das ihr wie ein Felsbrocken auf der Seele lag.
So kam es, dass sie muffelig und wortkarg in ihrem Frühstück herumstocherte, im Kopf nur einen Gedanken: Wie drehe ich die Geschichte so, dass sich Nick für den Vater hält?
»Oh, mein Gott!«
Der Ausruf ließ sie die Sorgen vorübergehend vergessen. Leonie sprang von ihrem Stuhl hoch und starrte ihren Verlobten an, als sei er geradewegs vom Himmel gefallen.
»Oh Gott, was ist das denn?«, rief Nick erneut und tippte auf das Papier vor seiner Nase. »Das kann doch wohl nicht wahr sein!«
Leonie kam um den Tisch herum und stellte sich hinter Nicholas, um über seine Schulter auf das Blatt zu sehen. Die Zahlenreihe, die dort aufgelistet stand, war in der Tat beeindruckend.
»Darling?« Nick ließ das Papier sinken und wandte den Kopf. »Ist dir klar, dass du ein Vermögen ausgegeben hast?«
Leonie überlegte nicht lange. Erst einmal alles abstreiten, sich dumm stellen und Nicholas ablenken, das war ihre Devise. Überlegen und sich Ausreden ausdenken konnte sie später immer noch.
»Schatz, du hast doch gesagt, ich soll es mir gut gehen lassen«, hauchte sie und sah ihn mit ihren großen Kinderaugen an. »Schließlich war es deine Idee, dass ich nach Wildflow fahren sollte. Ich habe dir gleich gesagt, dass es dort stinklangweilig ist.«
»Mag sein, dass ich das gesagt habe«, gab Nicholas zu. »Aber ich habe nicht gesagt, dass du den gesamten Ort kaufen sollst. Sieh dir doch nur den Betrag an, den die Bank vom Konto abgebucht hat. Von dieser Summe lebt normalerweise eine vierköpfige Familie.«
Leonie zog einen Schmollmund. »Seit wann bist du so kleinlich?«
»Kleinlich?« Fassungslosigkeit schwang in Nicks Stimme. »Du hast sage und schreibe vierunddreißigtausend Dollar ausgegeben. Vier-und-dreißig-tau-send! Wofür? Hast du ein Haus gekauft, ein Grundstück? Aktien? Sag mir um Himmels willen, was du mit dem ganzen Geld gemacht hast!«
Leonie schluckte unbehaglich. Bisher hatte sie immer darauf geachtet, dass Nick ihre finanziellen Eskapaden gar nicht erst bemerkte und dafür gesorgt, dass die Abrechnungen der Bank zuerst in ihre Hände gelangten. Zudem interessierte Nicholas sich im Allgemeinen nicht sonderlich dafür, was sie mit der Kreditkarte anstellte, die er ihr großzügig überlassen hatte. Aber diesmal war irgendetwas schiefgelaufen. Zu dumm, dass es sich ausgerechnet um die Abrechnung handelte, die einen besonders hohen Betrag auswies.
Wie sollte sie die Ausgabe von mehr als dreißigtausend Dollar begründen? Die Wahrheit konnte Leonie ihrem Verlobten nicht gestehen. Selbst ein Engel würde einen Wutanfall bekommen, wenn er erfahren müsste, dass er für sein hart verdientes Geld Geschenke und Unterhalt für einen süßen, enorm potenten Italiener bezahlt hatte.
Selbst jetzt, in dieser prekären Situation, verspürte Leonie ein unruhiges Kribbeln, das sich aus dem Innersten ihres Schmuckdöschens bis in ihren gesamten Unterbauch ausbreitete, wenn sie an Carlo dachte. Ach, wäre das schön, sich jetzt an ihn schmiegen zu dürfen und seine pochende Erektion an der Hüfte zu spüren.
Er würde nicht lange fackeln, sondern mit einem einzigen Stoß in sie eindringen. Und dann würde er sich zuerst ganz langsam in ihr bewegen, bis sie glaubte, vor Verlangen jeden Moment verrückt zu werden. Erst, wenn sie es nicht mehr aushielt und ihre langen, rotlackierten Nägel in seine Haut grub, würde er Gnade walten lassen und sie richtig rannehmen. Sie würden es so wild miteinander treiben, dass ihre Körper schweißnass wären vor Anstrengung und Lust.
Oh Gott, sie sehnte sich so sehr nach ihm! Wäre er jetzt, in diesem Moment durch die Tür getreten, Leonie hätte sich, ungeachtet ihres Verlobten, auf Carlo gestürzt und es auf der Stelle mit ihm getrieben. Aber der Geliebte kam nicht, um ihr diesen Vormittag zu versüßen und sie ihre Sorgen vergessen zu lassen.
Allerdings half ihr die Vorstellung, als sie sich an Nicholas schmiegte und neckisch an seinem Ohrläppchen knabberte. Dann umfasste sie seinen Kopf mit beiden Händen und zog ihn zwischen ihre warmen, festen Brüste. Normalerweise war das der Moment, in dem Nicholas kapitulierte und sich begann, ausgiebig mit ihrem Körper zu beschäftigen. Aber heute war er gegen Leonies Reize immun. Mit einem Ruck befreite er sich aus ihrem Griff und wandte sich wieder den Rechnungen zu.
Leonie überlegte blitzschnell, ob sie eine andere Taktik anwenden sollte. Doch als ihr Blick zu seinem Schoß hinunterwanderte, um zu prüfen, ob sich dort irgendetwas regte, musste sie enttäuscht erkennen, dass in der eleganten Markenjeans alles ruhig blieb.
Nicholas tippte erneut auf die Rechnung.
»Und was heißt das hier?« Seine Stimme klang eisig. »Siebentausend Dollar für vierzehn Übernachtungen? Pro Übernachtung und Person zweihundertfünfzig Dollar!«
»Äh – ich verstehe nicht …«, stammelte Leonie leicht überfordert. Mathematik war noch nie ihr Fall gewesen.
»Ich erkläre es dir.« Nick sah sie aus frostig glitzernden Augen an. »Du zahlst für eine Übernachtung zweihundertfünfzig Dollar. Das macht bei zehn Übernachtungen zweitausendfünfhundert Dollar und bei vierzehn Übernachtungen dreitausendfünfhundert Dollar. Das Hotel hat dir aber genau das Doppelte, nämlich siebentausend Dollar berechnet. Das bedeutet, dass sie dich entweder um satte dreitausendfünfhundert Dollar betrogen haben oder dass du für jemanden mitbezahlt hast. Wie lautet deine Erklärung?«
Leonie wusste, dass Nick sie in die Enge getrieben hatte. Jetzt wäre es taktisch klug gewesen, das kleine Dummchen zu spielen, das völlig aus dem Häuschen geriet und nichts mehr begriff. Heulen, betteln und sich ahnungslos stellen, das hatte bisher immer bei Nicholas funktioniert. Aber Leonies durch das andere Problem bereits stark angegriffenes Nervenkostüm hielt dem Druck nicht stand. So tat Leonie das Unvernünftigste, was sie in diesem Moment tun konnte: Sie rastete aus und schrie ihrem ungeliebten Verlobten ihre ganze Verachtung ins Gesicht.
»Was glaubst du eigentlich, wer du bist?«, brüllte sie los. »Der Traum jeder unbefriedigten Jungfrau? Mann, vergiss es! An deiner Seite kann man sich als Frau doch bloß zu Tode langweilen oder sich in die Arme irgendeines Lovers stürzen. Und da ich an meinem Leben hänge, habe ich Letzteres getan.«
Mit ungezügelter Wut stampfte Leonie mit dem Fuß auf. So heftig, dass der leichte Morgenmantel auf einer Seite von den Schultern rutschte und so ihre wogende, üppige Brust entblößte. Der dunkle Warzenhof leuchtete, aber Nicholas sah es nicht.
»Jawohl, ich betrüge dich!«, kreischte Leonie weiter, ohne das Negligé zurechtzurücken. »Ich habe diese lumpigen Neuntausend-weiß-ich-wie-viel-Dollar dafür ausgegeben, mich mal wieder so richtig durchficken zu lassen. Und soll ich dir was sagen? Der Kerl, der’s mir gemacht hat, war jeden verdammten Cent wert!«
»Nun …« Nicholas schob die Kaffeetasse von sich und stand auf. »Wenn das so ist, denke ich, dass du in Zukunft bei diesem Herrn wohnen solltest.« Er ging zur Tür, ohne Leonie noch eines Blickes zu würdigen. »Du hast genau eine Woche Zeit, dieses Haus zu verlassen. Wenn ich zurückkomme, möchte ich dich hier nicht mehr vorfinden.«
Leonie öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber Nick ließ ihr keine Gelegenheit dazu. Er hatte das Zimmer bereits verlassen.
Langsam ließ Leonie sich auf dem nächstbesten Stuhl fallen und starrte fassungslos vor sich hin. Was hatte sie getan? Wie hatte sie nur so dumm sein können?
Irgendwo im Haus rumorte es. Es hörte sich an, als würde jemand schwere Gegenstände hin und her tragen. Erst jetzt ging Leonie die ganze Bedeutung von Nicks Worten auf. Sie sprang hoch und hastete die wenigen Stufen in den ersten Stock hinauf.
Nicholas war gerade dabei, seine Koffer zu packen. Leonie lief in sein Schlafzimmer und hielt ihn am Ärmel seines Anzugs fest.
»Verzeih mir!«, rief sie in höchster Not. »Es stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe. Ich war nur so wütend darüber, dass du mir misstraust, dass ich die Fassung verloren habe. Natürlich liebe ich dich. Es gibt keinen anderen. Bitte glaube mir!«
Nicholas hielt in seiner Tätigkeit inne und drehte sich um.
»Für wie blöd hältst du mich eigentlich?« Seine Stimme klang beunruhigend gefasst. »Glaubst du, ich hätte nicht längst bemerkt, dass du mich hintergehst? Dieser Carlo oder wie er heißen mag ist doch schon länger Thema. Ich hatte allerdings bis eben gehofft, dass er nur ein kleiner Flirt ist, wie ihn Frauen eben ab und zu haben. Aber deine Reaktion und diese Abrechnung sprechen dagegen. Und ich habe wirklich keine Lust, einen Rivalen mit meinem Geld zu finanzieren.«
»Aber das tust du doch gar nicht«, versuchte Leonie, sich herauszureden. »Okay, ich habe wirklich ein bisschen viel ausgegeben. Aber das mache ich wieder gut.«
»Ach, und wie?«, erkundigte Nick sich spöttisch. »Etwa im Bett? Danke, deine Qualitäten reichen nicht aus, mich über den Verlust von mehr als dreißigtausend Dollar hinwegzutrösten. Oder willst du etwa arbeiten gehen und mir deine Schulden in lebenslänglichen Raten zurückzahlen?« Er lachte voller Bitterkeit. »Danke, das möchte ich nicht. Weil ich nämlich nicht mein ganzes Leben lang jeden Monat aufs Neue an meinen größten Irrtum erinnert werden möchte. Also lassen wir es dabei. Du ziehst aus und verschwindest aus meinem Leben.«
Nick ließ den Kofferdeckel zufallen, und die Schlösser schnappten zu. Dann hob er das Gepäckstück auf, nahm einige Papiere aus dem Safe im Wohnzimmer und verließ den Raum. An der Haustür blieb er noch einmal stehen und wandte sich zu Leonie um, die ihm gefolgt war.
»Meine Kreditkarte.« Fordernd streckte er die linke Hand aus.
Leonie erstarrte. Aber dann lief sie doch davon, um das Gewünschte zu holen. Wütend reichte sie Nick das Plastikkärtchen.
»Fahr zur Hölle!«, schrie sie ihm unbeherrscht hinterher, als er ins Freie hinaustrat.
Nick tat, als habe er es nicht gehört.
3. Kapitel
Mandolyn fuhr vom Dalton-House aus sofort nach Denver, um Clemens Sufforth vom Swedish Medical Center abzuholen. Die Fahrt von Summersprings in die Hauptstadt dauerte über den Highway ungefähr eine Stunde und gab Mandy Gelegenheit, sich auf das Treffen mit ihrem Verlobten einzustimmen.
Seit drei Jahren arbeitete Clem am Swedish Medical als Oberarzt der Gynäkologischen Station. Er war ein ehrgeiziger und, so vermutete Mandy heimlich, wahrscheinlich nicht überaus einfühlsamer Mann, der eher seine Karriere im Auge hatte als das psychische Wohlergehen seiner Patientinnen. Aber er war ein guter, sogar ein sehr guter Arzt, vor allem auf dem Gebiet der ungewollten Sterilität und künstlichen Befruchtung. Er plante, in ein paar Jahren eine eigene Praxis zu eröffnen und sich dann nur noch diesem Fachgebiet zu widmen.
Mandy zweifelte keine Sekunde daran, dass er seinen Weg machen würde. Clem war der ideale Ehemann, treu, zuverlässig und verantwortungsbewusst. Für seine Familie würde er sich zerreißen. Trotzdem beschlich sie immer öfter der Verdacht, dass sie sich an seiner Seite langsam zu Tode langweilen könnte. Das war auch der Grund dafür, weshalb sie sich immer noch nicht für einen bestimmten Hochzeitstermin entschieden hatte.
Clemens seinerseits machte zwar hin und wieder einen halbherzigen Vorstoß in Richtung Traualtar, doch Mandy war es bisher jedes Mal gelungen, ihn mit dem Argument, dass sie noch warten sollten, bis er seine Praxis eingerichtet hatte, von dieser Idee abzubringen.
Er gehörte nicht zu den Männern, die einen Ballon mieten, um über dem Haus seiner Angebeteten tausend rote Rosen abzuwerfen. Clem gehörte zu den bodenständigen Typen, die von Altersvorsorge, Sicherheit und Ordnung redeten und weder romantisch noch fantasievoll genug waren, sich vorzustellen, dass es noch eine andere Seite des Lebens gab.
Das hatte zur Folge, dass er als Liebhaber nicht unbedingt eine Granate war. Aber er hatte bereits dazugelernt, und solange es nicht um allzu abenteuerliche Praktiken ging, hegte Mandy die Hoffnung, dass sie ihm im Laufe der Zeit noch das eine oder andere würde beibringen können.
Er erwartete sie bereits vor dem Eingang des Swedish Medical Center. Mit strahlendem Lächeln kam er zu ihrem Wagen, stieg ein und drückte Mandolyn einen zärtlichen Begrüßungskuss auf die Wange. Doch sein munteres Gehabe konnte sie nicht täuschen. Sein Gesicht wirkte müde, die dunklen Ringe unter seinen Augen sprachen von einer kurzen Nacht und einem anstrengenden Dienst.
»Wollen wir nicht lieber auf den Theaterbesuch verzichten?«, schlug Mandy vorsichtig vor. Clem hatte drei Tage hintereinander Nachtdienst gehabt. Es war Vollmond, das beste Wehenmittel, um alle fälligen Babys auf die Welt zu locken. Bei Vollmond herrschte auf allen Entbindungsstationen regelmäßig der Ausnahmezustand.
Clemens schüttelte den Kopf, während er sich mit der Hand über die Augen fuhr.