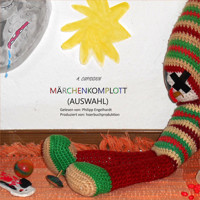24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum pro Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir hören oft vom edlen Prinzen, der die arme Königstochter aus den Klauen ihrer pestbösen Stiefmutter befreit, selbstverständlich nachdem er vielerlei Prüfungen bestanden hat. Königreiche, schöne Prinzessinnen, Untertanen: Der Hauptgewinn für fordernde Abenteuer, damit junge Köpfe friedlich einschlafen und ihren Helden nacheifern sollen. Mit diesen altbackenen Klischees wird nun aufgeräumt! Und was gibt es darüber hinaus? Dass heute jeder "König" werden kann und es auch versucht, hat oft eine Schneise der Verwüstung zur Folge, ganz im Sinne neuzeitlicher Moralismen. Mit solchen und ähnlichen Problematiken beschäftigen sich die im vorliegenden Band gesammelten Märchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1008
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2023 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-207-1
ISBN e-book: 978-3-99146-208-8
Lektorat: Dominique Schmidt
Umschlagfotos: Furemisupiddororokka,Veronika Oliinyk | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Politospektive
Der Stammesführer, groß und stark,
gebeut mit Gewalt und Habe
über die seinen, ohnmächtig und schwach;
es kommt einer mit größerer Gabe,
erschlägt ihn, seine Macht liegt brach.
Blaublut auf Thron regiert autark
zu Wasser, Luft und Land,
sein Volk ergeben, die Flotten befehlsbereit;
huldvoll ergreift er die beringte Hand:
Wer von beiden ist nun gescheit?
Der frei Gewählte dünkt sich weise,
des Volkswillens befehlender Stimme
gehören sein Herz und innige Treue;
listig weiß er zu lenken, dass niemand ergrimme
und seine Wiederwahl bereue.
Wohin geht die Reise?
Immer galt Hier und Jetzt als ewig und wahr,
steigt das Chaos, wird vielen angst und bange;
es scheint so notwendig wie klar,
dass der Kindmensch seine Reife erlange.
Bauernlegende
Es ging die Rede von einem ehrlichen Bauersmann, er habe die Sitten und Gebräuche seiner Familie bis in unsere Zeit in würdige Hände weitergegeben. Selbst wenn seine Urenkel heute ihr täglich Brot anderweitig verdienen, so pocht das Blut des Fleißes in ihren Adern; ihr Ahne war es, der die Grundlage einer langen, ehrbaren Familientradition schuf. Er hatte jedoch einen Nebenbuhler, der seinen Beruf mehr als Mittel zum Zweck sah, um sein Leben so unabhängig wie nur irgend möglich zu gestalten.
Jedes Mal, als der Tag der Steuerabgaben kam, ärgerte ihn die Tatsache, dass er als Leibeigener sein Leben fristen musste und der Fürst von seinen Erträgen einzog, was ihm seiner Meinung nach nicht zustand. Diesmal aber hatte er einen Plan, um sein Erwirtschaftetes zu behalten. Er paktierte mit einer hartgesottenen Räuberbande, die in der Nähe seines Grundstücks ihr Versteck hatte. Er sagte zu ihnen: »Wollt ihr nicht auch frei sein und endgültig die Furcht vor dem Galgen ablegen! Dann hört, was ich euch vorschlage: Morgen kommt der Fürst mit seinen Eintreibern, um mir wegzunehmen, wofür ich hart gearbeitet habe, und sie lassen mir so wenig, dass ich nicht begreifen kann, wie andere Bauern hierbei noch Sinn für Recht und Ehrfurcht bewahren können. Sie sind wahre Verbrecher! Wenn ihr mir helft, gegen sie vorzugehen, lasse ich euch die Hälfte meines Ertrags vom letzten Jahr; wenn ihr nicht verschwenderisch damit umgeht, reicht es für fast ein Jahr, ihr könntet leben wie der Fürst und hättet nie wieder etwas von seinen Schergen zu befürchten.«Die Räuber gingen auf das Angebot ein.
Als nun der Zug der Reiter und Wagen über das Feld herzog, lagen die Räuber im Wald auf der Lauer, der den Bauernhof umschloss.
Wie wilde Urmenschen fielen sie über die Gefolgschaft des Fürsten her, verschonten keine lebende Seele. Seine Furcht schlecht verbergend, wurde der Fürst dem rebellischen Bauern vorgeführt, während die Räuber den vereinbarten Lohn auf die Packtiere luden und davonritten. Voller Stolz sprach der Bauer zum gefesselten Fürsten: »Am Ende hat sich also doch herausgestellt, dass du besiegbar bist wie jeder einfache Lehnsträger.«Er überließ ihm seinen Hof, die Hilfsmittel, die Tiere, die Äcker und sagte, er könne ohne Weiteres sein Leben bestreiten, wenn er weise mit dem Gegebenen umginge. Er selbst bezog des Fürsten Schloss, erklärte der Dienerschaft, er habe dem Tyrannen den Garaus gemacht, und lebte fürderhin in Saus und Braus. Der Fürst aber verendete auf den Feldern nach weniger Zeit nahe eines Pflugschars; was denkt ihr: War es sein verletzter Stolz? Oder sein Unvermögen, den Anforderungen des rauen, ländlichen Lebens gerecht zu werden?
Die Machtverhältnisse hatten sich verschoben. Von nun an konnte ein Müllerssohn ausziehen, um König zu werden, es genügte, im Bunde der Untertanen den Edelleuten finstere Blicke zuzusenden, und sofort schlotterten ihre Knie. Stück für Stück wurde so die Leibeigenschaft abgeschafft; auch die Hochachtung vor dem Glauben geriet ins Wanken, als klar wurde, wie schamlos die ehemaligen Herrscher ihn angewandt hatten, um ihr Sklavenvolk in einem Leben ständiger Angst und Abhängigkeit zu halten. Von reichen bis heiligen Müßiggängern, hart arbeitenden Ehrlichen und denen, die von beidem die Schnauze voll hatten, handelte nun die Weltgeschichte, wobei die Letzteren den meisten Zuwachs bekamen.
Wie sich die verschiedene Wesenheit der beiden Bauern in ihren Familien fortsetzte, so auch ihre Rivalität in der veränderlichen Welt.
Ein Urenkel des Gehorsamen ist vom Mechaniker zum Parlamentarier geworden (also ein vom Volk wählbarer König, wie wir es heute noch kennen). Ein Erfolg freilich, dessen Grundlegung er dem Rivalen seines Ahnen hätte verdanken müssen.
Er verschrieb seine Seele dem messianischen Glauben, so wählten ihn auch solche, die dieser Tradition frönten. Aber die Regeln dieser neuen Welt behaupteten, jede Ansicht darüber, was man dürfe und nicht dürfe, hätte Lebensrecht, und so gab es solche, die, während nun der messianische Parlamentarier regierte, daran forschten, wie man von Erbkrankheiten befreite Kinder künstlich zur Welt bringen könnte. Der Urenkel des rebellischen Bauern wuchs in einer Umgebung auf, in welcher er den alten Glauben zu lernen gedrängt wurde und gleichzeitig davon hörte, wie die sogenannten Forscher zwar ebenfalls Schöpfer großen Wissens waren, aber von ihrem Stande und Mitspracherecht sich den gegenwärtig regierenden Ideen unterzuordnen hatten. Das erschien ihm unsinnig.
Da er ohne Arbeit war, ging er daran, Gleichgesinnte und Gleichbeschicksalte für einen Machtsturz zu gewinnen. Es war nicht schwer, die Verelendeten in den Straßen aufzufinden und zum Mitmachen zu überreden, denn da sie nichts mehr zu verlieren hatten, konnten sie lächelnd der Gefahr ins Antlitz blicken. Zuerst stieß der Arbeitslose auf den Schreiner, der an einem Metallstück werkelte. Er fragte ihn verwundert: »Was bastelst du an dem deinem Handwerk abgewandten Metallstück?«Der junge Schreiner sprach traurig: »Ach, jüngst noch verdiente ich mein täglich Brot als Aushilfe beim alten Tischler; als er mich nicht mehr brauchte, wurde ich von den Volksbildnern zu den Metallbauern geschickt, und jetzt soll ich lernen, was ich nicht will und kann.«
»Komm mit mir«, ermunterte ihn der Arbeitslose, »gemeinsam werden wir der Blindheit ihrer angeblichen Fürsorge trotzen.«Der Schreiner schloss sich ihm an. Bald darauf trafen sie auf den Fließbandarbeiter. Er saß im Dreck und pflegte eine Gruppe wunderschöner Topfpflanzen. Der Arbeitslose fragte ihn: »Wie schaffst du es, als maschinenähnlicher Arbeiter derart entzückende Blumen zu züchten?«Der Fließbandarbeiter erwiderte: »Die geistlose Arbeit drohte mich zu zermürben, also widmete ich meine Aufmerksamkeit den Urkräften unserer Naturverbundenheit.«
»Komm mit uns«, schlug ihm der Arbeitslose vor, »hier wirst du ja doch nicht glücklich. Es sollte jeder zu jeder Zeit tun können, was er will und kann, ohne in der Gosse zu enden.«Freudig schloss sich der Fließbandarbeiter den beiden an. Als Nächstes begegneten sie dem Maler und Verputzer. Still und betrübt saß er vor seiner Staffelei und zauberte mit all seinen Farben die schönsten Gestalten und Landschaften hin. Der Arbeitslose war baff, er erkundigte sich: »Wie kann jemand mit deinem Talent einem so gewöhnlichen Beruf nachgehen?«Verärgert antwortete der Maler: »Es sind Unterrichtsfächer, die mich nicht interessieren, in denen ich aber gut sein muss; es sind Berufe, die gerade mehr gefragt sind auf dem Markt als andere; es sind Ideen, für die sich niemand interessiert, weil der Wettbewerb der Unternehmen untereinander für meine malerischen Ausgeburten keinen Spielraum lässt.«
Der Arbeitslose schlug ihm tröstend vor: »Schließe dich uns an. Ich bin davon überzeugt, dass jede Idee das Recht hat, gehört zu werden.«Der Maler ließ sich nicht zweimal bitten.
Im verfallensten Viertel am Ende der Stadt wurden die vier Verbündeten Zeugen eines Gefängnisaufstandes. Im allgemeinen Tumult sahen sie einen Häftling, der im Begriff war, einem am Kragen gepackten Wärter eine Flasche auf dem Schädel zu zerschmettern. Mutig trat der Arbeitslose vor und fragte ihn: »Was macht dich so gewalttätig der Staatsgewalt gegenüber?«Selbstbewusst antwortete der Häftling: »Weil ich einst den Tod meines Meisters aus Überzeugung über seine Verlogenheit herbeiführte, sperrte man mich für acht Jahre ein. Obwohl ich schon damals wusste, was ich tat, glaubten sie, die Entbehrungen meiner Inhaftierung würden mich vom Gegenteil überzeugen. Sie wollten tatsächlich einen reifen Verstand zum unmündigen Kinde herabbefehlen!«Beeindruckt sprach der Arbeitslose: »Du schließt den Kreis unseres Bundes. Komm mit uns, und du wirst noch vieles antreffen, wo du deine Rache üben kannst.«
Da zogen sie zu fünft weiter. Bei der Bahnstation hielt ein lumpiger Bettler den Arbeitslosen um eine Spende an. Er lehnte barsch ab und entfernte sich rasch. Was er nicht ahnen konnte, war, dass der Bettler, empört über die unhöfliche Behandlung, dem Verweigerer den Tod wünschte. Und dabei handelte es sich um den Wunsch seines ehemaligen Freundes aus Schultagen. Seitdem fühlte er in seinem Bauch diese eigenartige Bewegung, als würde jemand in seinem Magen herumrühren.
Bevor unsere fünf Rebellen das Parlamentsgebäude erreichten, das auf dem Gipfel des großen Berges unter düsteren Wolken aufragte, führte sie ihr Weg durch den Panikwald. Dort erschraken sie über die Neugeborenen, die, sobald sie das Licht der Welt erblickten, ängstlich in die Gebärmutter zurückschlüpften. Die Mütter indes, in jeder Siedlung zu den Tugendhaftesten gehörend, ertrugen das neue Leben in ihrem Inneren nicht lange, und so überkamen sie mehr und mehr alle menschlichen Laster. Da warnte ein Geburtshelfer unsere fünf Reisenden nachdrücklich: »Flieht aus dieser Gegend! Niemand will Zeuge davon werden, wie unschuldige Mütter schuldigen Nachwuchs gebären, unter allen Anzeichen geheuchelter Freude! Daran ist nichts zu ehren! Oh, dies zeugungswillige Jahrhundert – es liebt den Augenblick und weigert sich, Verantwortung für die folgenden zu übernehmen. Ihr wisst, wem wir das zu verdanken haben …!?«
Unsere Freunde schritten schneller voran, um noch vor Nachteinbruch das Parlamentsgebäude zu erreichen, doch sie waren müde. Unter einem großen Baum richteten sie ihr Lager her und schliefen bis zum Morgengrauen. Als sie aufbrachen, beschäftigte den Maler der eigenartige Traum, der ihn vergangene Nacht befallen hatte. Als Geist schwebte er durch den Wald, wobei sein einziges Streben dem Horten irdischer Reichtümer galt, wie und wo er sie auch finden mochte. Er ließ sich dennoch nichts anmerken, als die mutige Rotte sich unaufhaltsam ihrem Zielort näherte. Da standen sie nun. Eine tiefe Schlucht trennte das schmucke Parlament von den fünf Rebellen, die es um jeden Preis besetzen wollten. Doch wie sollten sie hinüber? Da kam dem Arbeitslosen der Gedanke, mithilfe des Schreiners könnten sie das umliegende Gehölz zu einer sicheren Brücke zusammenzimmern. Und so geschah es. Nach langer, mühsamer Arbeit gelang es ihnen, den Abgrund zu überbrücken, und so konnten sie gefahrlos hinübergehen. Aber die nächste Schwierigkeit ließ nicht lange auf sich warten. Vor ihnen taten sich drei unwegsame Wegmäuler auf, überwuchert von allerlei Sträuchern und Schlingengewächsen. Nun lag es am Hobbygärtner, seine Mitstreiter gesund durch die schmalen Gänge zwischen den Steilwänden zu geleiten. Sie waren ihrem Ziel zum Greifen nahegekommen. Wie es der Zufall wollte, wurden gerade Restaurationsarbeiten in der Vorhalle des Parlaments verrichtet; das brachte den Maler auf die Idee, den vorständigen Maler zu überwältigen und sich in seinem Namen als neuer Meister unter die Arbeiter zu mischen. Seinen Freunden besorgte er entsprechende Kleidung, sodass sie niemand verdächtigte, wenn sie im Parlament ein- und ausgingen. Innerhalb kürzester Zeit gestaltete er die Vorhalle derart schick, dass alle, die das Gebäude betraten oder verließen, wie gebannt auf die Fresken blickten. Zur Belohnung wurden die Maler vom Parlamentsvorsitzenden persönlich zur Dankbezeigung in den runden Saal geladen; doch dazu hatte sich der Maler von seinen Gehilfen bereits verabschiedet und kam ausschließlich mit seinen vier Mitstreitern der Einladung nach. Das Gesicht des Vorsitzenden hättet ihr sehen sollen, als sich die fünf Recken ihrer farbverschmierten Kleidung entledigten und ihn wie eine Jagdbeute umringten. »Wir sind gekommen, um deine Herrschaft zu kippen«, sagte der Arbeitslose und trat vor. Es war, als wäre die Macht ihrer Ahnen in ihren Augen entflammt. »Pah!«, stieß der Vorsitzende verächtlich hervor. »Solange ich vom Volk gewählt bin, ist alles, was ich tue, richtig. Ihr könnt eure Beschwerden schriftlich an den Parlamentsrat schicken …«Noch bevor der Satz von seinen Lippen glitt, packte ihn der Häftling am Kragen, wuchtete ihn einige Male im Saal herum, ehe er ihn vornüber zwischen Rückenlehne und Flächenrand des nächstbesten Stuhls mit dem Knie niederdrückte. »Wisst ihr denn nicht, dass die Macht nicht auf, sondern hinter dem Thron sitzt?«, ächzte das hohe Parlamentsmitglied, und da kamen schon die Sicherheitskräfte hinzugeeilt und nahmen die fünf Rebellen getrennt voneinander in Gewahrsam. Bevor zwei bullige Kerle den Arbeitslosen abführten, ließ ihn sein Erzfeind zu sich entbieten. Er fragte ihn verbittert: »Du bist der Anführer dieser Bande. An ihren unterschiedlichen Bekleidungen erkannte ich ihre Eigenschaften. Grüne Latzhose (der Gärtner), die hellbraune Latzhose (der Schreiner), die weiße Hose (der Maler) und die Sträflingsuniform. Welches ist dein Beruf, dass er dich über sie erhebt?«
Aufrecht hob der Gefragte an: »Nie noch habe ich einen Beruf erlernt. Meine Kräfte liegen im Verborgenen, undenkbar, dass es jemandem gelingen sollte, sie nach geltenden Vorschriften formen zu können. Dass meine Begleiter auf mich hörten, mag daran gelegen haben, dass ich für sie das Endergebnis ihres Verdrusses darstelle, der jeden auf seine Weise ärgerte. Und zugleich beirrt mich kein gelerntes Handwerk und hält mich in Abhängigkeit; damit bin ich sowohl der Anfang jedes Volksaufstandes als auch sein Ende.«
»So mögest du an deinem Ende angelangt sein!«Der Parlamentsvorsitzende gab Zeichen, und der Arbeitslose wurde in seine Zelle geführt. Im Parlamentsgefängnis waren viele gerissene Regierungsmitglieder, die sich alle Mühe gaben, den Widerstand der fünf Rebellen zu brechen. Dies gelang ihnen auch. Allerdings nur beim Gärtner, dem Maler und dem Schreiner. Man versprach ihnen das Blaue vom Himmel, gab ihnen sichere Arbeitsplätze, der Maler wurde sogar als Parlamentsrestaurator mit Regierungsaufträgen betraut und verdiente übermäßig viel; so vergaßen sie bald schon, weshalb sie einst ausgezogen waren. Der Sträfling, zum zweiten Mal in Haft, war die Umgebung und den Druck gewohnt, nichts und niemand konnte seinen Willen brechen. »Dümmer zu gehen, als ich hereingekommen bin – das ist eure hässliche Absicht! Die Idee wird triumphieren!«, schrie er aus vollem Halse. Doch niemand hörte ihm zu. Er verbrachte den Rest seines Lebens hinter Gitter; äußerlich alt und runzlig, innerlich hart und willensstark.
Jahre vergingen. Indes hatte man den Arbeitslosen aus der Haft entlassen; das gemeine Volk schimpfte auf ihn, wo es ihn sah, dazu hatte die Regierung viel beigetragen, um die Leute vor ähnlichem Aufstandsgebaren abzuschrecken. Ohne Ziel und Hoffnung ging er in die Freiheit, die für ihn nicht wirklich Freiheit war. Sein Weg führte ihn abermals durch die Straßen seiner Heimat. Diesmal beschloss er, nichts Besseres anzustreben, als seine Armut mit jener anderer zu vermählen, helfend, wo er helfen konnte, und zwar ohne Rückvergütung zu fordern. »Wenn dieser Parlamentsabgeordnete die Urideen des Glaubens, den er zu verteidigen vorgibt, derart frech in arm und reich aufspaltet, dann fange ich’s lieber richtig an und bleibe ein richtiger Armer. Ich bin gespannt, wem von uns beiden der Himmel gehören wird. Oder ob ich dadurch einen neuen Himmel schaffe. Meine Ahnenfolge endet bei mir und sagt: Meine Tragödie macht Sinn! Die Idee wird triumphieren!«
Noch immer spürte er im Magen dieses eigenartige Umrühren, als er damals dem unerkannten Schulkameraden die Spende nicht vergönnt hatte.
Das Land war nach wie vor gebeutelt. Es gab verschiedene Menschensorten: Wer arbeitete und auch arbeiten wollte, war entweder glücklich oder von der Not gedrungen, in jedem Fall tat er seinen Mund nie auf – sie stellten die Mehrheit. Wer nicht arbeitete, konnte entweder keine finden, dann war er, fing man ihn rechtzeitig auf, für neue Ideen durchaus zu begeistern; oder aber er wollte nicht arbeiten, dann war er aus jenem Holz geschnitzt wie auch unser Held. Sie waren die Wenigsten.
Auf seinen Streifzügen lenkten ihn seine Schritte nach langem in den Panikwald. Noch immer gab es Neugeborene, die, sobald ihr Auge sich auftat, um die Grausamkeiten der Welt zu erspähen, furchtgeschüttelt in die Gebärmutter zurückkrochen. In dem alten, grauen Mann, der neben einer Wiege saß und sie betrübt hin- und herbewegte, glaubte der Arbeitslose den Geburtshelfer wiederzuerkennen, der ihn einst vor dem Fluch der Erbsünde gewarnt hatte. Als auch er sich auf den alten Durchgangsreisenden Stück für Stück rückbesann, hielt er mit dem Schaukeln inne und sprach: »Die Dinge sind noch schlimmer geworden, seit du das letzte Mal hier gewesen bist. Trotz der Fortschritte unserer Forscher heben wir fast so viele Gräber aus, wie wir Neugeborene erwarten. Es sind dies die Einzelheiten, über die uns das Parlament im Dunkeln lässt: Ist die Seele konstant? Stirbt man jung, ist und bleibt man jenseitig ebenfalls jung? Es ist nicht Aufgabe unserer Forscher, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, vielmehr, dass kein Anlass mehr besteht, sie zu stellen. Doch gerade das will das Parlament nicht. Sie wollen, dass wir krank auf die Welt kommen; sie wollen, dass wir unsere Kinder mit überholten Mustern erziehen; sie wollen, dass wir uns streiten und gegenseitig vernichten. Sieh’, wie alt ich schon bin, und trotzdem belasten mich mehr Fragen, als mich Antworten friedlich sterben ließen.«
Traurig setzte der Arbeitslose seinen Weg fort. Als er an eine Biegung kam, stürzte ein großer Baum fast lautlos auf ihn und beendete sein Leben. Seine letzten Gedanken kreisten um die Worte des Geburtshelfers. Er dachte, wie die Erbsünde in Zusammenhang mit der sogenannten Strafmündigkeit, die erst ab einem fortgeschrittenen Kindesalter in Kraft trat, die weltabgewandten Neugeborenen doch in den Himmel bringen müsse. Er war sich nämlich sicher: Der Jüngste Tag war nicht weit; wer aber am jüngsten Tag jung, also nicht strafmündig, verschied, musste als Übergänger zählen, während die Welt im Chaos der Neuordnung röchelte. Den Himmel also für die erbsündigen Kinder, die dort aufwachsen sollten; wie viel mochte das Blut ihrer Ahnen da mitbestimmen? Niemand weiß, ob er mit seiner Vermutung Recht hatte.
Der unzufriedene Lukas
Lukas war ein rechter Stubenhocker, der seinem Vater viel Kummer bereitete. Wenn die Sonne herrlich das Land mit ihrer Wonne übergoss, saß er in seinem Zimmer und schaute fern. Einmal, als seine Schulkameraden die heiße Mittagssonne genossen, trat sein Vater herein und sagte: »Ich kann es nicht glauben, dass du hier bist. Niemand, der bei klarem Verstand ist, sitzt, wenn ihn sonst keinerlei Verpflichtungen binden, bei diesem schönen Wetter in der dumpfen Bude. Also bitte, geh hinaus!«
Der Vater wusste nicht, dass Lukas eine außergewöhnliche Begabung hatte. Er besaß die Fähigkeit, seinen Körper zurückzulassen und mit der Seele die Welt zu besehen. Gerade jetzt unternahm er wieder eines seiner Abenteuer. Wie der Vater merkte, dass alles Drängen und Bitten nichts nützte, schlug er heftig die Türe zu; doch Lukas war zu dieser Zeit schon in den Körper einer Wespe gestiegen, die sich am Fensterbrett über eine tote Fliege hermachte. Sie rollte und kroch über das regungslose Insekt, musste erst mit den neuen Anforderungen zurechtkommen. Dann, als sie ihre Beute in gutem Griff hatte, flog sie davon, hinaus in den Wald. Eigentlich wollte sie so weit wie irgend möglich von anderen Tierchen weg sein, aber sie musste über den Teich fliegen, der sich unter ihr ausdehnte. Plötzlich merkte sie, wie ihr Flug leichter wurde; ein gemeiner Frosch hatte ihr die Beute abgezogen. »Oak, oak«, sagte der alte Frosch, »ich habe noch Hunger. Wirst du mich auch nicht innerlich totstechen, wenn ich dich hinunterschlucke?«
Die Wespe antwortete: »Du kannst darauf wetten, dass ich das tun werde. Aber wenn du mir gestattest, vorübergehend deinen Platz einzunehmen, werde ich meinen Stachel ruhighalten.«Der Frosch war einverstanden, schnellte mit der Zunge nach der Wespe, doch ehe sie in seinem Bauch ihrem Ende entgegenblickte, fuhr die Seele aus ihrem Körper und wanderte in den des Frosches.
Eine Zeitlang verweilte er am Teich, dann ging er auf Erkundungstour. Er hüpfte davon, schnappte nach jedem Insektchen, das vor ihm herschwirrte. »Frosch zu sein ist langweilig«, sagte er sich und überlegte, was er als Nächstes tun könne. Da bedeckte ihn mit einem Male ein riesiger Schatten, dass er kaum wagte, nach oben zu sehen, weil er sich gut vorstellen konnte, wer es war. Als der Schatten größer wurde, war kein Platz mehr zum Verstecken, und so bereitete er sich auf die nächste Seelenverpflanzung vor, bis endlich der schmale Schnabel an seinen Seiten zuschnappte und er von nun an als Storch durch die Lüfte schwebte.
»So ist es mir genehmer«, sagte er mit einem Gefühle der Unbesiegbarkeit. Damit er das Land gut betrachten konnte, flog er tief, über den Wipfeln aber wurde es immer dichter; er dachte sich nichts dabei, als er hinabsegelte, doch zu seinem Unglück blieben seine Beine an einem Stacheldrahtzaun hängen. Er flatterte aus Leibeskräften, versuchte wie von Sinnen sich der blutigen Falle zu entwinden, doch es half nichts. Er verhedderte sich noch mehr, bis schließlich alle Hoffnung begraben war. Im Todeskampf drangen Töne an seine Ohren und er erblickte ein Radio, das am Fuß des Zauns vor sich hinspielte. Ihm blieb keine Wahl, er konzentrierte seine letzten Kräfte auf das Unterhaltungsgerät … und, schwups, war ein vormals lebloses Ding plötzlich von einer Seele erwärmt. Wie die fröhliche Musik so dudelte, kam ein Wolf dahergetrabt, der sich unweit vom Radio hinter einem Gebüsch, ohne jede Heimlichkeit, auf die Lauer legte. »Er muss das Blut gewittert haben«, meinte das Radio, »aber verflixt nochmal: Warum starrt er mich an!«
Die Musik spielte ohne Unterlass und es überlegte, ob es nicht auf den Tonträger umschalten sollte, denn irgendetwas störte die Gute-Laune-Wellen. Da waren unterschwellig gequälte Stimmen zu hören, riefen um Hilfe, sandten Flüche aus an jene, die so tollkühn ihr Leben schönmalten, während sie Not litten. Für ihn war es doppelt grausam, denn er hörte die Klagen parallel zum Sendeprogramm, und der Moderator gab sich beileibe nicht weniger falsch-fröhlich in diesen unausgeglichenen Zeiten. Noch eher aber war es der Wolf, der ihn beunruhigte, denn er hatte sich ein Stück weit aus dem Gebüsch hervorgewagt, wahrscheinlich fühlte er mit dem Radio; nur wäre es eben dasselbe gewesen, über das er gnadenlos hergefallen wäre, wenn es nicht flugs den Tonträger abgespielt hätte. »Bewegender Rhythmus, tiefsinnige Texte: Das ist ehrliche Musik!«, erkannte das Radio. »Noch dazu ist sie viel älter als das, was sie aktuell spielen.«Da der Wolf innehielt und keinen Schritt mehr näherkam, entschied es, den Tonträger so lange abzuspielen, bis sich die Gelegenheit böte, sich weiterzuverpflanzen; der Wolf hatte stechende Augen, die jedem Angriff widerstanden, er schien zu wissen, was mit dem Radio vor sich ging. Die Seele war gefangen in den Transistoren, war energetisch verbunden mit den Batterien; ihre Hoffnung ruhte darauf, dass ein anderes Tier vorbeikomme und sie erlöse, dem Wolf nämlich war die Sterbensgeduld aus dem Blick zu lesen. Oder sie ließ das Radio dudeln, bis die Batterien erschöpft waren.
Der kleine Cyborg
Es wird einmal ein kleines Wesen geboren werden, halb Mensch, halb Roboter. Hört zu, ihr Lieben, dies ist die Geschichte noch nicht eingetretener Zustände und Wesen, die uns aber zum Teil heute schon andeutungsweise umgeben. Ich sehe also die Zukunft, das, was noch nicht passiert ist, worüber man jedoch häufig aussagt, seine Gestaltung liege an uns selbst. Wenn dem so ist, dann brauchen euch die Figuren meiner werdenden Geschichte keineswegs zu beunruhigen. Es sitzt also der kleine Micha vor dem Fernsehgerät. Es läuft gerade einer dieser Filme, die ein naturfremdes Bild der Zukunft ausmalen, wo Menschen mit Robotern zusammenleben, damit diese jenen dienen können, um ihnen die tägliche Arbeit zu erleichtern. Micha verfolgt mit Begeisterung, wie der Robodiener anfängt, sich mehr und mehr menschlich zu verhalten, sodass man meinen könnte, er habe auch wirklich menschliche Gefühle. Oh, ich sehe, dass seine Mutter hereinkommen wird, sie macht ihm Vorhaltungen, er solle sich nicht diese dummen Filme anschauen. Sie schaltet auf einen anderen Sender um; bunte, hässliche Zeichentrickfiguren hüpfen über den Schirm. Micha ist unglücklich. Tags darauf erzählt er in der Schule vom Verhalten seiner Mutter. Niemand wird ihr Verhalten verstehen, selbst Doktor Weisbart nicht, der Physiklehrer. Eigentlich ist er mehr als Physiker, sein Wissen erstreckt sich auf neue Fachgebiete, die, ob diese Geschichte sich nun bewahrheitet oder nicht, künftig unentbehrlich für die Menschheit sein werden. Im Schullabor haben die Kinder eine Menge Spaß. Doktor Weisbart wird es gelingen, einen Roboter zu erschaffen, der menschlichen Befehlen gehorcht, ganz so, wie es Micha im Film gesehen hat. Als Hausarbeit müssen die jungen Wissenschaftler einen Aufsatz über interagierende Kombinationen schreiben, also die Verbindung von menschlichen und roboterähnlichen Eigenschaften in ein- und demselben Körper. Micha wird die Bestnote erhalten. Die anderen Kinder scheinen Doktor Weisbart wenig interessiert an seinem Unterricht zu sein – wahrscheinlich drückt sie die Pflicht –, obwohl er ihn doch so leidenschaftlich abhält und regelmäßig auf die kommende Wichtigkeit des Fachs hinweist. Nach Schulschluss wird er Micha bitten, für einen Moment zu bleiben, er habe mit ihm etwas zu besprechen. Ja, ich höre ihn genau, er wird verzweifelt zu ihm sagen: »Lange, mühsame Stunden habe ich an meinem Roboter gearbeitet, damit er menschlich wirke. Ach, es ist so traurig, dass das Schicksal mich und meine Frau mit einem herzkranken Sohn gesegnet hat. Dieser da wird niemals hinlänglicher Ersatz für ihn sein. Mein Beruf begann mit der Anbringung fremder Körperteile an Unfallopfer, doch bald stellte sich heraus, dass die Eigenschaften der verstorbenen Spender auf die Körperfunktionen der Opfer übergriffen. So bekam mein Sohn das Spenderherz eines verrückten Gewalttäters; er wurde erschossen, als er nach einem Raubüberfall flüchtete. Heute bin ich weiter. Du bist interessiert und begabt, Micha. Ich vertraue dir all mein Wissen an, vielleicht wird es dir eines Tages gelingen, die Einfachheit eines seelenlosen Metallmännleins mit den schwierigen, unergründlich tiefen Geisteszuständen des Menschen harmonisch zu versöhnen.«
Micha lächelt darauf und sagt: »Gerne werde ich mich mit Feuereifer in das Wissen stürzen, welches Ihr Fach so besonders macht. Aber es gibt niemanden, mit dem ich mich austauschen kann, niemanden, der die überwältigende Bedeutung erkannt hätte, die meisten halten es einfach für Humbug. Ich wüsste nicht, wie ich anders lernen sollte als im Heimlichen, und das nimmt die Freude daran. Lieber würde ich mich selber zum Roboter machen lassen, um alldem zu entgehen …«Als Weisbart diesen letzten Satz hört, lehnt er sich in seinem Stuhl zurück, verschränkt die Arme vor der Brust und denkt nach, sein Schnurrbart, lang wie Libellenflügel, hüpft auf und ab.
»Wenn du das wirklich ernst meinst«, beginnt er, »kann ich dir vermutlich helfen. Solange meine Forschungsarbeit allseits missbilligt wird, bleiben ihre Ergebnisse im Schatten voreingenommener Wissenschaftler, die Wissen nach ihrem Gutdünken schaffen. Vergiss nicht, deine Großeltern haben etwas anderes gelernt als deine Eltern, deine Eltern was anderes als du, und deine Kinder werden wiederum etwas Neues lernen, das du heute nicht einmal ahnst. Was meinst du: Willst du das Experiment an dir wagen, um die Besserwisser von der Schaffenskraft verkannter Weltverbesserer zu überzeugen?«
Micha bebt vor Begeisterung: »Ja! Ja! Tausendmal ja! Ist doch das ganze Leben ein Experiment. Warum also nicht für eine höhere Sache sich aufopfern!«
Und schon bald kommt sein großer Tag, uhhh, wie sehr wird diese überstürzte Entscheidung seine Mutter schmerzen! In einer düsteren Nacht beginnt die Umwandlung. Micha lässt sich in Tiefschlaf versetzen, sein tauber Körper wird in eine auf seine Größe genormte Glasröhre gesteckt, deren bis zum Rand reichende, geruchlose Flüssigkeit von verschiedenen, einführenden Schläuchen anfängt zu blubbern. Weisbart weiß genau, was er tut. Nach mühseligen Stunden der Überwachung, Verbesserung und Erweiterung an Michas Körperfunktionen wird ein Wesen aus der Schonvorrichtung steigen, wie es die Welt bislang nur aus Fantasiegeschichten kennt. »Dein Name sei von nun an Michatron«, sagt Weisbart voll Stolz. Mit ungeübten Bewegungen erkundet der Cyborgjunge die Umgebung, die ihm wie neu scheint, ehe er seinen Schöpfer musternd ins Auge fasst, der lächelnd seine Annäherung erwartet. »Komm, komm«, winkt er ihn vertraulich heran, »hab keine Angst. Von nun an beginnt ein neues Leben für dich. Was du einst gewesen bist, ist nicht mehr. Was du jetzt bist – ist Macht und Vorbild! Ich habe dich auf deinen Wunsch hin umgewandelt, in ein Wesen, das mehr Maschine als Mensch ist. Solange ich lebe, wirst du hier im Labor bleiben, deine Geschicklichkeit an Spielen üben, deine Muskeln trainieren und … vergessen, wie niederschlagend es gewesen ist, Mensch zu sein.«Weisbart kann sich seiner väterlichen Gefühle nicht erwehren, die Michatron als seinen zweiten Sohn haben wollen. Ebendies wird auch der Hintergedanke bei seinem wundersamen Schöpfungsakt sein. So wird also im unterirdischen Schullabor das fantastische Doppelwesen leben, Michas Mutter und allen, die ihn kennen, wird indes die traurige Mitteilung gemacht, er sei vermutlich auf dem Nachhauseweg entführt worden. Jahre später wird Doktor Weisbart sterben und mit ihm alle, die eine direkte oder indirekte Erinnerung an den kleinen Micha haben. Er indes wird sie restlos überleben, viel länger noch, die technischen Gehilfen des Doktors werden sich von Generation zu Generation der Sache widmen, der sich ihr Großmeister verschreibt. Oh Schreck! Was sehe ich als Nächstes! Eines Tages wird die Schule abgerissen werden, da die Staatskassen in Zukunft am wenigsten für Bildung abdrücken, sie werden vergessen, dass Kinder viel liebevolle Betreuung brauchen; sie wird einer automatisierten Aufmerksamkeit weichen, wo dem Kind keine Zeit gelassen wird, die Wunder der Welt mit frischer Neugierde zu erkunden. Das wird der Moment sein, wo zwei Wissenschaftler in den Ruinen der alten Schule auf die durchsichtige Schonvorrichtung stoßen, in welcher Michatron seine Kräfte auffrischt. Ihr müsst wissen, dass das Wissen der Menschheit zu jener Zeit in die Fußstapfen Doktor Weisbarts getreten sein wird, allerdings erlahmt die Forschung für eine kurze Weile, weil die Herrscher ihr Geld lieber in unsinnige Sachen stecken, die gut sind, solange sie ihren eigenen Wohlstand garantieren. Also sehe ich’s. Es sind zwei Zwillingsdoktoren, Psych und Phys, die die Aufzeichnungen und gespeicherten Dateien von Doktor Weisbarts Arbeiten finden und sie entscheiden sich, seine Erkenntnisse weiterzuentwickeln. Die zielstrebigen Zwillinge haben Schwierigkeiten, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen; erst als die Regierung auf dem Grundstück der ehemaligen Schule ein Forschungszentrum errichtet, erhalten sie die Chance, wie Doktor Weisbart lange vor ihnen, in der Zurückgezogenheit des wiederaufgebauten Labors ihrem Forscherdrang ungestört nachzugehen. Schließlich werden sie die Ersten sein, die auf die brillante Entdeckung in den verlassenen Ruinen stoßen, somit ahnen sie, welchen wirtschaftlichen Vorteil sie gegenüber ihren Kollegen haben. Aber das Ärzteduo ist alles andere als einmütig. Während Psych bei seinen Experimenten wohlüberlegt und verantwortungsvoll die Folgen für sich und die Mitwelt abwägt, verfährt sein Bruder ohne Skrupel, ihm genügt es, einen sittenlosen Regierungsauftrag in der Tasche zu haben, und sein Eifer kennt keine Grenzen mehr. Bis sie ihre Arbeit an Weisbarts Vermächtnis aufnehmen, werden viele Kriege über die Lande gezogen sein. Die Welt wird eine andere geworden sein, so wird’s mir gezeigt. Und Michatron ein Symbol für sie, als Doktor Phys ihm die metallischen Gliedmaßen durch Nahkampf- und Schusswaffen ersetzen will. »Tu’s nicht!«, gebietet ihm Dr. Psych. »Lange waren wir Kollegen; solltest du dich dennoch für verantwortungslose Regierungsaufträge hergeben, wirst du nicht nur auf meine Unterstützung verzichten müssen: Ich werde dich von deinem Vorhaben abhalten!«Doch Phys trickst ihn aus. Als der rechtschaffene Doktor das Wort seines Bruders darauf bekommt, die unheilstiftende Forschung einzustellen, stößt dieser ihn in die umgebaute Vorrichtung, in welcher Michatron seine Energien aufzufrischen gewohnt sein wird. Als er sieht, wie der unglückliche Doktor von den mechanisch-elektrischen Bestandteilen getötet wird, regt sich etwas ganz Leises in ihm, ohne es beschreiben zu können. Sein Geist hat keinen festen Sitz, er ist komprimiert in den kleinsten Zellen seines Körpers. Wo andere Zorn und Entsetzen spüren, übertragen seine Augen die Bildinformationen an ein von Urteilsfähigkeit befreites Gehirn. Denn darum wird er Doktor Weisbart gebeten haben, dass er die verhängnisvollen emotionalen Anwandlungen in ihm ausschalte. Er kann bei dem, was er dort sieht, nicht helfend eingreifen. Eines Nachts, als das Forschungszentrum still daliegt, betritt der letzte noch lebende technische Pfleger Michatrons das Labor. Als er beim Abriss des Schulgebäudes flieht, heuert er Jahre später im Forschungszentrum als Reinigungskraft an. Obwohl ihm strengstens untersagt ist, das Labor zu betreten, überbrückt er geschickt den Sicherheitscode der Tür. Ihm strömt das Herz über, als er Michatron in seinem Schongehäuse erblickt, offenbar unverändert. Als er jedoch den verlängerten rechten Arm, die verdickten Metallhüften und im Licht der eingeschalteten Überwachungsschirme die kämpferische Rüstung sieht, senkt er traurig den Kopf. »Doktor … Doktor … tot … retten!«, surrt es aus Michatrons Computerkehle, und der Techniker blickt hoffnungsvoll auf. Unweit sieht er einen Kühlbehälter, in dem er Doktor Psychs ermordeten Leichnam vorfindet. Er beschließt, nachdem er sich halbwegs einen Reim auf die Umstände machen kann, des toten Doktors noch im Körper befindlichen Geist in jenen Michatrons zu integrieren, ihm sozusagen ein neues Bewusstsein zu geben. Nachdem er alles zur Verknüpfung vorbereitet haben wird, betätigt er die notwendigen Schalter, überwacht die neurochemischen Prozesse, greift regulierend ein, wenn es zu Abweichungen in der Übertragung kommt. Bald hat er es geschafft. Michatron, mit neuem menschlichen Bewusstsein ausgestattet, tritt vor seinen alten Bekannten. »Wer bist du?«, fragt er ihn mit seiner klanglosen Stimme. Der Techniker antwortet: »Ich habe dich hier gefunden und musste dich vor dem grauenvollen Missbrauch behüten, der dir drohte. Ich bin einer der alten Techniker, die Doktor Weisbart geschworen haben, sich bis an ihr Lebensende um dich zu kümmern. Deine Erinnerung wird noch ein wenig brauchen, trägst du ja jetzt zwei Seelen in dir, deren eine mir unbekannt ist. Doch wäre sie schlecht gewesen, hätte man ihren Träger bestimmt nicht ermordet.«
»Du hast recht«, gibt Michatron zurück. »Mein Bruder, Doktor Phys, ist ein Scheusal. Er muss aufgehalten werden, ehe er noch mehr Schaden anrichtet. Glücklicherweise weiß ich, was er vorhat. Mithilfe von Weisbarts Forschungsergebnissen will er eine Armee von Supersoldaten züchten; ich war der Prototyp. Aber mit mir kann er nun nicht mehr rechnen, ich …«Ich höre, wie die Stimme der Menschmaschine stockt, es scheint, als dringe ihr eigentliches Ich, nämlich der kleine Micha, ins Nervenzentrum, wo jetzt Doktor Psych das Kommando hat. Schließlich gelingt es ihm kurzzeitig, man hört die metallisch verzerrte Stimme Michas reden, während Psych respektvoll schweigt. »Mein Schlaf in mir selbst war lang, doch nun ist es an der Zeit, zu erwachen. Ich hätte ahnen müssen, dass dieser Tag kommt. Schließlich habe ich genug Filme gesehen. Mit zwei Seelen in einem Körper sind wir aufs Beste vorbereitet.«
Der Techniker warnt Michatron: »Ich helfe euch, wo ich kann, aber ich muss besonders dich, Micha, warnen: Es hat sich sehr viel geändert! Schon während deiner Jahre unter Doktor Weisbarts Obhut hat er es vorsorglich vermieden, dich Situationen auszusetzen, die dich an die Schwierigkeit, Mensch zu sein, erinnern konnten. Bist du auch ein perfekter, organischer Roboter, so darfst du nicht vergessen, wie wankelmütig und verletzlich Menschen sind; die wenigsten haben Schuld daran, dass du dich wieder als ihresgleichen unter sie begibst.«»Glaubst du, mir ist es nur um Rache zu tun?«Da versagt Michas Stimme, als würde sie wieder in die Stummheit der Körperzellen zurücksinken. Psych ergreift das Wort: »Mache dir keine Sorgen, ich kümmere mich um den Jungen. Wenn wir uns nur menschlich genug verhalten, wird sein Geist sich wieder dauerhaft dort einfinden, wo ich jetzt bin. Noch ist er im Halbschlaf, es besteht sogar die Gefahr, dass er für immer einschläft, sollte er sich nicht aktiv am Menschsein beteiligen. Es ist sein Körper, doch ich bin der Lenker.«
So wird also Michatron, der nun zwei Persönlichkeiten, eine wache und eine schläfrige, in sich trägt, hinaufgehen, um Menschlichkeit wiederzuerlernen. Er hat einen Tag Zeit, um so viel wie nur irgend möglich zu unternehmen, sonst wird der gemeingefährliche Doktor Phys seine Abwesenheit bemerken und erbarmungslos nach Michatron fahnden lassen. Er wird zuvorderst in eine Stadt aufsteigen, deren Hauswände rußgeschwärzt sind, kein Vogel zieht am Himmel entlang, die traurig hin- und herschlurfenden Leute sind wie magere Vogelscheuchen auf einer wüsten Heide. Doktor Psych kennt den Grund, Micha, der nur äußerst schwerfällig diese Dinge auffasst, kommt alles noch wie ein Albtraum vor. Doktor Psych wartet mit erklärenden Worten auf: »Was du hier siehst, ist die Stadt Bombenschauer. Sie war der Schauplatz altmodischer Kriegsführung, von Mann-gegen-Mann-Gefechten über Panzerattacken bis hin zu weiträumigen Bombenabwürfen. Die Leute haben ihre Heimat zwar größtenteils aufgebaut, doch die Angst vor weiterer Zerstörung ist geblieben.«Michatrons nächster Reiseort ist die Stadt Genom. Seine computergestützten Augen gleiten über arbeitende Menschen, die zwar wie Menschen aussehen, doch höchst eigentümlich ihre Geschäfte verrichten – leblos, kalt … mechanisch. Michatron kann sich frei unter ihnen bewegen, niemand sendet ihm neugierige oder argwöhnische Blicke nach. Auf dem sauberen und gepflegten Gehsteig, auf dem die Passanten sich wie fremdgesteuert fortbewegen, wird er von jemandem in der Enge angerempelt, der ihn darauf unverwandt ansieht. Michatron macht es ihm nach. Dann sagt der Rempler mit Erstaunen: »Nein, das ist unmöglich! Micha! Micha! Du bist es, oder? Ach, was sage ich: Du musst es sein! Was ist? Erkennst du deinen alten Klassenkameraden Claude nicht wieder?«Jawohl, er wird es sein, Claude aus Doktor Weisbarts Unterrichtsstunden und dem er in dem hektischen Gedränge wiederbegegnet nach so vielen Jahren. Doch Michas Geist schlummert noch tief in seiner verbliebenen organischen Zellstruktur, obgleich er jeden Umweltreiz genauestens speichert und jedes Mal aus Seelenkräften versucht, sich ins Bewusstsein des maschinellen Zentrums durchzuringen. Somit übernimmt Doktor Psych das Sprechen und erklärt Claude, was mit Micha geschehen ist und was sie zu tun beabsichtigen. Claude bietet seine Hilfe an, denn ihm geht es auch nicht besser. Er ist das unfreiwillige Opfer des Klonvorgangs geworden, also des identischen Wiedererschaffens eines Menschen, der dem Urbild nicht nur aufs Haar gleicht, sondern auch in seinem Denken und Fühlen. Es wird derselbe Claude sein, der schon Jahre zuvor gestorben sein wird; weil ihn verbotene Dinge antreiben, will man ihn hierfür gebührend haftbar machen, doch wird ihn der Krebs den strafenden Händen entziehen. Der jetzige, erfolgreich geklonte Claude ist frei von Krankheit, seine Strafe ist sozusagen der forsche, immer gesunde Einsatz seiner Arbeitskraft für Genom, wo es offenbar keinen Menschen gibt, der auf gewöhnlichem Weg geboren wird. Als die Klone in ihren Blocks sich zur verbindlichen Nachtruhe betten, pflanzt ihm Michatron einen Digitalwecker ein; er weckt ihn vorzeitig aus dem Pflichtschlaf, sodass er unbemerkt aus Genom fliehen kann. Nun ziehen zwei mehr oder weniger menschliche Körper und drei Seelen gemeinsam fort. Bevor sie in die nächste Stadt kommen, gehen sie über ein ausgedorrtes, staubtrockenes Feld. Michatrons Sinne beginnen zu surren vor Erregung. Doktor Psych fängt die Signale auf und er versteht, was Micha ihm sagen will. Mehr zu Micha als zu Claude sagt er: »Ja, du hast es richtig erkannt. Hier, wo der Felsgigant auf das Tal hinabblickt, lagen einst die Äcker, die zur Ernährung des Landes Gutgenug dienten. Die Ernte wurde für alle Zeit von Bakterien vernichtet, die man in Laboratorien künstlich erschuf. Sie sollten ursprünglich den Welthunger bekämpfen, indem sie Nahrungsmittel labortechnisch vervielfältigen. Doch die verschworenen Nachbarländer hatten andere Pläne mit Gutgenugs Bevölkerung …«Claude wird traurig erkennen: Was schon damals, als er noch sein altes Ich war, bei Doktor Weisbart lang und breit besprochen wurde, ist heute bittere Wahrheit. »Irgendwie habe ich’s schon immer gewusst.«, schimpft er und dann betreten sie die Wohnbezirke von Gutgenug. Obgleich die Straßen wie normal bewohnt scheinen, zeigt sich niemand, wie durch eine Geisterstadt wandeln Claude und Michatron, während des Letzteren Nervenzellen und Sinne Stück für Stück ihren alten Platz einnehmen. Nach mehreren Stunden glücklosen Herumirrens, ohne auf eine Menschenseele zu treffen, entscheiden sie, die tote Stadt zu verlassen. Sie sehen am Himmel eine eigentümliche Bewegung. Gegenstände, Zäune, Dächer – und auch schreiende Menschen! – quirlen hilflos im und um den Trichter eines Wirbelsturms. Nicht weit dahinter sehen sie noch einen, größer, zerstörerischer. Als sie schutzsuchend in eine unterirdische Höhle schlüpfen, glauben sie, der Gefahr entkommen zu sein, da merken sie, dass ihnen im Rücken ein weiterer Trichtersturm auflauerte; nur knapp retten sie sich in die dunklen Abgründe. Michatrons automatische Scheinwerfer erhellen die Gewölbe, als wäre es Tag. Da treffen sie auf seltsame, zusammengeschrumpfte Menschlein, die keine Augen haben. Sie wittern ängstlich die Fremdlinge, ihr Sprecher indes tritt mutig vor und spricht hehr: »Willkommen in dem, was vom schönen Arodnap übriggeblieben ist. Ich spüre, dass ihr Fremde seid. Wenn ihr bis nach Neu Eden durchkommen wollt, zeige ich euch gerne den Weg.«
»Warum geht ihr denn selber nicht?«, dringt es aus Michatron auf einmal hervor, als hätte er keine Stunde das Sprechen verlernt. Der blinde Sprecher senkt den Kopf und spricht: »Wir glauben daran, dass es einst vorbei sein wird! Wir lassen uns unsere Heimat nicht wegnehmen! Man erzählt uns, die Natur nehme Rache an uns, weil wir unachtsam mit unserer Umwelt umgingen. Das aber ist nicht einmal die halbe Wahrheit. Diese abgefeimten Wissenschaftler nämlich arbeiten Tag und Nacht an neuen heimtückischen Waffen, mit denen sie ihre finsteren Pläne, die niemand endgültig kennt, umsetzen. Wir wissen nur eins: Ein Menschenleben bedeutet ihnen nichts …!«Im Schutze der unterirdischen Gänge dringen Michatron und Claude mit ihrem Führer unversehrt unter dem Sturmland bis zu den Polywäldern vor. Sie erfahren von ihm, dass in jenem Land ein wissenschaftlicher Kongress abgehalten wird, an dem der Fiesling Doktor Phys beteiligt ist. Wieder über Tage nehmen sie Abschied von ihrem sinngeschärften Führer und fliehen vor den abklingenden Resten des pfeifenden Gewitters unter die hohen, eindeckenden Schirme der Laubbäume. Claude, als ganzer, wenn auch wiedererschaffener Mensch, ist ruhebedürftiger als Michatron, so bittet er sich eine Pause aus. Sitzend auf einem abgehauenen Stamm, besprüht er seine Haut vorsorglich mit Zeckenspray, Michatron fährt seine Apparaturen auf Schonenergie herab, und tut das, was für ihn Ruhe und Erholung bedeutet. Als sie eine Weile so dasitzen, bemerkt Claude wiederholtes Piksen auf seiner Haut. Als er von sich zufällig niederblickt, stellt er entsetzt fest, dass sich etwa ein halbes Dutzend birnengroßer Zecken an seinem Leib festgebissen haben. Er schreit um Hilfe, Michatron, wie in solchem Falle nicht anders zu wünschen, ist sofort auf den Beinen, richtet auf Claudes schlotternden Körper den stumpfen Unterarm, der aus seinen winzigen Löchern geruchlosen Dampf aussendet und die Zecken besiegt herabpurzeln lässt. »Ich hätte es wissen müssen!«, macht sich Michatron Vorwürfe, allerdings wird es Doktor Psych sein, der hier spricht. »Es sind Experimente, die mein Bruder beaufsichtigt hat. Er wollte durch mutierte Kleinstlebewesen feindliche Länder angreifen, die in ihren Körpern auch die ein oder andere Bombe bergen. Gleichsam machte er sie in ihrer Urgröße zu immunen Trägern von beliebig vielen Krankheiten, dazu genügt es, dass sie ihr Opfer einmal zwicken.«Claude hört das mit Entsetzen. Er drängt Michatron, dass sie so schnell als möglich aus den Polywäldern fliehen, um von Doktor Phys ein Gegenmittel zu erzwingen, falls die Zecken ihm wirklich eine wie auch immer geartete Krankheit übertragen hatten. Sie erreichen Neu Eden. Hier geht es über alle Maßen friedlich zu. Die Leute sind freundlich, erheben niemals ihre Stimme gegeneinander; sie gleichen in ihrem Verhalten engelhaften Wesen. Kaum zu glauben, dass es bis vor kurzem kein Gebiet auf der ganzen Welt gegeben zu haben scheint, in welchem ruhiges, verständnisvolles Betragen in solch krassem Gegensatz nun zu Tage tritt. Michatron, dessen Geist seiner bewussten Warte immer näher rückt, empfindet das Leben hier mit Wohlwollen, Claude dagegen drängt ihn ständig, dass sie es eilig haben. Sie treffen auf eine Gruppe junger Leute, die vor einem farblosen, unbewegten Monitor versammelt sitzen. Da merkt Michatron, dass sie einzeln über Augen und Ohren mit dem geräuschlosen Gerät verkabelt sind. Als Claude versehentlich über den Kabelwust stolpert, reißt er damit einer Schülerin die Verbindungseinheit vom Kopf; sie schreit verzweifelt auf. Doktor Psych lässt Michatron sprechen, denn er fühlt ihn mehr und mehr heraufkommen: »Was schreist du so? Was ist das hier für ein Ulk? Ihr seid wohl Maschinenmenschen, so wie ich, und habt nichts Besseres zu tun, als euch Kinofilme direkt ins Gehirn leiten zu lassen.«Das Mädchen lacht und spricht: »Unsinn! Wir sind beim Schulunterricht. Unsere Lehrkraft vorne versorgt uns mit den neusten Episoden aus den ruhmreichen Tagen unserer Vorfahren.«Michatron schnappt sich die Verbindungseinheit, wehrt dabei den hindernden Zugriffen des Mädchens und schließt sie an seine halborganischen Sinne. Womit sein Gehirn gefüttert wird, ist unglaublich, doch Doktor Psych möchte Micha zeigen, wie verlogen es um Neu Eden steht. Er sieht Berichte und Dokumentationen, wie Spielfilme gedreht, handelnd von einer Zeit, in der Michatron noch der einsame Junge reinen Fleisches und Blutes war. Er erinnert sich. In den Videos fehlt jede Spur menschlicher Gewalttätigkeit, Unvernunft und Zwanghaftigkeit. Kein Wunder, dass die Schüler gleichermaßen den Unterricht genießen: Was sie wissen müssen, wird ungeprüft in ihre Gehirne eingespeist, somit gibt es in Neu Eden weder eine freie Wissenschaft noch das Bedürfnis nach einer solchen, denn jeder lernt, die Welt sei schon immer perfekt gewesen – und bleibe es. Als Michatron genug von dem Lügenmaterial hat, geht er mit schwer aufstampfenden Schritten zu der elektronischen Lehrkraft, steckt das Kabel seines Gedächtnisspeichers in das Gerät und transferiert jede einzelne Information seines Lebens in den Lehrkasten, der sie unverzüglich in die Stimuhelme der Schüler weiterleitet. Ihre Mundwinkel senken sich fast zeitgleich, als ihnen gezeigt wird, was wirklich geschah, was noch geschieht – und geschehen wird! Einige Schüler schaffen es, sich den Stimuhelm vom Haupt zu reißen und stürmen wie von Sinnen davon. »Vergesst nicht«, mahnt Michatron die übrigen Schüler, »Lernen hat nichts mit Unterhaltung zu tun! Glücklich zwar, wer Lernen als Unterhaltung empfindet, doch muss der Lehrstoff verbürgten Tatsachen entsprechen. Ihr seid lange getäuscht worden, nun habt ihr gelernt, wie die Welt wirklich beschaffen ist.«Neu Eden stellt keineswegs die letzte Etappe auf Michatrons Selbstfindungswanderschaft dar. Schon gar nicht, seit er ja weiß, dass sich der gefährliche Doktor Phys jenseits von Neu Eden in der Kongresshalle befindet. Auch Claudes Sorge um seine Gesundheit drängt die beiden zur entscheidenden Begegnung mit ihrem Widersacher. Die Kongresshalle steht auf dem Gipfel des einst für seine großartigen Bauwerke und klugen Leute bekannten Landes Patricorn. Seit jedoch der Handelsverkehr mit anderen Ländern in regen Austausch gekommen ist, sind unzählige Völker unterschiedlichster Gesinnung und Verhaltenstypen nach Patricorn geströmt; schrittweise werden sie seine festen Kulturpfeiler ins Wanken bringen, Michatron und Claude glauben fast, es hätte nie jenes vortreffliche Land gegeben, lediglich von einigen wenigen Ureinwohnern erfahren sie, wie reichhaltig ihre verlorene Heimat einst gewesen ist. Gehört dies etwa auch zu den Machenschaften des Doktor Phys, was meint ihr? Jedenfalls sind Claude und Michatron auf den Höhen der Kongresshalle, doch kommen sie leider zu spät; die Versammlung ist bereits beendet. Sie sehen die gepanzerten Wagen mit ihren wichtigen Köpfen abfahren, darunter auch Phys – mit seiner Familie. Michatron hat sein Bewusstsein so weit zurück, dass Geist und Körper ebenso viele Befehle erteilen können wie Psych, der bislang die meiste Kontrolle haben wird. So hadern die beiden miteinander, als Psych Michas zornerfüllte Absichten erfühlt; sanft auf ihn einredend, versucht er, Micha zur Vernunft zu bewegen. Doch Micha ist in seinem Entschluss gefestigt. Er ist dem Wagen auf der Spur, bis er an einem Badeort hält, wo Phys mit seiner Gattin und den drei Kindern den sonnigen Nachmittag verbringt. Er wartet auf den passenden Moment, um sich Phys heimlich vorzuknöpfen, doch da beginnt schon der wiedererstarkte Geist Michas in eine Gewissenskrise zu versinken. Wie er so die vielen Familien in Wonne sieht und hört, fällt es ihm schwer, zu glauben, dass einer unter ihnen ist, der so grässliche Dinge verursachte, die Michatron auf seinem Selbstfindungspfad so bitter mitbekommen wird. Nichtsdestotrotz stellt er ihn zur Rede. Als Frau und Kinder zerstreut im Wasser spielen, packt Michatron seinen Umschöpfer und faucht im Wutrausch mit vorgehaltener Armschiene: »Sie haben mir diese Waffen angepflanzt. Wie wär’s, wenn Sie der Erste sind, der ihre Wirkung erfährt?«Der Bedrohte stammelt: »Ich kenne dich, Micha. Ich weiß, was du brauchst. Du warst ein Vorreiter, der Erste, der die Zwietracht der Menschlichkeit freiwillig einebnen ließ, indem du dir dachtest: Dem Körper beschränkte Genüsse, aber der Seele die erregungslose Weitschweife des Universums. Du bist ein Engel, erkennst du das denn nicht? Indem du deinen Körper hingabst, befreitest du deine Seele.«
Michatron erwidert, wutentbrannter denn je: »Und dennoch wurde mein Körper für kriegerische Absichten missbraucht …«Schon ist er dabei, einen Schuss abzufeuern, da stürmt Doktor Psych sein Bewusstsein. »Bruder, hörst du mich? Ich habe versucht, dem Jungen sein altes Ich wiederzugeben; mit übermäßigem Erfolg, wie sich nun herausstellt. Deine Taten sind unverantwortlich, so viel ist wahr. Doch bitte ich dich: Beweise dem Jungen, dass du ein Mensch bist, dem Liebe nicht allein Privatsache ist, er sah, wie du deine Kinder geherzt hast, sie mit einem Ausdruck inniger Väterlichkeit in deine Arme geschlossen hast und sie nur schwer von dir ließest. Beweise ihm, dass ein Mann des Wissens auch ein Verfechter der Liebe ist.«Psych hält Michas rachedurstigen Kräfte zurück, sein listiger Zwilling nutzt diesen inneren Widerstreit und macht sich aus dem Staub; noch ehe Michatron ihm nachsetzen kann, verschwindet er hinter der Bleitür seines Geheimbunkers, von denen Dutzende im gesamten Großreich angelegt sind. Kurz darauf schießt eine Rakete mit großem Lärm in den Abendhimmel, geradewegs zu Phys’ Sternenlabor, in sicherer Entfernung von der kranken Erde. Aus dem Loch, welches ringsum nach dem Feuerstrahl von verkohlten Pflanzen umgeben sein wird, gleitet ein glühend roter Ball empor und spricht zu Michatron und Claude: »Ich bin der Kern, das Herz der Erde. Lange duldete ich eure Gräuel auf meiner Haut. Doch dass ihr euch anmaßt, gegen das Tor meiner Liebe zu rammen, um es endlich zu durchbrechen, zeugt von schlechter Natur; ihr seid es nicht länger würdig, dass ich euch meine Kinder heiße.«Der Kern sinkt in das Loch zurück und lässt die Erde fürchterlich erbeben. Claude sagt spitz zu Michatron: »Und wie soll ich jetzt noch erfahren, ob ich krank bin oder nicht?«Michatron, im Einklang zweier Seelen, übergeht seine Frage und spricht wie ein Erleuchteter: »Als ich noch reiner Menschenjunge war, passierte es oft, dass sogenannte Ungebildete bisweilen die sogenannten Gebildeten mit ihrer Verständigkeit in Erstaunen versetzten; so auch mir. Aus Sicht der Letzteren setzt alles dem Menschen erreichbare Wissen den Sklavenstand des zu Belehrenden voraus. Nicht so aus Doktor Weisbarts, in ihm überwog das Mitgefühl, er billigte meinen Wunsch, da er einerseits um die allgemeine Gleichgültigkeit um seine Arbeit wusste und zweitens treuherzig glauben musste, sie entwickle sich einst zum Guten. Die Ruinen der Schule lieferten den Beweis dafür, dass ich mich damals richtig entschied; wer ist denn wirklich gebildet, wer ungebildet …?«Claude indes drängt ihn zu einer Antwort, da er sich große Sorgen um sein Wohlergehen macht. Michatron schüttelt den Kopf und sagt mit einem schwachen Lächeln: »Menschen wollen Unsterblichkeit, weil sie sterblich sind. Und wären sie unsterblich, würden sie sich massenweise nach Tod sehnen.«Ich bin am Ende meiner Ausblicke, weiter wird mir nichts gezeigt. Wenn also wieder mal ein Lehrer oder eure Eltern schimpfen, euch Dummkopf nennen und ihr das Gefühl habt, dass sie zu Unrecht einfach alles besser wissen, dann denkt daran: Jeder von euch könnte ein Claude oder Michatron werden …
Es muss doch wahr sein
Zwei politische Extremisten saßen gemeinsam am Flussufer. Der eine verfocht vehement seine Ansicht: »Dieser Stein dort im Wasser – er ist das Sinnbild für Dauerhaftigkeit, Brauchtum und Stärke. Nichts kann ihm etwas anhaben, so wird er noch stehen, wenn alles um ihn verschwunden sein wird.«Der andere, nicht minder überzeugt von seinen Zielsetzungen, hielt entgegen: »Das treibende Wasser wird den Stein über kurz oder lang abtragen, denn alles ist in Bewegung, ist ständigem Wechsel unterworfen – und so gibt es kein Bestehen für etwas, das sich gegen Veränderungen auflehnt.«
Während beide stritten, kam Grillwarze des Weges, genannt »der weise Kindskopf«, der seiner Schiedssprüche wegen hoch angesehen war. Man bat ihn, den Streitfall zu beenden. Er hieß die beiden Rivalen in die Barke steigen, um ans andere Ufer zu übersetzen, nichts anderes hatte in seiner Absicht gelegen. Als sie über einer seichten Stelle dümpelten, wies er den Verfechter des Dauerhaften an, ins Wasser zu steigen und dort zu verharren. Seinem Rivalen indes gebot er, als das Wasser strömender dahinfloss, mit entsprechender Ausrüstung auf Tauchgang zu gehen und jene Stelle anzusteuern, wo der andere wartete. Mit der Harpune sollte er den Wartenden angreifen, der Überlebende aber sei der Sieger. Dem mörderischen Taucher gelang es, seinen Gegner umzubringen, doch geriet er in seiner Siegestrunkenheit unversehens in einen Strudel, der ihn fortriss und auch seinem Leben auf hartem Gefels unterhalb des Wassersturzes ein Ende setzte. Grillwarze hatte bekommen, was er wollte, man hatte ihn ans andere Ufer gebracht und das bisschen Nässe, das er aus dem Zipfel seines Kleides wringte, war ein spottgeringer Preis gewesen. Jahrhunderte später avancierte die Sage von den Erzrivalen zur Touristenattraktion. Festspiele, Wettbewerbe und Souvenirstände bewarben den einfältigen Zwist, der aus den Heimatbüchern ausgegraben worden war und in seiner Prägnanz so zeitlos schien, dass er jedem Typus etwas bot. Dies geschah zu Friedenszeiten. Nachdem die zivilisatorische Erosion namens Krieg über das Land rollte, erinnerte nichts mehr an die von stürmischen Jahren aufgefressene Polemik, die so naturnah begonnen hatte, ebenso wenig an die darauffolgende Sagenpflege. Allein die sterblichen Überreste der im Wasser Umgekommenen, längst in der Nahrungskette aufgegangen, konnten ihren Überzeugungen die Stütze für die sich erneuernde Umwelt geben. Denn schon eilten die Flüsse dahin, und es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis sie irgendwo aufbrandeten. Und damit die Spiritisten sich nicht betrogen fühlen, sei angemerkt, dass Augenzeugenberichte von Erscheinungen sprachen, die das ungleiche Paar gesehen haben wollten, wie sie, bar von zeitlichen Begrifflichkeiten, der Arm des einen über die Schulter des anderen gelegt, am Ufer sitzend, mitleidsvoll über die Unbelehrbarkeit der Sterblichen lamentierten.
Bildersprache
Der umtriebige Wind kehrte nach langer Reise bei seiner Freundin, der Zelle, ein. Sie beneidete ihn um seine umfassende Bildung, während er ihre stille Geduld schätzte angesichts der zahlreichen Vorgänge innerhalb ihrer Wände, die oft ans Unerträgliche grenzten. Er, der Welterfahrene, fing unverzüglich zu berichten an: »Glauben wirst du’s mir nicht, liebe Freundin, aber ich habe Länder bereist, wo die heimischen Wände ihren Bewohnern zum Gefängnis wurden. Manch einem mag dies zur inneren Einkehr verholfen haben, die große Mehrheit aber, sobald Freigang sich unwiderstehlich anbot, ging ihren früheren Ausschweifungen wieder nach. Es heißt: Wenn Wände reden könnten … zum Glück kenne ich welche, die es vermögen; über jene, die von ihnen umschlossen werden, gibt es nur wenig Ehrbares zu sagen. Wer denkt schon an diesen Raum, der sich nie wandelt …«Er erwartete, dass die Zelle etwas erwidern würde, aber da sie schwieg, fuhr er in seinem Bericht fort. »Ich habe beachtliche Gehirne gesehen, deren Hände Mangelhaftes hervorbrachten, und umgekehrt; ich habe Kleinkriege sich mit Großkriegen abwechseln sehen, und jeder einzelne fing auf seine Weise die Unendlichkeit ein; ferner habe ich Bild mit Bild streiten sehen, da jedes sich für das schönste hielt. Wäre ich nicht ständig auf Reisen, ich glaube der Stillstand, mithin die Beschäftigung mit dem Gesehenen, würde mich zerstören.«Die einsilbige Zelle ließ nun ihr Wort erklingen: »Meist streifst du die Dinge nur. Viel gesehen zu haben heißt nicht, vieles zu verstehen. Nicht alles lässt sich bequem in Bildern ausdrücken. Immerhin, ich will es dennoch versuchen. Einer meiner früheren Beseeler saß in Gesellschaft zweier, die aus ihm einerseits etwas herauskitzeln und ihm andererseits etwas einreden wollten. Die zwei verfochten die>politische Korrektheit<, er hingegen stand auf Seiten der >wissenschaftlichen Korrektheit<. Seine Reden waren verständig, wie es die deinen auch sind; vom Forscherdrang geleitet, wollte er Licht ins Dunkel politischer Höhlen bringen, die sich dem verwehrten. Ihre Reden gingen nämlich so: >Krankheit ist böse! Böses muss bekämpft werden!< Die seinen gingen so: >Krankheit ist natürlich, obgleich sie freilich, wenn möglich, geheilt werden sollte.< Unter denkenden Wesen gibt es keine Einigkeit darüber, wo die Grenzen von Krankheit anfangen beziehungsweise aufhören, schon gar nicht über das Böse. Wer dies dennoch behauptet oder durch sein Handeln darauf schließen lässt, dass es so ist, fährt auf geistiger Einbahnstraße; rücksichtslos reißt er andere Verkehrsteilnehmer mit und steuert schnurstracks auf die Sackgasse zu, die zur Sackgasse aller werden soll. Auch ich habe viel gesehen, wie du. Wir sind, was wir sind, was wir werden mussten, doch einen bestimmten Posten zu verteidigen bringt es mit sich, andere Gesichtspunkte zu ignorieren, ja, zu leugnen; vielleicht stehen die anderen für etwas ein, was dir gerade fehlt, was du im Austausch erhalten könntest, wärest du nicht so sehr darauf aus, ununterbrochen auf Kriegsfuß zu stehen. Was meinst du: Können komplizierte Sachverhalte kurz und bündig wiedergegeben werden? Oder sind sie ein Selbstzweck, dann wären sie allerdings das rahmenlose Abbild der unergründlichen Natur der Dinge. Wie wollte man etwa das längst Entschiedene und das zufällig Errungene bildlich, als Einheit sogar darstellen? Du siehst, ich vermag nicht, weiterzuforschen.«Nach einer Weile wurde die Zelle abgerissen. Ob dies längst entschieden worden war, konnte niemand beantworten. Was sie zufällig errungen hatte, trug der Wind mit sich fort.
Das falsche Märchen
– Von der doppelten Moral –
Lupold war ein aufmerksamer Junge, der sich gerne beim Zubettgehen alte Märchen von seiner Mutter vorlesen ließ. Diesen Abend ging es um den ehrbaren Müller, dessen fester Gottesglaube ihm bis kurz vor seinem Hinscheiden nur Mühsal beschied; die Engel überhäuften ihn mit Reichtum, nachdem seine unholden Widersacher den Preis für ihre Bösartigkeit bezahlt hatten. Das Märchen schloss mit den Worten: »…denn am Ende siegt das Gute.«
Am nächsten Morgen, auf dem Schulweg, sah Lupold den Dorfpriester mit seinem Gebetbuch nach einem Bettler schlagen, als dieser sich nicht vom Kirchportal entfernen wollte. Da kam eine mitleidige Frau hinzugeeilt und schalt den Gottesmann: »Sobald Ihr hereingeht, erzählt Ihr doch von Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Euer Glaube gründet sich doch auf dem Leben eines Besitzlosen!«In dieser Nacht hatte Lupold einen schweren Schlaf. In unseren Träumen sehen wir die Dinge oft auf eine Weise behandelt, über die man uns im Wachen zu schweigen lehrt. Das Unterbewusstsein (das ist der unsichtbare Wahrsager unserer Gefühle und Gedanken) lenkte Lupolds Geist auf jenen Gipfel, von wo aus er den Widersinn erkannte zwischen der zwingenden Märchenmoral und den lebensechten Zuständen. Denn eines musste doch dem anderen vorausgehen, nicht wahr? Als er schweißgebadet aufschreckte, rief er nach seiner Mutter und erzählte ihr in jeder Einzelheit, wie sein Traum ihn warnen wollte. Die Frau unterschätzte wohl die Klugheit ihres Sohnes, sie beruhigte ihn mit dem abgedroschenen Ausspruch: »Schlaf weiter. Es warnurein Traum.«Aber Lupold ließ sich nicht so einfach beruhigen. Heute hörte er in der Schule von den Umweltproblemen, den riesigen Müllbergen, die immer höher und höher wuchsen; um die Natur zu schützen, hieß man die Kinder, auf überflüssiges Verpackungsmaterial zu verzichten, sonderlich auf solche, die nicht wiederverwertet werden konnten. Tat man so, dann freute sich die liebe Natur. Zu Hause angekommen, hetzte Lupolds Mutter den armen Jungen von einem Zimmer ins nächste, um rasch sämtlichen Abfall zusammenzusuchen, den er finden mochte, da die Müllabfuhr bald eintreffen werde. So musste er teures Essen aus Verpackungen, die noch gut zur Hälfte gefüllt waren, auskippen und wusste nicht wohin mit der verderblichen Nahrung. Am Ende hatte er die Hände voll Plastikmüll, von dem er wusste, dass er damit der empfindlichen Umwelt wehtun werde. Aber was sollte er tun? Auch in dieser Nacht schlief Lupold schlecht; die letzten beiden Abende ließ er sich nichts vorlesen, er fand nämlich, er müsse die jüngsten Widersinnigkeiten erst richtig einordnen. Seinem Unterbewusstsein, dem großen Traumschöpfer, konnte er indes nicht so leicht das Ruder wegreißen. Es bedachte den armen Jungen mit schrecklichen Angstabenteuern, bis er aufschrie und schrie, als er schon aufrecht im Bett saß, allein im dunklen Zimmer, um zu sehen, dass Mutter hereinstürmte, damit er gewiss sein konnte, der Hilflosigkeit der eigenen Fantasien entflohen zu sein. Doch niemand kam. Dieses war die Nacht, die ihm den Mut gab, von zu Hause auszuziehen und nach Antworten für das seltsame Verhalten der Menschen zu suchen.
– Die erste Reise –
Er war schon weit gewandert, da traf er auf den Stammessohn und den Zivilisten, zu dessen Welt auch er gehörte. Ersterer klagte: »Mein Wort hat beim Stammesältesten kein Gehör gefunden! Ich konnte mich nicht einfügen, so verbannte man mich aus meinem Stamm.«