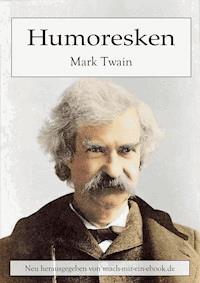Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mark Twains Buch 'Meine Reise um die Welt' ist ein faszinierendes Werk, das eine Reihe von humorvollen und kenntnisreichen Reiseerzählungen des Autors enthält. Twain präsentiert dem Leser eine Sammlung von Berichten aus seinen zahlreichen Abenteuern und Begegnungen während seiner Reise um die Welt. Sein leichter und unterhaltsamer Schreibstil wird durch seine scharfe Beobachtungsgabe und seinen einzigartigen Humor ergänzt, der dem Leser ein lebendiges Bild der verschiedenen Länder und Kulturen vermittelt, die er besucht hat. 'Meine Reise um die Welt' ist ein bemerkenswertes Werk, das Twains kulturelle Sensibilität und literarisches Talent widerspiegelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 615
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mark Twain: Meine Reise um die Welt
Books
Inhaltsverzeichnis
Erste Abteilung
Im stillen Ozean / Australien. Von Australien nach Indien
Erstes Kapitel.
Es kommt vor, daß ein Mensch zwar keine üblen Angewohnheiten hat – aber Schlimmeres.
Querkopf Wilsons Kalender.
Der Ausgangspunkt meiner Vorlesungstour um die Welt war Paris, wo ich seit ein paar Jahren mit den Meinigen lebte. Wir reisten von dort nach Amerika, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Das war schnell geschehen. Zwei meiner Angehörigen beschlossen die Reise mitzumachen – desgleichen ein Karbunkel. Im Wörterbuch steht: ein Karbunkel oder Karfunkel ist eine Art Edelstein. Ich muß gestehen, daß der Humor in einem Wörterbuch schlecht am Platze ist.
Mitten im Sommer brachen wir von New York nach dem Westen auf; alles Geschäftliche übernahm Herr Pond, bis zum Stillen Ozean. Es war ein heißes Stück Arbeit und in den letzten vierzehn Tagen obendrein rauchig zum Ersticken, weil in Oregon und Britisch Columbia gerade die Waldbrände wüteten.
Während einer Woche genossen wir den Rauch auch noch am Seestrande, wo wir eine Zeitlang auf unser Schiff warten mußten. Es hatte im Rauch die Richtung verloren, war auf den Grund geraten und mußte erst gedockt und aufgezimmert werden.
Endlich wurden die Anker gelichtet, und damit endete unser Schneckengang auf dem Festland, der vierzig Tage gedauert hatte. Wir segelten westwärts über die leicht gekräuselte, glitzernde Sommersee, die, zum Entzücken klar und kühl, von jedermann an Bord freudig begrüßt wurde. Am willkommensten war sie mir, nach dem Staub, dem Rauch und der Hitze, die ich in den letzten Wochen durchgemacht hatte. Die Seereise verschaffte mir eine dreiwöchentliche, fast ununterbrochene Ruhezeit. Wir hatten den ganzen Stillen Ozean vor uns, und nichts zu tun als nichts zu tun und uns gemütlich zu fühlen. Victoria, die Hauptstadt der Vancouver-Insel, leuchtete nur noch schwach aus ihrer Rauchwolke herüber und wollte eben verschwinden. Wir legten die Feldstecher beiseite und ließen uns friedlich auf den Klappstühlen nieder, wie zufriedene Leute. Aber sie brachen unter uns in Trümmer zusammen und brachten uns in Schmach und Schande vor allen Passagieren. Zum Preis von guten Stühlen hatten wir sie aus dem größten Möbelgeschäft von Victoria bezogen, und dabei waren sie keinen Heller per Dutzend wert. Im Indischen und im Stillen Ozean muß jeder noch immer seinen eigenen Klappstuhl mit an Bord bringen, wie das in längst vergangenen Zeiten auch auf dem Atlantischen Ozean Sitte war – im finstern Mittelalter der Seereisen.
Unser Dampfer war sonst recht behaglich eingerichtet; wir bekamen die gewöhnliche Schiffskost – gute und reichliche Nahrung, von der Vorsehung gespendet, aber in des Teufels Küche gekocht. Auch die Mannszucht an Bord war so gut, wie sie überhaupt in jenen Breiten zu haben ist. Für eine Fahrt in den Tropen war das Schiff nicht besonders zweckmäßig ausgerüstet, aber das ist ja durchgängig bei allen Fahrzeugen der Fall, die man nach den Tropen schickt. An Kakerlaken litten wir keinen Mangel; auch das ist die Regel auf den Schiffen in jenen Meeren, das heißt, auf allen, die schon längere Zeit im Dienste stehen.
Der Kapitän war ein junger, schöner Mann, groß und hübsch gebaut; eine Gestalt, auf der sich eine kleidsame Uniform besonders vorteilhaft ausnimmt. Er meinte es sehr gut mit uns und war freundlich und höflich, wie ein vollendeter Kavalier. Durch sein angenehmes, verbindliches Wesen verwandelte er jeden Raum, den er betrat, sofort in einen Salon; im Rauchzimmer ließ er sich nicht blicken. Von schlechten Gewohnheiten war er ganz frei; er rauchte und schnupfte nicht, kaute auch keinen Tabak; man hörte ihn weder fluchen noch schimpfen, kein grobes oder unfeines Wort kam je aus seinem Munde. Er machte keine schlechten Witze, erzählte keine Anekdoten, lachte nie unmäßig oder erhob die Stimme lauter, als es die Gesetze der Schicklichkeit vorschrieben; jeder Befehl, den er erteilte, nahm den Ton einer Bitte an. Nach Tische erschien er mit seinen Offizieren bei der Gesellschaft im Damensalon, beteiligte sich am Gesang und Klavierspiel oder wendete die Notenblätter um. Er besaß eine weiche, angenehme Tenorstimme und sang mit Geschmack und gutem Vortrag. War die Musik zu Ende, so kam eine Whistpartie an die Reihe, bis es für die Damen Schlafenszeit wurde. Im Salon brannte das elektrische Licht, solange die Gesellschaft es irgend wünschte, im Rauchzimmer aber nur bis elf Uhr. Keine von allen Vorschriften an Bord wurde so streng gehandhabt wie diese. Der Kapitän erklärte uns, daß er so fest darauf bestehen müsse, weil seine eigene Kajüte neben dem Rauchzimmer läge, und ihm vom Tabakgeruch übel würde. Da sich nun aber die beiden Zimmer auf dem Oberdeck befanden, wo immer frische Luft wehte, begriff ich nicht recht, wie unser Rauch in seine Kajüte kommen sollte. Die Zimmer waren durch keine Tür verbunden, und in der dicken Zwischenwand gab es weder Sprünge noch Risse. Für einen empfindlichen Magen ist aber vielleicht bloß eingebildeter Tabakrauch schon schädlich.
Mit seiner sanften Natur, dem feinen, liebenswürdigen Wesen, seiner Lauterkeit in Sitte und Rede, paßte der Kapitän für den herrischen, rauhen Seemannsberuf so gut wie die Faust aufs Auge. Er war mir ein rechtes Beispiel von der Ironie des Schicksals.
Obendrein lastete ein Mißgeschick auf ihm; das wußten die Passagiere und er tat ihnen leid: In der Nähe von Vancouver hatte er bei einer engen und schwierigen Durchfahrt, wo der dichte Rauch der Waldbrände alles in Dunkel hüllte, seinen Kurs verloren und war mit dem Schiff auf die Klippen geraten. Dergleichen würde unsereins für einen verzeihlichen Irrtum ansehen; bei den Direktoren einer Dampfschiffgesellschaft gilt es aber als ein Verbrechen. Zwar hatte das Admiralitätsgericht in Vancouver den Kapitän von aller Schuld freigesprochen, aber das konnte ihn nicht trösten. Bei seiner Heimkehr nach Sydney würde ein strengerer Gerichtshof den Fall untersuchen – das Direktorium der Gesellschaft, auf deren Schiffen der junge Mann seit Jahren als Steuermann gedient hatte. Dies war seine erste Reise als Kapitän.
Die Offiziere an Bord waren wackere und gesellige junge Leute, die sich an allen Belustigungen mit Vergnügen beteiligten, damit den Passagieren die Zeit nicht lang würde. Die Reisen auf dem Stillen und Indischen Ozean sind überhaupt wahre Lustfahrten für die Mannschaft. Unser Zahlmeister, ein junger Schotte, zeigte sich immer aufgeräumt, gesprächig und voller Leben, und doch war er ein körperlich kranker Mensch, das sah man ihm an. Aber sein Geist triumphierte über das Leiden; er besaß eine wunderbare Selbstbeherrschung, redete nie von seinen Schmerzen und benahm sich ganz wie jemand, der gesund und kräftig ist. Zu Zeiten litt er jedoch an den entsetzlichsten Herzkrämpfen, die oft viele Stunden dauerten. Während eines solchen Anfalls konnte er weder sitzen noch liegen; einmal hatte er sogar vierundzwanzig Stunden lang aufrecht stehen müssen, bei dem qualvollen Kampf auf Leben und Tod. Aber tags darauf sprudelte er wieder über von Lust und Laune, als ob nichts geschehen sei.
Der geistreichste Passagier an Bord, ein Mensch von glänzender Begabung, war ein junger Kanadier, dem es die Branntweinflasche angetan hatte. Er stammte aus einer reichen, angesehenen Familie und schien bestimmt Großes in der Welt zu leisten, doch nützten ihm alle Talente nichts, weil er seine Trunksucht nicht bezähmen konnte. Schon oft hatte er das feierliche Versprechen abgelegt, sich des Trinkens zu enthalten: aber man weiß ja, wie wenig dergleichen törichte Gelübde einem Menschen helfen, der nicht einen wahrhaft eisernen Willen hat. Dies Mittel ist in doppelter Hinsicht gänzlich verkehrt: erstens greift es das Uebel nicht bei der Wurzel an, und zweitens ist jedes Gelübde irgendwelcher Art etwas durchaus Naturwidriges. Es gleicht einer klirrenden Kette, die den Träger ohne Unterlaß daran erinnert, daß er kein freier Mensch ist.
Ja, ich wiederhole es: das Mittel greift das Uebel nicht bei der Wurzel an. Nicht das Trinken sollte man bekämpfen, sondern das Verlangen nach geistigen Getränken. Das ist ganz zweierlei. Zu ersterem gehört nur Willenskraft, die aber sehr stark und ausdauernd sein muß; zu letzterem nichts als Wachsamkeit und zwar während einer verhältnismäßig kurzen Frist. Da das Verlangen natürlich der Tat vorangeht, sollte man ihm auch die erste Aufmerksamkeit widmen. Was nützt es, immer und immer wieder der Tat zu wehren und das Verlangen ganz frei und unbehelligt zu lassen? Es macht sich stets von neuem geltend und endlich trägt es doch den Sieg davon. Sobald das Verlangen Einlaß begehrt, sollte man ihm die Türe verschließen; man muß unausgesetzt auf seiner Hut sein und es beizeiten vertreiben; sonst hat es sich fest eingenistet, ehe man sich's versieht. Weist man dagegen ein Verlangen nur vierzehn Tage lang beständig zurück, so kann man fast mit Sicherheit darauf zählen, daß es nach Ablauf dieser Zeit stirbt. Das ist die einzige Art, um die Trunksucht zu heilen. Sich nur immer wieder des Trinkens zu enthalten, ohne gegen das Verlangen zu Felde zu ziehen, scheint mir die törichtste Kriegsführung, die sich denken läßt.
Ich habe früher auch Gelübde abgelegt und sie gleich darauf gebrochen. Das ließ sich nicht ändern, denn mein Wille war nicht stark genug. Auch ärgert es einen im übrigen freien Menschen, sich irgendwie gebunden zu fühlen, und er zerrt so lange an seiner Kette, bis sie zerreißt. Deshalb übernahm ich zuletzt gar keine bestimmten Verpflichtungen mehr und beschloß nur, das schädliche Verlangen zu ertöten, ohne mich der Freiheit zu berauben, Verlangen und Gewohnheit wieder aufzunehmen, sobald ich wollte. Nun hatte ich keine Beschwerde mehr. In fünf Tagen machte ich meinem Verlangen Tabak zu rauchen den Garaus und brauchte nun nicht mehr auf der Hut zu sein, denn ich empfand niemals einen sehr heftigen Wunsch danach. Eines Tages wollte ich wieder anfangen ein Buch zu schreiben, nachdem ich fünfviertel Jahre so gut wie nichts getan hatte; aber seltsamerweise kam ich damit nicht von der Stelle. Da versuchte ich zu rauchen, um zu sehen, ob es mir dann gelingen würde. Und wirklich – das half. Nun rauchte ich fünf Monate lang täglich acht bis zehn Zigarren und ebensoviele Pfeifen, bis das Buch fertig war. Dann rauchte ich ein ganzes Jahr über gar nicht mehr, bis ich ein neues Buch beginnen mußte.
Ich vermag jede meiner neunzehn schlechten Gewohnheiten beliebig abzulegen, ohne daß es mir unbehaglich oder lästig wird. Auch Leute wie Doktor Tanner und andere, die vierzig Tage lang nichts essen, können das sicherlich nur durchsetzen, weil sie das Verlangen nach Speise gleich zu Anfang mit Entschlossenheit unterdrücken. Schon nach wenigen Stunden wird das Verlangen schwach und bleibt bald ganz aus.
Einmal habe ich meine Methode auch in großem Maßstabe als Kur angewendet. Ich lag schon mehrere Tage am Rheumatismus zu Bett, und mein Zustand wollte sich nicht bessern. Zuletzt sagte der Doktor:
»Meine Arzneien können Ihnen unmöglich helfen; bedenken Sie nur, wogegen ich alles ankämpfen muß; Sie rauchen ungemein stark, nicht wahr?«
»Jawohl.«
»Und trinken sehr viel Kaffee?«
»Jawohl.«
»Auch Tee?«
»Jawohl.«
»Sie essen allerlei durcheinander, was sich nicht zusammen verträgt?«
»Jawohl.«
»Auch trinken Sie jeden Abend zwei Gläser heißen Grog?«
»Jawohl.«
»Nun sehen Sie, das alles leistet mir Widerstand. Wie soll da die Genesung Fortschritte machen? Sie müssen sich durchaus in allen diesen Dingen beschränken und ein paar Tage lang weit weniger davon zu sich nehmen.«
»Das kann ich nicht, Doktor.«
»Warum denn nicht?«
»Mir fehlt die Willenskraft. Sie mir ganz versagen – das kann ich. Aber sie nur mäßig zu genießen, geht über mein Vermögen.«
Er meinte, das werde auch dem Zweck entsprechen; morgen wolle er mich wieder besuchen. Doch wurde er selber krank und konnte nicht kommen; es war aber auch nicht mehr nötig. Zwei Tage und zwei Nächte lang enthielt ich mich aller jener Genußmittel, ja ich aß überhaupt nichts und trank nur Wasser. Nach vierundzwanzig Stunden verlor der Rheumatismus alle Kraft und verschwand spurlos. Ich war wieder kerngesund, dankte meinem Schöpfer und nahm meine frühere Lebensweise von neuem auf.
Das Heilverfahren schien mir sehr empfehlenswert und ich riet es einer Dame an. Sie war sehr leidend und wurde immer schwächer, bis ihr zuletzt keine Arznei mehr helfen wollte. Als ich ihr sagte, ich könnte sie ohne allen Zweifel in acht Tagen wieder gesund machen, bekam sie neuen Mut und versprach, meine Ratschläge pünktlich zu befolgen. Nun sagte ich ihr, sie solle vier Tage lang weder trinken, noch fluchen, noch rauchen, noch zu viel essen, dann würde sie ganz hergestellt sein. Und ich weiß, meine Prophezeiung wäre auch eingetroffen; aber sie meinte, sie könne nicht aufhören zu rauchen, zu fluchen und zu trinken, weil sie so etwas überhaupt noch nie getan hätte. Da lag der Hase im Pfeffer: sie besaß gar keine Angewohnheiten, an die sie sich jetzt hätte halten können. Da sie versäumt hatte sich rechtzeitig einen Vorrat anzulegen, der ihr im Notfall zu gute käme, war ihr nicht mehr zu helfen. Sie glich einem sinkenden Schiff, das keinen Ballast hat, den man über Bord werfen kann, um das Fahrzeug zu retten. Irgend ein paar schlechte Gewohnheiten hätten sie noch retten können, aber es fand sich nichts bei ihr vor, sie war die reinste moralische Bettlerin. Als sie noch jung genug war, um sich dies oder jenes anzugewöhnen, hinderten ihre Eltern sie daran, die zwar in der besten Gesellschaft lebten, aber die Unwissenheit selber waren. Man muß für dergleichen in der Kindheit sorgen; wenn erst Alter und Krankheit kommen, läßt sich nichts mehr nachholen, und man hat kein Mittel in der Hand, um sie zu bekämpfen.
Als junger Mensch faßte ich, wie gesagt, oft die besten Vorsätze und gelobte auch sie auszuführen, aber ich habe es nie gekonnt, weil ich meine Gewohnheiten nicht bei der Wurzel packte und das böse Verlangen ausriß; mehr als einen Monat setzte ich die Tugend nie durch. Einmal versuchte ich Maß zu halten und eine Weile ging es auch gut. Ich hatte mich verpflichtet, täglich nur eine Zigarre zu rauchen; das schob ich immer auf bis zur Schlafenszeit, und dann schmeckte sie mir wundervoll. Aber das Verlangen verfolgte mich Tag für Tag, vom Morgen bis zum Abend. Vor Ablauf einer Woche fing ich an, mich nach größern Zigarren umzusehen, als ich zu rauchen gewohnt war; dann wählte ich noch größere und immer größere. Als vierzehn Tage um waren, bestellte ich mir besondere Zigarren; sie wuchsen fort und fort. Am Ende des Monats war meine Zigarre zu solcher Länge und Dicke gediehen, daß ich sie als Krückstock hätte brauchen können. Da erkannte ich denn, daß es töricht sei, sich auf eine Zigarre zu beschränken, weil es den Menschen doch nicht vor dem Verlangen schützt. Also warf ich mein Versprechen über den Haufen und war wieder ein freier Mann.
Doch, um wieder auf den jungen Kanadier zu kommen: er war auf ›Monatsgeld gesetzt‹, eine Einrichtung, von der ich bisher noch nie gehört hatte und die ich mir von den Passagieren erklären ließ. Die angesehenen Familien in England und Kanada pflegen nämlich ihre Taugenichtse nicht auszustoßen, solange noch irgend welche Hoffnung für sie vorhanden ist. Schwindet aber endlich jede Aussicht auf Besserung, dann wird der Tunichtgut eingeschifft und bekommt nur so viel Geld in die Tasche – nein, in des Zahlmeisters Tasche – um die Reisebedürfnisse zu bestreiten. Erreicht er den Ort seiner Bestimmung, so erwartet ihn dort ein Monatsgeld, und vier Wochen später trifft wieder ein Wechsel im gleichen – nicht sehr hohen – Betrage ein. Damit pflegt er unverzüglich seine monatliche Kost und Wohnung zu bezahlen – der Hauswirt sorgt dafür, daß er diese Pflicht nicht vergißt – und den Rest noch am selben Abend zu verprassen. Dann treibt er sich müßig, voll Kummer, Not und Schwermut umher, bis der nächste Wechsel kommt. Ein solches Leben erweckt das tiefste Mitgefühl.
Wir hatten noch zwei andere Taugenichtse an Bord, die aber dem Kanadier in keiner Weise glichen; sie besaßen weder seinen Verstand noch seine hübsche Außenseite, weder sein anständiges Wesen noch seine Entschlossenheit, Großmut und Höflichkeit. Der eine mochte etwa zwanzig Jahre zählen, war aber in Kleidung, Sitte und äußerer Erscheinung eine lebendige Ruine. Er behauptete der Sprößling eines herzoglichen Hauses in England zu sein, den man, um der Familie willen, nach Kanada eingeschifft hatte, wo er alsbald in Ungelegenheiten geraten war; jetzt wurde er nach Australien befördert. Einen Titel hatte er nicht, wie er sagte; im übrigen ging er jedoch sehr sparsam mit der Wahrheit um. Bei seiner Ankunft in Australien brachte er es gleich so weit, daß man ihn ins Loch steckte, und am nächsten Morgen gab er sich bei dem Verhör auf dem Polizeiamt für einen Grafen aus, konnte aber den Beweis für diese Behauptung nicht liefern.
Zweites Kapitel.
Im Zweifelsfall sprich die Wahrheit!
Querkopf Wilsons Kalender
Am fünften Tag nachdem wir Victoria verlassen hatten, wurde das Wetter heiß und alle männlichen Passagiere an Bord erschienen in weißen Leinwandanzügen. Einige Tage später passierten wir den 25. Grad nördlicher Breite, worauf sämtliche Schiffsoffiziere auf Befehl die blaue Uniform ablegten und sich in weiße Leinwand kleideten. Auch die Damen waren bereits ganz in Weiß. Auf dem Promenadendeck sah es so verlockend kühl und vergnüglich aus, von allen den schneeweißen Kostümen, wie bei einem großen Picknick.
*
Aus meinem Tagebuch:
Es gibt mancherlei Uebel in der Welt, denen der Mensch nie ganz entfliehen kann, er mag reisen so weit er will. Ist man dem einen glücklich entgangen, so fällt man dem andern sicherlich in die Klauen. Die Lügengeschichten von Seeschlangen und Haifischen sind wir endlich los geworden, das ist ein tröstlicher Gedanke. Aber nun kommen wir in das Bereich des Bumerangs, und es wird uns wieder weh zu Mute. Der erste Offizier erzählte, er habe einen Mann gesehen, der sich vor seinem Feinde hinter einem Baum versteckte; aber der Feind schleuderte seinen Bumerang hoch in die Luft, daß er weit fortflog, dann kam er zurück, fiel herunter und tötete den Mann hinter dem Baum. Der nach Australien bestimmte Passagier hatte gesehen, wie dasselbe Geschick zwei Männer hinter zwei Bäumen ereilte und zwar mit ein und demselben Wurf des Bumerangs.
Da bei dieser Behauptung alle schwiegen, weil sie ihnen zweifelhaft erschien, bekräftigte er sie noch durch die Mitteilung, daß sein Bruder einmal gesehen hätte, wie der Bumerang einen Vogel auf hundert Meter Entfernung getötet und ihn dann dem Werfer gebracht hätte. – Es gibt keine Hilfe gegen derlei Uebel; man muß sie eben ertragen.
Vom Bumerang ging das Gespräch auf Träume über – gewöhnlich ein fruchtbares Thema zu Wasser und zu Land – aber diesmal war der Ertrag nur gering. Dann kam man auf Fälle von außerordentlichem Gedächtnis zu reden, das hatte bessern Erfolg. Jemand erwähnte den blinden Tom, einen schwarzen Klavierspieler, der jedes noch so lange und schwierige Stück richtig spielen konnte, nachdem er es einmal gehört hatte. Ein halbes Jahr später konnte er es abermals fehlerlos vortragen, ohne es inzwischen gespielt zu haben. Das auffallendste Beispiel erzählte uns aber ein Herr, der im Stabe des Vizekönigs von Indien gedient hatte. Er las uns vieles aus seinem Notizbuch vor, wo er die ganze Begebenheit auf frischer Tat eingetragen hatte, damit er sie, wie er sagte, Schwarz auf Weiß besäße und nicht in Versuchung käme zu glauben, er habe sie geträumt oder erfunden.
Der Vizekönig machte eine Rundreise, und unter den Festlichkeiten, die der Maharajah von Mysore ihm zu Ehren veranstaltete, war auch eine Vorstellung der Gedächtniskunst. Nachdem der Vizekönig mit dreißig Herren seines Gefolges in einer Reihe Platz genommen hatte, wurde der Gedächtniskünstler, ein vornehmer Mann aus der Brahminenkaste, hereingeführt und setzte sich ihnen gegenüber auf den Fußboden. Außer seiner eigenen Sprache konnte er nur Englisch, erbot sich aber, die gewünschten Gedächtnisproben auch in jeder beliebigen fremden Sprache abzulegen. Sein merkwürdiges Programm bestand in folgendem: Er ließ sich von einem Herrn ein Wort aus einem Satze sagen und den Platz angeben, den es darin einnahm. Das französische Wort est wurde ihm genannt; es war in einem Satz von drei Wörtern das zweite. Ein anderer Herr gab ihm das deutsche Wort verloren, als das dritte in einem Satz von vier Wörtern. Von dem nächsten Herrn ließ er sich eine Zahl zum Addieren, dann eine zum Subtrahieren nennen, auch andere Ziffern aus allerlei Rechenexempeln. Ferner erhielt er einzelne Wörter aus dem Griechischen, Lateinischen, Spanischen, Portugiesischen, Italienischen und andern Sprachen, nebst den Angaben ihrer Stelle im Satze. Als ihm jeder der Anwesenden das Bruchstück eines Satzes oder eine Zahl genannt hatte, fing er wieder von vorne an und ließ sich das zweite Wort und seine Stellung im Satze und die zweite Zahl in der Rechnung nennen, und so immer fort. Wieder und wieder nahm er alles vom Anfang an durch, bis er die sämtlichen Teile der Exempel und Sätze beisammen hatte, aber natürlich ganz durcheinander, ohne irgend welche Reihenfolge. Das dauerte zwei Stunden lang.
Nun starrte der Brahmine eine Weile schweigend und nachdenklich vor sich hin und begann hierauf alle Sätze in richtiger Wortstellung zu wiederholen, die verwirrten Zahlen der Rechenexempel zu ordnen und für jedes die entsprechende Lösung anzugeben.
Beim Beginn der Vorstellung hatte er die Zuschauer aufgefordert, ihn zwei Stunden lang mit Mandeln zu bewerfen, er wolle dann sagen, wie viele jeder von den Herren geworfen habe. Dies unterblieb jedoch, weil der Vizekönig meinte, das Kunststück wäre ohnehin schon anstrengend genug, man brauche es nicht noch zu erschweren.
Auch General Grant hatte ein treffliches Gedächtnis, besonders für Namen und Gesichter. Davon hätte ich ein Beispiel zum besten geben können, aber es fiel mir gerade nicht ein. Bald nach seiner ersten Wahl zum Präsidenten kam ich von der Küste des Stillen Ozeans in Washington an, wo ich fremd war und das Publikum noch nichts von mir wußte. Als ich nun eines Morgens am Weißen Hause vorüberging, begegnete mir ein Bekannter, ein Senator aus Nevada, der mich fragte, ob ich wohl Lust hätte, den Präsidenten zu sehen. Ich erwiderte, daß es mir sehr angenehm sein würde und wir traten ein. Wenn ich aber gedacht hätte, ich würde den Präsidenten von einer Menschenschar umgeben finden, so daß ich ihn von ferne in aller Gemütsruhe betrachten könnte, wie die Katz den Kaiser ansieht, so befand ich mich im Irrtum. Es war noch früh am Tage und ich ahnte nicht, daß der Senator sich ein Vorrecht seines Amtes zu nutze machen wollte, um das Staatsoberhaupt in seinen Arbeitsstunden zu stören. Ehe ich mich's versah standen wir vor ihm, und außer uns dreien war niemand zugegen. General Grant erhob sich langsam vom Schreibtisch, legte die Feder hin und trat mit dem steinernen Ausdruck eines Mannes, der seit sieben Jahren nicht gelacht hat und auch in den nächsten sieben Jahren nicht zu lachen gedenkt, auf uns zu. Er schaute mich groß an, da schwand mir der Mut und ich senkte den Blick. Ich hatte noch nie einem bedeutenden Manne gegenüber gestanden und im Bewußtsein meiner eigenen Nichtigkeit überkam mich eine erbärmliche Angst.
»Herr Präsident,« sagte der Senator, »darf ich mir erlauben, Ihnen Herrn Clemens vorzustellen?«
Der Präsident hielt meine Hand einen Augenblick teilnahmslos in der seinen und ließ sie wieder los; er sprach kein Wort und stand nur stocksteif da. In meiner Not fiel mir auch nicht das geringste ein, was ich hätte sagen können und ich wünschte mich hundert Meilen weit weg. Es folgte eine unangenehme, trübselige, entsetzliche Pause. Da kam mir ein Gedanke; ich sah empor in sein unbewegliches Gesicht und sagte schüchtern:
»Herr Präsident, ich – ich bin in rechter Verlegenheit. Sie wohl auch?«
Seine Züge erhellten sich – nur ganz wenig – der schwache Schimmer eines Lächelns, der volle sieben Jahre zu früh kam, blitzte darin auf. So schnell wie er wieder verschwand, war auch ich zur Türe hinaus.
Zehn Jahre darauf sah ich Grant zum zweitenmal. Ich war inzwischen eine bekannte Persönlichkeit geworden und hatte den Auftrag erhalten, bei einem Bankett, das die Armee von Tennessee dem General nach seiner Rückkehr von der Reise um die Welt in Chicago gab, einen längeren Toast auszubringen. Mitten in der Nacht war ich angekommen und stand morgens spät auf. Alle Treppen und Gänge des Hotels waren dicht voll Menschen, die General Grant erwarteten, der sich auf den für ihn bestimmten Platz begeben sollte, wo der große Festzug vorüberzog. Ich drängte mich an einer ganzen Reihe von überfüllten Wohnzimmern vorbei, bis ich endlich an der Ecke des Hauses ein offenes Fenster sah, das auf eine geräumige, mit Teppichen und Fahnen geschmückte Plattform hinausging. Als ich sie betrat, gewahrte ich unter mir Millionen von Menschen, welche die Straßen besetzt hatten; weitere Millionen schauten aus allen Fenstern und von den Hausdächern rings umher. Diese Menschenmassen hielten mich alle für General Grant und brachen in donnernde Hochrufe aus. Es war aber ein sehr guter Platz um den Festzug zu sehen, deshalb blieb ich dort.
Nicht lange, so ertönte von ferne Militärmusik; der Zug kam die Straße herauf und machte sich Bahn durch die jubelnde Menge. An der Spitze ritt Sheridan, die kriegerischste Gestalt aus dem ganzen Feldzug, in seiner Generalleutnants-Uniform.
Da trat General Grant Arm in Arm mit Major Harrison auf die Plattform; ihm folgten paarweise im Galaanzug die Mitglieder des Empfangskomités mit ihren Abzeichen. Der General sah genau so aus wie vor zehn Jahren bei jenem unangenehmen Besuch, eisern und unnahbar in seiner unerschütterlichen Selbstbeherrschung. Harrison kam und führte mich zu Grant, dem er mich feierlich vorstellte. Aber ehe ich noch die passenden Worte finden konnte, sagte der General:
»Herr Clemens, Sie sind wohl in Verlegenheit? Ich nicht.« Und dabei blitzte wieder, wie vor zehn Jahren, jenes schwache Lächeln in seinen Zügen auf.
Seitdem sind siebzehn Jahre vergangen, und während ich dies schreibe ist ganz New York auf den Straßen versammelt, um den sterblichen Ueberresten des großen Kriegers, die man zu ihrem letzten Ruheplatz unter dem Denkmal trägt, das Ehrengeleit zu geben. Kanonenschüsse und Trauergeläute schallen durch die Lüfte und viele Millionen Amerikaner gedenken des Mannes, der die Union gerettet, ihr Banner hochgehalten und der Volksregierung zu neuem Leben verholfen hat, so daß sie unter den segensreichen menschlichen Institutionen ihren Platz dauernd behaupten wird, wie wir hoffen und glauben.
Eine Geschichte ohne Ende.
Abends, wenn wir Männer uns nach dem öden, einförmigen Tageslauf im Rauchzimmer erfrischen wollten, vertrieben wir uns manchmal die Zeit damit, unvollendete Geschichten zu vervollständigen. Das heißt, jemand erzählte eine Geschichte bis auf das Ende und die andern versuchten den Schluß aus eigener Erfindung zu ergänzen. Wenn jeder, der wollte, seine Lesart zum besten gegeben hatte, fügte der erste Erzähler den ursprünglichen Schluß hinzu und überließ uns die Wahl. Manchmal gefiel uns eines der neuen Enden besser als das alte. Eine Geschichte jedoch, mit der wir uns am eifrigsten und längsten beschäftigten, hatte überhaupt keinen Schluß, man konnte daher auch keinen Vergleich anstellen, ob eine unserer Erfindungen besser gewesen wäre. Der Erzähler sagte, er könne die einzelnen Tatsachen nur bis zu einem gewissen Punkte berichten, weiter wisse er selber nichts. Er hätte die Geschichte vor fünfundzwanzig Jahren gelesen, sei aber unterbrochen worden, ehe er ans Ende kam. Nun wolle er demjenigen, der einen befriedigenden Schluß dazu fände, fünfzig Dollars geben; wir möchten Richter aus unserer Mitte wählen, die zu entscheiden hätten, wem der Preis gebühre. Das taten wir und gingen der Geschichte wacker zu Leibe; aber, obgleich wir uns dies und jenes Ende ausdachten, so verwarfen die Richter doch alles, was vorgebracht wurde – und sie hatten recht. Einen befriedigenden Schluß für diese Geschichte hätte nur der Verfasser selbst möglicherweise finden können, und wenn ihm das gelungen ist, so möchte ich wohl wissen wie. Ihr Inhalt ist etwa folgender:
John Brown, ein guter, sanfter, ängstlicher und schüchterner Mensch von einunddreißig Jahren, wohnte in einem friedlichen Dorfe des Staates Missouri, wo er das Amt eines Vorstands der presbyterianischen Sonntagsschule bekleidete. Das war an sich nichts Großes, aber doch das Einzige, womit er in die Öffentlichkeit trat. Er betrieb es mit Treue und Eifer und war in aller Bescheidenheit stolz darauf. Jedermann kannte seine große Menschenfreundlichkeit und die Leute sagten, er sei ganz aus Güte und Schüchternheit zusammengesetzt. Auf seine Hilfe könne man immer rechnen, wo sie gebraucht werde und auch auf seine Schüchternheit, mochte sie am Platze sein oder nicht.
Mary Taylor, ein sittsames, liebenswürdiges und schönes Mädchen von dreiundzwanzig Jahren, war sein ein und alles, und auch ihr Herz gehörte ihm fast ganz. Noch schwankte sie zwar, ob sie ihm ihr Jawort geben sollte, aber er war doch voller Hoffnung. Ihre Mutter hatte im Anfang allerlei Einwendungen gehabt; jetzt neigte sie sich zu seinen Gunsten. Offenbar hatte sein warmes Interesse für ihre beiden Schützlinge und seine Beisteuer zu deren Unterhalt ihr Herz gerührt und erobert. Diese Schützlinge waren nämlich zwei alte einsame Schwestern, die in einer Holzhütte an einem entlegenen Kreuzweg, vier Meilen weit von Frau Taylors Farm wohnten. Eine der Schwestern war irrsinnig und manchmal sogar gewalttätig, aber das kam nicht häufig vor.
Eines Tages glaubte Brown, daß der rechte Augenblick für den entscheidenden Antrag gekommen sei. Er nahm allen Mut zusammen und beschloß, der Mutter, um sie günstig zu stimmen, die doppelte Summe wie gewöhnlich zu überreichen. War erst ihr Widerstand gebrochen, so durfte er eines schnellen Sieges gewiß sein.
An einem schönen Sonntagnachmittag machte er sich also bei mildem Sommerwetter auf den Weg, gehörig ausstaffiert, wie es die Gelegenheit verlangte. Er war ganz in weiße Leinwand gekleidet, trug ein blaues Band als Krawatte und enge Lackstiefel; sein Einspänner war der feinste aus dem ganzen Mietstall, mit einer nagelneuen, weißleinenen Wagendecke, deren breiter, gestickter Rand an Schönheit und Kunst seinesgleichen suchte.
Schon war er vier Meilen gefahren, als er in einsamer Gegend über eine hölzerne Brücke kam; da flog ihm der Strohhut vom Kopfe, fiel in den Fluß und wurde stromabwärts getrieben, bis er an einem Balken hängen blieb. Brown besann sich, was er tun sollte; den Hut mußte er wiederbekommen, das verstand sich von selbst, aber wie ließ sich das bewerkstelligen?
Da kam ihm ein Gedanke. Die Straße war menschenleer, nichts regte sich. Ja, er wollte es wagen. Nachdem er sein Tier an den Rain geführt hatte, wo es nach Belieben grasen konnte, zog er sich aus, legte seine Kleider in den Wagen, streichelte dem Pferde den Hals, zum Zeichen beiderseitigen Wohlwollens, und eilte zum Fluß. Er schwamm nach dem Balken und gelangte rasch wieder in Besitz seines Hutes; als er aber ans Ufer zurückkehrte, waren Pferd und Wagen fort.
Der Schrecken fuhr ihm in alle Glieder. Da er aber sah, wie das Pferd im Schritt den Weg weiter verfolgte, trabte er hinterdrein. »Halt, halt,« rief er, »warte mein gutes Tier!« Aber so oft er nahe genug herankam und sich im Sprung auf den Wagen schwingen wollte, lief das Pferd schneller und vereitelte sein Bemühen. In Todesangst rannte der nackte Mann immer weiter, jeden Augenblick fürchtend, einen Menschen zu Gesicht zu bekommen. Er bat, er beschwor das Tier stillzustehen; aber erst als er nicht mehr weit von Frau Taylors Behausung war, gelang es ihm endlich, in den Wagen zu springen. Rasch warf er das Hemd über, band seine Krawatte um, schlüpfte in den Rock und langte nach den – aber ach, zu spät! Er setzte sich plötzlich nieder und zog die Wagendecke in die Höhe, denn er sah jemand durch das Hoftor kommen – eine Frau, wie ihm schien. Eilig lenkte er das Pferd zur Linken auf den Kreuzweg. Der war schnurgerade und von allen Seiten sichtbar, aber in einiger Entfernung kam eine Waldecke, wo die Straße eine scharfe Krümmung machte. Er pries sich glücklich, als er die Stelle erreicht hatte, ließ das Pferd im Schritt gehen und langte nach den Ho – aber leider wiederum zu spät.
Gerade als er um die Ecke bog, stieß er auf Frau Enderby, Frau Glossop, Frau Taylor und Mary, die zu Fuß einherkamen und sehr müde und aufgeregt schienen. Sie traten an den Wagen, schüttelten Brown die Hand und versicherten alle zusammen aufs lebhafteste, wie froh sie wären ihn zu sehen und was für ein Glück es sei, daß er da wäre. Frau Enderby fügte mit großem Nachdruck hinzu:
»Mag es auch wie ein Zufall aussehen, daß er gerade jetzt kommt, so halte ich es doch für eine Sünde, das anzunehmen – nein, er ist uns gewißlich vom Himmel gesendet.«
Alle waren gerührt und Frau Glossop flüsterte mit ehrfurchtsvoller Scheu:
»Da hast du ein wahres Wort gesprochen, Sarah Enderby. Es ist kein Zufall, sondern die Vorsehung hat es so gewollt. Als Engel hat sie ihn uns geschickt; er kommt als ein Retter und Befreier. Nun soll mir noch jemand sagen, daß es keine besonderen Fügungen des Himmels gibt; wir haben hier den klarsten Beweis vor uns.«
»Ja,« fiel Frau Taylor begeistert ein, »das ist auch meine Ueberzeugung. Wahrhaftig, John Brown, ich könnte vor Ihnen niederknieen und Sie anbeten. Fühlten Sie es nicht im Herzen – trieb Sie nicht eine innere Stimme hierher? O, ich könnte den Saum Ihrer Wagendecke küssen.«
Er brachte kein Wort heraus; Scham und Furcht lähmten ihm die Zunge.
»Mag man die Sache betrachten wie man will, Julia Glossop,« fuhr Frau Taylor fort, »in allem läßt sich die Hand der Vorsehung sichtbarlich erkennen. Gegen Mittag sahen wir den Rauch aufsteigen. ›Die Hütte der alten Schwestern brennt, Julia‹, sagte ich. Nicht wahr, du kannst es bezeugen?«
»Jawohl, Nancy, ich stand dicht bei dir und habe es deutlich gehört. Du warst ganz blaß geworden und sahst so weiß aus wie hier die Wagendecke.«
»Kein Wunder! Und dann rief ich Mary zu, der Knecht solle gleich das Gefährt anspannen, wir müßten den Aermsten zu Hilfe eilen. Aber der war aufs Land gefahren, um seine Angehörigen zu besuchen. Ich hatte ihm selbst erlaubt, über den Sonntag zu bleiben, es jedoch ganz vergessen. So gingen wir denn zu Fuß und trafen Sarah unterwegs.«
»Ja, und ich ging mit euch,« fiel Frau Enderby ein. »Wir fanden die Hütte in Asche liegen; die Irrsinnige hatte sie in Brand gesteckt. Die beiden alten Geschöpfe waren so schwach und hinfällig, daß wir sie nicht mitnehmen konnten. Wir führten sie an einen schattigen Platz, machten es ihnen behaglich so gut es ging und zerbrachen uns den Kopf, wie wir es anfangen sollten, um sie bis nach Nancys Haus zu schaffen. Da brach ich das Schweigen, und wißt ihr noch, was ich gesagt habe? ›Wir wollen es der Vorsehung anheimstellen!‹ Ja, das waren meine Worte.«
»Richtig, das hatte ich ganz vergessen. So wahr ich lebe, du hast es gesagt. Wie wunderbar!«
»Dann sind wir zusammen zwei Meilen weit bis zu Mosleys gegangen, aber wir fanden niemand zu Hause, alle waren im Feldgottesdienst. Wir kamen die zwei Meilen zurück und dann noch eine Meile hieher. Und nun schickt uns die Vorsehung Hilfe in der Not, das seht ihr ja selbst.«
Alle blickten einander an, hoben die Hände empor und riefen wie aus einem Munde:
»Es ist zu wunderbar!«
»Wie wollen wir es nun aber machen?« fragte Frau Glossop. »Soll Herr Brown die alten Schwestern einzeln zu Frau Taylor fahren oder sie alle beide auf einmal in den Wagen setzen und das Pferd am Zügel führen?«
Brown holte tief Atem.
»Ja, das ist recht schwierig zu entscheiden,« meinte Frau Enderby. »Wir sind alle todmüde, und wenn Herr Brown die beiden schwachen Geschöpfe in den Wagen heben soll, so muß eine von uns mitgehen und ihm helfen; allein bringt er das nicht fertig.«
»Wie wär's denn aber, wenn ich mit Herrn Brown hinführe?« sagte Frau Taylor, »und ihr andern ginget nach meinem Haus, um alles in Bereitschaft zu setzen? Wir heben die eine Alte zusammen in den Wagen und fahren mit ihr –«
»Wer wird denn aber unterdessen auf die andere acht geben?« fragte Frau Enderby. »Sie kann doch nicht allein im Walde bleiben – die Irrsinnige schon gar nicht. Bis man hin-und zurückkommt dauert's gute anderthalb Stunden.«
Alle hatten sich, um auszuruhen, neben den Wagen ins Gras gesetzt und dachten schweigend nach, um einen Ausweg zu finden.
»Jetzt hab' ich's,« rief endlich Frau Enderby, frohlockend. »Daß wir nicht mehr zu Fuß gehen können ist klar; seit Mittag haben wir neun Meilen zurückgelegt ohne einen Bissen zu essen – vier Meilen hin, zwei Meilen zu Mosley macht sechs, und dann noch bis hierher – es ist kaum zu glauben! Also, eine von uns muß mit Herrn Brown hinfahren und mit einer Alten zurückkommen; Brown leistet der anderen Gesellschaft. Die übrigen gehen nach Nancys Wohnung, ruhen sich aus und warten; dann fährt eine von uns zurück, holt die andere Alte, und Herr Brown geht zu Fuß.«
»Vortrefflich,« riefen die Damen, »das können wir tun, so läßt sich's machen!«
Frau Enderbys Plan ward sehr gelobt, und um ihren Scharfsinn zu ehren, beschloß man, daß sie zuerst mit Brown zurückfahren solle. Glücklich und leichten Herzens standen alle vom Rasen auf, strichen ihre Kleider glatt und schickten sich zur Heimkehr an, während Frau Enderby schon den Fuß auf den Wagentritt setzte, um einzusteigen. Da endlich konnte Brown Worte finden und stieß keuchend hervor:
»Bitte, rufen Sie die Damen zurück – ich fühle mich unwohl – ich kann nicht zu Fuß gehen – es ist mir völlig unmöglich.«
»O, lieber Herr Brown, Sie sehen wirklich ganz blaß aus! Weshalb habe ich das nur nicht gleich bemerkt? Kommt alle zurück, hört ihr! Herr Brown ist krank. Ach, es tut mir so leid. Kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Schmerzen?«
»Nein, o nein, mir fehlt nichts, ich fühle mich nur in letzter Zeit zu schwach – sonst hat es gar nichts auf sich.«
Die Damen kehrten um und waren voller Teilnahme und Mitgefühl. Auch machten sie sich bittere Vorwürfe, weil ihnen Browns blasses Aussehen nicht sofort aufgefallen war. Augenblicklich entwarfen sie einen neuen Plan und kamen bald überein, daß es sich so am allerbesten machen würde: Zuerst wollten sie alle zu Frau Taylor gehen; dort sollte sich Herr Brown im Wohnzimmer auf das Sofa legen und sich von Mary und ihrer Mutter pflegen lassen, während die andern Damen erst eine der alten Schwestern abholten und dann die andere, welcher eine von ihnen inzwischen Gesellschaft geleistet hatte, und –
Unter solchen Beratungen waren sie zu dem Pferde getreten und schickten sich an, den Wagen zu wenden. Aber in der höchsten Gefahr fand Brown die Stimme wieder und das war seine Rettung.
»Meine Damen,« sagte er, »Sie übersehen einen Umstand, der den Plan unausführbar macht. Wenn Sie die eine alte Schwester nach Hause bringen und jemand mit der anderen dort bleibt, so sind drei Personen an Ort und Stelle, wenn eine von Ihnen zurückkommt, um die andere Alte zu holen. Aber drei haben nicht Platz im Wagen und jemand muß doch kutschieren.«
»Ganz recht, so ist es,« riefen alle in großer Bestürzung.
»Was sollen wir nur anfangen?« sagte Frau Glossop seufzend; »eine so verwickelte Geschichte ist mir noch nie vorgekommen. Die Sache mit dem Wolf, der Ziege und dem Kohlkopf ist dagegen nur ein Kinderspiel.«
Ganz ermattet setzten sie sich abermals nieder, um sich aufs neue das Hirn zu zermartern und einen Ausweg zu suchen. Mary hatte bisher noch keinen Vorschlag gemacht, endlich tat sie aber den Mund auf:
»Ich bin jung, stark und gut zu Fuße,« sagte sie, »auch habe ich jetzt eine Weile ausgeruht. Bringt Herrn Brown in unser Haus und sorgt für ihn – man sieht ihm ja an, wie sehr er der Pflege bedarf. Inzwischen will ich die beiden Alten behüten, in einer halben Stunde kann ich dort sein. Ihr andern aber führt unsern ersten Plan aus und paßt auf, bis ein Wagen auf der Landstraße vorbeifährt, den schickt ihr hin und laßt uns alle drei holen. Die Pächter kommen jetzt bald aus der Stadt zurück, da braucht ihr nicht lange zu warten. Der alten Polly will ich schon zureden, daß sie Geduld hat und guten Mutes bleibt – bei der Irrsinnigen ist das nicht nötig.«
Der Plan ward reiflich erwogen und gut befunden; etwas Besseres ließ sich unter den Umständen nicht tun, und den beiden Alten wurde gewiß die Zeit schon lang. Brown fühlte sich wie erlöst und von Herzen dankbar. Wenn er nur erst auf der Landstraße war, wollte er schon Mittel und Wege finden, dem Unheil zu entgehen.
»Die Abendkühle wird früh hereinbrechen,« sagte jetzt Frau Taylor, »und die armen Abgebrannten haben nichts, um sich zu erwärmen. Nimm die Wagendecke mit, liebes Kind, das ist wenigstens ein Notbehelf.«
»Das kann ich ja tun, Mutter, wenn du meinst,« versetzte Mary. Sie trat zum Wagen und streckte die Hand nach der Decke aus –
*
Weiter ging die Geschichte nicht. Der Passagier, der sie uns erzählte, sagte, er sei vor fünfundzwanzig Jahren, als er sie im Eisenbahnwagen las, an diesem Punkt unterbrochen worden, weil der Zug von einer Brücke ins Wasser stürzte.
Zuerst glaubten wir, es würde ein Leichtes sein, die Geschichte zu Ende zu bringen und gingen sehr zuversichtlich ans Werk. Bald stellte sich jedoch heraus, daß die Sache keineswegs so einfach war, sondern im Gegenteil höchst verworren und schwierig. Daran war Browns Charakter schuld – seine Großmut und Güte, verbunden mit außerordentlicher Schüchternheit und Befangenheit, besonders in Gegenwart von Damen. Ferner kam seine Liebe zu Mary mit ins Spiel, die zwar sehr hoffnungsvoll, aber noch keineswegs der Erhörung sicher war – das heißt, gerade in einem Stadium, wo die größte Vorsicht geboten schien, um weder einen Mißgriff zu begehen, noch Anstoß zu erregen. Und es galt die Mutter zu berücksichtigen, die noch schwankte, ob sie einwilligen solle, und die sich vielleicht jetzt oder nie gewinnen ließ, wenn man sie geschickt zu behandeln wußte. Im Walde warteten die beiden hilflosen Alten – ihr Schicksal und Browns künftiges Lebensglück hing von der nächsten Sekunde ab. Mary streckte die Hand nach der Wagendecke aus; es war keine Zeit zu verlieren.
Natürlich konnte der Preis nur jemand zuerkannt werden, der die Sache zu einen: glücklichen Ende brachte. Browns Ansehen bei den Damen durfte nicht geschmälert, seine Selbstlosigkeit nicht in Frage gestellt, sein Anstandsgefühl nicht verletzt werden. Er mußte helfen die beiden Alten aus dem Walde zu holen, so daß man ihn als ihren Wohltäter pries, sein Lob in aller Munde war und sein Name mit Stolz und Freude genannt wurde.
Wir versuchten es so einzurichten; aber auf allen Seiten stellten sich uns unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Natürlich würde Brown aus Scham und Befangenheit die Wagendecke nicht hergeben wollen. Dies mußten Mary und ihre Mutter übel nehmen, und auch die anderen Damen würden sich sehr darüber verwundern, denn ein solches Benehmen, wo es den unglücklichen Alten zu helfen galt, paßte nicht zu Browns Charakter; er war ja als Engel vom Himmel gesandt und konnte unmöglich so eigennützig handeln. Hätte man eine Erklärung von ihm verlangt, so wäre er viel zu schüchtern gewesen, um die Wahrheit zu bekennen, und aus Mangel an Uebung und Erfindungsgeist würde ihm keine glaubhafte Lüge eingefallen sein.
Wir arbeiteten bis drei Uhr morgens an dem schwierigen Problem herum; aber noch immer langte Mary nach der Wagendecke. Da gaben wir es auf und ließen sie weiter die Hand danach ausstrecken. – Nun kann sich der Leser selbst das Vergnügen machen, zu entscheiden, was aus der Sache geworden ist.
Am siebenten Tage unserer Fahrt sahen wir eine ungeheure dunkle Masse in schwachen Umrissen aus den Fluten des Stillen Ozeans aufsteigen und wußten, daß dies gespenstische Vorgebirge der Diamantfels war, den ich zuletzt vor neunundzwanzig Jahren erblickt hatte. Wir näherten uns also Honolulu, der Hauptstadt der Sandwichinseln, die für mich das Paradies waren; ich hatte die ganze lange Zeit über gewünscht, sie noch einmal wiederzusehen. Nichts in der weiten Welt hätte mich so aufregen können, wie der Anblick jenes Bergriesen.
Bei Nacht gingen wir eine Meile vom Ufer vor Anker. Durch meine Kajütenfenster konnte ich die Lichter von Honolulu funkeln sehen; zur Rechten und Linken dehnten sich schwarze Gebirgszüge aus. Das schöne Nuuana-Tal vermochte ich nicht zu entdecken, aber ich wußte, wo es lag und sah es in der Erinnerung noch deutlich vor mir. Wir jungen Leute pflegten dies Tal öfters zu Pferde zu durchstreifen und in einer sandigen Gegend, wo König Kamehameha eine seiner ersten Schlachten geschlagen hatte, Totenknochen zu sammeln.
Das war ein merkwürdiger Mensch; merkwürdig nicht nur als König, sondern auch als Barbar. Noch ein kleiner, unbedeutender Fürst, als Kapitän Cook 1778 ins Land kam, faßte er vier Jahre später den Entschluß, ›seine Machtsphäre auszudehnen‹. Dies ist die beliebte Redewendung, durch die man heutzutage bezeichnet, daß jemand Raub an seinem Nachbar begeht, und zwar zu dessen eigenem Vorteil – eine Wohltätigkeitsvorstellung, bei welcher als Ort der Handlung hauptsächlich Afrika benützt wird. Kamehameha unternahm einen Kriegszug, vertrieb im Lauf von zehn Jahren alle andern Könige und machte sich zum Herrn der sämtlichen neun oder zehn Inseln, welche die Gruppe der Sandwichinseln bilden. Aber er tat noch mehr. Er kaufte Schiffe, belud sie mit Sandelholz und andern heimischen Produkten und schickte sie bis nach Südamerika und China. Die fremden Stoffe, Werkzeuge und Gerätschaften, welche die Schiffe zurückbrachten, verkaufte er an seine Wilden und wurde so der Begründer der Zivilisation. Ob die Geschichte irgend eines andern Barbaren Aehnliches aufzuweisen hat, möchte ich bezweifeln. Die Wilden sind meist eifrig bemüht, dem weißen Manne neue Methoden abzulernen, wie sie einander umbringen können; aber seine höheren und edleren Anschauungen pflegen sie sich nicht anzueignen. Bei Kamehameha sehen wir dagegen, daß er stets bemüht war, alles gründlich zu untersuchen, was ihm die Weißen Neues boten, und unter den Proben, die er zu Gesicht bekam, eine einsichtsvolle Auswahl zu treffen.
Nach meiner Meinung bewies er dabei weit größeren Scharfsinn als sein Sohn und Nachfolger Liholiho. Dieser hätte sich vielleicht zum Reformator geeignet, aber als König verfehlte er seinen Beruf, und zwar, weil er zugleich König und Reformator sein wollte. Das heißt aber, Feuer und Schießpulver untereinander mischen. Ein König sollte sich verständigerweise mit Reformen nichts zu schaffen machen. Das Beste, was er tun kann, ist, die Zustände zu lassen wie sie sind, und wo das nicht angeht, sie möglichst zu verschlechtern. Ich sage das nicht nur obenhin, denn ich habe mir die Sache reiflich überlegt, damit ich, falls sich mir einmal die Gelegenheit bietet König zu werden, gleich weiß, wie ich es am besten anzugreifen habe.
Als Liholiho seinem Vater in der Regierung folgte, fand er sich im Besitz königlicher Vorrechte und Befugnisse, die ein weiserer Fürst verstanden hätte mit Vorteil auszunützen. Im ganzen Reich herrschte nur ein Szepter, das er in Händen hielt, und eine Staatskirche, deren Haupt er war. Den Oberbefehl seines Heeres, das aus 114 Gemeinen, 27 Generalen und einem Feldmarschall bestand, führte er allein. Ein stolzer alter Erbadel war im Lande ansässig. Und dann gab es noch eine merkwürdige Einrichtung, welche ›Tabu‹ genannt wurde. Dies war eine geheimnisvolle und furchtbare Macht, wie sie kein europäischer Monarch jemals besessen hat, ein Mittel und Werkzeug von unschätzbarem Wert für den Gewalthaber. Liholiho war auch Herr und Meister des ›Tabu‹. Es war die wirksamste und sinnreichste Erfindung, die je gemacht worden ist, um die Ansprüche des Volkes in bescheidenen Grenzen zu halten.
Dies ›Tabu‹ (das Wort bedeutet ein Ding, das verboten ist) verlangte, daß beide Geschlechter in verschiedenen Häusern wohnten; aber essen durften sie nicht in den Häusern, dazu gab es einen andern Ort. Es untersagte den Frauen, ihres Mannes Haus zu betreten. Auch durften beide Geschlechter nicht zusammen essen; zuerst aßen die Männer, und die Weiber mußten sie bedienen. Dann konnten die Weiber essen, was übrig blieb – wenn überhaupt noch etwas da war – und sich selbst bedienen. Das heißt, sie bekamen nur die Reste der gröbsten, unschmackhaftesten Kost. Alle guten, leckern und auserlesenen Eßwaren, wie Schweinefleisch, Geflügel, Bananen, Kokosnüsse, die bessern Fischsorten und dergleichen, bestimmte das ›Tabu‹ ausschließlich zur Speise für die Männer. Die Weiber mußten sich ihr Lebenlang mit einem ungestillten Sehnen danach begnügen, und mußten sterben ohne je zu erfahren, wie das alles schmeckte.
Diese Regeln waren, wie man sieht, sehr klar und verständlich, auch leicht zu behalten, und nützlich. Denn auf jeder Uebertretung eines Verbots aus der ganzen Liste stand Todesstrafe. Was Wunder, wenn die Frauen es gern zufrieden waren, Haifische, Hundefleisch und Torowurzeln zu verzehren, da sie andere Nahrungsmittel so teuer bezahlen mußten.
Dem Tode verfiel, wer über verbotenen Grund und Boden ging, wer einen vom ›Tabu‹ geheiligten Gegenstand durch seine Berührung entweihte, wer einem Häuptling nicht kriechende Ehrerbietung zollte oder auf des Königs Schatten trat. Edelleute, Priester und Könige hängten immer bald hier bald da kleine Lappen auf, um dem Volke kund zu tun, daß der Ort oder das Ding mit ›Tabu‹ belegt war und der Tod in der Nähe lauerte. Der Kampf ums Dasein muß wohl zu jener Zeit auf den Inseln höchst ungewiß und schwierig gewesen sein.
Alle diese Vorteile besaß der neue König, und was war das erste, das er nach seinem Regierungsantritt tat? Er rottete die Staatskirche mit Stumpf und Stil aus. Bildlich gesprochen glich er einem Seemann, der sein wackeres Schiff verbrennt und sich einem unsicheren Floß anvertraut. Jene Kirche war eine gräßliche Anstalt, die das ganze Land aufs schwerste bedrückte, und durch düstere, geheimnisvolle Drohungen alles in Furcht und Zittern erhielt. Sie schlachtete ihre Opfer an den Altären greulicher Götzen aus Holz oder Stein; sie ängstigte und schreckte das Volk und zwang es zu sklavischer Unterwürfigkeit gegen die Priester und durch diese gegen den König! Wahrlich, eine bessere und zuverlässigere Stütze hätte sich kein König wünschen können! Wenn ein berufsmäßiger Reformator die furchtbare, verderbliche Gewalt dieser Kirche zerstörte, so gebührte ihm Lob und Preis; aber ein König, der das unternahm, verdiente den schwersten Tadel, dem sich höchstens ein Gefühl des Mitleids zugesellen könnte, daß er so ganz und gar untauglich für seine Stellung war.
Weil er die Torheit beging, seine Staatskirche abzuschaffen und ihre Götzen zu verbrennen, ist das Königreich jetzt zur Republik geworden. Das kommt davon!
Zwar läßt sich nicht leugnen, daß es einen Fortschritt in der Zivilisation und zum Wohl seines Volkes bedeutete, aber geschäftsmäßig war es nicht, sondern höchst unköniglich und einfältig. Es brachte auch seinem Hause großen Verdruß. Noch rauchten die verbrannten Götzen auf den Altären, als amerikanische Missionäre ins Land kamen. Sie fanden das Volk ohne Religion und beeilten sich dem Mangel abzuhelfen, indem sie ihm ihre eigene Religion darboten, die mit Dank angenommen wurde. Aber dem unumschränkten Königtum gewährte sie keine Stütze und seit jener Stunde begann seine Herrschermacht zu sinken. Als ich siebenundvierzig Jahre nachher auf die Inseln kam, stellte Kamehameha V. gerade den Versuch an, Liholihos Mißgriff wieder gut zu machen, aber es gelang ihm nicht. Er errichtete eine Staatskirche und trat als Haupt derselben auf, doch war das nichts als Flickwerk und unechte Nachahmung – eine Seifenblase, ein leeres Schaugepränge. Die Kirche besaß keine Macht und brachte dem Könige keinen Nutzen. Sie konnte das Volk weder aussaugen noch verbrennen und totschlagen; der wunderbaren Maschinerie, welche Liholiho zerstört hatte, glich sie in keiner Weise. Es war eine Staatskirche ohne Gemeinde, denn das ganze Volk bestand aus Nonkonformisten.
Das Königtum selbst war schon längst nur noch ein bloßer Name und Schein. Die Missionäre hatten es frühzeitig in eine Art Republik verwandelt, und in letzter Zeit haben es die handeltreibenden Weißen ganz und gar zum Freistaat gemacht.
In Kapitän Cooks Zeit (1778) schätzte man die eingeborene Bevölkerung auf 400 000 Köpfe, 1836 betrug sie noch etwa 200 000, 1866 kaum 50 000 und die heutige Volkszählung weist 25 000 auf. Alle einsichtsvollen Leute rühmen Kamehameha I. und Liholiho, weil sie ihrem Volke die Zivilisation zum Geschenk gemacht haben. Natürlich würde ich das auch tun, wäre nicht mein Verstand durch Ueberarbeitung jetzt etwas in die Brüche geraten. Als ich vor fast einem Menschenalter in Honolulu war, verkehrte ich dort mit einem jungen amerikanischen Ehepaar, das ein allerliebstes Söhnchen hatte; leider konnte ich mich mit dem Knaben nicht viel abgeben, weil er kein Englisch verstand. Er hatte von Geburt an auf der Pflanzung seines Vaters mit den kleinen Kanakas gespielt und solches Wohlgefallen an ihrer Sprache gefunden, daß er keine andere lernen wollte. Einen Monat nach meiner Ankunft zog die Familie von der Insel fort und alsbald vergaß der Knabe die Kanakasprache und lernte Englisch; im zwölften Jahre konnte er kein Wort Kanaka mehr. Neun Jahre später, als er einundzwanzig war, traf ich mit der Familie an einem der Seen im Staate New York zusammen, und die Mutter erzählte mir von einem Erlebnis, das ihr Sohn kürzlich gehabt hatte. Er war Taucher von Beruf. Bei einem Sturm auf dem See war ein Passagierdampfer mit Mann und Maus untergegangen, und einige Tage darauf ließ sich der junge Mann in vollem Taucheranzug in die Tiefe und betrat den Speisesaal des Bootes. Er stand auf der Kajütentreppe, hielt sich mit der Hand am Geländer fest und starrte in die düstere Flut. Da berührte ihn von hinten etwas an der Schulter; er wandte sich um und sah einen Toten, der dicht neben ihm auf und nieder tanzte und ihn forschend zu betrachten schien. Der Schrecken lähmte ihm alle Glieder. Er hatte, ohne es zu wissen, beim Herabtauchen das Wasser bewegt, und nun sah er von allen Seiten Leichen auf sich zuschwimmen, die mit dem Kopfe wackelten und sich hin-und herwälzten, wie schlaflose Menschen zu tun pflegen. Ihm schwanden die Sinne; er wurde in bewußtlosem Zustand wieder an die Oberfläche gezogen und verfiel in eine Krankheit. Mehrere Tage lang redete er in seinen Fieberphantasien unaufhörlich und fließend in der Kanakasprache und kein Wort Englisch. Auch als man mich an sein Bett führte, sprach er mit mir Kanaka, was ich natürlich nicht verstand.
Wir wissen aus medizinischen Büchern, daß derartige Fälle nicht selten vorkommen; da sollten die Aerzte doch nach einem Mittel forschen, um solche Resultate öfter erzielen zu können. Wie viele Sprachen und Tatsachen geraten in unsern Köpfen in Vergessenheit und kommen nie wieder zum Vorschein, bloß weil man dies Mittel nicht kennt!
Während wir die Nacht über bei der Insel vor Anker lagen, tauchten allerlei Erinnerungen an Honolulu wieder in mir auf. Entzückende Bilder zogen ohne Ende an meinem Geiste vorüber und ich erwartete den kommenden Morgen mit der größten Ungeduld.
Drittes Kapitel.
Es macht mehr Mühe, Lebensregeln aufzustellen, als das Rechte zu tun.
Querkopf Wilsons Kalender.
Endlich kam er – aber wie wurde ich enttäuscht! – Die Cholera war in der Stadt ausgebrochen und jeder Verkehr mit dem Ufer untersagt. So fiel mein neunundzwanzigjähriger Traum plötzlich ins Wasser. Zwar erhielt ich Grüße und Botschaften von den Freunden am Lande; sie selber durfte ich nicht sehen. Der Saal stand für meine Vorlesung bereit, allein ich sollte ihn nicht betreten.
Von unsern Passagieren waren mehrere in Honolulu ansässig und wurden ans Land gesetzt; doch niemand durfte von dort wieder zurückkehren. Auch konnten wir die Leute, die bereits eingeschrieben waren, um mit uns nach Australien zu segeln, nicht auf der Insel abholen; wir hatten sonst vor Sydney wer weiß wie lange Quarantäne halten müssen. Tags zuvor wäre es ihnen noch möglich gewesen, nach San Francisco zu entkommen, aber jetzt war der Hafen gesperrt, und Wochen konnten vergehen, bevor ein Schiff wagen durfte, sie irgendwohin mitzunehmen. Uebrigens waren sie nicht die einzigen, denen ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Eine ältere Dame aus Massachusetts hatte mit ihrem Sohn zur Erholung eine Seefahrt unternommen; unversehens waren sie immer weiter mit uns nach Westen gefahren, hatten mehrmals den Rückweg antreten wollen und zuletzt den Beschluß gefaßt, von Honolulu bestimmt umzukehren. Aber, was nützen dergleichen Vorsätze in dieser Welt! – Mutter und Sohn sahen sich jetzt gezwungen bei uns zu bleiben, bis wir Australien erreichten. Von dort konnten sie eine Reise um die Welt machen oder auf dem nämlichen Wege wieder zurückkehren; in betreff der Entfernung, der Kosten und des Zeitverlustes kam es ganz auf dasselbe heraus. So wie so mußten sie ihren beabsichtigten Ausflug von etwa fünfhundert Meilen auf vierundzwanzigtausend Meilen verlängern. Das war keine Kleinigkeit.
Auch einen Rechtsanwalt aus Victoria hatten wir an Bord, der von der Regierung in internationalen Angelegenheiten nach Honolulu geschickt worden war. Er hatte seine Frau mitgenommen und die Kinder bei den Dienstleuten zu Hause gelassen – was sollte er nun tun? Es wäre Torheit gewesen, auf die Gefahr der Ansteckung hin ans Land zu gehen. Das Ehepaar beschloß daher, nach den Fidschi-Inseln zu fahren und dort vierzehn Tage auf das nächste Schiff zu warten, um die Heimreise anzutreten. Daß es sechs Wochen dauern würde, bis sie ein solches Schiff zu Gesicht bekamen und sie inzwischen von den Kindern keinerlei Nachricht erhalten, noch ihnen irgend welche Kunde zukommen lassen könnten, hatten sie nicht vorausgesehen. Es ist kein Kunststück, in dieser Welt Pläne zu machen; auch ein Kater kann das tun. Aber man darf nur nicht vergessen, daß in jenen fernen Meeren menschliches Denken keinen größeren Wert hat, als eine Kateridee. Seine Bedeutung schrumpft dort ganz außerordentlich zusammen.
Uns blieb keine andere Wahl, als auf dem Deck im Schatten der Sonnenzelte zu sitzen und nach den fernen Inseln hinüberzusehen. Wir lagen in klaren, blauen Gewässern, landwärts wurde das Wasser glänzend grün und am Ufer brach es sich in einer langen weißen Schaumwelle, aber ohne Anprall; kein Laut erreichte unser Ohr. Die Stadt schien wie begraben in undurchdringlichem Laubwerk. Ueber die duftigen Berge war der zarteste Schmelz und Farbenglanz ausgegossen und die Klippen hüllten sich in leichte Nebel. Ich erkannte alles wieder. Gerade so hatte ich es vor langen Jahren erblickt; die Schönheit war noch unverändert, nichts fehlte an dem entzückenden Bilde.
Und doch hatte sich dort ein Wechsel vollzogen, aber er war politischer Art und vom Schiff aus nicht zu erkennen. Die damalige Monarchie hatte sich in eine Republik verwandelt, was aber keinen wesentlichen Unterschied machte. Nur den alten leeren Pomp und das unnütze, lärmende Schaugepränge bekommt man nicht mehr zu sehen, und die königliche Schutzmarke ist allenthalben verschwunden; etwas anderes würde man jedoch schwerlich vermissen. Jene Scheinmonarchie war schon zu meiner Zeit höchst absonderlich; hätte sie noch dreißig Jahre länger bestanden, so wären dem Könige gar keine Untertanen von seiner eigenen Rasse mehr übrig geblieben.
Wir hatten einen wundervollen Sonnenuntergang. Die weite Oberfläche des Meeres teilte sich in Farbenstreifen, welche scharf von einander abstachen. Einige Strecken waren dunkelblau, andere purpurrot oder von glänzender Bronzefarbe; über die wellenförmige Bergkette breiteten sich die zartesten braunen, grünen, blauen und roten Schattierungen; manche der runden schwarzen Kuppen sahen so sammetweich aus wie ein glänzender Katzenbuckel; man bekam ordentlich Lust sie zu streicheln.
Das allmählich abfallende Vorgebirge, das im Westen weit ins Meer hinausragte, hatte zuerst ein bleifarbenes, gespenstisches Aussehen, dann wurde es von einem roten Hauch übergossen, es zerfloß sozusagen in ein rosenfarbenes Traumgebilde und schien nicht der Wirklichkeit anzugehören. Urplötzlich aber sah man diesen Wolkenfels in eine wahre Feuersglut getaucht, die sich in den Wellen widerspiegelte; es war ein Anblick, bei dem man hätte trunken werden können vor Entzücken.
Zufolge meiner Gespräche mit den Passagieren, die in Honolulu zu Hause waren, und mit Hilfe einer Skizze von Frau Mary Krout, war ich imstande, das heutige Honolulu mit dem damaligen zu vergleichen. Zu meiner Zeit war es ein schönes Städtchen, das aus schneeweißen, hölzernen Landhäusern bestand, die über und über mit tropischen Schlingpflanzen bedeckt und rings von Blumen, Bäumen und Sträuchern umgeben waren; Straßen und Wege, auf Korallengrund erbaut, waren steinhart, glatt und eben und so weiß wie die Häuser selbst. Schon der äußere Anblick verriet einen Zwar bescheidenen aber behaglichen Wohlstand, der sich – das ist nicht zu viel gesagt – auf alle Bewohner erstreckte. Kostbare Häuser, Möbel und Zierate gab es nicht. In den Schlafzimmern brannte man Talglichter und im Salon eine Tranlampe. Matten aus einheimischem Fabrikat dienten statt der Teppiche, zwei oder drei Lithographien schmückten die Wände; meist waren es Bilder von Kamehameha IV., Ludwig Kossuth, Jenny Lind, oder auch ein paar Kupferstiche, z. B. Rebekka am Brunnen, Moses schlägt Wasser aus dem Felsen, Josephs Diener finden den Becher in Benjamins Sack u. dgl. Auf dem Mitteltisch lagen Bücher friedlichen Inhalts, wie: ›Menschenpflichten‹, Baxters ›Ruhe der Heiligen‹, ›Die Märtyrer‹ von Fox und Tuppers ›Philosophie in Sprichwörtern‹; auch der ›Missionsherold‹ und Pater Dämons ›Freund des Seemanns‹ in gebundenen Exemplaren.