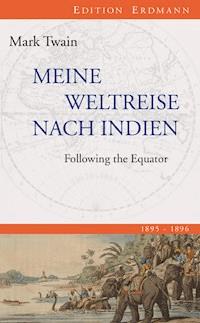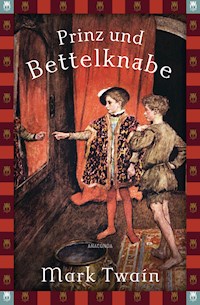
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Anaconda Kinderbuchklassiker
- Sprache: Deutsch
Tom und Edward kommen am gleichen Tag des Jahres 1537 zur Welt. Während der Bettelknabe Tom sich ein Leben am Hof erträumt, hätte Edward nichts lieber als eine ganz normale Kindheit – denn er ist Prinz und der Thronfolger seines Landes. Eines Tages begegnen sich die beiden Jungen, die sich ähnlich sehen wie Zwillinge. Aus Spaß tauschen sie ihre Kleidung und gehen ihrer Wege – in zwei Leben mit neuen Rollen, turbulenten Verwechslungen und vielen spannenden Erlebnissen. Wie die Geschichten um Tom Sawyer und Huckleberry Finn schrieb Mark Twain seinen Abenteuerroman vor allem für junge Leser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
MARK TWAIN
Prinz und Bettelknabe
Aus dem Englischen von Helene Lobedan
Mit 36 Illustrationen von Willy Planck
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Titel der amerikanischen Originalausgabe: The Prince and the Pauper (1881). Die Übertragung von Helene Lobedan folgt der Ausgabe Prinz und Bettelknabe. Eine Erzählung für die reifere Jugend. Mit 8 Vollbildern und 28 Textillustrationen von Willy Planck. Sechste Auflage. Stuttgart: Loewes Verlag Ferdinand Carl o. J. [1925]. Orthografie und Interpunktion wurden auf neue deutsche Rechtschreibung umgestellt, überkommene grammatische und stilistische Eigenheiten behutsam modernisiert. Die Reproduktion der Illustrationen von Willy Planck (1870–1956) erfolgt ohne ausdrückliche Genehmigung, da ein Rechteinhaber trotz eingehender Bemühungen nicht ausfindig gemacht werden konnte. Rechtmäßige Ansprüche werden auf Anfrage abgegolten.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2016 Anaconda Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlagmotiv: Arthur C. Michael (gest.1945),
»The two went and stood side by side before a great mirror« (1923),
Private Collection / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
ISBN 978-3-7306-9143-4V002
www.anacondaverlag.de
Vorwort
Ich will eine Geschichte erzählen, die mir mein Vater erzählt hat, der sie von dem seinen gehört hatte, und dieser wieder von dem seinen; – und so rückwärts mehr denn dreihundert Jahre hatten die Väter diese Erzählung ihren Söhnen überliefert und sie so der Nachwelt aufbewahrt. Vielleicht ist es eine geschichtliche Tatsache, vielleicht nur eine Sage. Vielleicht hat es sich so zugetragen, vielleicht hat es sich nicht so zugetragen; aber es hätte so sein können. Vielleicht haben in alten Tagen weise und gelehrte Leute es geglaubt, vielleicht aber haben nur schlichte und ungelehrte Leute diese Geschichte geliebt und sie für wahr gehalten.
Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang,
Sie träufelt wie des Himmels milder Regen,
Zur Erde unter ihr: zwiefach gesegnet:
Sie segnet den, der gibt und den, der nimmt:
Am mächtigsten in Mächt’gen zieret sie
Den Fürsten auf dem Thron mehr wie die Krone.
Der Kaufmann von Venedig
Inhalt
1. Kapitel. Die Geburt des Prinzen und des Bettelknaben
2. Kapitel. Toms Jugend
3. Kapitel. Tom lernt den Prinzen kennen
4. Kapitel. Des Prinzen Not beginnt
5. Kapitel. Tom als Königssohn
6. Kapitel. Toms Ratgeber
7. Kapitel. Die königliche Tafel
8. Kapitel. Das große Staatssiegel
9. Kapitel. Der Festzug auf der Themse
10. Kapitel. Die Leiden des Prinzen
11. Kapitel. In Guildhall
12. Kapitel. Der Prinz und sein Befreier
13. Kapitel. Der Prinz verschwindet
14. Kapitel. »Le roi est mort, vive le roi!«
15. Kapitel. Tom als König
16. Kapitel. Die öffentliche Tafel
17. Kapitel. Foo-Foo der Erste
18. Kapitel. Der Prinz unter den Landstreichern
19. Kapitel. Der Prinz im Bauernhaus
20. Kapitel. Der Prinz und der Einsiedler
21. Kapitel. Hendon! Zu Hilfe!
22. Kapitel. Ein Opfer des Verrats
23. Kapitel. Der Prinz als Gefangener
24. Kapitel. Die Flucht
25. Kapitel. Hendon Hall
26. Kapitel. Verleugnet
27. Kapitel. Im Gefängnis
28. Kapitel. Das Opfer
29. Kapitel. Nach London
30. Kapitel. Toms Erlebnisse
31. Kapitel. Der Huldigungszug
32. Kapitel. Der Krönungstag
33. Kapitel. Eduard als König
Schluss. Gerechtigkeit und Vergeltung
Erläuternde Anmerkungen
1. KAPITEL
Die Geburt des Prinzenund des Bettelknaben
An einem Herbsttag im zweiten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts wurde in der alten Stadt London einer armen Familie namens Canty ein Knabe geboren; und sie freute sich gar nicht über diesen Zuwachs.
Am selbigen Tag wurde ein anderes englisches Kind geboren und zwar der mächtigen Familie Tudor, die diesen Knaben heiß ersehnt hatte. Ganz England hatte nach ihm verlangt. England hatte den Knaben so erwünscht, so auf ihn gehofft, Gott um seinetwillen so heiß angefleht, dass, als er nun wirklich da war, die Leute vor Freude beinahe von Sinnen waren. Selbst diejenigen, die einander nur oberflächlich kannten, herzten und küssten sich und vergossen Freudentränen. Der Tag wurde ein Feiertag für alle: Hoch und Gering, Reich und Arm tafelten, tanzten und sangen, und waren sehr gerührt; und das dauerte mehrere Tage und Nächte lang. Bei Tag bot London einen prächtigen Anblick dar, denn von jedem Dach und jedem Balkon wehten bunte Fahnen, und glänzende Festaufzüge durchzogen die Straßen. Abends war das Schauspiel nicht minder sehenswert, denn an jeder Ecke brannten große Freudenfeuer, und Scharen von Zechern hatten sich um sie gelagert. In ganz England redete man von nichts anderem als dem neugeborenen Kind, Eduard Tudor, dem Prinzen von Wales, der, in Seide und Atlas gehüllt, nichts von dieser großen Aufregung merkte, nicht wusste, dass vornehme Herren und Damen ihn pflegten und bewachten – und wenn er es gewusst, sich nichts daraus gemacht hätte. Von dem anderen Knaben, Tom Canty, der in Lumpen gebettet war, redete niemand außer seiner Familie, der er zur Last fiel.
2. KAPITEL
Toms Jugend
Überspringen wir eine Reihe von Jahren.
London war fünfzehnhundert Jahre alt und war, nach damaligen Begriffen, eine große Stadt. Es hatte einhunderttausend Einwohner – oder, wie einige Leute meinen, noch einmal so viel. Die Straßen waren sehr schmal, winkelig und unsauber, besonders in der Gegend, wo Tom wohnte, nämlich unweit der Londoner Brücke. Die Häuser bestanden aus Holz; das zweite Stockwerk überragte das Untergeschoss, und das dritte Stockwerk lehnte sich über das zweite vor. Je höher die Häuser wurden, desto breiter baute man sie. Sie hatten ein Gerippe von Fachwerk mit festem Mauerwerk dazwischen, das mit Mörtel übertüncht war. Die Balken aber malte man rot, blau oder schwarz an, je nach dem Geschmack des Besitzers, und das gab den Häusern ein sehr malerisches Ansehen. Die Fenster waren klein, mit Butzenscheiben geschlossen; sie hingen in Angeln und öffneten sich nach außen wie Türen.
Das Haus, in dem Toms Vater wohnte, lag in einem schmutzigen Sackgässchen, das man Kehrichtshof nannte, seitwärts von Pudding Lane. Es war ein kleines, verkommenes und baufälliges Haus, doch dicht gedrängt wohnte das elendeste Bettelvolk darin. Die Familie Canty bewohnte eine Stube im dritten Stock. Für den Vater und die Mutter stand ein Bett in der einen Ecke; in Bezug auf den Platz waren Tom, seine Großmutter und seine beiden Schwestern nicht beschränkt, sie hatten den ganzen Fußboden zu ihrer Verfügung und konnten schlafen, wo sie wollten. Sie hatten ein paar zerlumpte Decken und etwas altes schmutziges Stroh, doch konnte man dies berechtigterweise nicht Betten nennen, denn man warf das Ganze morgens auf einen Haufen und sie nahmen sich nachts davon zum Gebrauch, so viel ein jeder erwischen konnte.
Bet und Nan waren Zwillinge und jetzt fünfzehn Jahre alt, gutmütige Mädchen, ungewaschen, zerlumpt und unwissend. Die Mutter war wie sie. Aber der Vater und die Großmutter waren von Grund auf böse. Oft waren sie betrunken und dann prügelten sie einander oder jedweden, der ihnen in den Weg kam; und einerlei, ob sie betrunken oder nüchtern waren, führten sie beständig Schimpfworte oder Flüche im Munde. John Canty war ein Dieb und seine Mutter eine berufsmäßige Bettlerin. Auch die Kinder mussten betteln, aber zum Stehlen ließen sie sich nicht verleiten. Unter diesem abscheulichen Gesindel, aber ohne zu ihm zu gehören, wohnte ein guter, alter Priester, den der König mit einer ganz geringfügigen Pension von Haus und Hof verjagt hatte, und der sich im Geheimen der Kinder annahm und sie gute und nützliche Dinge lehrte. Von Vater Andreas lernte Tom etwas Latein, auch Lesen und Schreiben; und er würde die letzteren Fertigkeiten auch den Mädchen beigebracht haben, aber diese fürchteten von ihren Genossen verspottet zu werden, wenn sie sich Kenntnisse aneigneten, die für ihren Stand ungewöhnlich waren.
Überall im Kehrichtshof ging es so zu wie bei Cantys. Trunkenheit, Zank, Gewalttätigkeit gab es den ganzen Tag lang und bis tief in die Nacht hinein; und blutige Köpfe waren dort so alltäglich wie der Hunger. Trotzdem fühlte sich Tom nicht unglücklich. Er hatte es schlecht, aber er wusste es nicht. Denn den anderen Jungen in seiner Umgebung ging es nicht anders, und darum meinte er, so wäre es recht und gut. Kam er abends mit leeren Händen heim, wusste er, dass sein Vater ihn auszanken und prügeln würde, und dass, wenn der fertig wäre, die böse Großmutter damit anfangen und es noch ärger treiben werde. Dann würde spät in der Nacht seine arme, schwache Mutter sich zu ihm schleichen und ihm ein Stückchen trockenes Brot zustecken, das sie für ihn beiseite geschafft hatte und lieber selbst hungrig zu Bett gegangen war, obwohl sie bei diesem verbotenen Bemühen oft von ihrem Ehemann abgefasst wurde und arge Schläge dafür erhielt.
Nein, Tom fand sein Leben gar nicht so übel, besonders im Sommer nicht. Er bettelte nur gerade so viel, um zu Hause nicht gar zu arg misshandelt zu werden, denn auch die Gesetze gegen die Bettelei waren hart und mit schweren Bußen belegt. Es blieb ihm viel Zeit, den schönen Geschichten und Sagen des guten Vaters Andreas zu lauschen, der von Riesen und Feen, Zwergen und Geistern, Zauberschlössern, mächtigen Königen und edlen Prinzen zu erzählen wusste. Sein Kopf füllte sich mit diesen Wunderdingen, und manche Nacht, wenn er im Dunkeln auf dem harten, übel riechenden Stroh lag, müde, hungrig, zerschlagen und von Schmerzen gequält, ließ er seiner Einbildungskraft freien Lauf und vergaß sein Leid, indem er sich das Wohlleben eines verwöhnten Prinzen in seinem Königsschloss ausmalte. Allmählich bemächtigte sich seiner ein Wunsch bei Tag und bei Nacht: Er wollte einen wirklichen Prinzen mit eigenen Augen sehen. Das sprach er einmal gegenüber seinen Spielgefährten vom Kehrichtshof aus, aber sie verhöhnten und verspotteten ihn so unbarmherzig, dass er seitdem seine Hirngespinste für sich behielt.
Nun las er des Priesters alte Bücher wieder und wieder und ließ sich alles noch ausführlicher erzählen, und das Lesen und Nachdenken darüber bewirkte bei ihm mit der Zeit eine Veränderung. Jene Märchengestalten gefielen ihm so sehr, dass er sich seiner Lumpen und seines Schmutzes schämte, und sich wünschte, reinlicher zu sein und bessere Kleider zu tragen. Zwar spielte er noch auf der schmutzigen Straße, und gern sogar; aber wenn er in der Themse herumpaddelte, tat er es nicht nur, weil es so lustig dabei herging, sondern auch wegen der reinigenden Wirkung des Bades.
Tom fand immer Unterhaltung, wenn er entweder zum Maibaum in Cheapside oder auf die Jahrmärkte ging. Ab und zu sah er, so wie die übrige Londoner Bevölkerung auch, die Entfaltung der Kriegsmacht, wenn ein unglücklicher Staatsgefangener zu Land oder zu Schiff zum Tower gebracht wurde. Eines Tages sah er auch die arme Anna Askew und drei Männer auf einem Scheiterhaufen in Smithfield verbrennen und hörte einen ehemaligen Bischof darüber eine Predigt halten, die er nicht verstand. Ja, es fehlte Toms Leben nicht an Abwechslung, und er fand es im Ganzen recht vergnüglich.
Das Lesen und Nachsinnen über das Leben eines Fürstensohns übten eine so starke Wirkung auf Tom aus, dass er unbewusst anfing, sich so zu benehmen, als ob er ein Prinz wäre. Seine Reden und sein Betragen wurden ungewöhnlich feierlich und höflich zur höchsten Bewunderung und Verwunderung seiner nächsten Freunde. Dabei aber nahm Toms Einfluss auf seine jugendlichen Genossen täglich zu, und sie blickten mit Staunen zu ihm auf, wie zu einem höheren Wesen. Er erschien ihnen so reich an Kenntnissen, und er tat und sagte so merkmürdige Sachen, und dabei war er so klug und nachdenklich! Toms Reden und Tun wurde durch die Knaben ihren Eltern hinterbracht, und diese fingen auch an, Tom Canty für einen sehr klugen und außergewöhnlich begabten Jungen zu halten. Erwachsene Leute wendeten sich an Tom, wenn sie in Verlegenheit waren und wunderten sich über den Witz und Scharfsinn seiner Ratschläge. So wurde er überall wie ein Wunder bestaunt, nur nicht in seiner eigenen Familie – die fand gar nichts Besonderes an ihm.
Ganz im Stillen richtete sich Tom einen Hofstaat ein. Er war der Prinz, seine Spielgefährten ernannte er zu seiner Leibwache, zu Kammerherren, Stallmeistern, Hofdamen und Hofherren. Der falsche Prinz umgab sich mit einem weitschweifigen Zeremoniell, das er den Märchenbüchern entlehnt hatte: Täglich wurden die Staatsangelegenheiten des erträumten Königreichs im Staatsrat verhandelt, und täglich erteilte der kleine Fürst Befehle an sein nur in der Fantasie vorhandenes Kriegsheer, seine Flotte und seine Statthalter. Morgens ging er wieder in seinem zerlumpten Rock aufs Betteln aus, verzehrte sein trockenes Brot, ertrug Püffe und Scheltreden, streckte sich auf das elende Strohlager und war dann im Traum ein Prinz.
Und immer wuchs sein Verlangen, einmal einen wirklichen Prinzen leibhaftig vor sich zu sehen; mit jedem Tag, jeder Woche nahm es zu, bis es alle anderen Wünsche verdrängte und zu einer alles beherrschenden Leidenschaft wurde.
Als er an einem Januartag wieder betteln gegangen war, wandelte er stundenlang frierend und barfüßig trübselig zwischen Mincing Lane und East Cheap hin und her und betrachtete die an den Fenstern der Garküchen ausgestellten Speisen, die an und für sich gar nicht begehrenswert waren; doch für ihn schienen sie Leckerbissen, eines Engels würdig, und er urteilte nur nach dem Geruch, denn er hatte noch nie etwas Ähnliches zu essen bekommen. Der Regen rieselte kalt herunter, die Luft war grau, ein melancholischer Tag. Abends kam er so nass, erschöpft und hungrig heim, dass sein kläglicher Zustand selbst dem Vater und der Großmutter auffiel und sie ihm ihr Mitgefühl auf ihre Weise ausdrückten: Das heißt, sie gaben ihm gleich ein paar Püffe und schickten ihn schlafen. Lange Zeit noch hielten ihn Schmerz und Hunger sowie der im Haus tobende Lärm wach, aber schließlich entschwebten seine Gedanken in das Land der Träume, und er meinte, an der Seite von gold- und edelsteingeschmückten Königskindern zu schlummern und Diener zu haben, die ihm mit tiefen Verbeugungen aufwarteten oder seine Befehle mit Windeseile vollzogen. Und zuletzt träumte er wie gewöhnlich, dass er selbst ein Prinz wäre.
Die ganze Nacht hindurch währte diese Herrscherwonne. Er bewegte sich zwischen vornehmen Herren und Damen, ein Lichtmeer umfloß ihn; er atmete Wohlgerüche, köstliche Musik tönte an sein Ohr, und mit einem Lächeln oder einem gnädigen Neigen seines fürstlichen Hauptes beantwortete er die ehrfurchtsvolle Begrüßung der glänzenden Menge, die zu beiden Seiten vor ihm zurückwich.
Als er morgens aufwachte und seine armselige Umgebung betrachtete, wirkte jener Traum wieder wie gewöhnlich: Ihm erschien sein Zustand noch tausendmal schlimmer. Da überfielen ihn Bitterkeit, Herzeleid und Tränen.
3. KAPITEL
Tom lernt den Prinzen kennen
Hungrig stand Tom auf, und hungrig ging er fort, die Gedanken noch ganz von der leeren Herrlichkeit seines Traumes erfüllt. Er schlenderte durch die innere Stadt hin und her, ohne darauf zu achten, wo er war, oder was um ihn vorging. Die Leute liefen gegen ihn und manche riefen ihm unwirsch Scheltworte zu, aber der Träumer merkte nichts davon. So kam er allmählich nach Temple Bar – so weit hatte er sich in dieser Richtung noch nie von zu Hause entfernt. Er blieb einen Augenblick stehen und überlegte; dann versank er wieder in seine Grübeleien und ließ die Mauern Londons hinter sich. Damals war der Strand kein Landweg mehr; er hielt sich selbst schon für eine Straße, wenn auch keine vollständige, denn obwohl die eine Seite von einer beinahe ununterbrochenen Reihe von Häusern eingefasst war, standen auf der anderen nur zerstreut einige große Gebäude, Paläste reicher Edelleute, von schönen, großen Parkanlagen umgeben, die sich bis zum Fluss herunterzogen, Grundstücke, die heutzutage eng bedeckt mit düsteren Häusern sind.
Tom gelangte ins Dorf Charing und rastete an dem schönen Kreuz, welches hier ein trauernder König errichtet hatte. Dann schlenderte er einen einsamen lieblichen Weg entlang, an des großen Kardinals stattlichem Wohnsitz vorüber auf ein noch mächtigeres, Ehrfurcht gebietendes Schloss zu – das war Westminster.
Mit frohem Staunen betrachtete Tom das ungeheuere Gebäude, die weitausgreifenden Flügel, die finsteren Türme und Zinnen, das hohe, steinerne Portal mit dem vergoldeten Gitter und dem prächtigen Aufbau der riesigen Granitlöwen und den anderen Zeichen und Sinnbildern der englischen Königsmacht. Sollte endlich das Verlangen seiner Seele gestillt werden? Denn das dort war ein Königsschloss. Konnte Tom nicht hoffen, wenn der Himmel ihm gnädig war, nun auch einen leibhaftigen Prinzen zu sehen?
An jeder Seite des goldenen Gitters stand eine lebende Bildsäule, nämlich ein hoch aufgerichteter, stattlicher und regungsloser Kriegsmann, von Kopf bis Fuß in eine blanke Stahlrüstung gekleidet. In ehrfurchtsvoller Entfernung hielten sich viele Städter und Bauersleute auf und warteten darauf, etwas von der königlichen Herrlichkeit zu sehen. Prächtige Kutschen mit prächtig gekleideten Insassen und prächtig gekleideten Dienern draußen auf dem Bock fuhren durch die verschiedenen mächtigen Einfahrten, die zu dem Wohnsitz des Königs führten.
Der arme, zerlumpte kleine Tom trat näher und schlich, klopfenden Herzens und mit steigender Hoffnung, langsam und schüchtern an den Schildwachen vorbei, als seine Augen durch die goldenen Stäbe ein Schauspiel erblickten, bei dem er vor Freude beinahe laut aufgejauchzt hätte.
Hinter dem Gitter stand ein munterer Knabe, frisch und gebräunt durch kräftige Bewegung im Freien. Er war gar schön in Seide und Atlas gekleidet und strahlte vor Juwelen. An der Seite trug er einen kleinen mit Edelsteinen besetzten Degen und einen Dolch, zierliche Schuhe an den Füßen mit roten Absätzen und keck auf dem Kopf eine karmesinfarbene Mütze mit wallenden Federn, die durch ein großes, blitzendes Kleinod festgehalten wurden. Mehrere reich gekleidete Herren standen in seiner Nähe, ohne Zweifel seine Dienerschaft. Ja, das musste ein Prinz sein, ein lebendiger, wirklicher Prinz, das stand fest – und das Gebet des Bettelknaben hatte endlich Erhörung gefunden.
Toms Atem flog vor Aufregung, und seine Augen wurden immer größer vor Staunen und Entzücken. Jeder andere Gedanke wich jetzt dem einen Wunsch: in die Nähe des Prinzen zu kommen und sich an ihm satt zu sehen. Ehe er wusste, was er tat, hatte er schon das Gesicht gegen die Stäbe des Gitters gedrückt. Im nächsten Augenblick riss ihn einer der Soldaten mit rauer Faust weg und schleuderte ihn in den Haufen der gaffenden Landleute und müßigen Londoner mit der barschen Weisung: »Keine Unverschämtheit, du Bettelpack!«
Die Menge höhnte und lachte über den Spaß, aber der junge Prinz sprang dicht an das Gitter und rief mit blitzenden Augen und vor Unwillen gerötetem Antlitz: »Wie wagst du, den armen Jungen so zu misshandeln! Wie wagst du selbst dem geringsten von meines Vaters Untertanen so zu begegnen! Öffne das Gitter und lass ihn ein!«
Da hätte man die wankelmütige Menge sehen sollen, die nun die Hüte abriss; da hörte man sie begeistert rufen: »Lang lebe der Prinz von Wales!«
Die Leibwächter schulterten die Hellebarden, öffneten die Pforte und präsentierten wieder das Gewehr, als der kleine Bettelprinz in seinen Lumpen eintrat, um dem Gebieter über unermessliche Reichtümer die Hand zu reichen.
Eduard Tudor sagte: »Du siehst müde und hungrig aus: Du bist schlecht behandelt worden. Komm mit mir!«
Ein halbes Dutzend seines Gefolges trat eilig vor, wohl um Einspruch zu erheben. Aber mit einer echt königlichen Handbewegung winkte er ab, und sie blieben regungslos an ihrem Platz. Eduard führte Tom in ein prächtiges Gemach des Schlosses, das er sein Kabinett nannte. Auf seinen Befehl wurde eine Mahlzeit herbeigebracht, wie Tom sie bisher nur aus Büchern gekannt hatte. Mit fürstlichem Zartgefühl und Takt schickte der Prinz die Diener fort, damit sein armer Gast nicht durch ihre spöttischen Mienen in Verlegenheit gebracht würde. Dann setzte er sich zu Tom und richtete Fragen an ihn, während er aß.
»Wie heißt du, Junge?«
»Tom Canty, mit Verlaub, Herr.«
»Ein wunderlicher Name! Und wo wohnst du?«
»Im Kehrichtshof, in der City, bei Pudding Lane.«
»Kehrichtshof! Auch eine merkwürdige Bezeichnung. Hast du Eltern?«
»Eltern habe ich und auch ‘ne Großmutter; aber Gott verzeih mir’s, wenn ich sage, ich mache mir nichts aus ihr. Dann habe ich auch Zwillingsschwestern, die Nan und die Bet.«
»Die Großmutter ist wohl nicht besonders zärtlich mit dir, will mir scheinen?«
»Sie ist’s auch sonst nicht, mit Eurer Gnaden Verlaub. Sie hat ein böses Herz und tut ihr Lebtag nichts Gutes.«
»Behandelt sie dich schlecht?«
»Manchmal, wenn sie schläft oder gar betrunken ist, lässt sie die Hand ruhen, aber wenn sie bei Verstand ist, prügelt sie mich gehörig.«
Die Augen des kleinen Prinzen funkelten zornig und er rief: »Wie, sie schlägt dich?«
»Nun freilich, Herr!«
»Sie schlägt dich und du bist so klein und schwach. Höre, noch vor heute Abend soll sie in den Tower gesperrt werden. Mein Vater, der König …«
»Herr, Ihr vergesst ihren geringen Stand. Der Tower ist nur für vornehme Leute.«
»Richtig. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich werde überlegen, wie sie zu bestrafen ist. Ist dein Vater gut zu dir?«
»Nicht anders wie die Großmutter Canty, Herr.«
»Das mag so der Väter Art sein. Meiner ist auch nicht von den Sanftmütigen. Er hat eine scharfe Hand. Aber mit mir verfährt er gnädig, wenn er mich manchmal auch hart anfährt. Wie ist deine Mutter zu dir?«
»Gut, Herr, sie hat mir noch nie ein Leid getan, und darin sind Nan und Bet ganz wie sie.«
»Wie alt sind die beiden?«
»Fünfzehn Jahre, mit Verlaub, Herr.«
»Meine Schwester, Lady Elisabeth ist vierzehn und meine Base, Lady Jane Grey ist von meinem eigenen Alter und dabei hübsch und lustig. Aber meine Schwester, die Lady Mary, hat einen finsteren Blick und – sag einmal, verbieten deine Schwestern auch ihren Dienerinnen das Lachen, weil es das Heil ihrer Seele gefährden könne?«
»Sie? Oh Herr, meinst du, sie hätten Dienerinnen?«
Der Prinz sah den Bettelknaben einen Augenblick nachdenklich an: »Und warum denn nicht? Wer hilft ihnen abends beim Entkleiden? Wer zieht sie morgens an?«
»Niemand, Herr. Meint ihr denn, sie sollten ihren Rock ausziehen und unbekleidet schlafen, wie die Tiere?«
»Haben sie denn nur ein Kleidungsstück?«
»Was brauchten sie denn mehrere Anzüge, Herr? Es hat doch ein jeder nur einen Leib.«
»Was für eine absonderliche Vorstellung! Verzeih, dass ich lachte! Aber deine gute Nan und deine Bet sollen sofort Kleider in Fülle haben und Dienerschaft obendrein. Mein Schatzmeister wird dafür sorgen. Nein, danke mir nicht: Es ist nicht der Rede wert. Du sprichst gut, du drückst dich mit Leichtigkeit aus. Bist du gut unterrichtet?«
»Das weiß ich nicht, Herr. Der gute Priester, den man Vater Andreas nennt, hat mich aus Freundlichkeit manches aus seinen Büchern gelehrt.«
»Kannst du Latein?«
»Nur wenig, Herr!«
»Lerne es, Junge. Es ist nur zuerst schwer. Griechisch ist schwerer, aber weder diese Sprache noch irgendeine andere machen meiner Schwester, der Prinzessin Elisabeth, oder meiner Base Mühe. Du solltest sie nur hören, wenn sie ihre Aufgaben hersagen. Aber erzähle mir vom Kehrichtshof. Führst du ein lustiges Leben?«
»Gewiss, Herr, wenn nur der Hunger nicht wäre. Da sieht man Puppenspiele und Affen – ach was das für drollige Tiere sind! Und so prächtig angezogen. Dann gibt es manchmal auch Schauspiele, in denen die Schauspieler schreien und kämpfen bis alle tot sind – das ist wunderschön zu sehen und kostet nur einen Kupferheller; aber trotzdem ist es doch schwer, das Geld zu beschaffen, Herr.«
»Erzähle mir noch mehr.«
»Manchmal kämpfen wir Jungen gegeneinander mit Knüppeln, so wie es die Lehrburschen tun.«
Des Prinzen Augen leuchteten. »Das würde mir gefallen. Erzähle mir mehr.«
»Wir laufen um die Wette, zu sehen, wer der Flinkste ist.«
»Auch das möchte ich gern. Nur weiter!«
»Zur Sommerszeit, Herr, waten und schwimmen wir in den Kanälen und in dem Fluss. Ein jeder duckt seinen Nachbar unter, bespritzt ihn mit Wasser; dann tauchen wir, jubeln und tummeln uns …«
»Ich gäbe mein Königreich dafür, es einmal mitzumachen! Bitte, fahre fort.«
»Wir tanzen und singen um den Maibaum in Cheapside, wir spielen im Sand und graben uns Gruben oder stecken die anderen hinein. Und wie schön kann man aus Sand backen! Ja, über feuchten Sand geht überhaupt nichts, und mit Verlaub, Herr, wir wälzen uns darin.«
»Nein, nicht weiter! Es ist zu schön. Wenn ich nur angezogen wäre wie du. Wenn ich die Schuhe abstreifen könnte und einmal im Sand wühlen, ohne dass es mir jemand verbietet oder mich hofmeistert, ich gäbe meine Krone darum!«
»Ach, lieber Herr, und wäre ich einmal gekleidet wie Ihr – nur ein einziges Mal …«
»Wie? Das möchtest du! Das kann geschehen. Leg die Lumpen ab, und ziehe dies Prachtgewand an. Es ist ein kurzes Glück, doch wird es dir darum nicht minder gut gefallen. Wir wollen es genießen, solange wir können und die Kleider wieder tauschen, ehe wir gestört werden.«
Einige Minuten darauf war der kleine Prinz von Wales mit Toms zerrissenen und zerschlitzten Habseligkeiten bekleidet und der kleine Bettelprinz in das bunte königliche Gefieder geschlüpft. Die beiden traten nebeneinander vor einen großen Spiegel, und oh Wunder, der Tausch war nicht zu bemerken. Sie sahen einander, dann das Spiegelbild und wieder einander betroffen an. Schließlich sagte der Prinz nachdenklich:
»Was hältst du davon?«
»Oh, Euer Gnaden dürfen mich nicht danach fragen. Es schickt sich nicht, dass meinesgleichen ein Urteil abgibt.«
»Dann will ich es abgeben. Du hast dasselbe Haar, dieselben Augen, dieselbe Stimme und Haltung, dieselbe Größe und Gestalt, dasselbe Antlitz, dieselben Züge, die ich habe. Ständen wir nackt nebeneinander, könnte niemand sagen, wer du wärst und welcher der Prinz von Wales. Und während ich nun gekleidet bin wie du es warst, kann ich dir noch besser nachfühlen, was du empfandest, als der rohe Kriegsmann dich anpackte. Zeige her, ist nicht eine Beule auf deiner Hand?«
»Ja, aber es macht nichts, und Euer Gnaden weiß, der arme Leibwächter tat nur seine Schuldigkeit.«
»Schweig! Es war abscheulich und grausam!«, rief der kleine Prinz, mit dem Fuß stampfend. »Wenn das der König wüsste – rühre dich keinen Schritt von hier, bis ich wiederkomme. Das befehle ich dir!«
Hierauf nahm er schnell noch einen für den Staat hochwichtigen Gegenstand vom Tisch und verwahrte ihn. Dann sprang er mit blitzenden Augen und vor Erregung geröteten Wangen aus der Tür und eilte, dass die Lumpen flatterten, durch den Schlossgarten. Als er das Gitter erreichte, fasste er die Riegel, wollte sie öffnen und rief: »Macht auf! Öffnet das Gitter!«
Der Soldat, welcher Tom so unsanft angefasst hatte, gehorchte sofort, und als der Prinz aus dem Portal eilte, ganz außer sich von fürstlicher Ungeduld, versetzte ihm der Kriegsmann eine schallende Ohrfeige, die ihn ein Stück weit auf die Straße schleuderte und sagte: »Nimm das zum Dank, du Bettelbrut, für den Rüffel, den ich deinetwegen von der Hoheit bekommen habe!«
Die Menge brach in ein wieherndes Gelächter aus. Der Prinz aber sprang auf, stürzte gegen die Schildwache los und rief: »Ich bin der Prinz von Wales! Meine Person ist geheiligt – und du sollst gehenkt werden, weil du Hand an mich gelegt hast.«
Der Soldat präsentierte vor ihm die Hellebarde und spottete: »So grüße ich Eure Königliche Hoheit«, setzte aber dann barsch hinzu: »Scher dich fort, du verrückter Bengel!«
Nun drängte die höhnende Menge sich dicht um den armen kleinen Prinzen und trieb ihn die Straße hinunter mit dem Ruf: »Platz für den Prinzen von Wales. Platz für den Prinzen von Wales!«
4. KAPITEL
Des Prinzen Not beginnt
Nachdem das Gesindel den kleinen Prinzen stundenlang gequält und verfolgt hatte, ließ es ihn endlich in Frieden. Solange er Kräfte gehabt hatte, dem Pöbel zu antworten, ihn in königlicher Haltung zu bedrohen und von oben herab Befehle zu erteilen, über welche die Leute aus vollem Hals lachen konnten, fanden sie ihn unterhaltend; doch als die Müdigkeit ihn schließlich zwang zu schweigen, wurden die Verfolger seiner überdrüssig und sie suchten sich anderen Zeitvertreib. Nun sah er sich um, wo er war, doch er vermochte den Ort nicht zu erkennen. Er war in der City – in der Altstadt von London, mehr wusste er nicht. Ziellos wanderte er weiter. Allmählich standen die Häuser vereinzelt und die Zahl der Fußgänger verminderte sich. Er kühlte seine blutenden Füße in dem Bach, der dort floß, wo jetzt die Farringdonstreet liegt, rastete eine Weile und kam dann auf einen Platz, auf dem nur wenige Häuser – und eine gewaltige Kirche standen, von Gerüsten umgeben, mit vielen Arbeitern darauf, denn sie wurde ausgebaut. Des Prinzen Zuversicht wuchs. Er meinte, seine Not sei nun vorüber, denn er sagte sich: Dies ist die ehemalige Kirche der Grauen Brüder, die mein Vater den Mönchen fortgenommen und sie unter dem neuen Namen Christ Church zum Obdach für arme und verlassene Kinder bestimmt hat. Von Herzen gern werden sie sich dienstwillig gegenüber dem Sohn des Mannes beweisen, der so großmütig für sie gesorgt hat; umso mehr, da dieser Sohn jetzt so arm und verlassen ist wie kein Knabe je zuvor, der hier Aufnahme gefunden hat oder in späterer Zeit finden wird.
Bald befand er sich in einer Knabenschar, die einander jagten, Ball spielten, Bock sprangen oder sich anderweitig vergnügten, und zwar in sehr lärmender Weise. Sie waren alle gleich gekleidet in der Art, wie es damals Dienstleute und Lehrlinge trugen. Dazu hatte ein jeder auf dem Kopf eine flache schwarze Mütze von der Größe einer Tasse, die wegen ihrer Kleinheit als Kopfbedeckung unzweckmäßig und an und für sich auch nicht kleidsam war, darunter fiel das Haar ungescheitelt bis halb in die Stirn und zwar ringsum glatt abgeschnitten. Um den Hals trugen sie Bäffchen; der blaue eng anliegende Rock reichte bis auf die Knie, er hatte weite Ärmel und wurde durch einen breiten, roten Gürtel geschlossen; außerdem Strümpfe von knallgelber Farbe, die über das Knie heraufreichten und ausgeschnittene Schuhe mit großen Metallschnallen. Es war eine hässliche Tracht.*
Die Jungen unterbrachen ihre Spiele und drängten sich um den Prinzen, der mit natürlicher Würde sagte: »Meine lieben Knaben, meldet eurem Lehrer, dass Eduard, Prinz von Wales, mit ihm zu reden begehrt.«
Gellendes Gelächter folgte auf diese Worte und ein dreister Junge fragte: »Bettelbube, bist du des Prinzen Abgesandter?« Dem Prinzen stieg die Zornesröte in das Antlitz, unwillkürlich griff die Hand zur Seite, aber er fand die Stelle leer. Es folgte ein neuer Ausbruch der Heiterkeit und einer der Knaben rief: »Habt ihr’s bemerkt? Er meinte ein Schwert an der Seite zu haben – vielleicht ist’s doch der Prinz.« Diese Bemerkung rief neues Lachen hervor, und der arme Eduard richtete sich stolz auf und sagte: »Ich bin der Prinz; und es ziemt euch schlecht, die ihr von meines Vaters Wohltat lebt, mir so übel zu begegnen.«
Das machte ihnen erst recht Spaß, wie das Gelächter bewies, und der Junge, der zuerst geredet hatte, rief nun seinen Genossen zu: »Holla, ihr unmanierlichen Tiere, ihr Sklaven, ihr Almosenempfänger seines gnädigen Vaters, wisst ihr nicht, was sich schickt? Auf die Knie, sage ich, einer wie der andere, und beweist eure Ehrfurcht vor seiner königlichen Haltung und seiner Lumpenherrlichkeit!«
Mit wildem Toben fielen sie alle auf die Knie und höhnten ihr Opfer durch spöttische Ehrbezeugungen. Der Prinz versetzte dem ihm nächsten Knaben einen Fußtritt und rief heftig: »Nimm das vorläufig zum Lohn. Warte bis morgen, dann lasse ich einen Galgen bauen.«
Ja, das war kein Scherz mehr, das ging über den Spaß. Das Gelächter verstummte plötzlich und die Wut trat an die Stelle. Ein Dutzend Stimmen rief: »Greift ihn! In die Pferdeschwemme, in die Pferdeschwemme! Wo sind die Hunde? Hierher Leo! Hierher Packan!«
Nun folgte ein Schauspiel, das England noch nie gesehen hatte – die geheiligte Person des Thronerben wurde von rohen Fäusten verprügelt und von den Hunden angefallen.
Als die Nacht hereinbrach, fand sich der Prinz wieder in dem dichtbebauten Teil der City. Sein Körper war wund, die Hände bluteten, und seine Lumpen waren mit Schmutz bedeckt. Weiter und weiter wanderte er und ihm wurde immer wirrer im Kopf und dabei war er so müde und kraftlos, dass er kaum einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Auch fragte er niemanden mehr nach dem Weg, da ihm seine Erkundigungen nur Grobheiten und keine Belehrung eingetragen hatten. Dabei sagte er halblaut vor sich hin: »Kehrichtshof, so hieß die Straße. Wenn ich nur den Weg dorthin fände, ehe meine Kräfte völlig erschöpft sind und ich zusammenbreche, denn dann bin ich gerettet: Seine Angehörigen werden mich aufs Schloss bringen und beweisen, dass ich keiner von ihnen bin, sondern der echte Prinz, und so werde ich wieder an den mir gebührenden Platz kommen.«
Ab und zu kehrte die Erinnerung an die Behandlung zurück, welche die rohen Knaben aus dem Christ-Hospital ihm hatten zuteil werden lassen, und er sagte: »Wenn ich einmal König bin, sollen sie nicht allein Brot und Obdach erhalten, sondern auch Unterricht. Ein voller Magen ist nichts wert, wenn Herz und Geist leer bleiben. Das will ich mir einprägen, damit mir die Erfahrung des heutigen Tages nicht verloren geht und mein Volk darunter leidet. Denn Belehrung macht das Herz weicher und erzeugt Milde und Barmherzigkeit.«*
Die Lichter wurden angezündet. Es begann zu regnen, der Wind erhob sich stärker, und die Nacht drohte nass und rau zu werden. Der obdachlose Prinz, der herumirrende Erbe des englischen Thrones ging immer weiter, immer tiefer in die schmutzigen Gassen, in denen Armut und Elend massenhaft beieinander wohnten.
Plötzlich packte ihn ein großer, betrunkener Kerl und sagte: »Bist du immer noch bei dieser Nachtzeit draußen! Ich wette, du hast wieder keinen Heller nach Hause gebracht. Wenn dem so ist, und ich dir nicht jeden Knochen in deinem mageren Gerippe entzweischlage, will ich nicht John Canty heißen!«
Der Prinz wand sich los, strich sich unwillkürlich die unerlaubt berührte Schulter, sagte aber schnell: »Seid Ihr wirklich sein Vater? Der gütige Himmel gebe, dass es so sei – dann holt ihn ab und bringt mich hin.«
»Sein Vater? Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Aber ich weiß, dass ich dein Vater bin, wie du bald Ursache haben wirst zu spüren.«
»Oh scherzt nicht, zögert nicht! Ich bin müde, ich blute. Ich kann es nicht aushalten. Führt mich zum König, meinem Vater, und er wird Euch reicher belohnen, als Ihr Euch vorstellen könnt. Glaubt es mir, Mann, glaubt es mir. Ich lüge nicht, ich rede die Wahrheit. Bietet mir die Hand und rettet mich! Ich bin wirklich der Prinz von Wales.«
Der Mann blickte verwundert auf den Knaben herunter, schüttelte dann den Kopf und sagte: »Er ist verrückt, ganz verrückt geworden!«, dann packte er ihn wieder und rief lachend und mit einem Fluch: »Aber verrückt oder nicht, ich und Großmutter Canty werden dich windelweich hauen, so wahr ich lebe!« Dann zog er den verzweifelnden und sich widersetzenden Prinzen fort und verschwand mit ihm in einem Hof, auf dem es von altem und jungem Gesindel wimmelte.
5. KAPITEL
Tom als Königssohn
Als Tom allein in dem Zimmer des Prinzen zurückgeblieben war, machte er sich diese Gelegenheit zunutze. Vor dem großen Spiegel drehte er sich bald nach dieser, bald nach jener Seite und bewunderte die schönen Kleider. Dann schritt er auf und ab, des Prinzen vornehme Haltung nachahmend, und beobachtete im Spiegel, wie er sich dabei anstellte. Darauf zog er den schönen Degen, verbeugte sich, küsste die Klinge und legte sie über die Brust: Alles so wie er es vor fünf oder sechs Wochen den edlen Ritter hatte tun sehen, bei der Begrüßung des Befehlshabers des Towers, als jener die hochgeborenen Lords von Norfolk und Surrey als Gefangene überlieferte. Tom spielte mit dem juwelenbesetzten Dolch, der ihm an der Seite hing. Er betrachtete die seltenen und kostbaren Schaustücke in dem Zimmer, setzte sich probeweise in einen der bequemen Sessel nach dem anderen und dachte, wie stolz er sein würde, wenn seine Spielgefährten aus dem Kehrichtshof ihn in dieser Pracht bewundern könnten. Er überlegte, ob sie ihm wohl Glauben schenken würden, wenn er ihnen nach seiner Heimkehr diese wunderbare Geschichte erzählte oder ob sie die Köpfe schütteln und meinen würden, seine überreizte Einbildungskraft hätte ihn schließlich um den Verstand gebracht.
Nach einer halben Stunde deuchte es ihn, dass der Prinz sehr lange ausbleibe, und nun fühlte er sich recht einsam. Er horchte, ob der Prinz nicht wiederkäme und sehnte ihn herbei. Es machte ihm keine Freude mehr, mit den hübschen Sachen zu spielen. Es wurde ihm unbehaglich zumute, unruhig und ängstlich. Was würde geschehen, wenn jemand käme und ihn in des Prinzen Kleidern sähe und dieser wäre nicht da, den Vorgang aufzuklären? Vielleicht hingen sie ihn gleich auf und untersuchten die Geschichte erst hinterdrein! Er hatte gehört, dass die Großen schnell mit der Strafe bei der Hand wären. Immer höher und höher stieg seine Besorgnis, und bebend öffnete er die Tür zu dem Vorzimmer mit dem Entschluss zu fliehen, den Prinzen aufzusuchen und sich von ihm schützen und befreien zu lassen. Sechs goldstrotzende Diener und zwei junge Pagen aus vornehmer Familie, so bunt gekleidet wie Schmetterlinge, sprangen auf und verneigten sich tief vor ihm. Schnell trat er wieder zurück und schloss die Tür.
»Sie machen sich nur über mich lustig«, dachte er. »Sie werden hingehen und mich anzeigen. Ach, warum bin ich hergekommen. Es wird mich das Leben kosten.«
Von banger Furcht erfüllt, ging er im Zimmer auf und ab, lauschte und fuhr bei dem geringsten Geräusch erschrocken zusammen. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und ein seidenglänzender Page meldete: »Lady Jane Grey!«
Die Tür schloss sich, und ein holdseliges, reich gekleidetes junges Fräulein eilte auf ihn zu. Aber plötzlich blieb sie stehen und sagte erschrocken: »Was fehlt Eurer Hoheit?«
Tom versagte die Stimme, doch er raffte alle Kraft zusammen und stammelte: »Oh erbarmet Euch meiner! Ich bin ja gar kein vornehmer Herr, sondern nur der arme Tom Canty aus dem Kehrichtshof in der Altstadt. Ich bitte Euch, bringt mich zu dem Prinzen, und er wird mir gnädig meinen zerlumpten Kittel wiedergeben und mich ungekränkt ziehen lassen. Ach, seid barmherzig und rettet mich!«
Der Knabe war dabei auf die Knie gesunken, und die erhobenen Augen und Hände gaben seinen Worten noch mehr Nachdruck.
Das junge Mädchen starrte ihn entsetzt an: »Mein Prinz auf den Knien und vor mir?« Dann eilte sie erschrocken davon. Tom sank verzweifelt zu Boden und murmelte: »Es hilft nichts! Mir bleibt keine Hoffnung. Nun werden sie kommen und mich greifen.«
Während er vor Furcht betäubt dalag, verbreiteten sich beängstigende Gerüchte im Schloss. Man flüsterte sich zu, denn hier flüsterte man nur, aber es ging von Diener zu Diener, von diesem Lord zu jener Lady, die langen Gänge herunter, von Stockwerk zu Stockwerk, von Saal zu Saal: »Der Prinz ist irrsinnig. Der Prinz ist verrückt!«
Bald stand in jedem Saal, in jeder Marmorhalle eine Gruppe reich gekleideter vornehmer Herren und Frauen beieinander oder geringere Leute, die sich eifrig in gedämpftem Ton unterhielten, und Entsetzen malte sich auf allen Gesichtern. Plötzlich erschien ein hoher Hofbeamter, der durch die Gruppen schreitend feierlich verkündete:
»Im Namen des Königs! Bei Todesstrafe soll niemand auf das falsche und törichte Gerücht achten, noch darüber reden oder es weiter verbreiten. Im Namen des Königs!«
Das Geflüster hörte sofort auf, als ob die Flüsternden mit einem Mal den Gebrauch der Sprache verloren hätten.
Bald darauf wurde eine allgemeine Aufregung in den Gängen bemerkbar: »Der Prinz!«, hieß es. »Der Prinz kommt!«
Der arme Tom schritt langsam durch die sich tief verbeugenden Gruppen, versuchte die Grüße zu erwidern und betrachtete mit verwunderten, traurigen Augen die ihm unbekannte Umgebung. Ihm zur Seite schritten zwei der Großen des Reiches, die ihm den Arm geboten hatten, sich darauf zu stützen, damit er nicht strauchelte. Ihnen folgten die Leibärzte und einige Diener.
Nach kurzer Zeit sah sich Tom in einem hohen Gemach und hörte eine Tür hinter sich schließen. Diejenigen, die ihn hergeleitet hatten, stellten sich im Kreis um ihn auf. Unfern von ihm lag auf einem Ruhebett ein sehr großer, sehr dicker Mann, dessen Gesicht breit und gedunsen aussah und einen finsteren Ausdruck zeigte. Sein buschiges Haar war grau, und der Backenbart, der wie ein Rahmen sein Gesicht umgab, war ebenfalls von grauer Farbe. Seine Kleider schienen aus reichem Stoff, waren aber alt und stellenweise abgenutzt. Das eine seiner geschwollenen Beine war mit Binden umwickelt und ruhte auf einem Kissen. Es herrschte tiefe Stille, und jeder, mit Ausnahme dieses Mannes, beugte unterwürfig den Kopf.
Der streng blickende Kranke war der gefürchtete Heinrich VIII. Er sagte – und seine Züge wurden sanft, als er redete: »Was höre ich, Lord Eduard, mein Prinz? Warum willst du mich, den guten König, deinen Vater, der dich liebt und auf Händen trägt, mit einem übel ersonnenen Scherz täuschen?«
Der arme Tom hatte sich zusammengenommen, so gut es seine Betäubung erlaubte, um die Rede zu verstehen. Aber als die Worte »mich den guten König« an sein Ohr klangen, erbleichte er und sank so geschwind auf die Knie, als hätte ihn ein Schuss niedergestreckt. Er hob die Hände und rief: »Du, der König! Ach, dann bin ich verloren!«
Diese Antwort brachte den König außer Fassung. Seine Augen wanderten betroffen von Gesicht zu Gesicht und blieben traurig auf dem vor ihm knienden Knaben haften. Dann erwiderte er in dem Ton schmerzlichster Enttäuschung: »Ach, ich hielt es für ein übertriebenes Gerücht. Aber ich fürchte, das ist es nicht.« Er seufzte tief auf und fuhr mit milder Stimme fort: »Komm her zu deinem Vater, mein Kind, dir ist nicht wohl.«