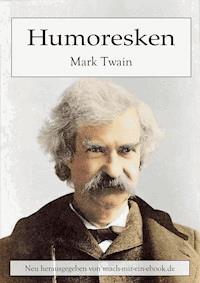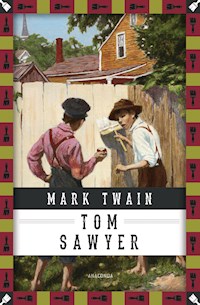
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Anaconda Kinderbuchklassiker
- Sprache: Deutsch
Mark Twains »Tom Sawyers Abenteuer« begeistert seit fast 150 Jahren ganze Heerscharen kleiner und großer Leser. Die Geschichte der beiden Freunde Tom Sawyer und Huckleberry Finn spielt an den Ufern des Mississippi und erschien erstmals 1876. Twains Blick auf seine Helden ist getragen von der Erinnerung an seine eigenen Kindertage und er weiß, was sie bewegt. Die Lust auf Abenteuer und die unverbrüchlichen Bande der Freundschaft sind die zeitlosen Themen dieses wunderbaren Romans.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mark Twain
Tom Sawyers Abenteuer
Aus dem amerikanischen Englisch von Margarete Jacobi
Anaconda
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
The Adventures of Tom Sawyer
(Hartford, Conn.: American Publishing Company 1876).
Die Übersetzung von Margarete Jacobi folgt der Ausgabe Stuttgart: Verlag von Robert Lutz 1900 [d. i. Band I: Tom Sawyers Streiche und Abenteuer der Edition Mark Twains ausgewählte humoristische Schriften]. Diese Übersetzung ist nicht vollständig und wurde für die vorliegende Ausgabe nicht ergänzt. Der Text wurde an manchen Stellen behutsam überarbeitet, Orthografie und Interpunktion wurden auf neue deutsche Rechtschreibung umgestellt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-641-27908-0V001
© 2015, 2021 by Anaconda Verlag,einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Illustration of Tom Sawyer
Whitewashing a Fence (1910), American School (20th century),
Private Collection / Photo © GraphicaArtis / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
www.anacondaverlag.de
Die meisten der im »Tom Sawyer« erzählten Abenteuer sind wirklich vorgekommen. Eines oder zwei habe ich selbst erlebt, die anderen meine Schulkameraden. Huck Finn ist nach dem Leben gezeichnet, Tom Sawyer ebenfalls, jedoch mit dem Unterschied, dass in ihm die Charaktereigenschaften mehrerer Knaben vereinigt sind.
Hartford, 1876
Der Verfasser
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Schlusswort
Erstes Kapitel
Tom!«
Keine Antwort.
»Tom!«
Tiefes Schweigen.
»Wo der Junge nun wieder steckt, möcht ich wissen. Du – Tom!«
Die alte Dame zog ihre Brille gegen die Nasenspitze herunter und starrte drüber weg im Zimmer herum, dann schob sie sie rasch wieder empor und spähte drunter her nach allen Seiten aus. Nun und nimmer würde sie dieselbe so entweiht haben, dass sie durch die geheiligten Gläser hindurch nach solchem geringfügigen Gegenstand geschaut hätte, wie ein kleiner Junge einer ist. War es doch ihre Staatsbrille, der Stolz ihres Herzens, welche sie sich nur der Zierde und Würde halber zugelegt, keineswegs zur Benutzung – ebenso gut hätte sie durch ein paar Kochherdringe sehen können. Einen Moment lang schien sie verblüfft, da sie nichts entdecken konnte, dann ertönte wiederum ihre Stimme, nicht gerade ärgerlich, aber doch laut genug, um von der Umgebung, dem Zimmergerät nämlich, gehört zu werden: »Wart, wenn ich dich kriege, ich – –«
Sie beendete den Satz nicht, denn sie war inzwischen ans Bett herangetreten, unter welchem sie energisch mit dem Besen herumstöberte, was ihre ganze Kraft, all ihren Atem in Anspruch nahm. Trotz der Anstrengung förderte sie jedoch nichts zutage als die alte Katze, die ob der Störung sehr entrüstet schien.
»So was wie den Jungen gibt’s nicht wieder!«
Sie trat unter die offene Haustür und ließ den Blick über die Tomaten und Kartoffeln schweifen, welche den Garten vorstellten. Kein Tom zu sehen! Jetzt erhob sich ihre Stimme zu einem Schall, der für eine ziemlich beträchtliche Entfernung berechnet war:
»Holla – du – To-om!«
Ein schwaches Geräusch hinter ihr veranlasste sie, sich umzudrehen, und zwar eben noch zu rechter Zeit, um einen kleinen, schmächtigen Jungen mit raschem Griff am Zipfel seiner Jacke zu erwischen und eine offenbar geplante Flucht zu verhindern.
»Na, natürlich! An die Speisekammer hätte ich denken müssen! Was hast du drinnen wieder angestellt?«
»Nichts.«
»Nichts? Na, sieh mal einer! Betracht mal deine Hände, he, und was klebt denn da um deinen Mund?«
»Das weiß ich doch nicht, Tante!«
»So, aber ich weiß es. Marmelade ist’s, du Schlingel, und gar nichts anderes. Hab ich dir nicht schon hundert Mal gesagt, wenn du mir die nicht in Ruhe ließest, wollt ich dich ordentlich gerben? Was? Hast du’s vergessen? Reich mir mal das Stöckchen da!«
Schon schwebte die Gerte in der Luft, die Gefahr war dringend.
»Himmel, sieh doch mal hinter dich, Tante!«
Die alte Dame fuhr herum wie von der Tarantel gestochen und packte instinktiv ihre Röcke, um sie in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig war der Junge mit einem Satz aus ihrem Bereich, kletterte wie ein Eichkätzchen über den hohen Bretterzaun und war im nächsten Moment verschwunden. Tante Polly sah ihm einen Augenblick verdutzt, wortlos nach, dann brach sie in leises Lachen aus.
»Hol den Jungen der und jener! Kann ich denn nie gescheit werden? Hat er mir nicht schon Streiche genug gespielt, dass ich mich endlich einmal vor ihm in Acht nehmen könnte! Aber, wahr ist’s, alte Narren sind die schlimmsten die’s gibt, und ein alter Pudel lernt keine neuen Kunststückchen mehr, heißt’s schon im Sprichwort. Wie soll man aber auch wissen, was der Junge im Schilde führt, wenn’s jeden Tag was andres ist! Weiß der Bengel doch genau, wie weit er bei mir gehen kann, bis ich wild werde, und ebenso gut weiß er, dass, wenn er mich durch irgendeinen Kniff dazu bringen kann, eine Minute zu zögern, ehe ich zuhaue, oder wenn ich gar lachen muss, es aus und vorbei ist mit den Prügeln. Weiß Gott, ich tu meine Pflicht nicht an dem Jungen. ›Wer sein Kind lieb hat, der züchtiget es‹, heißt’s in der Bibel. Ich aber, ich – Sünde und Schande wird über uns kommen, über meinen Tom und mich, ich seh’s voraus, Herr, du mein Gott, ich seh’s kommen! Er steckt voller Satanspossen, aber, lieber Gott, er ist meiner toten Schwester einziger Junge, und ich hab nicht das Herz, ihn zu hauen. Jedes Mal, wenn ich ihn durchlasse, zwickt mich mein Gewissen ganz grimmig, und hab ich ihn einmal tüchtig vorgenommen, dann – ja dann will mir das alte, dumme Herz beinahe brechen. Ja, ja, der vom Weib geborene Mensch ist arm und schwach, kurz nur währen seine Tage und sind voll Müh und Trübsal, so sagt die Heilige Schrift und wahrhaftig, es ist so! Heute wird sich der Bengel nun wohl nicht mehr blicken lassen, wird die Schule schwänzen, denk ich, und ich werd ihm wohl für morgen irgendeine Strafarbeit geben müssen. Ihn am Sonnabend, wenn alle Jungen frei haben, arbeiten zu lassen, ist fürchterlich hart, namentlich für Tom, der die Arbeit mehr scheut als irgendwas sonst, aber ich muss meine Pflicht tun an dem Jungen, wenigstens einigermaßen, ich muss, sonst bin ich sein Verderben!«
Tom, der, wie Tante Polly sehr richtig geraten, die Schule schwänzte, ließ sich am Nachmittag nicht mehr blicken, sondern trieb sich draußen herum und vergnügte sich königlich dabei. Gegen Abend erschien er dann wieder, kaum zur rechten Zeit vor dem Abendessen, um Jim, dem kleinen Niggerjungen, helfen zu können, das nötige Holz für den nächsten Tag klein zu machen. Dabei blieb ihm aber Zeit genug, Jim sein Abenteuer zu erzählen, während dieser neun Zehntel der Arbeit tat. Toms jüngerer Bruder oder besser Halbbruder Sid hatte seinen Teil am Werk, das Zusammenlesen der Holzspäne, schon besorgt. Er war ein fleißiger, ruhiger Junge, nicht so unbändig und abenteuerlustig wie Tom. Während dieser sich das Abendessen schmecken ließ und dazwischen bei günstiger Gelegenheit Zuckerstückchen stibitzte, stellte Tante Polly ein, wie sie glaubte, äußerst schlaues und scharfes Kreuzverhör mit ihm an, um ihn zu verderbenbringenden Geständnissen zu verlocken. Wie so manche andere arglos-schlichte Seele glaubte sie an ihr Talent für die schwarze, geheimnisvolle Kunst der Diplomatie. Es war der stolzeste Traum ihres kindlichen Herzens, und die allerdurchsichtigsten kleinen Kniffe, derer sie sich bediente, schienen ihr wahre Wunder an Schlauheit und List. So fragte sie jetzt:
»Tom, es war wohl ziemlich warm in der Schule?«
»Ja, Tante.«
»Sehr warm, nicht?«
»Ja, Tante.«
»Hast du nicht Lust gehabt, schwimmen zu gehen?«
Wie ein warnender Blitz durchzuckte es Tom – hatte sie Verdacht? Er suchte in ihrem Gesicht zu lesen, das verriet nichts. So sagte er:
»N-nein, Tante – das heißt nicht viel.«
Die alte Dame streckte die Hand nach Toms Hemdkragen aus, befühlte den und meinte:
»Jetzt ist dir’s doch nicht mehr zu warm, oder?«
Und dabei bildete sie sich ein, bildete sich wirklich und wahrhaftig ein, sie habe den trockenen Zustand besagten Hemdes entdeckt, ohne dass eine menschliche Seele ahne, worauf sie ziele. Tom aber wusste genau, woher der Wind wehte, so kam er der mutmaßlich nächsten Wendung zuvor.
»Ein paar von uns haben die Köpfe unter die Pumpe gehalten – meiner ist noch nass, sieh!«
Tante Polly empfand es sehr unangenehm, dass sie diesen belastenden Beweis übersehen und sich so im Voraus aus dem Feld hatte schlagen lassen. Ihr kam eine neue Eingebung.
»Tom, du hast doch wohl nicht deinen Hemdkragen abnehmen müssen, den ich dir angenäht habe, um dir auf den Kopf pumpen zu lassen, oder? Knöpf doch mal deine Jacke auf!«
Aus Toms Antlitz war jede Spur von Sorge verschwunden. Er öffnete die Jacke, der Kragen war fest und sicher angenäht.
»Dass dich! Na, mach dich fort. Ich hätte Gift drauf genommen, dass du heute Mittag schwimmen gegangen bist. Wollen’s gut sein lassen. Dir geht’s diesmal wie der verbrühten Katze, du bist besser, als du aussiehst – aber nur diesmal, Tom, nur diesmal!«
Halb war’s ihr leid, dass alle ihre angewandte Schlauheit so ganz umsonst gewesen, und halb freute sie sich, dass Tom doch einmal wenigstens gleichsam unversehens in den Gehorsam hineingestolpert war.
Da sagte Sidney:
»Ja aber, Tante, hast du denn den Kragen mit schwarzem Zwirn aufgenäht?«
»Schwarz? Nein, er war weiß, soviel ich mich erinnere, Tom!«
Tom aber wartete das Ende der Unterredung nicht ab. Wie der Wind war er an der Tür, rief beim Abgehen Sid noch ein freundschaftliches »wart, das sollst du mir büßen« zu und war verschwunden.
An sicherem Ort untersuchte er drauf zwei eingefädelte Nähnadeln, die er in das Futter seiner Jacke gesteckt trug, die eine mit weißem, die andre mit schwarzem Zwirn, und brummte vor sich hin:
»Sie hätt’s nie gemerkt, wenn’s der dumme Kerl, der Sid, nicht verraten hätte. Zum Kuckuck! Einmal nimmt sie weißen und einmal schwarzen Zwirn, wer kann das behalten. Aber Sid soll seine Keile schon kriegen; der soll mir nur kommen!«
Tom war mitnichten der Musterjunge seines Heimatortes – es gab aber einen solchen und Tom kannte und verabscheute ihn rechtschaffen.
Zwei Minuten später oder in noch kürzerer Zeit hatte er alle seine Sorgen vergessen. Nicht, dass sie weniger schwer waren oder weniger auf ihm lasteten als eines Mannes Sorgen auf eines Mannes Schultern, nein durchaus nicht, aber ein neues, mächtiges Interesse zog seine Gedanken ab, gerade wie ein Mann die alte Last und Not in der Erregung eines neuen Unternehmens vergessen kann. Dieses starke und mächtige Interesse war eine eben errungene, neue Methode im Pfeifen, die ihm ein befreundeter Nigger kürzlich beigebracht hatte und die er nun ungestört üben wollte. Die Kunst bestand darin, dass man einen hellen, schmetternden Vogeltriller hervorzubringen sucht, indem man in kurzen Zwischenpausen während des Pfeifens mit der Zunge den Gaumen berührt. Wer von den Lesern jemals ein Junge gewesen ist, wird genau wissen, was ich meine. Tom hatte sich mit Fleiß und Aufmerksamkeit das Ding baldigst zu Eigen gemacht und schritt nun die Hauptstraße hinunter, den Mund voll tönenden Wohllauts, die Seele voll stolzer Genugtuung. Ihm war ungefähr zumute wie einem Astronomen, der einen neuen Stern entdeckt hat, doch glaube ich kaum, dass die Freude des glücklichen Entdeckers der seinen an Größe, Tiefe und ungetrübter Reinheit gleichkommt.
Die Sommerabende waren lang. Noch war’s nicht dunkel geworden. Toms Pfeifen verstummte plötzlich. Ein Fremder stand vor ihm, ein Junge, nur vielleicht einen Zoll größer als er selbst. Die Erscheinung eines Fremden irgendwelchen Alters oder Geschlechtes war ein Ereignis in dem armen, kleinen Städtchen St. Petersburg. Und dieser Junge war noch dazu sauber gekleidet – sauber gekleidet an einem Wochentag! Das war einfach geradezu unfasslich, überwältigend! Seine Mütze war ein niedliches, zierliches Ding, seine dunkelblaue, dicht zugeknöpfte Tuchjacke nett und tadellos: auch die Hosen waren ohne Flecken. Schuhe hatte er an, Schuhe, und es war doch heute erst Freitag, noch zwei ganze Tage bis zum Sonntag! Um den Hals trug er ein seidenes Tuch geschlungen. Er hatte so etwas Zivilisiertes, so etwas Städtisches an sich, das Tom in die innerste Seele schnitt. Je mehr er dieses Wunder von Eleganz anstarrte, je mehr er die Nase rümpfte über den ›erbärmlichen Schwindel‹, wie er sich innerlich ausdrückte, desto schäbiger und ruppiger dünkte ihm seine eigene Ausstattung. Keiner der Jungen sprach. Wenn der eine sich bewegte, bewegte sich auch der andere, aber immer nur seitwärts im Kreis herum. So standen sie einander gegenüber, Angesicht zu Angesicht, Auge in Auge. Schließlich sagt Tom:
»Ich kann dich unterkriegen!«
»Probier’s einmal!«
»N – ja, ich kann.«
»Nein, du kannst nicht.«
»Und doch!«
»Und doch nicht!«
»Ich kann’s.«
»Du kannst’s nicht.«
»Kann’s.«
»Kannst’s nicht.«
Ungemütliche Pause. Dann fängt Tom wieder an:
»Wie heißt du?«
»Geht dich nichts an.«
»Will dir schon zeigen, dass mich’s angeht.«
»Nun, so zeig’s doch.«
»Wenn du noch viel sagst, tu ich’s.«
»Viel – viel – viel! Da! Nun komm ran!«
»Ach, du hältst dich wohl für furchtbar gescheit, gelt du? Du Putzaff’! Ich könnt’ dich ja unterkriegen mit einer Hand auf den Rücken gebunden – wenn ich nur wollt’!«
»Na, warum tust du’s denn nicht? Du sagst’s doch immer nur!«
»Wart, ich tu’s, wenn du dich mausig machst!«
»Ja ja, sagen kann das jeder, aber tun – tun ist was andres.«
»Aff’ du! Gelt du meinst, du seist was rechtes? – Puh, was für ein Hut!«
»Guck woanders hin, wenn er dir nicht gefällt. Schlag ihn doch runter! Der aber, der’s tut, wird den Himmel für ’ne Bassgeig’ ansehen!«
»Lügner, Prahlhans!«
»Selber!«
»Maulheld! Gelt du willst dir die Hände schonen?«
»Oh – geh heim!«
»Wart, wenn du noch mehr von deinem Blödsinn verzapfst, so nehm ich einen Stein und schmeiß ihn dir an deinem Kopf entzwei.«
»Ei, natürlich – schmeiß nur!«
»Ja, ich tu’s!«
»Na, warum denn nicht gleich? Warum wartest du denn noch? Warum tust du’s nicht? Ätsch, du hast Angst!«
»Ich hab keine Angst.«
»Doch, doch!«
»Nein, ich hab keine.«
»Du hast welche!«
Erneute Pause, verstärktes Anstarren und langsames Umkreisen. Plötzlich stehen sie Schulter an Schulter. Tom sagt:
»Mach dich weg von hier!«
»Mach dich selber weg!«
»Ich nicht!«
»Ich gewiss nicht!«
So stehen sie nun fest gegeneinandergepresst, jeder als Stütze ein Bein im Winkel vor sich gegen den Boden stemmend, und schieben, stoßen und drängen sich gegenseitig mit aller Gewalt, einander mit wutschnaubenden, hasserfüllten Augen anstarrend. Keiner aber vermag dem andern einen Vorteil abzugewinnen. Nachdem sie so schweigend gerungen, bis beide ganz heiß und glühendrot geworden, lassen sie wie auf Verabredung langsam und vorsichtig nach und Tom sagt:
»Du bist ein Feigling und ein Aff ’ dazu. Ich sag’s meinem großen Bruder, der haut dich mit seinem kleinen Finger krumm und lahm, wart nur!«
»Was liegt mir an deinem großen Bruder! Meiner ist noch viel größer, wenn der ihn nur anbläst, fliegt er über den Zaun, ohne dass er weiß wie!« (Beide Brüder existierten nur in der Einbildung.)
»Das ist gelogen!«
»Was weißt denn du?«
Tom zieht nun mit seiner großen Zehe eine Linie in den Staub und sagt:
»Da spring rüber und ich hau dich, dass du deinen Vater nicht von einem Kirchturm unterscheiden kannst!«
Der neue Junge springt sofort ohne sich zu besinnen hinüber und ruft:
»Jetzt komm endlich ran und tu’s und hau, aber prahl nicht länger!«
»Reiz mich nicht, nimm dich in Acht!«
»Na, nun mach aber, jetzt bin ich’s müde! Warum kommst du nicht!«
»Weiß Gott, jetzt tu ich’s für zwei Cents!«
Flink zieht der fremde Junge zwei Cents aus der Tasche und hält sie Tom herausfordernd unter die Nase. Tom schlägt sie zu Boden. Im nächsten Moment wälzen sich die Jungen fest umschlungen im Staub, krallen einander wie Katzen, reißen und zerren sich an den Haaren und Kleidern, bläuen und zerkratzen sich die Gesichter und Nasen und bedecken sich mit Schmutz und Ruhm. Nach ein paar Minuten etwa nimmt der sich wälzende Klumpen Gestalt an, und in dem Staub des Kampfes wird Tom sichtbar, der rittlings auf dem neuen Jungen sitzt und denselben mit den Fäusten bearbeitet.
»Schrei ›genug‹«, mahnt er.
Der Junge ringt nur stumm, sich zu befreien, er weint vor Zorn und Wut.
»Schrei ›genug‹«, mahnt Tom noch einmal und drischt lustig weiter.
Endlich stößt der Fremde ein halb ersticktes ›genug‹ hervor, Tom lässt ihn alsbald los und sagt: »Jetzt hast du’s, das nächste Mal pass auf, mit wem du anbindest!«
Der fremde Junge rannte heulend davon, sich den Staub von den Kleidern klopfend. Gelegentlich sah er sich um, ballte wütend die Faust und drohte, was er Tom alles tun wolle, »wenn er ihn wieder erwische«. Tom antwortete darauf nur mit Hohngelächter und machte sich wonnetrunken ob der vollbrachten Heldentat in entgegengesetzter Richtung auf. Sobald er aber den Rücken gewandt hatte, hob der besiegte Junge einen Stein, schleuderte ihn Tom nach und traf ihn gerade zwischen den Schultern, dann gab er schleunigst Fersengeld und lief davon wie ein Hase. Tom wandte sich und setzte hinter dem Verräter her bis zu dessen Haus, wodurch er herausfand, wo dieser wohnte. Er pflanzte sich vor das Gitter hin und forderte den Feind auf, herauszukommen und den Streit aufzunehmen, der aber weigerte sich und schnitt ihm nur Grimassen durch das Fenster. Endlich kam die Mutter des Feindes zum Vorschein, schalt Tom einen bösen, ungezogenen, gemeinen Buben und hieß ihn sich fortmachen. Tom trollte sich also, brummte aber, er wollte es dem Affen schon noch zeigen.
Erst sehr spät kam er nach Hause, und als er vorsichtig zum Fenster hineinklettern wollte, stieß er auf einen Hinterhalt in Gestalt der Tante. Als diese dann den Zustand seiner Kleider gewahrte, gedieh ihr Entschluss, seinen freien Sonnabend in einen Sträflingstag bei harter Arbeit zu verwandeln, zu eiserner Festigkeit.
Zweites Kapitel
Der Sonnabendmorgen tagte, die ganze sommerliche Welt draußen war sonnig und klar, sprudelnd von Leben und Bewegung. In jedem Herzen schien’s zu klingen und zu singen, und wenn das Herz jung war, trat der Klang unversehens auf die Lippen. Freude und Lust malte sich in jedem Antlitz, jeder Schritt war beflügelt. Die Akazien blühten und erfüllten mit ihrem köstlichen Duft rings alle Lüfte.
Tom erschien auf der Bildfläche mit einem Eimer voll Tünche und einem langstieligen Pinsel. Er stand vor dem Zaun, besah sich das zukünftige Feld seiner Tätigkeit, und es war ihm, als schwände mit einem Schlag alle Freude aus der Natur. Eine tiefe Schwermut bemächtigte sich seines ahnungsvollen Geistes. Dreißig Meter lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun! Das Leben schien ihm öde, das Dasein eine Last. Seufzend tauchte er den Pinsel ein und fuhr damit über die oberste Planke, wiederholte das Manöver einmal und noch einmal. Dann verglich er die unbedeutende übertünchte Strecke mit der Riesenausdehnung des noch ungetünchten Zauns und ließ sich entmutigt auf ein paar knorrigen Baumwurzeln nieder. Jim, der kleine Nigger, trat singend und springend aus dem Hoftor mit einem Holzeimer in der Hand. Wasser an der Dorfpumpe holen zu müssen war Tom bis jetzt immer gründlich verhasst gewesen, in diesem Augenblick dünkte es ihm die höchste Wonne. Er erinnerte sich, dass man dort immer Gesellschaft traf; Weiße, Mulatten und Nigger-Jungen und Mädchen waren da stets zu finden, die warteten, bis die Reihe an sie kam, und sich inzwischen ausruhten, mit allerlei handelten oder tauschten, sich zankten, rauften, prügelten und dergleichen Kurzweil trieben. Auch durfte man Jim mit seinem Eimer Wasser nie vor Ablauf einer Stunde zurück erwarten, obgleich die Pumpe kaum einige hundert Schritte vom Haus entfernt war, und selbst dann musste gewöhnlich noch nach ihm geschickt werden. Ruft also Tom:
»Hör, Jim, ich will das Wasser holen, streich du hier ein bisschen an.«
Jim schüttelte den Dickkopf und sagte:
»Nix das können, junge Herr Tom. Alte Tante sagen, Jim sollen nix tun andres als Wasser holen, sollen ja nix anstreichen. Sie sagen, junge Herr Tom wohl werden fragen Jim, ob er wollen anstreichen, aber er nix sollen es tun – ja nix sollen es tun.«
»Ach was, Jim, lass dir nichts weismachen, so redet sie immer. Her mit dem Eimer, ich bin gleich wieder da. Sie merkt’s noch gar nicht.«
»Jim sein so bange, er’s nix wollen tun. Alte Tante sagen, sie ihm reißen Kopf ab, wenn er’s tun.«
»Sie! Oh herrjemine, die kann ja gar niemand ordentlich durchhauen – die fährt einem ja nur mit der Hand über den Kopf, als ob sie streicheln wollte, und ich möcht wissen, wer sich daraus was macht. Ja, schwatzen tut sie von durchhauen und allem, aber schwatzen tut nicht weh – das heißt, so lang sie nicht weint dazu. Jim, da, ich schenk dir auch ’ne große Murmel – da und noch ’nen Gummi dazu!«
Jim schwankte.
»’nen Gummi, Jim, und was für ein Stück, sieh mal her!«
»Oh, du meine alles! Sein das prachtvoll Stück Gummi. Aber, junge Herr Tom, Jim sein so ganz furchtbar bange vor alte Tante!«
Jim aber war auch nur ein schwacher Mensch – diese Versuchung erwies sich als zu stark für ihn. Er stellte seinen Eimer hin und streckte die Hand nach dem verlockenden Gummi aus. Im nächsten Moment flog er jedoch laut aufheulend samt seinem Eimer die Straße hinunter, Tom tünchte mit Todesverachtung drauf los und Tante Polly zog sich stolz vom Schlachtfeld zurück, Pantoffel in der Hand, Triumph im Auge.
Toms Eifer hielt nicht lange an. Ihm fiel all das Schöne ein, das er für diesen Tag geplant, und sein Kummer wuchs immer mehr. Bald würden sie vorüberschwärmen, die glücklichen Jungen, die heute frei waren, auf die Berge, in den Wald, zum Fluss, überall hin, wo’s schön und herrlich war. Und wie würden sie ihn höhnen und auslachen und verspotten, dass er dableiben und arbeiten musste – schon der Gedanke allein brannte ihn wie Feuer. Er leerte seine Taschen und musterte seine weltlichen Güter – alte Federn, Glas- und Steinkugeln, Marken und sonst allerlei Kram. Da war wohl genug, um sich dafür einen Arbeitstausch zu verschaffen, aber keineswegs genug, um sich auch nur eine knappe halbe Stunde voller Freiheit zu erkaufen. Seufzend wanderten die beschränkten Mittel wieder in die Tasche zurück, und Tom musste wohl oder übel die Idee fahren lassen, einen oder den andern der Jungen zur Beihilfe zu bestechen. In diesem dunkeln, hoffnungslosen Moment kam ihm eine Eingebung! Eine große, eine herrliche Eingebung! Er nahm seinen Pinsel wieder auf und machte sich still und emsig an die Arbeit. Da tauchte Ben Rogers in der Entfernung auf, Ben Rogers, dessen Spott er von allen gerade am meisten gefürchtet hatte. Bens Gang, als er so daherkam, war ein springender, hüpfender kurzer Trab, Beweis genug, dass sein Herz leicht und seine Erwartungen hoch gespannt waren. Er biss lustig in einen Apfel und ließ dazu in kurzen Zwischenpausen ein langes, melodisches Geheul ertönen, dem allemal ein tiefes gezogenes ding – dong – dang, ding – dong – dang folgte. Er stellte nämlich einen Dampfer vor. Als er sich Tom näherte, gab er Halb-Dampf, hielt sich in der Mitte der Straße, wandte sich stark nach Steuerbord und glitt drauf in stolzem Bogen dem Ufer zu, mit allem Aufwand von Pomp und Umständlichkeit, denn er stellte nichts Geringeres vor als den ›Großen Missouri‹ mit neun Fuß Tiefgang. Er war Schiff, Kapitän, Mannschaft, Dampfmaschine, Glocke, alles in allem, stand also auf seiner eigenen Schiffsbrücke, erteilte Befehle und führte sie aus.
»Halt, stoppen! Klinge-linge-ling.« Der Hauptweg war zu Ende und der Dampfer wandte sich langsam dem Seitenweg zu. »Wenden! Klingelingeling!« Steif ließ er die Arme an den Seiten niederfallen. »Wenden Steuerbord! Klingelingeling! Tschu! tsch-tschu-u-tschu!«
Nun beschrieb der rechte Arm große Kreise, denn er stellte ein vierzig Fuß großes Rad vor. »Zurück, Backbord! Klingelingeling! Tschu-tsch-tschu-u-sch!« Der linke Arm begann nun Kreise zu beschreiben.
»Steuerbord stoppen! Lustig, Jungens! Anker auf – nieder! Klingeling! Tsch-tschuu-tschtu! Los! Maschine stoppen! He, Sie da! Scht-sch-tscht!« (Ausströmen des Dampfes.)
Tom tünchte währenddessen und ließ den Dampfer Dampfer sein. Ben starrte ihn einen Augenblick an und grinste dann:
»Hihi! Festgenagelt – äh?«
Keine Antwort. Tom schien seinen letzten Strich mit dem Auge eines Künstlers zu prüfen, dann fuhr er zart mit dem Pinsel noch einmal drüber und übersah das Resultat in derselben kritischen Weise wie zuvor. Ben marschierte nun neben ihm auf. Toms Mund wässerte nach dem Apfel, er hielt sich aber tapfer an die Arbeit. Sagt Ben:
»Hallo, alter Junge, Strafarbeit, ja?«
»Ach, du bist’s, Ben, ich hab gar nicht aufgepasst!«
»Hör du, ich geh schwimmen, willst du vielleicht mit? Aber gelt, du arbeitest lieber, natürlich, du bleibst viel lieber da, gelt?«
Tom maß ihn erstaunt von oben bis unten.
»Was nennst du eigentlich arbeiten?«
»W-was? Ist das keine Arbeit?«
Tom tauchte seinen Pinsel wieder ein und bemerkte gleichgültig:
»Vielleicht – vielleicht auch nicht! Ich weiß nur so viel, dass das dem Tom Sawyer passt.«
»Na, du willst mir doch nicht weismachen, dass du’s zum Vergnügen tust?«
Der Pinsel strich und strich.
»Zum Vergnügen? Na, seh nicht ein, warum nicht. Kann unsereiner denn alle Tag ’nen Zaun anstreichen?«
Das warf nun ein neues Licht auf die Sache. Ben überlegte und knupperte an seinem Apfel. Tom fuhr sacht mit seinem Pinsel hin und her, trat dann zurück, um die Wirkung zu prüfen, besserte hie und da noch etwas nach, prüfte wieder, alles ohne sich im Geringsten um Ben zu kümmern. Dieser verfolgte jede Bewegung, eifriger und eifriger mit steigendem Interesse. Sagt er plötzlich:
»Du, Tom, lass mich ein bisschen streichen!«
Tom überlegte, schien nachgeben zu wollen, gab aber diese Absicht wieder auf: »Nein, nein, das würde nicht gehen, Ben, wahrhaftig nicht. Weißt du, Tante Polly nimmt’s besonders genau mit diesem Zaun, so dicht bei der Straße, siehst du. Ja, wenn’s irgendwo dahinten wär, da läg nichts dran – mir nicht und ihr nicht – so aber! Ja, sie nimmt’s ganz ungeheuer genau mit diesem Zaun, der muss ganz besonders vorsichtig gestrichen werden – einer von hundert Jungen vielleicht, oder noch weniger, kann’s so machen, wie’s gemacht werden muss.«
»Nein, wirklich? Na komm, Tom, lass mich’s probieren, nur ein ganz klein bisschen. Ich ließe dich auch dran, Tom, wenn ich’s zu tun hätte!«
»Ben, wahrhaftig, ich tät’s ja gern, aber Tante Polly – Jim hat’s tun wollen und Sid, aber die haben’s beide nicht gedurft. Siehst du nicht, wie ich in der Klemme stecke? Wenn du nun anstreichst und ’s passiert was und der Zaun ist verdorben, dann –«
»Ach, Unsinn, ich will’s schon recht machen. Na, gib her – wart, du kriegst auch den Rest von meinem Apfel; ’s ist freilich nur noch der Butzen, aber etwas Fleisch sitzt doch noch drum.«
»Na, denn los! Nein, Ben, doch nicht, ich hab Angst, du –«
»Da hast du noch ’nen ganzen Apfel dazu!«
Tom gab nun den Pinsel ab, Widerstreben im Antlitz, Freude im Herzen. Und während der frühere Dampfer ›Großer Missouri‹ im Schweiße seines Angesichts drauflos strich, saß der zurückgetretene Künstler auf einem Fässchen im Schatten dicht dabei, baumelte mit den Beinen, verschlang seinen Apfel und brütete über dem Gedanken, wie er noch mehr Opfer in sein Netz zöge. An Material dazu war kein Mangel. Jungen kamen in Menge vorüber. Sie kamen, um zu spotten, und blieben, um zu tünchen! Als Ben müde war, hatte Tom schon Kontrakt gemacht mit Billy Fisher, der ihm einen fast neuen, nur wenig geflickten Drachen bot. Dann trat Johnny Miller gegen eine tote Ratte ein, die an einer Schnur zum Hinundherschwingen befestigt war und so weiter und so weiter, Stunde um Stunde. Und als der Nachmittag zur Hälfte verstrichen, war aus Tom, dem mit Armut geschlagenen Jungen mit leeren Taschen und leeren Händen, ein im Reichtum förmlich schwelgender Glücklicher geworden. Er besaß außer den Dingen, die ich oben angeführt, noch zwölf Steinkugeln, eine freilich schon etwas stark geschädigte Mundharmonika, ein Stück blaues Glas, um die Welt dadurch zu betrachten, ein halbes Blasrohr, einen alten Schlüssel und nichts damit aufzuschließen, ein Stück Kreide, einen halb zerbrochenen Glasstöpsel von einer Wasserflasche, einen Bleisoldaten, ein Stück Seil, sechs Zündhütchen, ein junges Kätzchen mit nur einem Auge, einen alten messingenen Türgriff, ein Hundehalsband ohne Hund, eine Messerklinge, vier Orangenschalen und ein altes, wackeliges Stück Fensterrahmen. Dazu war er lustig und guter Dinge, brauchte sich gar nicht weiter anzustrengen die ganze Zeit über und hatte mehr Gesellschaft beinahe, als ihm lieb war. Der Zaun wurde nicht weniger als dreimal vollständig überpinselt, und wenn die Tünche im Eimer nicht ausgegangen wäre, hätte er zum Schluss noch jeden einzelnen Jungen des Dorfes bankrott gemacht.
Unserm Tom kam die Welt gar nicht mehr so traurig und öde vor. Ohne es zu wissen hatte er ein tief in der menschlichen Natur wurzelndes Gesetz entdeckt, die Triebfeder zu vielen, vielen Handlungen. Um das Begehren eines Menschen, sei er nun erwachsen oder nicht – das Alter macht in dem Fall keinen Unterschied – also, um eines Menschen Begehren nach irgendetwas zu erwecken, braucht man ihm nur das Erlangen dieses ›etwas‹ schwierig erscheinen zu lassen. Wäre Tom ein gewiegter, ein großer Philosoph gewesen, wie zum Beispiel der Schreiber dieses Buches, er hätte daraus gelernt, wie der Begriff von Arbeit einfach darin besteht, dass man etwas tun muss, dass dagegen Vergnügen das ist, was man freiwillig tut. Er würde verstanden haben, warum künstliche Blumen machen oder in einer Tretmühle gehen ›Arbeit‹ heißt, während Kegel schieben im Schweiße des Angesichts oder den Montblanc erklettern lediglich als Vergnügen gilt. Ja, ja, wer erklärt diese Widersprüche in der menschlichen Natur!
Drittes Kapitel
Tom erschien vor Tante Polly, die am offenen Fenster eines Hinterzimmers saß, das Schlaf-, Wohn-, Esszimmer, Bibliothek, alles in sich vereinigte. Die balsamische Sommerluft, die friedliche Ruhe, der Blumenduft, das einschläfernde Summen der Bienen, alles hatte seine Wirkung auf sie ausgeübt – sie war über ihrem Strickstrumpf eingenickt in Gesellschaft der Katze, die auf ihrem Schoß friedlich schlummerte. Die Brille war zur Sicherheit ganz auf den alten, grauen Kopf geschoben. Sie war fest überzeugt gewesen, dass Tom längst durchgebrannt sei, und wunderte sich nun nicht wenig, als er sich jetzt so furchtlos ihrer Macht überlieferte.
»Darf ich jetzt gehen und spielen, Tante?«, fragte er.
»Was – schon? Ei, wie weit bist du denn?«
»Fertig, Tante.«
»Tom, schwindle nicht, du weißt, das kann ich nicht vertragen.«
»Gewiss und wahrhaftig, Tante, ich bin fertig.«
Tante Polly schien nur wenig Zutrauen zu der Angabe zu hegen, denn sie erhob sich, um selbst nachzusehen; sie wäre froh und dankbar gewesen, hätte sie nur zwanzig Prozent von Toms Aussage bestätigt gefunden. Als sie aber nun den ganzen Zaun getüncht fand und nicht nur so einmal leicht überstrichen, sondern sorgsam mit einer festen, tadellosen Lage Tünche versehen, da kannte ihr Erstaunen, ihre freudige Verund Bewunderung keine Grenzen.
»Na, so was!«, stieß sie fast atemlos hervor. »Arbeiten kannst du, wenn du willst, Tom, das muss dir dein Feind lassen. Selten genug freilich willst du einmal«, schwächte sie ihr Kompliment ab. »Aber nun geh und spiel, mach dich flink fort. Dass du mir aber vor Ablauf einer Woche wiederkommst, hörst du, sonst gerb ich dir das Fell doch noch durch!«
Sie war aber so gerührt von seiner Heldentat, dass sie ihn zuerst noch mit in die Speisekammer nahm und einen herrlichen, dicken, rotbackigen Apfel auslas, den sie ihm einhändigte, daran den salbungsvollen Hinweis knüpfend, wie Verdienst und ehrliche Anstrengung den Genuss einer Gabe erhöhe, die man als Lohn der Tugend erworben, nicht durch sündige Tücke. Und während sie die Predigt mit einer ebenso passend als glücklich gewählten Schriftstelle schloss, hatte Tom hinterrücks ein Stückchen Kuchen stibitzt, um sich den Lohn der Tugend wie die Errungenschaft sündiger Tücke ganz gleich gut schmecken zu lassen.
Dann schlüpfte er hinaus und sah gerade, wie Sid die Außentreppe, die zu dem Hinterzimmer des zweiten Stocks führte, hinaufhuschte. Erdklumpen waren zur Hand und im Moment war die Luft voll davon. Sie flogen um Sid wie ein Hagelwetter, und ehe noch Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammelte oder zu Hilfe kommen konnte, hatten sechs oder sieben ihr Ziel getroffen, Sid brüllte und Tom war über den Zaun gesetzt und verschwunden. Es gab freilich auch ein Tor, aber für gewöhnlich konnte es Tom aus Mangel an Zeit nicht benutzen. Nun hatte seine Seele Ruhe, jetzt hatte er abgerechnet mit Sid und ihm die Verräterei mit dem schwarzen Zwirn heimgezahlt. Der würde ihn nicht so bald wieder in Ungelegenheiten zu bringen wagen!
Tom schlich auf Umwegen hinter dem Stall um Haus und Hof herum, bis er außer dem Bereich der Gefangennahme und Abstrafung war, dann setzte er sich eiligst nach dem Hauptplatz des Dorfes in Trab, wo der Verabredung gemäß zwei feindliche Heere sich eine Schlacht liefern sollten. Tom war General der einen Armee, Joe Harper, sein Busenfreund, General der zweiten. Die beiden ruhmgekrönten, großen Anführer ließen sich aber nicht zum Fechten in Person herbei; bewahre, ganz nach berühmten Mustern sahen sie nur von ferne zu, von irgendeiner Erhöhung herab, und leiteten die Bewegungen der kämpfenden Heere durch Befehle, welche Adjutanten überbringen mussten. Nach langem, heißem Kampf trug Toms Schar den Sieg davon. Nun wurden die Toten gezählt, Gefangene ausgetauscht, die Bedingungen zum nächsten Streit vereinbart und der Tag für die daraus notwendig sich ergebende Schlacht festgesetzt, die Armeen lösten sich auf und Tom marschierte allein heimwärts.
Als er am Haus des Bürgermeisters vorüberkam, sah er ein fremdes kleines Mädchen im Garten, ein liebliches, zartes, blauäugiges Geschöpf mit langen, gelben, in zwei dicke Schwänze geflochtenen Haaren, weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmgekrönte Held fiel ohne Schuss und Streich. Eine gewisse Amy Lawrence verschwand aus seinem Herzen, ohne auch nur einen Schatten ihrer selbst zurückzulassen. Tom hatte seine Liebe zu besagter Amy für verzehrende Feuersglut gehalten, und nun war es nur noch ein leise flackerndes, verlöschendes Flämmchen. Monatelang hatte er um sie geworben, vor einer Woche erst hatte sie ihm ihre Gegenliebe gestanden, sieben Tage lang war er der stolzeste, glücklichste Junge des Städtchens gewesen und jetzt – im Umdrehen hatte sie sich empfohlen aus seinem Herzen, wie irgendein fremder Besuch, dessen Zeit um ist.
Mit verstohlenen Blicken verfolgte Tom den neu auftauchenden Engel, bis er bemerkte, dass sie ihn entdeckt hatte. Jetzt tat er, als ob er sie gar nicht sähe, und begann nach echter Jungenart, ›sich zu zeigen‹, in der Absicht, ihre Bewunderung zu erringen. Eine Zeit lang trieb er es so fort, aber mitten in irgendeiner halsbrecherischen, gymnastischen Leistung schielte er seitwärts und bemerkte, dass die Holde sich dem Haus zuwandte. Er brach ab und sprang auf den Zaun zu, voller Bedauern und in der Hoffnung, dass sie doch noch ein wenig länger verweilen werde. Einen Moment blieb sie auf den Stufen stehen, näherte sich dann aber schnell der Tür. Tom stieß einen schweren, schallenden Seufzer aus, als ihr Fuß die Schwelle berührte, im selben Moment aber erhellte sich sein melancholisches Antlitz – sie hatte ein Stiefmütterchen über den Zaun geworfen im Augenblick, da sie verschwand. Der Junge rannte drauf los, blieb aber einen oder zwei Fuß von der Blume entfernt stehen, beschattete die Augen mit der Hand und tat, als habe er, weit da unten in der Straße, etwas von großem Interesse entdeckt. Gleich danach raffte er einen Strohhalm vom Boden auf, um ihn auf der Nase zu balancieren, indem er den Kopf weit zurück warf, und als er sich dabei hin und her bewegte, rückte er der Blume immer näher. Schließlich berührte er sie mit seinem nackten Fuß, seine geschmeidigen Zehen umschlossen dieselbe, auf einem Bein hüpfte er fort mit dem eroberten Schatz und verschwand um die nächste Ecke. Aber nur für eine Minute – nur bis er die Blume an seinem Herzen geborgen hatte oder auch an seinem Magen vielleicht – Tom war nicht sehr bewandert in der Anatomie und jedenfalls nicht allzu kritisch.
Jetzt kehrte er zu seinem früheren Standort zurück und trieb sich am Zaun herum, bis die Nacht hereinbrach, immer von Zeit zu Zeit seine Kunststücke loslassend. Die blonde Schöne aber zeigte sich nicht wieder, und Tom tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie sicher hinter irgendeinem der Fenster gestanden habe und seine Aufmerksamkeiten also nicht auf dürren Boden gefallen seien. Endlich bequemte er sich widerstrebend zum Abzug, Kopf und Sinn voll wunderbarer Visionen.
Während des ganzen Abendessens war er in solch gehobener Stimmung, dass seine Tante nicht klug daraus wurde, »was zum Kuckuck in den Jungen gefahren sei!« Den Ausputzer, den er für Sids Beschießung mit Erdklumpen erhielt, nahm er mit Lammsgeduld entgegen und schüttelte ihn ebenso schnell wieder ab. Er probierte, der Tante vor der Nase weg Zucker zu stibitzen, und kriegte dafür ordentlich auf die Pfoten. Vorwurfsvoll meinte er:
»Tante, du klopfst doch den Sid nicht, wenn er Zucker nascht.«
»Der quält mich auch nicht so wie du. Was, ei wenn ich dir nicht aufpasste, du stecktest den ganzen Tag in der Zuckerdose!«
Gleich danach wollte sie in der Küche etwas holen und ging hinaus. Sid, im Gefühl seiner Unstrafbarkeit, langte nach der Zuckerdose mit einer Überhebung, die Tom unerträglich dünkte. Aber weh! – Sids Hand zitterte, die Dose entglitt den haltenden Fingern, fiel zu Boden und zerbrach. Tom triumphierte – triumphierte so, dass er sich bezwang, seine Zunge im Zaum hielt und atemlos, erwartungsvoll schwieg. Er gelobte sich innerlich, kein Wort zu sagen, selbst wenn die Tante wieder hereinkäme, sondern sich ganz still zu verhalten, bis sie frage, wer das Unheil angestellt, dann würde er berichten, und welche Wonne, wenn der geliebte ›Musterjunge‹ auch einmal was Ordentliches abkriegte. Er platzte beinahe vor Ungeduld und konnte sich kaum auf dem Stuhl halten, als nun die alte Dame hereintrat und sprachlos, Wutblitze unter ihrer Brille hervorschleudernd, vor den Trümmern stand. »Jetzt kommt’s, jetzt geht’s los«, frohlockte er. Im nächsten Moment fühlte er sich gepackt, zu Boden geworfen und schon hob sich die strafende Faust zum zweiten und dritten Mal über seinem südlichen Rückenende, ehe er sprachlos vor Überraschung und Entrüstung Worte fand:
»Lass los, Tante, was haust du mich denn? Sid hat’s ja getan!«
Tante Pollys erhobene Faust sank noch einmal mechanisch mit klatschendem Schlag, dann hielt sie ein, erstaunt, verwirrt, während Tom, eines Ausbruchs tröstenden, selbstanklagenden Mitleids gewärtig, vorwurfsvoll zu ihr emporstarrte. Aber alles, was sie sagte, als sie zu Atem kam, war:
»Na, Gott weiß, an dir ist kein Schlag verloren, das ist mein Trost. Nimm’s einstweilen als Abschlagszahlung, hörst du!«
Danach aber empfand sie doch Gewissensbisse, und ihr gutes, weiches Herz sehnte sich, dem armen, unschuldig Gezüchtigten ein liebevolles Wort zu sagen. Aus Rücksichten der Disziplin aber enthielt sie sich jeder Zusprache, die ihr doch nur als ein Eingeständnis des Unrechts ausgelegt worden wäre. So schwieg sie denn und ging bekümmerten Herzens ihrer Arbeit nach. Tom schmollte in einem Winkel und steigerte seine Leiden ins Unendliche. Er wusste, dass die Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, und dies Bewusstsein tat ihm wohl bis in die kleine Zehe. Er wollte sich um niemanden, niemanden mehr kümmern. Er fühlte, wie ihn von Zeit zu Zeit ein sehnsüchtiger, tränenverschleierter Blick traf, er aber tat, als merke er nichts und brüte nur stumm vor sich hin. Er sah sich krank, sterbend auf seinem Bett hingestreckt. Die Tante beugte sich über ihn und flehte händeringend um ein einziges kleines, armes Wort der Vergebung. Er aber wandte das Gesicht ab, stumm, tränenlos und starb – starb und das Wort der Vergebung blieb ungesagt. Was würde sie dann tun? – Oder er sah sich, wie man ihn vom Fluss zurückbrachte, tot, mit triefenden Haaren, blassem, stillem Antlitz, endlich Ruhe und Frieden im armen, gequälten Herzen – für immer. Wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen stromweise fließen und sie Gott anrufen, ihren armen Jungen wieder lebendig zu machen, den sie auch nie, nie wieder misshandeln wolle. Er aber läge da, kalt und still, ein armer Märtyrer, dessen Leiden zu Ende. – So arbeitete er sich dermaßen in Jammer und Elend hinein, dass er beinahe in Schluchzen ausgebrochen wäre und am Zurückdrängen desselben fast erstickte. Tränen standen in seinen Augen und alles erschien ihm in einem wässrigen Nebel. Wenn er mit den Augen zwinkerte, kamen die Tropfen langsam die Nase herab und träufelten von der Spitze hernieder. Dabei fühlte er sich so wohl in seinem Schmerz, dass er denselben ängstlich vor der profanen Lust, dem lärmenden Getriebe der Welt da draußen behütete. Als sein Bäschen Mary, die acht Tage auf dem Lande zu Besuch gewesen war, glückselig nach der ›langen Abwesenheit‹ zur einen Tür hereintanzte wie lauter Licht und Sonnenschein, entschlüpfte Tom in Nebel und Wolken gehüllt durch die andere. Weit in die Einsamkeit wanderte er hinweg. Ein Floß lockte ihn; er setzte sich darauf und starrte in die Wellen des Stromes. Wenn er nur auf einmal tot und ertrunken sein könnte, ohne etwas davon zu wissen, ohne erst all das viele Wasser zu schlucken! Dann dachte er an seine Blume, entnahm sie seinem Busen, verwelkt, zerknittert, und ihr Anblick erhöhte noch sein wonniges Schmerzgefühl. Ob sie ihn wohl bemitleiden würde, wenn sie es wüsste? Oder würde auch sie sich abwenden wie die übrige schnöde Welt? Wieder verlor er sich in einem Labyrinth von Träumen und erhob sich zuletzt seufzend, um in die Dunkelheit hineinzuwandern. Um zehn, halb elf schlich er die stille Straße hinunter, in der die vergötterte Unbekannte wohnte. An ihrer Tür hielt er an. Kein Laut traf sein lauschendes Ohr, nur aus einem Fenster des zweiten Stocks kam der trübe Schein eines einsamen Talglichts. War dort der geheiligte Raum, der sie umschloss? Er kletterte über den Zaun und stahl sich lautlos bis unter jenes Fenster. Voll Rührung schaute er hinan, dann streckte er sich der Länge lang auf den Boden aus, die Hände, welche die verwelkte Blume umschlossen, auf der Brust faltend. So wollte er sterben – draußen in der kalten Welt, kein Dach über seinem heimatlosen Haupt, keine Freundeshand, die ihm den Todesschweiß von der Stirn wischte, kein liebendes Antlitz, das sich mitleidsvoll über ihn beugte, wenn der letzte, große Kampf nahte. So sollte sie ihn sehen, wenn sie das Fenster öffnete, um dem jungen Morgen zuzulächeln und ach – würde sie wohl dem Toten eine Träne weihen, einen Seufzer hauchen über den leblosen stillen Rest, der alles war, was von dem frohen, jugendfrischen, vor der Zeit in der Wurzel geknickten, jungen Leben geblieben?
Das Fenster öffnete sich. Die schrille Stimme einer Magd entweihte die geheiligte Stille und eine Sündflut von Wasser durchtränkte die Gebeine das dahingestreckten Märtyrers.
Prustend und keuchend sprang unser Held auf und schüttelte sich heftig. Ein Wurfgeschoss durchschwirrte die Luft, untermischt mit einem halblauten Fluch, worauf ein klirrendes Splittern von Glas folgte. Eine kleine, undeutliche Gestalt kletterte eiligst über den Zaun und schoss in die Dunkelheit hinein.
Nicht lange danach, als Tom beim Schein eines Lichtstümpchens seine durchnässten Kleider besichtigte, erwachte Sid. Wenn der nun vorher die Absicht gehabt hatte, allerlei unliebsame Anspielungen zu machen, so besann er sich jetzt wohlweislich eines Besseren und hielt Frieden – es blitzte Gefahr in Toms Auge. Dieser aber kroch ins Bett ohne weitere unangenehme Förmlichkeiten wie Waschen oder Beten, wovon sich Sid im Geiste getreulich Notiz machte, und die Stille der Nacht umfing das Brüderpaar.
Viertes Kapitel
D