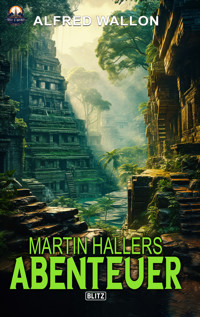
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: ONLY eBook Abenteuer
- Sprache: Deutsch
Martin Haller ist ein Forscher und Entdecker, der in den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts verschiedene Länder bereist und zusammen mit seinen beiden Freunden dort spannende Abenteuer erlebt. Seine Reisen führen ihn ins Outback von Australien, in das von Rebellionen zerrissene Mexiko und tief in unbekannte Regionen des brasilianischen Urwaldes. Die Suche nach vergessenen Städten und Relikten bringt ihn oft in gefährliche Situationen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alfred Wallon
Martin Hallers Abenteuer
Inhaltsverzeichnis
Band 1: EXPEDITION INS OUTBACK
Band 2: MONTEZUMAS GOLDSCHATZ
Band 3: DIE STADT IM URWALD
Über den Autor
Weitere Bücher des Autors
Impressum
Band 1: EXPEDITION INS OUTBACK
Wir schreiben das Jahr 1930. Die Welt steht am Rande eines neuen Krieges, und die politischen Verhältnisse werden immer undurchsichtiger. Das hindert aber viele wagemutige Forscher, Entdecker und Abenteurer nicht daran, Expeditionen in unbekannte Länder und Regionen unserer Erde zu starten.
Einer von ihnen ist Martin Haller. Zusammen mit seinem Freund und Weggefährten Peter Jacobs hat er schon zahlreiche Länder bereist und viele Abenteuer erfolgreich bestanden. Der Dritte im Bunde ist der Nigerianer Chidi, der immer dann zur Stelle ist, wenn das Schicksal seiner beiden weißen Freunde am seidenen Faden hängt.
Diesmal reisen unsere drei Freunde nach Australien. Eigentlich wollen sie einen alten Freund besuchen. Aber kurz nach ihrer Ankunft erfahren sie, dass er zusammen mit zwei Geologen zu einer Expedition ins Outback aufgebrochen ist. Martin, Peter und Chidi erkennen aber schon bald, dass ihr Freund in großen Schwierigkeiten steckt, denn es gibt zu viele Hinweise darauf, dass es gar keine Expedition war. Und schon beginnt ein weiteres gefährliches Abenteuer...
MARTIN HALLER – ENTDECKER – FORSCHER – ABENTEURER – Romane aus einer Zeit, als es noch viele unentdeckte Regionen auf der Weltkarte gab. Spannung und Abenteuer pur – geschrieben von Alfred Wallon
Erstes Kapitel: Im Hafen von Darwin
Wir hatten eine anstrengende Fahrt hinter uns, als unser Dampfer endlich den Hafen von Darwin im Nördlichen Territorium ansteuerte.
Unser Chidi fieberte förmlich danach, endlich wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen, denn gerade die letzten Tage waren alles andere als angenehm für ihn gewesen. Kurz vor der Küste war unser Schiff in einen heftigen Orkan geraten, der sämtliche Passagiere ziemlich durchgerüttelt hatte. Es war wirklich ein Wunder gewesen, dass das Schiff sonst nicht in Mitleidenschaft gezogen worden war.
Wir hatten es einzig und allein dem erfahrenen Kapitän zu verdanken, der sein Schiff sicher und zielstrebig durch die Sturmzone gesteuert hatte. Wir waren heilfroh, als dann am Morgen nach dem Sturm am Horizont endlich die Küste des nördlichen Australiens auftauchte.
Chidis verbitterte Miene änderte sich schlagartig, als ihm bewusst wurde, dass die Tage des Elends nun endlich vorbei waren. Er legte eine eigenartige Eile an den Tag und bestand darauf, sich sofort um unser Gepäck zu kümmern, damit wir als erste im Hafen von Bord gehen konnten. Ich musste unwillkürlich lächeln, als ich unserem hünenhaften Schwarzen hinterher sah, und Martin erging es genauso.
»Was meinst du, Martin?«, wandte ich mich dann an meinen Freund, während ich mit ihm oben auf dem Passagierdeck stand und beobachtete, wie das Schiff Kurs auf die Hafeneinmündung nahm. »Wird uns Neil Rogan dort drüben erwarten?«
»Ich kann es nur hoffen, Peter«, erwiderte Martin. »Ich nehme an, dass er unsere Nachricht rechtzeitig erhalten hat. Es wäre schön, ihm nach so langer Zeit gleich im Hafen die Hand schütteln zu können.«
Ich sah Martin an, wie sehr er sich auf das Wiedersehen mit Neil Rogan freute. Mir ging es ähnlich, denn wir hatten den Australier vor gut einem Jahr im südlichen Indien kennengelernt, als wir dort zusammen mit dem Maharadscha von Randapur auf einer gefährlichen Tigerjagd gewesen waren. Seit dieser Zeit wartete Rogan darauf, dass wir ihm einmal einen Besuch abstatteten, aber das Schicksal hatte es anders gewollt. Erst jetzt, nach dem Ende einer monatelangen Reise ins Innere Indiens, hatten wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt und beschlossen, uns einige ruhige Wochen zu gönnen. Was lag also näher, als Neil Rogan mitzuteilen, dass wir beschlossen hatten, ihn zu besuchen und dort eine Zeit lang zu bleiben.
Die Antwort des Australiers hatte uns noch erreicht, bevor wir an Bord des Schiffes gegangen waren. Neil hatte uns geschrieben, dass er sich schon sehr auf unsere Ankunft freue. Nun – jetzt würde er uns gleich persönlich begrüßen können.
Je näher das Schiff dem Hafen kam, umso mehr Einzelheiten konnten wir erkennen. Im Vergleich mit der Hauptstadt Sydney im südlichen Teil des noch jungen Staates Australien war Darwin eine winzige Provinz. Eine kleine Stadt, das Hinterland nur dünn besiedelt, und danach begann gleich das Niemandsland das Northern Territory, einer menschenleeren Einöde, durchzogen von trockenen Landstrichen und gefährlichen Sümpfen. Dort lebten nur die eingeborenen Stämme, teilweise in solch abgelegenen Regionen, dass sie noch nie einen Weißen zu Gesicht bekommen hatten. Vielleicht bekamen wir während unseres Aufenthalts in Darwin Gelegenheit dazu, einen Abstecher in diese Region zu machen. Wir waren ja schon lange nicht mehr in Australien gewesen, und ich kannte meinen Freund Martin nur zu gut, um zu wissen, dass er so eine einmalige Gelegenheit bestimmt nicht verstreichen ließ.
Der Hafen selbst war eher klein und wirkte irgendwie verloren. Trotzdem erkannten wir etliche Menschen am Pier, die die Ankunft des Schiffes neugierig erwarteten. In diesem Teil des Landes war das bestimmt eine mittlere Sensation. Denn das Schiff brachte Neuigkeiten aus anderen Teilen der Welt, die man hier natürlich auch erfahren wollte.
Langsam näherte sich das Schiff dem Anlegesteg. An Deck herrschte jetzt ziemliches Gedränge. Während die Besatzung ihre üblichen Routinearbeiten erledigte, kamen immer mehr Menschen an die Reling, blickten hinüber zu der wartenden Menge am Kai und suchten dort diejenigen, von denen sie schon erwartet wurden.
Auch Martin und ich versuchten, in dem Gewühl die vertraute Gestalt unseres australischen Freundes auszumachen. Aber das war vollkommen unmöglich in diesem Durcheinander.
Jetzt erschien auch Chidi an Deck. Er strahlte förmlich, als er sah, wie die Landungsbrücke angelegt wurde und die ersten Passagiere sich anschickten, das Schiff zu verlassen. Da hatte es unser schwarzer Freund natürlich besonders eilig. Wir beschlossen deshalb, ihn nicht unnötig warten zu lassen und verließen ebenfalls das Schiff.
Für manche der Passagiere gab es ein stürmisches Wiedersehen mit ihren Angehörigen, die sie wahrscheinlich eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hatten, Wir selbst hielten unentwegt Ausschau nach Neil Rogan, hofften einfach darauf, dass er uns nun endlich erspäht hatte und zu uns kam. Denn Chidis riesenhafte Gestalt war auch in diesem Gewühl einfach nicht zu übersehen. Wir bemerkten es an den Blicken einiger Neugieriger, die sich zu Recht fragten, was Chidi und uns wohl nach Darwin geführt hatte.
Aber so oft wir auch nach allen Seiten blickten und darauf warteten, ein bekanntes Gesicht zu sehen – von Neil Rogan gab es weit und breit keine Spur. Das musste aber nichts heißen. Trotz allem konnte er sich ja verspätet haben. Deshalb beschlossen wir, noch ein wenig zu warten. Er würde sicherlich schon bald auftauchen.
Ich bemerkte, dass Martin nun auch langsam ungeduldig wurde, als er zum wiederholten Mal auf seine Uhr schaute. Mehr als eine Stunde war schon vergangen, und noch immer war von Neil Rogan nichts zu sehen. Das beunruhigte uns doch ein wenig.
»Vielleicht ist ihm etwas dazwischengekommen, und er hat eine Nachricht für uns hinterlassen«, meinte Martin. »Wartet hier«, sagte er dann zu uns. »Ich werde bei der Hafenbehörde einmal kurz nachfragen.«
Ich nickte und sah Martin hinterher, wie er auf ein größeres Gebäude zuschritt, in dem sich die Hafenbehörde befand.
»Masser Rogan bestimmt gleich kommen«, meldete sich Chidi zu Wort, weil auch er unsere sorgenvollen Blicke bemerkt hatte. »Masser Jacobs und Masser Haller nur noch ein wenig warten.«
»Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, Chidi«, erwiderte ich daraufhin, spürte aber gleichzeitig ein eigenartiges Gefühl in meiner Magengegend. Ein Gefühl, das mich immer dann überfällt, wenn es Ärger gibt. Irgendwie fühlte ich, dass der Urlaub in Australien anders verlaufen sollte, als wir das geplant hatten.
Während Martin sich nach wie vor in dem Gebäude aufhielt, ließ ich meine Blicke schweifen. Natürlich in der Hoffnung, dass jetzt Neil Rogan auftauchte. Stattdessen sah ich drüben in der Nähe der Lagerhallen einen Mann mit einem Koffer in der Hand, der wohl offensichtlich auch auf jemanden wartete. Aber auch er schien versetzt worden zu sein.
Ich wollte meine Blicke schon wieder abwenden, als ich plötzlich bemerkte, dass es drüben bei den Lagerhallen Ärger zu geben schien. Plötzlich waren da einige merkwürdige Gestalten aufgetaucht, die den gut gekleideten Mann mit dem Koffer zu bedrängen schienen. Zwielichtiges Gesindel, das man wohl in jedem Hafen der Welt antrifft! Sie umkreisten den hilflos wirkenden Mann, hofften wohl, hier ein wehrloses Opfer gefunden zu haben und es ausrauben zu können. Dazu hatten sie wohl eine günstige Gelegenheit abgewartet, denn weit und breit war kein Polizist zu sehen, und die meisten Passagiere waren ohnehin schon lange weg. Also der beste Moment, das zu tun, was diese Kerle im Sinn hatten.
Chidi hatte natürlich auch bemerkt, was da drüben geschah. Ich brauchte ihm nur noch zuzunicken, denn es galt keine Zeit zu verlieren, ich hatte nämlich bemerkt, dass einer der Burschen bereits ein Messer gezogen hatte und damit versuchte, sein Opfer einzuschüchtern.
»Her mit dem Geld!«, hörte ich die krächzende Stimme des Messerhelden und vernahm das grölende Gelächter seiner Kumpane. Für die war der gut gekleidete Mann mit dem Koffer schon ein so sicheres Opfer, dass sie für einen Augenblick lang gar nicht darauf achteten, dass es da noch jemanden gab, der Zeuge dieser bevorstehenden Auseinandersetzung geworden war. Nämlich Chidi und ich. Bevor diese Lumpen so richtig begriffen hatten, was geschah, griffen wir auch schon in die Geschehnisse ein.
Bevor der Kerl mit dem Messer sein wehrloses Opfer ernsthaft verletzen konnte, hatte ich den Lumpen auch schon am Kragen gepackt und verpasste ihm einen Hieb, der ihn vor Schmerz und Überraschung laut aufschreien und zurück taumeln ließ.
Während das blitzende Messer seinen Händen entglitt, hatte Chidi auch nicht lange gefackelt und gleich zwei der zerlumpten Wegelagerer zu fassen bekommen. Chidi besaß Bärenkräfte, was die Kerle dann auch am eigenen Leibe spürten. Zwei Hiebe reichten aus, um die Diebe bewusstlos zu Boden zu schicken.
Aus den Augenwinkeln erkannte ich, dass jetzt auch Martin drüben aus dem Behördengebäude gelaufen kam. In Begleitung zweier Uniformierter, die sich wohl zu dieser Zeit dort aufgehalten hatten. Aber sie mussten nicht mehr in den Kampf eingreifen, denn Chidi und ich hatten den Kerlen eine Heidenangst eingejagt. Diejenigen, die wir nicht zu Boden geschlagen hatten, rannten was sie konnten, um sich dem Zugriff der gefürchteten Polizei zu entziehen. Was aus ihren Kumpanen wurde – darum kümmerte sich keiner von ihnen.
Chidi blickte mit rollenden Augen auf die drei auf dem Boden liegenden Burschen, die sichtlich zusammenzuckten. Sie schienen eine fürchterliche Angst vor unserem Schwarzen zu haben, denn er kam ihnen wohl vor wie der Leibhaftige persönlich. Dann waren Martin und die Polizisten auch schon zur Stelle, die sich die Kerle natürlich gleich griffen und ihnen Handschellen anlegten. Dabei gingen sie nicht gerade zimperlich zu Werk.
Erst jetzt kam ich dazu, mich dem Mann zuzuwenden, der beinahe das Opfer dieses Hafengesindels geworden wäre, wenn wir nicht im letzten Moment eingegriffen hätten. Er war immer noch kreidebleich und hatte sichtliche Mühe, die Schrecken der letzten Minuten zu verdauen. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn, und weiche Knie schien er auch zu haben.
»Vielen... vielen Dank, Gentlemen!«, stotterte er dann mühsam, während Martin nun zu uns kam. »Ich wüsste nicht, was geschehen wäre, wenn...« Wieder hielt er inne und holte Luft.
»Es ist ja noch mal gut gegangen«, meldete ich mich dann zu Wort, um dem Mann eine Atempause zu verschaffen, »Beruhigen Sie sich und vergessen Sie das Ganze so schnell wie möglich.«
Der Mann nickte heftig, wischte sich den Schweiß aus der Stirn, bevor er mich und Chidi lange ansah, Der dankbare Blick, den er Chidi zuwarf, verunsicherte unseren Schwarzen so sehr, dass er ein ganz unglückliches Gesicht machte, weil Hilfe in Not für Chidi ganz selbstverständlich war. Ich hatte Chidis Miene schon erahnt und konnte mir deshalb ein Lächeln nicht verkneifen. Genauso wie Martin, der das auch gesehen hatte.
»Trotzdem bin ich Ihnen zu großem Dank verpflichtet, meine Herren«, wiederholte der Mann aufs Neue, während die Polizisten die überführten Halunken abführten. »Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Humphrey Norman. Ich glaube mich zu erinnern, Sie an Bord des Schiffes gesehen zu haben – kurz nachdem ich an Bord gegangen bin.«
»Das ist richtig«, bestätigte ich ihm und nannte dann ebenfalls meinen Namen und die meiner Gefährten. Als Humphrey den Namen meines Freundes vernahm, leuchteten seine Augen überrascht auf. Fassungslos schaute er mich, Martin und Chidi mehrmals an, bevor er es schaffte, sich die passenden Worte zurechtzulegen.
»Das gibt es doch nicht!«, entfuhr es ihm dann. »Weiß Gott, Mr. Haller, ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Ebenso von Ihrem Freund, Mr. Jacobs, und dem treuen Chidi. Sind Sie es nicht gewesen, die erst vor kurzem Schlagzeilen in Singapore gemacht haben, weil...«
»Ja«, fiel ich dem eifrigen Norman ins Wort. »Aber eigentlich sind wir jetzt hierhergekommen, um uns von den Strapazen der letzten Monate zu erholen, Mr. Norman.«
»Das kann ich gut verstehen«, erwiderte Norman daraufhin und bestand trotzdem darauf, uns allen noch einmal die Hand für unsere tatkräftige Hilfe zu schütteln, wodurch Chidis Gesichtsausdruck sich in völlige Hilflosigkeit wandelte. »Sie würden mir eine große Freude machen, wenn ich Sie zu mir nach Hause einladen dürfte. Selbstverständlich nur, wenn ich Ihnen mit meiner Bitte nicht zur Last falle und falls Sie nicht schon etwas anderes vorhaben.«
»Eigentlich warten wir hier auf einen Freund«, erwiderte ich wahrheitsgemäß. »Aber er ist bis jetzt noch nicht eingetroffen und...«
»...eine Nachricht für sein Verspäten lag für uns auch nicht bereit«, vollendete Martin meine Gedankengänge und erklärte Chidi und mich mit diesen Worten über den Stand der Dinge auf. »Ehrlich gesagt, wissen wir nicht, ob wir hier noch länger warten sollen, Mr. Norman.«
»Dann kommen Sie doch einfach mit«, meinte Norman. »Ein Mitarbeiter meiner Firma, der mich abholen sollte, hat sich auch verspätet. Wissen Sie, hier im Northern Territory nimmt man es nicht ganz so genau mit der Zeit.« Er musste grinsen, als er das sagte, schaute aber nun doch auf seine Uhr. Bevor wir darauf etwas erwidern konnten, fuhr auch schon ein schwarzer Wagen um die Ecke, auf den Norman offensichtlich gewartet hatte.
»Wie ist es?«, fragte er uns nun noch einmal. »Machen Sie mir doch die Freude und kommen Sie mit. Selbstverständlich stelle ich Ihnen dann meinen Wagen zur Verfügung, wenn Sie Ihren Freund besuchen wollen. Das ist doch das mindeste, was ich ihnen schuldig bin.«
Martin und ich blickten uns an. Irgendwie spürten wir, dass Neil Rogan nicht mehr kommen würde, und wir fragten uns natürlich nach dem Grund. Schließlich erinnerten wir uns noch gut an seinen Brief, in dem er uns mitgeteilt hatte, wie willkommen wir ihm waren. Da lag es doch nahe, dass er uns abholen kam!
»Wir sind einverstanden, Mr. Norman«, erwiderte Martin schließlich, »Vielleicht können Sie uns auch ein wenig weiterhelfen. Wissen Sie, wir sind beunruhigt darüber, dass unser Freund nicht erschienen ist und...«
»Dafür gibt es bestimmt eine logische Erklärung«, erwiderte Humphrey Norman, um unsere Sorge zu vertreiben. Er gab dem Fahrer des Wagens, der mittlerweile ausgestiegen war und sich für die Verspätung entschuldigt hatte, einen Wink. Daraufhin beeilte sich der Mann, Mr. Normans und unsere Koffer im Gepäckraum zu verstauen. Dann mussten wir einsteigen.
Wäre es jedoch nach Chidis Willen gegangen, dann hätte er die betreffende Strecke lieber zu Fuß zurückgelegt als die Fahrt in den breiten gepolsterten Sitzen zu genießen. Unruhig rückte er hin und her, warf Martin und mir Hilfe suchende Blicke zu. Ich klopfte dem treuen Schwarzen auf die Schulter, nickte ihm aufmunternd zu, während der Wagen losfuhr und den Hafen hinter sich zurückließ.
Zu dieser Stunde konnten wir noch nicht ahnen, wie sehr sich unsere düsteren Ahnungen bewahrheiten sollten.
Zweites Kapitel: Eine böse Überraschung
Mr. Norman war wirklich ein vollendeter Gastgeber. Sofort nach unserer Ankunft in seinem Haus im historischen Stadtzentrum von Darwin beauftragte er einen seiner Bediensteten, zu der Adresse unseres Freundes zu fahren und dort in Erfahrung zu bringen, was die Gründe für Neils Verspätung waren. Schließlich musste Neil wissen, wo wir uns jetzt aufhielten.
Während Mr. Normans Angestellter unverzüglich aufbrach, erzählte er selbst ein wenig über seine Geschäfte in diesem Teil des Landes. Humphrey Norman handelte mit Opalen und seltenen Edelsteinen und hatte es mit Fleiß und Mühe geschafft, sich eine sichere Existenz aufzubauen. Natürlich mussten auch wir von unseren Erlebnissen berichten, aber ich war Martin dankbar, dass er den größten Teil der Schilderungen auf sich nahm. Denn ich ertappte mich immer wieder dabei, dass ich einen Blick aus dem Fenster warf – in der Hoffnung, dass Normans Angestellter jeden Moment zurückkam und uns über Neils Verbleib aufklärte.
Doch eine geschlagene Stunde verging, bis der Wagen endlich wieder das Tor passierte, Minuten später betrat der Angestellte das geräumige Wohnzimmer. Aber anhand seiner angespannten Miene wusste ich gleich, dass er mit unangenehmen Neuigkeiten zurückkam. Für so etwas bekommt man im Laufe der Jahre das richtige Gefühl.
Was wir dann zu hören bekamen, untermauerte meine Befürchtungen. Der Mann berichtete uns, dass Mr. Rogan schon seit längerer Zeit nicht zu Hause gewesen sei. Er habe mit einer Nachbarin gesprochen, und die wiederum habe ihm eine äußerst verwirrende Geschichte erzählt, die ihm etliches Kopfzerbrechen bereitete.
Während der Angestellte in kurzen Sätzen berichtete, was ihm die Nachbarin erzählt hatte, schauten Martin und ich uns an. Natürlich dachten wir das gleiche, und das reichte aus, um uns nicht mehr ruhig sitzen zu lassen.
»Da stimmt eine ganze Menge nicht«, sagte Martin und schaute Mr. Norman an. »Wir müssen uns sofort auf den Weg machen und mit dieser Frau sprechen. Selbstverständlich auch mit der Polizei. Neil Rogan ist kein Mann, der sang- und klanglos verschwindet, ohne dass es dafür einen plausiblen Grund gibt.«
Der Opalhändler sah ein, dass er uns nicht länger aufhalten durfte. Selbstverständlich stellte er uns einen Wagen und seinen Angestellten zur Verfügung, wofür wir ihm natürlich sehr dankbar waren. Chidi trugen wir auf, im Hause von Mr. Norman auf uns zu warten, bis wir wieder zurück waren, und dann ging es auch schon los.
Martin und ich spürten die Sorgen, die von uns Besitz ergriffen hatten. Wahrscheinlich fühlten wir beide in diesem Moment, dass es keinen erholsamen Urlaub für uns geben würde. Zumindest nicht so lange, bis wir Neil Rogan wieder gefunden hatten.
Der Angestellte brachte uns schnellstens zu der besagten Adresse, und Minuten später standen wir dann Ellen Dawson gegenüber, der Nachbarin Neil Rogans. Zuerst blickte uns die blonde, adrett gekleidete Frau misstrauisch an, als wir vor ihrer Tür standen. Aber als wir ihr dann versicherten, wir seien gute Freunde von Neil Rogan und konnten das durch seinen an uns gerichteten Brief belegen, da schwand das offensichtliche Misstrauen der Frau. Sie bat uns einzutreten.
»Gentlemen, ich mache mir große Sorgen um Neil – ich meine Mr. Rogan«, verbesserte sie sich dann rasch, was Martin und mir natürlich nicht entging. Ellen Dawson schien für Neil nicht nur nachbarliche Freundschaft zu empfinden. »Selbstverständlich habe ich nach einer gewissen Zeit die Polizei informiert, doch diese tappt nach wie vor im Dunkeln. Vielleicht haben sie die Angelegenheit auch schon längst zu den Akten gelegt und...«
Ihre Stimme brach, und Tränen zeichneten sich in ihren Augenwinkeln ab. Ein deutliches Zeichen, wie sehr Ellen Dawsons Nerven in Mitleidenschaft gezogen worden waren.
Schließlich hatte sie sich wieder gefasst und berichtete uns nun alles, was sie wusste. Sie erzählte uns von einem Auftrag, den Neil vor gut vier Wochen angenommen hatte. Es ging darum, zwei Geologen zu begleiten, die eine Expedition ins Arnhem Land geplant hatten. Martin konnte sich gut vorstellen, dass Neil eine so verlockende Aufgabe natürlich nicht zurückgewiesen hatte und teilte Ellen Dawson diese Vermutung auch mit.
»Sicher, Mr. Haller«, gab die hübsche Frau dann zu bedenken. »Aber Neil hat mir ausdrücklich versichert, dass die Expedition nicht lange dauern würde. Aber weder er noch die beiden Geologen sind jemals zurückgekehrt. Und da diese Expedition nicht ganz ungefährlich war, habe ich meine Sorgen auch der Polizei mitgeteilt. Aber diese hat mich nur vertröstet und mir klar zu machen versucht, dass eine Suche in so einem riesigen Areal unmöglich ist. Mr. Haller, Mr. Jacobs«, wandte sie sich dann an uns. »Wollen Sie mir helfen? Ich werde noch verrückt, wenn ich hier weiter ausharren und warten muss.«
»Selbstverständlich werden wir Ihnen helfen«, versicherte ihr Martin sofort. »Wir haben uns auch schon Sorgen über Neils Ausbleiben am Hafen gemacht und finden unsere Vermutungen jetzt bestätigt. Aber wenn unser Vorgehen Erfolg haben soll, dann brauchen wir noch mehr Informationen. Wissen Sie, welches Ziel genau diese Expedition hatte?«
»Warten Sie einen Augenblick, bitte«, sagte Ellen Dawson, verschwand im benachbarten Zimmer und kam dann wenige Augenblicke später mit einer Landkarte zurück, die sie vor uns ausbreitete. »Wenige Tage vor seinem Aufbruch habe ich mit Neil noch über diese Expedition gesprochen. Deshalb weiß ich auch den ungefähren Verlauf der Reise. Sehen Sie«, richtete sie dann unsere Aufmerksamkeit auf die Karte. »Die Expedition sollte dem Daly River folgen, bis weiter östlich zum Roper River. Endziel sollte die Gegend um den Mount Colton sein. Dort wollten die Geologen dann weitere Untersuchungen vornehmen. Ich weiß, das ist nicht viel, was ich Ihnen sagen kann, aber mehr hat mir Neil nicht gesagt.« Sie zuckte bedauernd die Schultern.
»Das ist trotzdem mehr, als wir uns erhofft hatten«, erwiderte Martin dann. Würden Sie uns diese Karte überlassen, Miss Dawson?« Als die junge Frau daraufhin nickte, fuhr Martin fort. »Ich verspreche Ihnen, dass wir schon morgen früh aufbrechen werden, um mit der Suche nach Neil zu beginnen. Das Northern Territory ist zwar ein großes Areal, und es wird sicherlich nicht leicht sein. Aber es ist nicht die erste Suche nach einem Vermissten, die wir unternehmen.«
Martin war optimistisch, ich jedoch weniger. Aber das behielt ich für mich, um die besorgte Frau nicht noch mehr aufzuregen. Schließlich verabschiedeten wir uns von Ellen Dawson, fuhren zurück zu Mr. Normans Haus und unterrichteten ihn davon, dass wir seine gut gemeinte Gastfreundschaft leider nur diese Nacht in Anspruch nehmen konnten, und erzählten ihm unsere Absicht, ebenfalls ins Landesinnere aufzubrechen, um nach dem Verbleib von Neil Rogan und den beiden Geologen zu forschen. Mr. Norman sagte uns seine Unterstützung zu, so gut das seine Beziehungen zuließen und versprach uns auch, für einen kundigen Führer zu sorgen, der uns auf dieser Reise begleiten sollte.
»Das Northern Territory und das Arnhem Land sind eigenartige Landstriche, Gentlemen«, klärte er uns dann auf. »Wer sich nicht auskennt, der kann schneller verloren gehen, als er sich denkt. Der Busch sieht überall gleich aus, und man kann sehr schnell die Orientierung verlieren. Ohne genügend Wasser bedeutet das einen grausamen Tod. Ich sage Ihnen das nur, damit Sie sich wenigstens ein ungefähres Bild von den Gefahren machen können, die Sie dort draußen im Busch erwarten.«
Er hielt einen winzigen Moment inne, warf einen Blick in unsere Gesichter, nur um festzustellen, dass wir uns keinesfalls von unserem Vorhaben abbringen ließen. Wir wollten dem guten Mr. Norman nicht lang und breit erklären, dass dieser Ausflug in die Wildnis des australischen Kontinents keineswegs unser erster war. Wenn es auch schon einige Jahre her war, dass wir hier einige Abenteuer erlebt hatten. Wir waren durch eine harte Schule der Wildnis gegangen und ich denke es gab nichts, was uns abschrecken konnte. Es würde sicherlich kein Spaziergang werden, doch komme, was wolle. Schließlich war Neil Norman ein guter Freund von uns, der jederzeit das gleiche für uns getan hätte.
»Ich sehe, Sie sind fest entschlossen«, sagte Mr. Norman kopfschüttelnd. »Wissen Sie, ich habe selbst Monate lang dort draußen nach Opalen gesucht, bis ich eines Tages den Grundstock für meine Existenz fand. Deswegen weiß ich um die Strapazen, die dort allgegenwärtig sind. Aber ich habe auch genug von Ihnen gehört, um zu wissen, dass Sie jeder Gefahr trotzen – so groß sie auch sein mag.«
»So ist es, Mr. Norman«, sagte Martin zu ihm. »Trotzdem sind wir Ihnen dankbar für die Unterstützung, die Sie uns gewähren wollen. Das hilft uns, frühzeitig aufzubrechen.«
»Ich werde auch ein robustes Fahrzeug auftreiben, ebenso genügend Proviant«, fügte der Opalhändler hinzu. »Schließlich bin ich Ihnen noch etwas schuldig, dass Sie mir in einer Notsituation geholfen haben. Überlassen Sie mir ruhig den organisatorischen Teil dieser Expedition. Schließlich müssen die Voraussetzungen stimmen, oder?«
Natürlich mussten wir ihm da zustimmen, im Grunde genommen waren wir Mr. Norman auch sehr dankbar für seine wirklich großzügige Hilfe. Es hätte sicher längere Zeit gedauert, bis wir selbst alle nötigen Vorbereitungen zu treffen in der Lage waren. Aber genau diese Zeit hatten wir jetzt nicht, denn es war höchste Zeit, die Spur der Vermissten aufzunehmen Obwohl jeder von uns wusste, wie gering die Aussicht auf Erfolg war.
Nur einer war mehr als hocherfreut, als wir ihm von unserem morgigen Vorhaben berichteten. Nämlich unser Chidi, der sich in Mr. Normans schönem Haus schon wohl gefühlt hatte wie in einem goldenen Käfig. Als er dann aus unserem Munde erfuhr, dass wir schon morgen früh ins Landesinnere aufbrechen würden, da war der Schwarze sichtlich erleichtert, dass die Zeit des Wartens nun endgültig vorbei war.
»Massers, Chidi will helfen, Masser Rogan zu finden«, sagte der treue Schwarze dann sofort zu uns. »Wir ihn suchen und ganz bestimmt finden!«, meinte er dann mit vollster Überzeugung.
Unser Chidi war wirklich ein unerschrockener Bursche, auf den wir immer zählen konnten. Selbst als wir ihm sagten, welche Strapazen auf uns warteten, schlich sich nur ein Lächeln in seine hässlich-markanten Züge ein. Stattdessen griff er nach seinem Speer, der ein treuer Reisebegleiter in all den Jahren geworden war, und umschloss ihn fest. Damit wollte er uns zeigen, dass er keinerlei Furcht vor dem Ungewissen hatte.
»Chidi jeden verjagen, der Massers Böses tun will«, meinte er, um seine Gesten noch zu untermalen. Damit war für ihn alles gesagt.
Drittes Kapitel: Aufbruch ins Ungewisse
Humphrey Norman hatte uns wirklich nicht zu viel versprochen. Der Himmel mochte wissen, wie er es geschafft hatte, innerhalb dieser kurzen Zeit einen robusten Wagen und einen Führer aufzutreiben. Aber tatsächlich wartete kurz nach Sonnenaufgang ein geräumiger Geländewagen und ein dunkelhäutiger grinsender Bursche mit einem so unaussprechlichen Namen auf uns, dass wir kurzerhand beschlossen, ihn einfach Anda zu nennen, weil das der erste Teil seines wahrhaft langen Namens war. Anda war ein Eingeborener, der den größten Teil seines Lebens draußen im Arnhem Land verbracht hatte und somit eine wertvolle Hilfe für uns sein würde, wenn wir auf Ureinwohner stießen. Das war so gut wie sicher, denn Martin und ich hatten gestern mit Mr. Norman noch ein langes Gespräch geführt und eine Menge Wissenswertes über die Bewohner dieses kargen Landstriches erfahren.
Auf unserer Suchexpedition würden wir auch das Gebiet der Yungman, der Wudwullam, der Warrai und der Larakia durchqueren müssen. Die Aborigines, der Sammelbegriff für die Ureinwohner Australiens, waren zwar recht scheue Stämme, aber Mr. Norman hatte uns auch belehrt, dass wir teilweise mit kriegerischem Verhalten rechnen müssten. Unter diesem Volk gab es immer noch vereinzelte, weit abseits lebende Stämme, die noch nie einen Weißen zu Gesicht bekommen hatten. Im Northern Territory lebten vielleicht noch insgesamt 15.000 Menschen dieser Volksgruppe, also eine verschwindend kleine Anzahl in einem Areal, das an Größe unsere Heimat um ein Vielfaches übertraf. Trotzdem sollten wir auf der Hut sein, was uns Mr. Norman auch noch mehrmals einschärfte.
Chidi war der erste, der am nächsten Morgen auf den Beinen war. Er schaffte es auch in Windeseile, unser Gepäck im Wagen zu verstauen und sich mit Anda, unserem eingeborenen Führer, anzufreunden. Dann hieß es Abschied nehmen. Der Opalhändler schüttelte uns allen noch einmal die Hände und wünschte uns Glück auf unserer Reise. Natürlich nicht, ohne dem australischen Führer noch einmal ans Herz zu legen, uns sicher und heil wieder zurückzubringen, was Anda natürlich hoch und heilig versicherte. Schließlich war er ein Mitglied des Yungman-Stammes, und alle Yungman seien ehrliche Leute, wie er besonders Martin und mir noch einmal bestätigte.
Martin und ich hatten uns kurz vorher noch abgesprochen. Deshalb war er der erste, der sich hinter das Steuer setzte. Anda nahm neben ihm Platz, während Chidi und ich es uns in dem hinteren Teil des robusten Wagens gemütlich machten. Während Martin den Wagen startete, warf ich einen letzten Blick aus dem Fenster und betrachtete mir noch einmal Mr. Normans schönes Haus. Für lange Zeit würden wir kein so bequemes Dach mehr über dem Kopf haben.
Schließlich schob ich diesen Gedanken beiseite und konzentrierte mich ganz auf die vor uns liegende Fahrt, die uns in eine Gegend führen würde, die kaum von Menschen besiedelt war, fern abseits der Zivilisation. Das in einem, im Grunde genommen noch jungen Land, dessen Inneres auf der Landkarte bis heute noch etliche weiße Flecken aufwies.
Chidi jedoch grinste mich an, als ich ihm einen Blick zuwarf. Der Schwarze freute sich schon auf das bevorstehende Abenteuer. Denn in Darwin und insbesondere in Mr. Normans Haus hatte er sich alles andere als wohl gefühlt.
Die größte Stadt im Northern Territory blieb hinter uns zurück, als wir in Richtung Südosten aufbrachen. Nur eine gute Stunde später umgab uns bereits die Einsamkeit des australischen Busches. Die Straße, die bereits wenige Meilen hinter Darwin zu einer holprigen Sandpiste geworden war, wies etliche Tücken und Schlaglöcher auf. Zwar wurden wir in dem Wagen ganz schön hin und her geschüttelt, aber wir gewöhnten uns daran.
Anda klärte uns auf, dass wir dieser Straße bis zum Einbruch der Dunkelheit folgen mussten. Er schlug uns vor, unser erstes Nachtlager in unmittelbarer Nachbarschaft des Daly River aufzuschlagen und von dort aus dem Flusslauf bis zum Roper River zu folgen. Das war die einzige Orientierungsmöglichkeit, die wir hatten, denn weiter im Landesinneren gab es keine Fahrpisten mehr, nach denen wir uns hätten orientieren können.
Ich schaute unwillkürlich hinter mich, um mich zu vergewissern, dass wir auch genügend Benzinvorräte mit uns führten, denn eine Panne in dieser trostlosen Wildnis war sicherlich alles andere als angenehm. Erleichtert atmete ich auf, als ich die drei großen Kanister sah, ebenso wie die bis zum Rand gefüllten Wasserflaschen. Wasser bedeutete Überleben im Busch, denn wir waren noch ein ziemliches Stück vom Daly River entfernt.
Bereits jetzt verspürte ich das Verlangen, nach einer der Flaschen zu greifen und einen Schluck zu mir zu nehmen. Und das, obwohl die Sonne noch lange nicht ihren höchsten Stand erreicht hatte. Aber wir bekamen schon einen kurzen Vorgeschmack auf die brütende Hitze der unerbittlichen Sonne, die ihre heißen Strahlen auf das öde Land warf. Martin bemerkte das, ignorierte aber die allgegenwärtige Hitze im Wagen. Stattdessen gab er Gas, um schneller das Tagesziel unserer Etappe zu erreichen.
Gelbbrauner Staub wurde von den Rädern des Geländewagens hochgewirbelt, nachdem Darwin schon gut zwei Stunden hinter uns lag. Die Einsamkeit des Northern Territory umgab uns von allen Seiten. Vor uns lag das weite und zum größten Teil unbekannte Arnhem Land, eine Wüsten- und Sumpflandschaft. Die ersten Auswirkungen bekamen wir jetzt schon zu spüren, denn die Mückenschwärme, die durch die halb offenen Wagenfenster eindrangen und uns quälten, wurden immer größer. Nur Anda schien sich daran gar nicht zu stören. Wahrscheinlich, weil er derartiges für ganz selbstverständlich hielt.
Der größte Teil der Fahrt verlief schweigend. Erst als die wüstenähnliche Steppe immer mehr Büsche und Bäume aufwies, versicherte uns Anda, dass jetzt der Daly River nicht mehr weit war. Man sah mir meine Erleichterung an, und auch Martin war sichtlich froh darüber, diese erste Etappe unbeschadet hinter sich gelassen zu haben.
»Besser weiter nach Osten fahren«, meldete sich Anda zu Wort, als er erkannte, dass Martin die bisherige Richtung beibehalten und in Richtung Daly River fahren wollte. »Ist Land von Warrai«, klärte er uns dann auf und fuchtelte dabei mit den Händen. »Warrai sehr kriegerisch«, fuhr er fort. »Wenn sie uns sehen, dann...«
Er sprach den Satz nicht zu Ende, aber jeder von uns wusste auch so, was Anda damit sagen wollte. Chidi machte ein grimmiges Gesicht und drückte damit aus, dass er sich von niemanden Angst einjagen lassen wollte, auch nicht von den kriegerischen Warrai. deren Land wir gerade durchquerten, weil es eben der kürzeste Weg auf unserer Etappe war. Schließlich durften wir ja keine Zeit verlieren, wenn wir Neil Rogan jemals lebend finden wollten. Aber je länger wir uns in diesem einsamen Land aufhielten, umso mehr wuchs die Gewissheit, dass diese Suche nach unserem Freund kein Ausflug werden, sondern eine gehörige Zeit in Anspruch nehmen würde. Wer weiß, wie lange wir überhaupt unterwegs sein würden? Vielleicht sogar noch Wochen?
Im gleißenden Licht der Sonne erkannte Anda als erster am fernen Horizont das glitzernde Band des Flusses, der in zahlreichen Schleifen sich durch sein Bett wand. Je näher wir kamen, umso besser konnten wir erkennen, dass der Fluss zu dieser Jahreszeit nur halb so viel Wasser führte, wie es sonst eigentlich der Fall war. Einen Fluss konnte man diesen nun kleinen Bach nun wirklich nicht nennen. Aber es war noch genügend Wasser vorhanden, um die Gegend zu beiden Seiten des Ufers in einer exotischen Pracht erblühen zu lassen. Da gab es Sträucher mit Blüten in schillernden Farben und Gewächse mit eigenartigen Ranken, die keiner von uns kannte. Ein Botaniker hätte hier sicherlich sein Paradies gefunden. Aber wir hatten leider keine Zeit, uns an den Schönheiten der Natur zu erfreuen, denn wir mussten uns jetzt darum kümmern, mit den Vorbereitungen für das Nachtlager zu beginnen, nachdem Martin den Wagen in der Nähe eines Gestrüpps angehalten und den Motor abgestellt hatte.
Sofort stürzte sich ein ziemlich hartnäckiger Mückenschwarm auf mich, nachdem ich den Wagen verlassen hatte. Aber Anda ging sofort zu einem der bunten Blütensträucher hinüber, riss einige Blüten ab, zerdrückte sie und rieb sich den Rest davon ins Gesicht und auf die Hände. Was zur Folge hatte, dass die Mücken sofort Reißaus nahmen. Wir folgten Andas Beispiel, rieben uns auch Gesicht und Arme ein und hatten schon wenig später Ruhe vor diesen Plagegeistern.
»Chidi sich ein wenig umschauen«, meinte unser treuer Begleiter zu uns, ergriff seinen Speer und war Augenblicke später im Busch verschwunden.
Anda machte Anstalten, Chidi zu folgen. Wahrscheinlich, weil er sich Sorgen darüber machte, ob Chidi die Gefahren dieser feindlichen Wildnis auch rechtzeitig wahrnahm. Aber ich legte unserem eingeborenen Führer beruhigend die Hand auf die Schulter.
»Chidi ist ein mutiger Bursche«, sagte ich zu Anda. »Um ihn musst du dir keine Gedanken machen. Wir kennen ihn gut genug, um zu wissen, dass er zu jeder Zeit mehr als nur wachsam ist.«
Meine Worte schienen den Yungman zu beruhigen. Er nickte nur und wandte sich wieder ab, um dann Martin zu helfen. Ich schloss mich den beiden an, sammelte genügend trockene Äste für ein Lagerfeuer, das Anda mit Martins Hilfe entfachte. Während sich die ersten kleinen Flammen gierig in das trockene Holz fraßen, holten Martin und ich Decken aus dem Wagen, die uns vor der nächtlichen Kälte schützen sollten. Denn wir wussten aus eigener Erfahrung, dass in dieser Gegend, wo tagsüber eine fürchterliche Hitze herrschte, die Nächte empfindlich kühl waren. Dem hatten wir mit Mr. Normans Hilfe vorgebeugt, sodass wir gewiss nicht frieren würden.
Ich holte einige Konserven aus dem Gepäckraum des Wagens, öffnete sie und gab den Inhalt in einen Topf, der schon auf einem Dreibein stand. Minuten später drang schon der verlockende Duft in unsere Nasen, Genau in dem Moment, wo Chidi wieder zurückkam.
»Alles ruhig da draußen«, versicherte er uns, während er am Feuer Platz nahm und darauf wartete, bis das Essen gar war. »Chidi nichts gesehen. Überhaupt keine Warrai – keine Menschenseele.«
Die letzten Worte waren an unseren Eingeborenenführer gerichtet, der uns ja vor diesem kriegerischen Stamm ausdrücklich gewarnt hatte.
»Warrai sich nur dann zeigen, wenn sie gesehen werden wollen«, äußerte er hartnäckig seine Zweifel. »Deshalb gleich morgen früh weiterfahren. Noch vor Sonnenaufgang.«
Martin versicherte ihm noch einmal, dass wir seinem Ratschlag folgen würden. Was aber nicht dazu beitrug, das Misstrauen des Yungman schwinden zu lassen. Stattdessen schlug er vor, die erste Wache zu übernehmen und Ausschau nach eventuellen Gefahren zu halten. Damit waren wir einverstanden.
Ich schlug vor, unseren Führer nach zwei Stunden abzulösen, gefolgt von Martin und Chidi. So konnten wir sicher sein, jederzeit auf unliebsamen Besuch gefasst zu sein. Schließlich waren Martin und ich beide gute Schützen und hatten uns schon des Öfteren gegen plötzliche Angreifer zur Wehr setzen müssen. Auf diese Erfahrung zählten wir auch jetzt wieder.
»Weiter drüben schlafen«, meinte Anda, als ich meine Decken unweit des Flusses ausbreitete. »Krokodile manchmal kommen.«
Ich begriff sofort und legte die Decken an einen anderen Platz in der Nähe des noch glimmenden Feuers, während Anda die erste Wache übernahm. Martin und ich hüllten uns in unsere Decken und versuchten ein wenig zu schlafen, was mir jedoch einige Mühe bereitete, denn in der Ferne erklang das klagende Heulen eines Dingos, des australischen Steppenhundes. Dieses Geräusch ließ mich lange Zeit nicht einschlafen. Doch schließlich gewöhnte wir uns alle an die Einsamkeit des Landes, die uns von allen Seiten umgab, und ich spürte, wie mir die Augenlider immer schwerer wurden. Das letzte, was ich sah, bevor ich die Augen schloss und in einen tiefen Schlaf fiel, war die schwach glimmende Glut des Lagerfeuers.
Viertes Kapitel: Der Tod schlägt zu
Ich wusste nicht, welches Geräusch mich geweckt hatte, als ich schließlich wieder die Augen öffnete und im ersten Moment verwirrt um mich blickte. Erst dann registrierte ich meine unmittelbare Umgebung, sah, dass Martin drüben seine Decken zusammengerollt hatte und im Begriff war, sie im Wagen zu verstauen. Chidi selbst bereitete diesmal das Essen, und unser eingeborener Führer war auf dem Weg zum Flussufer, in den Händen unsere Wasserflaschen, um sie wieder aufzufüllen.
Martin sah jetzt, dass ich wach geworden war und nickte mir zu.
»Warum hast du mich denn nicht früher geweckt?«, fragte ich ihn vorwurfsvoll, denn die anderen schienen schon einige Zeit auf den Beinen zu sein.
»Weil du heute eine ziemliche Strecke fahren musst«, erwiderte Martin lächelnd. »Und für so ein Vorhaben muss man ausgeruht sein.«
Das war logisch. Ich warf meine Decken zurück, rollte sie zusammen und verstaute sie ebenfalls im Wagen. Anschließend ging ich zu Chidi, um mich ordentlich zu stärken, bevor der zweite Teil unserer Etappe ihren Anfang nahm.
Ich hatte gerade den ersten Bissen hinuntergeschluckt, als ich plötzlich einen lauten Schrei vernahm, der unten vom Flussufer herkam. Auch Martin und Chidi hatten ihn gehört und handelten noch im selben Moment. Chidi ließ alles stehen und liegen, griff nach seinem Speer und hastete schon los, bevor Martin sich sein Gewehr gegriffen hatte. Mit riesigen Sätzen rannte unser Chidi hinunter zum Ufer, denn Andas Schreie – natürlich war er es gewesen – klangen jetzt noch durchdringender.
Was ich dann zu sehen bekam, ließ förmlich mein Blut erstarren, und ich wurde kreidebleich. Unser Führer, der wohl gerade dabei gewesen war, sich vom Ufer abzuwenden und zurück ins Lager zu gehen, war von einem geradezu riesigen Krokodil gepackt worden. Das Ungeheuer hatte ihn fest im Griff, umschloss ihn mit den messerscharfen Zähnen seines gewaltigen Maules. Der arme Anda schrie wie verrückt, weil er sich natürlich nicht mehr helfen konnte.
Martin und ich rissen unsere Gewehre hoch, aber die Bestie peitschte mit ihrem langen Schwanz das Wasser auf, zuckte mit der zappelnden Beute hin und her, sodass ein sicheres Zielen unmöglich war. Aber Chidi zögerte keine einzige Sekunde mehr. Er schleuderte seinen Speer der Bestie entgegen, traf sie direkt hinter dem Schädel in der ledernen Haut. Das Krokodil ließ daraufhin sein Opfer aus dem Griff seiner Kiefer, und wir nutzten diese Chance sofort, um zum Schuss zu kommen.
Martin drückte als erster ab, ich einen Sekundenbruchteil später. Beide Kugeln trafen ihr Ziel, und zerschmetterten den Schädel des großen Reptils. Blut färbte das Wasser, als die Bestie noch im Todeskampf um sich schlug und dann schließlich still auf der Wasseroberfläche trieb.
Indes hatte sich Chidi schon ins Wasser gestürzt, um den armen Anda zu bergen. Doch noch bevor Chidi unseren Führer ans trockene Ufer bringen konnte, wurde uns mit schrecklicher Gewissheit klar, welche schlimmen Wunden der Yungman vom plötzlichen Angriff des Krokodils davongetragen hatte.
Chidi schüttelte stumm den Kopf, als er Anda sanft im Gras absetzte, während Martin sich über den Schwerverletzten beugte, um ihn zu untersuchen. Aber die im Fluss treibende tote Bestie hatte buchstäblich ganze Arbeit geleistet. Die messerscharfen Zähne hatten Anda grässlich zugerichtet, und es war schon fast ein Wunder zu nennen, dass trotz der großen Wunde immer noch ein winziger Funken Leben in ihm steckte.
Anda hatte die Augen weit geöffnet, schien uns noch mit klarem Blick wahrnehmen zu können, aber über seine Lippen kam nur ein undeutliches Murmeln.
»Ganz ruhig«, sagte Martin zu ihm, obwohl er wusste, dass jede Hilfe vergeblich war. Aber da bäumte sich der Eingeborene auf, umkrallte Martins Arm mit den Händen und fiel dann leblos zurück. Gebrochene Augen blickten in die aufgehende Morgensonne.
»Verdammt!«, entfuhr es Martin, und er ballte ohnmächtig die Fäuste zusammen. Er sah mich stumm an, und ich konnte die Trauer über den plötzlichen Tod unseres Führers in seinen Augen erkennen. Anda war uns in der kurzen Zeit, die er uns begleitet hatte, wirklich ein treuer Gefährte geworden. Aber das unergründliche Schicksal hatte es wohl anders gewollt. Fern abseits seiner Heimat hatte er einen schrecklichen Tod in der Wildnis gefunden.
Auch Chidi musste mehrmals schlucken, als er den Toten stumm betrachtete. Kopfschüttelnd sah ich hinüber zum Fluss, wo der Kadaver des Krokodils langsam davon getrieben wurde. Noch vor wenigen Minuten hatte keiner von uns mit einem solch dramatischen Zwischenfall gerechnet, und nun war einer aus unserer Mitte gerissen worden. Bereits einen Tag nach unserem Aufbruch stand die Expedition unter einem unglücklichen Stern. Oder redete ich mir das nur ein? In diesen Moment fand ich einfach keine Antwort darauf.
Vielleicht ahnte Chidi meine Sorgen, denn er ergriff als erster wieder das Wort.
»Chidi Anda jetzt begraben«, riss er uns aus unseren trüben Gedanken. »Müssen weiter. Sonst Warrai uns doch noch finden.«
Natürlich hatte Chidi recht mit dem, was er gesagt hatte. Aber uns steckte eben noch der Schreck über den plötzlichen Tod unseres Gefährten in den Knochen. Trotzdem mussten wir uns damit abfinden, dass Anda nicht mehr bei uns war – und was vielleicht noch schlimmer war – dass er uns nicht mehr als Führer nützlich sein konnte. Eine Tatsache, deren Ausmaße Martin und mir erst jetzt so richtig bewusst wurde.
Wahrscheinlich hatte Martin die gleichen Gedanken wie ich, aber noch sagte er nichts, Stattdessen machte er sich mit Chidi daran, für den unglücklichen Anda ein Grab zu schaufeln. Eine halbe Stunde später hatten wir dann diese traurige Arbeit beendet. Martin sprach einige Worte, bevor er dann Chidi zunickte, das Grab zuzuschaufeln. Unser treuer Schwarzer machte sich gleich an die Arbeit, während ich Martin fragend anblickte.
»Und nun?«, rückte ich mit den Gedanken heraus, die mir die ganze Zeit über durch den Kopf gegangen waren. »Was sollen wir jetzt anfangen, Martin? Ohne Führer kommen wir in dieser Wildnis doch nicht weiter. Oder willst du vielleicht doch...?«
Ich stellte die Frage nicht zu Ende, da ich in Martins Augen einen Schimmer entdeckte, den ich nur zu gut kannte. So sah er mich immer an, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, wovon ihn kein Mensch abbringen konnte. Nicht einmal sein bester Freund.
»Willst du denn wirklich zurückfahren, Peter?«, richtete er statt einer Antwort eine Gegenfrage an mich. »Vergiss nicht, dass wir Ellen Dawson versprochen haben, nach Neil Rogan zu suchen. Er ist unser Freund, der vielleicht Hilfe braucht. Was mich betrifft, bin ich fest entschlossen, weiter zu machen.«
»Du hast recht«, pflichtete ich ihm schließlich bei, obwohl ich ein ziemlich mulmiges Gefühl im Magen verspürte. »Aber denk daran, welche Risiken wir damit auf uns nehmen. Anda war der einzige unter uns. der sich hier auskannte. Wir haben nichts außer einigen recht ungenauen Karten. Leicht wird das bestimmt nicht werden.«
»Was ist schon jemals leicht gewesen, was wir durchstehen mussten?«, erwiderte Martin achselzuckend und klopfte mir ermutigend auf die Schulter. »Aber geschafft haben wir es dann doch immer irgendwie, oder?«
»Dein Optimismus ist einfach nicht zu schlagen«, meinte ich mit einem Lächeln. Ein Blick zu Chidi zeigte mir, dass er seine traurige Arbeit beendet hatte. Er kam nun wieder zu uns und blickte uns fragend an. Er. erwartete jetzt natürlich eine Entscheidung von uns, wie es weitergehen sollte. Martin klärte ihn auf, was wir gerade beschlossen hatten.
Chidi nickte nur, als sei diese Entscheidung von Anfang an für ihn klar gewesen, und machte sich daran, die Schaufeln im Wagen zu verstauen. Martin und ich folgten ihm.
Bevor wir jedoch unsere Fahrt ins mittlerweile sprichwörtlich gewordene Ungewisse fortsetzten, holten wir die Karte aus dem Wagen, die uns Ellen Dawson mitgegeben hatte und vergewisserten uns noch einmal, an welchem Punkt unserer Suche wir uns gerade aufhielten.
»Wir befinden und jetzt östlich in Richtung Roper River«, sagte Martin und wies dabei auf einen winzigen markierten Punkt auf der Karte. »Sieh mal, Bitter Springs müsste nur eine Tagesreise von hier entfernt sein.«
»Bitter Springs?«, fragte ich meinen Freund, nachdem ich ebenfalls einen Blick auf die Karte geworfen hatte. »Was in aller Welt mag Bitter Springs nur sein? Eine Ansiedlung in dieser menschenleeren Gegend doch ganz bestimmt nicht.«
»Aber wahrscheinlich eine sogenannte Cattle Station«, klärte mich Martin auf. »Eine Art Farm inmitten der Wildnis, wo mutige Pioniere sich eine Rinderzucht aufgebaut haben. Ich schlage vor, dass wir nach Bitter Springs fahren und dann weitersehen. Vielleicht haben wir die Chance, dass Neil und die beiden Geologen ebenfalls diesen Weg eingeschlagen haben, um dort ihre Vorräte aufzufrischen.«
»Möglich ist alles in diesem Land«, seufzte ich. »Aber du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir zu dieser Cattle Station die Sandpiste verlassen und einfach nach Süden fahren müssen. Wegweiser nach Bitter Springs gibt es hier bestimmt nicht. Wenn wir uns verfahren, dann...«
»Du bist wirklich der geborene Optimist«, tadelte mich Martin und wies auf unseren schwarzen Begleiter. »Sieh dir Chidi an. Er kann es kaum abwarten, bis es endlich weitergeht. Nimm dir ein Beispiel an ihm.«
Im Grunde genommen hatte Martin ja recht. Nur gefiel mir eben der Gedanke nicht, die von Anda vorgeschlagene Route für ein kurzes Stück zu verlassen und stattdessen einen anderen Weg einzuschlagen. Eine Strecke, die ein ziemliches Risiko beinhaltete, wenn wir auch weiterhin vom Pech verfolgte wurden.
Aber ich hielt mir vor Augen, dass Neil Rogan jederzeit das gleiche für uns getan hätte, wenn wir uns in einer solchen verzwickten Lage befunden hätten, in der wir ihn vermuteten. Deshalb setzte ich mich hinter das Steuer des Wagens, nachdem Martin sich noch einmal vergewissert hatte, dass wir noch genügend Benzin im Tank hatten. Genug, um eine zweite Etappe zurücklegen zu können. Erst dann startete ich den Motor und fuhr los. Zurück blieb ein namenloses Grab in der einsamen Wildnis.
Fünftes Kapitel: Im Land der Warrai
Die Sonne hatte mittlerweile ihren höchsten Stand erreicht, als ich den Wagen das erste Mal anhielt, um uns eine kurze Ruhepause zu verschaffen. Gut vier Stunden waren wir dem Lauf des Daly River gefolgt, der schließlich eine Biegung nach Osten gemacht hatte. Wir aber wollten ja nach Bitter Springs, und das lag weiter südlich. Anfangs war mir gar nicht wohl bei dem Gedanken, die sichere Nähe des Daly River aufzugeben und stattdessen noch weiter in das Landesinnere zu fahren. Aber Martin hatte es doch irgendwie geschafft, seinen angeborenen Optimismus auf mich zu übertragen. Deshalb hatte ich meine trüben Gedanken endgültig abgelegt und hoffte ganz einfach, dass wir unser Etappenziel möglichst noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen würden. Das ließ sich nur bewerkstelligen, wenn ich zügig weiterfuhr.
Während das silbern glitzernde Band des kleinen Flusses hinter uns zurück blieb, tauchten weit vor uns am Horizont einige markante Felsengruppen auf, ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir wieder in Richtung Steppe und Wüste fuhren. Aber das war ja kein Wunder, denn der australische Kontinent war ein Land, das eigentlich nur an der Küste urbar gemacht und erschlossen werden konnte. Im Landesinneren gab es nur wenige Flüsse, die mit ihrem Wasser Leben spendeten. Der Rest war eine Staubschüssel mit Temperaturen, die kaum zu ertragen waren. Ohne genügend Wasservorräte hätten wir es hier keinen einzigen Tag ausgehalten.
Die Sonne saugte uns förmlich alles an Feuchtigkeit aus dem Körper und ließ uns träge und müde werden. Deshalb schlug ich Martin vor, wenigstens eine kurze Pause so lange einzulegen, bis die größte Mittagshitze vorbei war. Damit erklärte sich mein Freund ohne Zögern einverstanden.
Ich steuerte deshalb den Wagen an die Gruppe der markanten Felsen zu, drosselte das Tempo und brachte unser Gefährt schließlich dort zum Stehen. Das Glück schien heute wieder auf unserer Seite zu sein, denn einer der rotbraunen Felsen bot uns genügend Schutz vor den sengend heißen Strahlen der Sonne. Als ich den Motor abstellte und ausstieg, fühlte ich mich fast wie in einem Backofen, und das, obwohl wir uns im Schatten aufhielten. Was für ein mörderisches Land, dachte ich.
Wir verspürten Durst und erfrischten uns erst einmal, versuchten das ewige Verlangen nach Wasser so gut wie möglich zu unterdrücken. Denn wir durften nicht übermütig sein. Wasser bedeutete Überleben in dieser Wildnis. Deshalb behielt ich meinen letzten Schluck lange Augenblicke in meiner Mundhöhle und feuchtete alle Stellen noch einmal an. Wirklich, ich verspürte Erleichterung danach.
Martin warf indes noch einmal einen Blick auf die Karte. Vielleicht, um sich zu vergewissern, dass die Richtung, die wir eingeschlagen hatten, immer noch die richtige war. Aber auf dieser Karte waren die Felsen auch nicht eingezeichnet, in deren Schatten wir uns jetzt aufhielten. Deshalb faltete er die Karte wieder zusammen und verstaute sie in seiner Tasche.
»In einer halben Stunde sollten wir weiterfahren«, schlug er dann vor. Ich wollte daraufhin etwas erwidern, kam jedoch nicht mehr dazu, denn in diesem Moment kam Chidi von der anderen Seite des Felsens, wo er Posten bezogen und Ausschau nach eventuellen Gefahren gehalten hatte, zu uns gerannt. Der treue Schwarze hatte darauf bestanden, auch jetzt hier die Wache zu übernehmen, denn seine Instinkte sagten ihm wohl, dass man dieser Stille ringsherum besser nicht blindlings vertraue. Ein Gefühl, das sich jetzt bewahrheitete, denn auf Chidis Hinweis entdeckten auch wir plötzlich die kleine Rauchsäule weit draußen in der Steppe, die in den stahlblauen Himmel aufstieg. Der Rauch eines Feuers, das auf die Nähe von Menschen hinwies!
»Warrai«, sagte Chidi ganz aufgeregt und umfasste seinen Speer, den er selten aus der Hand legte, noch ein wenig fester. »Warrai uns entdeckt, werden bald angreifen.«
Martin und ich schauten uns an. Sofort eilten wir zu unserem Wagen zurück, griffen nach unseren Gewehren und steckten auch genügend Munition ein. Es sah nämlich ganz danach aus, als wenn wir schon bald Besuch bekommen würden. Besuch der uns alles andere als lieb war.
Natürlich wussten wir nicht viel über die australischen Ureinwohner, die in diesem Teil des Landes lebten. Das meiste hatten wir von Anda erfahren, und auch unser erster Aufenthalt vor Jahren in Australien hatte uns Erkenntnisse über die Eingeborenen gebracht. Andas Anwesenheit wäre jetzt für uns eine große Hilfe gewesen. Denn er hätte uns sofort sagen können, was das Feuer und die Rauchwolken für uns bedeuteten. Aber Anda war tot und begraben, wir mussten nun zusehen, wie wir zurechtkamen.
Misstrauisch blickte ich mit zusammengekniffenen Augen hinaus in die weite Steppe. Zum Glück hatte Martin ein gutes Fernglas dabei, das er jetzt rasch herbeiholte und hindurch spähte. Kopfschüttelnd reichte er es dann an mich weiter, und ich musste ebenfalls feststellen, dass sich da draußen überhaupt nichts rührte. Und doch mussten die Warrai irgendwo stecken, beobachteten uns wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit und warteten nur den günstigsten Zeitpunkt ab, um anzugreifen. Dass sie das tun würden, war uns klar, denn Anda hatte uns mehr als nur einmal vor diesem kriegerischen Stamm gewarnt.
Dass sich die Situation bedrohlich zuspitzte, erkannten wir schließlich eine halbe Stunde später, als in der Richtung, aus der wir gekommen waren, nun auch eine kleine Rauchwolke aufstieg. Die Warrai hatten uns umzingelt, lauerten überall. Ich hätte Gott weiß was darum gegeben, wenn ich gewusst hätte, mit wie vielen Gegnern wir eigentlich zu rechnen hatten. Zwar verfügten Martin und auch ich über äußerst treffsichere Waffen, und auch Chidi war entschlossen genug, sich mit seinem scharfen Speer so gut wie möglich zu wehren. Aber was nützte das, wenn der Feind in einem Hinterhalt so lange lauert, bis wir einen Fehler machen würden.
Vielleicht hätten wir unsere schützende Deckung verlassen und hastig in den Wagen steigen sollen. Aber dann verwarf ich diesen Gedanken wieder, da ich mir vor Augen hielt, was ein gut gezielter Speerwurf aus einer unerwarteten Richtung an Unheil anrichten. konnte. Nein, wir kannten unsere Gegner nicht, mussten ihnen den ersten Schritt überlassen. Aber das quälende Warten zerrte an unseren Nerven.
»Wir werden warten, bis es dunkel ist«, meinte Martin nach kurzem Überlegen. »Vielleicht schaffen wir es dann, mit dem Wagen zu entkommen, ohne dass uns ein Speer erwischt.«
»Wir werden uns gegenseitig Feuerschutz geben«, sagte ich zu Martin. Das untätige Warten in dieser schlimmen Nachmittagshitze kostete viel Kraft. »Du weißt ja, auf Chidi und mich kannst du zählen.«
»Das weiß ich«, grinste Martin. »Doch noch ist es nicht soweit. Ich weiß zwar nicht, wie diese Burschen es schaffen, sich so gut zu verbergen, aber ich kann keinen einzigen von ihnen ausmachen, auch nicht mit dem Fernglas. Vielleicht sind sie schon näher, als wir glauben...«
Noch bevor er diesen Satz beenden konnte, zischte plötzlich etwas dicht an Martins Kopf vorbei und fuhr mit einem dumpfen Laut neben Martins linkem Stiefel in den gelben Sand. Martin und ich handelten instinktiv, duckten uns, bevor ein zweiter gut gezielter Wurf doch noch einen von uns treffen konnte. Während Martin das Gewehr hoch riss und einen Schuss in die Richtung abgab, aus der der Speer geschleudert worden war, wandte ich kurz den Kopf und sah die tödliche Waffe, deren Schaft sich jetzt noch leicht hin und her bewegte.
Das Donnern des Schusses durchbrach die Stille der kargen Landschaft. Aber der Kerl, der es auf Martin abgesehen hatte, schien wohl schon längst wieder das Weite gesucht zu haben. Auf jeden Fall vernahmen wir keinen Laut oder sonst irgendein Anzeichen, dass Martins Kugel ihr Ziel gefunden haben könnte, Umso mehr wurde uns die Ausweglosigkeit unserer Situation bewusst, in der wir uns unfreiwillig befanden.
»Sie werden wohl erst angreifen, wenn es dunkel geworden ist«, schlussfolgerte Martin und setzte sein Gewehr ab. »Und dann können wir uns wohl auf etwas gefasst machen.«
»Chidi kämpfen wie Löwe!«, meldete sich unser schwarzer Freund mit lauter Stimme zu Wort. »Wenn Warrai angreifen wollen – sollen kommen! Chidi zeigen, was kämpfen heißt!«
Das war typisch für unseren Chidi. Selbst in so einer bedrohlichen Lage zeigte er keine Spur von Furcht. Nein, er war felsenfest davon überzeugt, dass wir diese Situation schon irgendwie meistern würden. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass wir von Feinden umzingelt und schlimm bedroht worden waren.
Indes neigte sich die Sonne allmählich gen Horizont und kündigte das baldige Hereinbrechen der Dunkelheit an. Unter normalen Umständen hätte ich dieses beeindruckende Bild der untergehenden Sonne genossen, aber so konnte ich es nur am Rande registrieren. Es gingen mir im Moment natürlich ganz andere Dinge durch den Kopf.
In der Ferne hörte ich das klagende Geheul eines einsamen Dingos. Wenige Augenblicke später folgte das Gekläff eines ganzen Rudels. Irgendwie spürte ich die Gänsehaut, die mir langsam aber sicher über den Rücken kroch, und ich bemühte mich, es mir nicht anmerken zu lassen. Martin hatte wohl trotzdem gemerkt, was ich dachte. Deshalb nickte er mir aufmunternd zu, während er jetzt Posten bezog und hinaus in die Ebene blickte, jederzeit auf einen plötzlichen Angriff der verborgenen Gegner gefasst.
Die an den Nerven zerrende Stille wurde jetzt von einer dumpfen Trommel durchbrochen, begleitet von eigenartigen Tönen aus uns fremden Musikinstrumenten. Der Himmel mochte wissen, was diese Warrai-Krieger jetzt beabsichtigten. Aber ganz bestimmt waren diese Trommelschläge ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Angriff jetzt unmittelbar bevorstand. Nun mussten wir besonders wachsam sein.
Plötzlich hörte ich ein leises Tappen drüben bei einem der flachen Sandsteinfelsen. Sofort riss ich mein Gewehr herum, blickte in die Dämmerung und versuchte, eine verdächtige Bewegung auszumachen. Aber es blieb wieder alles still. Hätte ich geahnt, dass das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver war, so hätte ich vielleicht das Schlimmste verhindern können. So aber kam alles anders. Im selben Atemzug hörte ich hinter mir einen halb unterdrückten Laut. Nur Bruchteile von Sekunden später sprang mich etwas heftig an, riss mich zu Boden.
Ich wandte den Kopf und blickte in die grässlich bemalte Fratze eines Warrai-Kriegers, dessen verzerrte Züge eine deutliche Sprache sprachen. In der Rechten hielt er ein Steinmesser, mit dem er nach meiner Kehle zielte und mir den Garaus zu machen versuchte. Geistesgegenwärtig blockte ich den nach meiner Kehle geführten Stich ab und versetzte dem Kerl einen Tritt in den Magen, der ihn zurück taumeln ließ.
Aber da waren schon zwei weitere Krieger, die sich auf mich stürzten und mich auszuschalten versuchten. Martin konnte mir in dieser bedrohlichen Lage nicht helfen, denn er hatte selbst alle Hände voll zu tun, um sich gegen drei weitere Angreifer zu wehren, die wie aus dem Nichts aufgetaucht waren und ihn lauernd umkreisten, nachdem einer von ihnen Martin das Gewehr aus der Hand geschlagen hatte und die Waffe nun für Martin unerreichbar auf dem Boden lag.
Mir selbst war es ähnlich ergangen. Durch den hinterhältigen Sprung war mir das Gewehr ebenfalls entfallen, und ich kam nicht mehr dazu, meine Pistole zu ziehen, denn die Krieger erahnten meine Absicht. Sie stürzten sich förmlich auf mich, schlugen und traten nach mir.
Irgendwo draußen im Dunkel hörte ich einen durchdringenden Todesschrei, während Martin und ich um unser Leben kämpften. Chidi, dachte ich verzweifelt. Wo in aller Welt ist Chidi?
Während ich mich gegen die eisenharten Griffe der Krieger zu wehren versuchte, hatten Martins Gegner ihn bereits zu Boden gezwungen. Einer der grell bemalten Burschen holte gerade jetzt mit einer Keule zu einem Schlag gegen Martins Kopf aus.
»Nein!«, schrie ich, als könne ich mit diesem Ruf der Verzweiflung noch das Schlimmste verhindern.
Ich bäumte mich auf wie ein Besessener, versuchte das Unvermeidliche zu verhindern. Aber alle Mühe war vergebens. Im selben Moment, in dem Martin brutal bewusstlos geschlagen wurde, trat einer der Warrai hinter mich und holte ebenfalls zu einem Hieb aus.
Ich wollte noch den Kopf zur Seite reißen, schaffte es aber nicht mehr. Etwas traf mit Wucht meine Schläfe, löste einen jähen Schmerz aus, der mich zusammenbrechen ließ. Das Letzte, das ich noch sehen konnte, waren bunte wirbelnde Schleier vor meinen Augen. Dann fiel ich in einen tiefen dunklen Schacht...
Sechstes Kapitel: Gefangen
»Peter, wach auf!«, vernahm ich eine undeutliche Stimme, die von ganz weit her zu kommen schien, während in meinem Schädel ein Heer kleiner Teufel umher tobte. Während ich allmählich das Bewusstsein wieder erlangte, spürte ich die hämmernden Schmerzen in meiner Schläfe, die sich jetzt wieder bemerkbar machten. Leise stöhnte ich auf. Erst danach versuchte ich, meine Augen zu öffnen, was mir erst beim dritten Versuch gelang. Unwillkürlich musste ich blinzeln, weil ich meine nähere Umgebung nur konturenhaft wahrnehmen konnte. Alles war dunkel und düster. Dann begriff ich, dass es Nacht war und ich Arme und Beine nicht bewegen konnte. Man hatte mich mit rauen Lederstreifen gefesselt.
»Gott sei Dank«, hörte ich die Stimme Martins neben mir. Mühsam drehte ich den Kopf, so gut das meine augenblickliche Lage zuließ und erkannte, dass auch mein Freund an Händen und Füßen gefesselt war. »Ich hatte schon befürchtet, du würdest gar nicht mehr aus der Bewusstlosigkeit erwachen, Peter.«
»Verdammt, dieser Bursche hätte mir beinahe den Schädel zertrümmert!«, stöhnte ich wieder, weil die Schmerzen jetzt stärker wurden. Automatisch nahm auch ich jetzt meine nähere Umgebung in Augenschein. Wo Martin und ich uns jetzt aufhielten, wussten wir nicht genau. Auf jeden Fall schienen uns die Warrai ein ziemliches Stück von dem Felsen weggeschleppt zu haben, hinter denen wir ursprünglich Posten bezogen hatten. Weiter weg wohl, denn ich konnte die vertrauten Umrisse der Felsen nicht entdecken, so sehr ich auch in die mondhelle Steppennacht hinausblickte.
»Wo ist Chidi?«, war meine erste Frage, als mir auf einmal klar wurde, dass unser schwarzer Freund nirgendwo zu sehen war. »Martin, weißt du, ob er...?«
»Ich hoffe nicht«, erwiderte Martin und schaute dabei misstrauisch hinüber zu einem flackernden Feuer gut fünfzehn Meter von uns entfernt, um das sich die Warrai-Krieger versammelt hatten. Um uns kümmerte sich jetzt keiner von den Wilden. Wozu auch? Schließlich waren wir gefesselt und konnten uns kaum bewegen. Da war ein Gedanke an Flucht absurd.
»Der Himmel mag wissen, was aus Chidi geworden ist«, fuhr Martin jetzt fort. »Bevor ich niedergeschlagen wurde, habe ich noch sehen können, dass er mit seinem Speer gegen zwei Warrai kämpfte und es dann schaffte, weg zu rennen.«





























