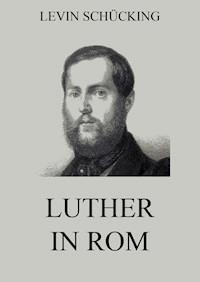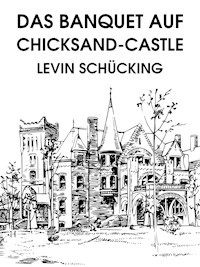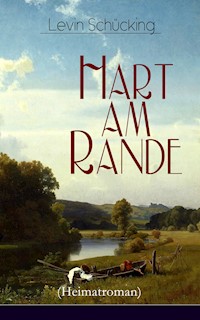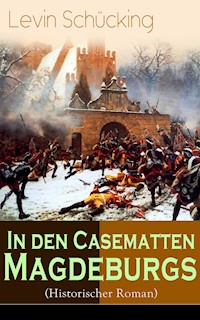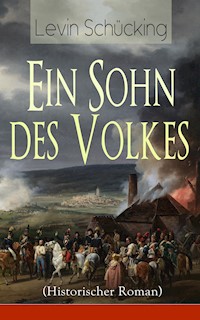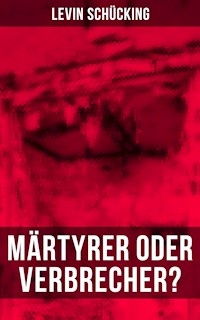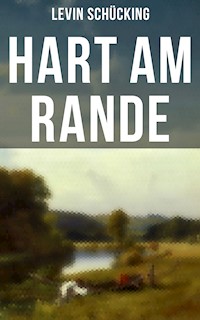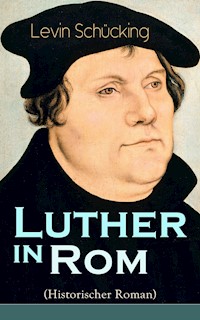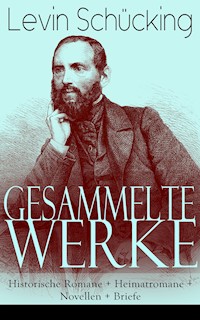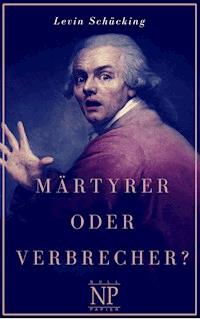
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Irgendwann im 19 Jahrhundert in einem kleinen Dorf: Zwei katholische Geistliche leben in einem Haushalt: ein älterer Pfarrer und sein jüngerer Kaplan. Doch der Ich-Erzähler wird sich der Rolle der beiden nicht klar. Warum leben beide zusammen, wo sie doch nichts gemeinsam zu haben scheinen? Der ältere Pfarrer, gutmütig, bieder und leidlich engagiert; der Jüngere, streitbar, zweifelnd, politisch. Die Stimmung wird endgültig vergiftet, als herauskommt, das der junge Kaplan einst wegen einer unbewiesenen Anschuldigung versetzt wurde: die des Raubmordes. Angeblich soll der Kaplan an seiner alten Wirkungsstätte einen Geldeintreiber erschlagen und beraubt haben. Was ist nun wahr? Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Levin Schücking
Märtyrer oder Verbrecher?
Historische Kriminalnovelle
Levin Schücking
Märtyrer oder Verbrecher?
Historische Kriminalnovelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954189-53-3
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
1
Als ich vor nun schon vielen Jahren meinen jetzigen Wohnsitz in einem von der von der Welt abgelegenen Dorfe bezog, sah ich mich zur Befriedigung jenes Geselligkeitsbedürfnisses, das jedem Sterblichen innewohnt und ihm auch unter den ihm gleichgültigsten Leuten treu bleibt, auf zwei Personen beschränkt, welche meine nächsten Nachbarn waren. Es waren die Bewohner des Pfarrhofes, in dessen bescheidene Gartenanlagen eine über den uns trennenden Bach geschlagene Brücke führte.
Der protestantische Pfarrhof spielt eine große Rolle im Kulturleben und in der geistigen Entwicklung unseres lieben Vaterlandes. Männer, welche aufs mächtigste in diese Entwicklung eingegriffen haben, verdanken ihm ihre Erziehung und Bildung; sie sind auf ihm jung geworden, und ihre ganze Wesensausprägung hat nie den Einfluß verleugnet, welchen der Charakter der Umgebung, in der ihr Gedankenleben aufblühte, auf sie übte. Und viele andere Männer wieder verdanken ihm in reiferen Jahren die Ruhe und Seelenstille, welche sie zum Austragen philosophischer Anschauungen, zum Ergründen wissenschaftlicher Probleme oder auch nur zur bloßen fördernden Literaturarbeit bedurften! Wie vieler berühmten Menschen Wiege stand auf einem Pfarrhof, wie vieler Dichter Lieblingsschauplatz für ihre Fiktionen ist der Pfarrhof; mit einem Pfarrhof-Idyll pflegt der junge Autor zu beginnen, der seinen ersten Genie-Ausbruch schäumend von Freundschafts- und Liebesgefühlen sich ergießen läßt.
Es steht anders um den katholischen Pfarrhof, und von einem solchen soll hier die Rede sein. Die Rolle, welche er in der Literatur spielt, ist gar klein; Initiative und Propaganda neuer Gedanken verdankt die Welt ihm nicht in erheblichem Maße; und als Mittelpunkt dichterischer Fiktion zu dienen, ist er wenigen geeignet erschienen, wenn auch Don Abbondio, der würdige Curato von den Ufern des Comosees, mit seiner Perpetua und seinem Heimwesen aufs beweglichste von Alessandro Manzoni abgeschildert ist.
Über diese Unangetastetheit seines stilleren Daseins wird sich der katholische Pfarrhof nun freilich nicht beklagen. Bene vixit qui bene latuit.1 Und in der Tat, es lebt sich ganz gut auf ihm. Was aber den Stoff zur dichterischen Behandlung angeht, so steht er an Reichtum daran sicherlich dem protestantischen weniger nach, als man wohl glaubt. Wenigstens sind Dramen des Herzenslebens, innere Gemütskonflikte und schwere Gedankenkämpfe, welche in hoffnungslosem Ringen sich in tiefes Schweigen hüllen mußten, auf ihm sicherlich mehr durchlebt, erlitten und zu tragischem oder gutem Ende geführt worden als auf jenem; und die Fiktion, welche den vertieften Erscheinungen allgemeinen, Menschenloses nachgeht, könnte eine Fülle der Gestalten voll realistischer Wahrheit und voll tieferregender Macht auf unsere Phantasie und unsere Empfindungen entdecken, wenn sie sich heimisch zu machen wüßte an dem flackernden Herde, an dem der würdige Mann Gottes mit dem ergrauten Haar seine müden Füße ausstreckt, nach seinen Wanderungen und Gängen durch Wetter und Wind und durch »des Pfarrers Woche«.
Es waren zwei geistliche Herren, welche den mir benachbarten Pfarrhof bewohnten. Der Pfarrer, ein mittelgroßer, ziemlich beleibter und bejahrter Mann mit einem offenen, überaus gutmütigen und blühenden Gesicht und einem ziemlich leeren Ausdruck der großen, wasserblauen Augen, offenbar ein überaus ruhiges und friedliches Gemüt, das das Leben, seine Aufgaben und seine Pflichten so aufnahm und getreulich erledigte wie seine Horen, Epistelfragmente und Lektionen in seinem Brevier, wie sie eben nacheinander nach den Jahreszeiten und Oktaven gereiht so dastanden, von Leuten, die wohl ihre Gründe dazu gehabt haben mußten, so nebeneinandergestellt und nicht anders. Ich habe ihn nie über etwas klagen oder etwas in seiner Lebensordnung anders wünschen hören; nur über seine Haushälterin klagte er, die seine Liebe zu Tieren nicht teilte und zuweilen mörderische Eingriffe in seinen Hühnerhof machte, ohne auf seine Protestaktionen und die intellektuellen Entwickelungen der selbstgezüchteten jungen Hähnchen Rücksicht zu nehmen, über deren Gedeihen er so recht eigentlich ab ovo gewacht. Zuweilen tauchte in den Reden des gutmütigen Herrn freilich wohl, wie ein plötzlich aufzuckendes und rasch wieder verlöschendes Lichtblinken, ein Wort, eine Äußerung auf, die verriet, daß auf dem Grunde seiner Seele auch der grübelnde Gedanke liege, das kleine stille Korn, das in so manchem Priester liegen mag, aber das er nicht keimen und wachsen lassen darf. »Es trägt so mancher«, sagte er wohl, »seine moralischen Tuberkeln in seiner Seele mit sich herum, aber im Lauf der Jahre sind sie verkapselt und unschädlich für seine Gesundheit geworden«, oder ein anderes Mal: »Den Hund, der unseren Herrgott anbellt, den Zweifel, haben wir wohl alle einmal in uns in Dressur nehmen müssen, bis er kuschen gelernt hat.« – »Die Philosophen«, sagte er auch, »bilden sich ein, der Magen der Menschheit vertrage den Glauben nur noch in homöopathischen Dosen, als ob der Glaube eine Medizin wäre und nicht eine unumgängliche Nahrung der armen Menschenkinder.«
Eigentümlich war des Pfarrers Verhältnis zu seinem jüngeren Hilfsgeistlichen, einem Mann von etwa fünfunddreißig Jahren und einer ziemlich auffallenden äußeren Erscheinung. Er war eine hohe, schlanke, mehr magere als volle Gestalt mit ein wenig vorgebeugter Haltung; sein dunkles Haar war länger, als man es gewöhnlich bei dem Manne aus dem Klerus sieht, und wellte sich gekräuselt über den auffallend stark über den Schläfen vorgewölbten Scheitelteilen, die den Sitz des Idealismus bilden sollen; ein großes, leuchtendes, braunes Auge unter hochgeschwungenen Brauen und ein regelmäßig gezeichneter, schwellender Mund, dessen Lippen oft aufzuckten, als wollten sie in ein verachtungsvolles Lächeln übergehen, zu dem es dann doch selten kam, der ganze tiefernste Ausdruck des Gesichts, alles das machte ihn auf den ersten Anblick anziehend und deutete auf eine ungewöhnliche Individualität.
Diese aber schien nicht von einer Art zu sein, die sich dem Pfarrer anziehend oder auch nur behaglich gemacht hatte, so leicht es auch scheinen mußte, des gutmütigen alten Herrn Freundschaft zu gewinnen und mit ihm auf den Fuß einer warmen und über Formen sich hinwegsetzenden Rückhaltlosigkeit des Verkehrs zu kommen. Ich fand bei meinen Besuchen nie beide zusammen; erst mein Erscheinen brachte den einen oder anderen herbei, und alsdann noch behielt das Gespräch etwas Geteiltes, als ob sie wechselseitige Anreden vermieden und vorzögen, alle Gedankenäußerungen sich einander indirekt und wie an mich gerichtet zu machen. Die beiden geistlichen Herren schienen entweder durch irgendeinen Hader, den sie zusammen gehabt, auseinandergekommen oder durch irgend etwas, dessen zwiespältige Auffassung sie einander fernhielt, innerlich getrennt zu sein. Es ging mich nichts an, was es war, und mochte ja auch im Grunde sehr unerheblicher Natur sein, nur durch die Einsamkeit, durch den Mangel an größeren oder höheren Interessen, der aus so manchen Mücken Elefanten wachsen läßt, zu einem Etwas geworden, was die beiden Männer nicht zu einem gemütlichen Verkehr in einer Lebenslage kommen ließ, in welcher sie doch so sehr darauf angewiesen waren.
Im übrigen schien mir die Schuld, wie ich mir nach einiger Beobachtung sagen mußte, nicht auf der Seite des jüngeren Mannes, wenigstens nicht in seinem Verhalten gegen den älteren, zu liegen. Er zeigte sich gegen diesen von einer kühl förmlichen, doch beflissenen Aufmerksamkeit; er war immer in der Haltung, welche das Bewußtsein des Untergebenseins bereitwillig zur Schau trägt; sein ganzes Wesen war ja überhaupt das eines Mannes, der aus einer Welt guter, geselliger Formen in diese ländliche Welt gekommen. Damit stimmte denn ja auch, daß ich eines Tages – er begegnete mir auf seiner Rückkehr aus der nächsten kleinen Stadt – ein schwarzweißes kleines Band, ein Ordensband, durch sein Knopfloch schimmern sah. So etwas ist etwas höchst Außergewöhnliches bei unsern Klerikern; er hatte es sich in einem Feldzuge als Krankenpfleger verdient. Übrigens mußte die Art von Freiwilligkeit, welche er in die durch seine Stellung ihm aufgezwungene Rücksichtnahme gegen den Vorgesetzten zu legen wußte, ihm nicht eben ganz leicht werden. Denn es konnte ihm das Bewußtsein nicht fehlen, daß er diesen Vorgesetzten an Kenntnissen, allgemeiner Bildung und an Schärfe des Urteils um Kopfeslänge überragte; wie offenbar auch der Kreis, dem er durch seine Geburt angehört hatte, ein gebildeterer gewesen war als der der ehrlichen Bürgersleute, von denen der Pfarrer abstammen mochte.
Als ich ihm damals bei seiner Rückkehr aus der Stadt begegnete und ich mich für den Heimweg ihm angeschlossen hatte, trug er ein paar Bücher unter dem Arm, und als ich ihn fragte, welche Lektüre er sich mit heimgebracht, zeigte er sie mir. »Es sind nur ältere Bücher«, sagte er, »die ich mir habe neu binden lassen müssen …«
»Weil Sie sie als Ihre Lieblingsautoren arg zerlesen hatten?«, antwortete ich, nach den Titeln schauend. Ich fand Bulwers »Eugen Aram« und Burckhardts »Kultur der Renaissance«, ein wenig überrascht über diese Bestandteile einer ländlichen Kaplansbibliothek. »Sagt Ihnen ›Eugen Aram‹ so zu?«
»Er sagt mir nicht zu, aber er fesselt mich«, gab er mit einem gewissen Zögern, mit einem Ton von Gleichgültigkeit zur Antwort.
»Dieser Versuch, uns das Unmögliche möglich zu zeigen?«
»Unmöglich? Was ist unmöglich?«
»In der Wirklichkeit vielleicht nichts. Für den Dichter, den Künstler vieles.«
»Auch eine Gestalt wie Eugen Aram?«
»Ja. Die dichterische Verwertung des Verbrechens scheint mir nur da möglich, wo eine gewisse Größe in der Tat liegt, weil sie eine Tat persönlicher Aufopferung ist, oder wo der spontane Affekt einer berechtigten Leidenschaft zu ihr hinriß. Beide Momente fehlen Eugen Aram, und so scheint mir, daß der Autor mit seinem Buch nur ›Öl und Mühe‹ verloren.«
Er schwieg darauf, um nach einer Pause zu sagen: »Sie mögen recht haben, daß das entschuldigende Moment, die uns verständliche, unsere Sympathien an sich reißende Leidenschaft, ihm fehlt. Er hat nur die Entschuldigung des ›Der Zweck heiligt die Mittel‹, und diese reicht in seinem Fall bei weitem nicht aus.«
»Gibt es Fälle, wo sie ausreicht?«
»O sicherlich«, antwortete er jetzt mit einer gewissen Lebhaftigkeit. »Mir scheint nichts törichter als der Sturm, der sich sofort erhebt, wenn man diesen Satz verteidigen will. Die Hälfte von allem, was geschieht, die Hälfte unserer Institutionen beruht auf diesem Satz, muß durch ihn seine Rechtfertigung finden. Der Arzt gibt mir Gift ein, wenn er dadurch meine Genesung hofft; so ist das ganze Leben mit Gift durchtränkt, das zur Aufrechterhaltung seiner Gesundheit nötig ist; der Krieg, die Todesstrafe, die Eintreibung der Steuer vom Armen, alle die Beschränkungen unserer natürlichen angeborenen Freiheit, denen wir uns zu unterwerfen haben! Wir lügen dem Kinde vor, dem die Wahrheit nicht taugt, wir betrügen den Irren, den wir in eine Heilanstalt locken wollen …«
»Pater Gury würde Sie mit Vergnügen plädieren hören«, unterbrach ich ihn lächelnd.
»Kennen Sie ihn?«
»Nein.«
»Desto besser. Er ist eine der Spitzen jener ganz falschen Richtung in der Kirche, die nicht spricht, der Zweck heiligt die Mittel, sondern das Mittel heiligt den Zweck. Durch das heilige Mittel des Glaubens wird der Zweck, die Fesselung des Geisteslebens und seine Unterwerfung, gerechtfertigt. Sie sehen mich erstaunt an, weil ich solche Gedanken ausspreche?«
»In der Tat, es überrascht mich …«