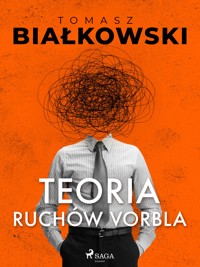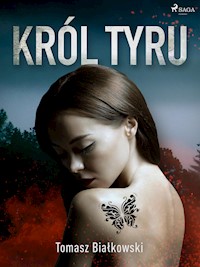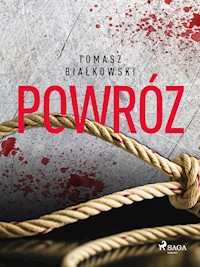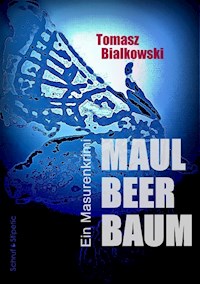
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schruf & Stipetic
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Pawel Werens liebt sportliche Autos und schöne Frauen und macht als Journalist in Warschau Karriere. Seiner verhassten Heimat im polnischen Norden hat er schon vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Es passt ihm gar nicht, dass ausgerechnet er dorthin geschickt wird, um über eine Mordserie zu berichten, die die touristische Idylle Masurens bedroht: Ältere Männer werden grausam gefoltert und umgebracht, die Tatorte rätselhaft arrangiert, im Mund jedes Opfers findet die Polizei einen weißen Schmetterling. Widerwillig quartiert Werens sich bei seinem Onkel, einem ehemaligen Priester, ein. Mit dessen Hilfe gelingt es ihm Hinweise zu entschlüsseln, die ihn zum Mörder führen. Doch damit kommt er einer mächtigen Seilschaft in die Quere.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Tomasz Bialkowski
Maulbeerbaum
Ein Masurenkrimi
Übersetzt von Ewa Krauss
Maulbeerbaum. Ein Masurenkrimi.
Deutsche Erstausgabe © Schruf & Stipetic GbR, Berlin 2014 www.schruf-stipetic.de
Titel der Originalausgabe: Szara Godzina Katowice 2012 © 2012 Tomasz Bialkowski
Covergestaltung: Kathrin Mock
ISBN: 978-3-944359-05-2
Für die deutsche Ausgabe wurde die Originalausgabe bearbeitet.
Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Schruf und Stipetic GbR.
Inhalt
26. Januar 2004, Montag
26. März 2004, Freitag
10. August 2004, Dienstag
13. August 2004, Freitag
14. August 2004, Samstag
24. Januar 1976, Samstag
14. August 2004, Samstag
25. Januar 1976, Sonntag
14. August 2004, Samstag
14. August 2004, Samstag
15. August 2004, Sonntag
24. Dezember 1977, Samstag
16. August 2004, Montag
6. Februar 1978, Montag
17. August 2004, Dienstag
18. August 2004, Mittwoch
19. August 2004, Donnerstag
20. August 1978, Samstag
20. August 2004, Freitag
10. September 1978, Sonntag
21. August 2004, Samstag
22. August 2004, Sonntag
Epilog
26. Januar 2004, Montag
Um einen rechteckigen Holztisch standen sechs Stühle. Auf einem davon saß gebückt ein grauhaariger Mann. Er strich sich mit den Händen über die mageren, nahezu knochigen Oberschenkel, dann griff er ungelenk an seine Knöchel. Langsam streckte er die steifen Glieder und richtete sich wieder auf. Mit feuchten Augen starrte er stumpf auf ein graues Blatt Papier, das vor ihm lag. Er ließ den Zeigefinger darauf kreisen und trommelte mit dem Daumen. Schließlich zerknüllte er das Blatt Papier mit der rechten Hand und warf es auf den verschlissenen Teppich. Schwerfällig erhob er sich und stakste auf seinen schmerzenden dürren Beinen in den Flur. Mit sichtlicher Mühe schob er die Füße in schwarze Lederschuhe und nahm einen braunen Wollmantel vom Kleiderhaken. Auf den Kopf setzte er sich eine Nerzfellmütze. Er schaltete das Licht aus. Vor der Wohnungstür blieb Rajmund Gesler eine Weile stehen. Seine Hand umklammerte den Türgriff, als ob er sich darauf stützte. Dann machte er das Licht wieder an und ging zurück in die Wohnung. Sein Blick wanderte über den gemusterten Teppich. Endlich fand er das zerknüllte Papier. Er hob es auf und ging zum Tisch. Mit der Handkante strich er das Papier glatt und kramte ein Feuerzeug aus der Hosentasche. Eine Flamme loderte auf. Im nächsten Moment legte er den brennenden Brief in einen Aschenbecher. Er zog den beißenden Rauch tief in die Lunge und verfolgte aufmerksam, wie das Blatt verbrannte. Als es sich in eine zarte Aschehaut verwandelt hatte, spuckte Gesler in das schwere, gläserne Gefäß. Langsam und bedächtig zerrieb er die Asche zwischen seinen knochigen Fingern, bis diese ganz grau waren. In seinem Gesicht war deutlich Angst zu lesen. Der alte Mann drehte sich um und schlurfte in seinen abgetragenen Schuhen zu einem alten Radioapparat, der noch an die Vorkriegsjahre erinnerte. Es war ein Telefunken-Gerät, Modell Fenomen Mb 713, hervorragend erhalten. Gesler hatte aber nicht vor, Musik zu hören. Mit seinen schmutzigen Händen griff er ans blank polierte Gehäuse und drehte das Gerät um 180 Grad. Dann löste er die provisorisch befestigte Rückwand und holte einen in Stoff eingewickelten Gegenstand heraus. Er schlug das Tuch auf und wog die von Schmieröl glänzende Pistole in seiner Hand. Nachdem er sie mit dem Stofflappen abgerieben hatte, ließ er sie geschickt in die Innentasche seines Mantels gleiten. Diesmal vergaß er das Licht auszumachen. Die Wohnungstür schloss er dagegen sorgfältig hinter sich ab. Er verließ das Treppenhaus des Mietshauses in der Grunwaldzka-Straße 11. In unmittelbarer Nachbarschaft befand sich eine kleine Turnhalle des Sportklubs »Budowlani«, wo die Ringer trainierten. Ein schwacher Lichtschein fiel aus den Fenstern auf die Straße. In Geslers Kindheit hatte dort eine Synagoge gestanden. Genau in dieser Straße hatte man 1941 alle Juden der Stadt und Umgebung in einem Altenheim zusammengetrieben und dann an einen unbekannten Ort gebracht. Und jetzt war er an der Reihe. Daran bestand kein Zweifel. Er würde nie mehr in seine Straße zurückkehren. Plötzlich fühlte er eine unangenehme Kälte. Er rückte seine Pelzmütze zurecht, schlug den Mantelkragen hoch und sah auf die Armbanduhr. Obwohl es erst drei Uhr nachmittags war, lag die Straße im Dunkeln. Schmutzige Schneehaufen türmten sich auf den Grünflächen und am Rand der Bürgersteige und ließen nur eine schmale Gasse frei, durch die sich die Menschen langsam und vorsichtig bewegten, um nicht auszurutschen. Gesler ging hinunter zum Taxistand an der Jana-Brücke. Unterwegs kam er an dem großen bröckelnden Obelisken vorbei, an dem eine Messingtafel angebracht war: »Am 3. Februar 1807 hielt sich Napoleon hier mit der Absicht auf, der russischen Armee eine Schlacht zu liefern.« Normalerweise musste er immer schmunzeln, wenn er diese alberne Inschrift las. Napoleon hielt sich mit der Absicht auf! Und das war Grund genug, diesen Gedenkstein hier zu setzen? Was für ein stumpfsinniges Volk! Hatten sie das Dezemberdekret schon vergessen? Lumpenpack! Woher kam diese unerwiderte Liebe zum Tyrannen? Heute war ihm aber nicht zum Lachen zumute. Vor dem Zebrastreifen blieb er eine Weile stehen, obwohl er die Straße bequem noch vor dem herankommenden weißen Opel hätte überqueren können. Aber Gesler hatte es nicht eilig. Er ging über die Brücke, unter der die Lyna floss. Trotz des heftigen Frostes war der Fluss noch eisfrei. In jungen Jahren war er häufig auf der Lyna gepaddelt. Es war sein einziges Hobby gewesen. Im Kajak musste man an nichts anderes denken. In diesen paar Stunden auf dem Fluss war die Welt rein und voll intensiver Düfte. Beim Paddeln hatte er nicht daran denken müssen, was er tagtäglich tat. Jetzt aber war die Lyna rau, dunkel und düster. Ganz wie er selbst. Er stieg in einen dunkelblauen Mercedes mit einem dicken Mittfünfziger am Steuer. Gesler wies ihn an, in die Parkowa-Straße am Rand des Stadtwalds zu fahren. Der Taxifahrer gehörte offensichtlich zu denen, die mit ihren Fahrgästen immer sofort eine Unterhaltung anfingen. Er kommentierte das Chaos auf den Straßen, die glatte Fahrbahn und miese Beleuchtung. An der Sybirakow-Allee schwelgte er in Erinnerungen an das Waldstadion. Ausgerechnet. Gesler schloss daraus, dass der Mann früher selbst Sportler gewesen war, wahrscheinlich Kugelstoßer. Das erklärte auch seinen korpulenten Körperbau. Schweigend hörte Gesler sich die Geschichte eines gewissen Szmidt an, eines zweifachen Olympiasiegers, der in diesem Stadion sämtliche Rekorde gebrochen und – ebenso wie der Fahrer selbst – eine Knieverletzung davongetragen hatte. Dann die Erzählung über den großen Leichtathletik-Wettkampf der Polen gegen die Schweizer. Der Fahrer zählte in einem Redeschwall Athleten aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg auf: Hirschfeld, Stock, Rosenthal. Auch beim Kassieren schwatzte er weiter über das Stadion, das die Kommunisten ruiniert hätten. Er wünschte sie zum Teufel.
Neugierig blickte der Taxifahrer seinem Fahrgast nach, den er dem Aussehen nach für einen pensionierten Lehrer hielt. Als der Alte an dem ehemaligen Kulturzentrum vorbei auf die alte Villa zuging, deren Blechdach im Mondlicht schimmerte, meldete sich der Taxifahrer bei der Zentrale und gab seinen Standort durch. Gesler betrat einen Weg aus Betonplatten, auf dem verharschter Schnee lag. Den Zaun, hinter dem das schmucke Gebäude stand, ließ er links liegen. Dann verschwand er zwischen den Bäumen in der Dunkelheit. Er folgte einem schmalen Pfad, der nur an den Vertiefungen in der Schneedecke zu erkennen war. Aus der Tasche holte er eine kleine Lampe, um den Weg zu beleuchten. Mit der freien Hand schob er dick verschneite Zweige beiseite. Der Schnee fiel auf sein Gesicht und seine Schulter. Es war noch kälter geworden. Gesler spürte seine Hände nicht mehr und sein Gesicht war von einer Eisschicht überzogen. Nach einer Viertelstunde trat er endlich auf eine Lichtung und konnte wieder aufrecht gehen. Er war an dem Ort angelangt, von dem der Taxifahrer gesprochen hatte. Vom früheren Stadion war nur eine schneebedeckte schilfüberwucherte Wiese übrig, die sich im Frühjahr in einen Sumpf verwandeln würde. Der Alte sah sich aufmerksam um. Seine Augen waren trotz des Alters immer noch gut. Mitten auf der Lichtung glaubte er einen gebückten Körper zu erkennen, weitere Gestalten kauerten im Gebüsch am nahe gelegenen Hang. Instinktiv griff er nach der Pistole in seiner Tasche. Er schluckte und rief mit möglichst fester Stimme: »Wozu hast du mich in diese verlassene Gegend kommen lassen, Montalto? Was sollte dieser Brief?« Er bekam keine Antwort. Irgendwo in der Ferne krächzte ein Vogel. »Ein seltsamer Ort für ein Treffen«, fuhr er fort. »Nach so vielen Jahren ... ein Vierteljahrhundert. Was willst du?« In das Krächzen des Vogels mischte sich Hundegebell. Gesler schaltete die Taschenlampe aus und ließ sie in den Schnee fallen, holte die alte Pistole aus dem Mantel und entsicherte sie. Am Rand der Lichtung tauchten immer mehr Gestalten auf. Geslers Hand zitterte. Er hatte nur sechs Patronen, nicht genug für alle seine Gegner. Vor ihm lagen die letzten Minuten seines Lebens. Er feuerte alle sechs Makarov-Patronen in Richtung der dunklen Schatten. Das Dröhnen der Schüsse verfing sich in den schneebedeckten Zweigen, den Tribünen dieses gespenstischen Stadions.
Gesler lag zusammengekrümmt im Schnee. Irgendwo hinter ihm flog ein Vogelschwarm auf und kreiste flatternd über der Lichtung. Er hörte, wie schwere Schritte die Schneedecke durchbrachen und jemand keuchend vor ihm stehen blieb. Gesler bedeckte den Kopf mit den Händen. Sie waren auf einmal heiß. Dann spürte er einen heftigen, bohrenden Schmerz im Rücken und Nacken. Gleich würde er das Bewusstsein verlieren. Im letzten Moment kam ihm ein merkwürdiger Gedanke: Was, wenn er nicht gekommen wäre? Dann hätte Montalto ihn am Tisch in seiner Wohnung erledigt. Er verlor er das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, lag er auf dem Rücken. Trotz der eisigen Temperaturen war ihm heiß. Vor allem an den Fußsohlen. Rasch erkannte er, warum. Er lag mit den Füßen an einem großen Feuer, von dem ein angenehmer Duft ausging. Seine Füße waren nackt. Die Hose war nass, vielleicht aufgrund des Temperaturunterschieds. Vielleicht hatte er aber auch in die Hose gemacht. So etwas hatte er schon oft erlebt. Dann ging ihm ein weiterer irrationaler Gedanke durch den Kopf: Warum hatte er sich nicht die Hände nicht gewaschen, bevor er aus dem Haus gegangen war? Und wohin waren die Vögel verschwunden? Stattdessen erkannte er nun die Gestalt eines Mannes, der über ihm stand. Er stieß flehentlich hervor: »Montalto. Warum?« Aber die Stimme, die er hörte, war die eines anderen. Sie kam Gesler bekannt vor, doch er konnte sich nicht erinnern, wem sie gehörte. »Am 26. Januar, in Smyrna, zur Zeit der Herrschaft von Marcus Antonius und Lucius Aurelius Commodus, wurde Er auf Befehl des Prokonsuls ins Feuer geworfen.« Gesler spürte, wie der Mann ihn an den Füßen packte und noch näher zum Feuer zog. Die Flammen leckten gierig an seinen Füßen und griffen auf die Hosenbeine über. Der Schmerz wurde von Minute zu Minute größer und Gesler verlor wieder das Bewusstsein. Der andere rieb ihm Schnee ins Gesicht und zog ihn wieder weg vom Feuer. Gesler wusste, dass es noch nicht zu Ende war. Er kannte sich mit dem Folterhandwerk aus. Sein Henker zog ein langes Messer aus einer ledernen Umhängetasche und sagte: »Das ganze Volk im Amphitheater verlangte Seinen Tod. Da die Flammen Ihm nichts anhaben konnten, wurde Er mit dem Schwert enthauptet.« Mit letzter Kraft hob Gesler den Kopf und erkannte, dass die Angreifer, auf die er seine Schüsse abgefeuert hatte, nur Schießscheiben mit menschlichen Umrissen gewesen waren. Er erkannte auch seinen Henker, schaffte es aber nicht, ihn beim Namen zu nennen, bevor das Fleischermesser seine Brust durchbohrte. Er starb langsam, während der andere die Pappfiguren ins Feuer warf und ihnen beim Verbrennen zusah. Er sprach: »Und mit Ihm zusammen gingen zwölf Einwohner von Philadelphia in den gleichen Tod.« Als der Mörder alle Attrappen verbrannt hatte, kehrte er zu dem Sterbenden zurück. Er drehte ihn um, sodass er mit dem Gesicht im Schnee lag. Der Henker kniete sich auf den Rücken des Alten und zog dessen Kopf mit einem kräftigen Ruck zu sich. Das Genick brach mit einem knackenden Geräusch. Dann trennte der Mörder mit seinem Fleischermesser den Kopf vom Körper. Er griff nach den Beinen seines Opfers, zog mit dem leblosen Körper einen blutigen Kreis in den Schnee. Dann legte er die Leiche in der Mitte des Kreises wieder ab, breitete ihre Arme aus und schob die Beine zusammen, all dies mit präzisen und bedächtigen Bewegungen. Zum Schluss griff er in seine Ledertasche und holte einen kleinen Plastikbeutel hervor. Er war gefroren und der Mann hauchte darauf und rieb ihn in seinen blutigen Händen. Endlich gelang es ihm, die Tüte aufzumachen. Vorsichtig entnahm er ihr einen großen, behaarten Schmetterling. Das Insekt war weiß, auf seinen von feinen Äderchen durchzogenen Flügeln gefror jetzt das klebrige Blut. Der Mörder hob Geslers Kopf auf Augenhöhe und begutachtete ihn zum letzten Mal. Dann stemmte er ihm mit der Messerspitze den Mund auf und legte den Schmetterling hinein. Er trug den Kopf in den Kreis und legte ihn am Hals ab. Die Vögel, die in diesem Moment lärmend über die Lichtung flogen, sahen nun eine Gestalt, die wie ein Kreuz auf dem Boden lag. Der Mörder wischte sich die Hände im Schnee ab, steckte das Messer zurück in die Tasche und verschwand zwischen den Bäumen.
26. März 2004, Freitag
Staatsanwalt Stefan Markowski fuhr mit seinem schwarzen BMW 745i vor der alten, denkmalgeschützten Getreidemühle vor. Sie beherbergte das vornehme Hotel »Mlyn«, das wegen seiner Lage inmitten von grünen Wäldern ein beliebtes Ausflugsziel war. Der Staatsanwalt stieg aus seinem luxuriös ausgestatteten Jahreswagen, betrat schnell das Foyer und ging direkt zur Rezeption, wo er einen Personalausweis zeigte und sagte, er habe ein Doppelzimmer auf den Namen Kowalski gebucht. Das war merkwürdig, denn Markowski alias Kowalski wohnte nur einige Straßenzüge weiter in einem pompösen Haus am Ostrand von Elblag. Er erhielt den Schlüssel und ging auf sein Zimmer, duschte und zog den Hotelbademantel an. Dann öffnete er die mitgebrachte Kognakflasche. Eine Viertelstunde später klopfte es. Mit lüsternem Lächeln rückte er seinen Gürtel zurecht und ging zur Tür. Unbekümmert zog er sie weit auf, doch beim Anblick der Gestalt im Flur wich er zurück. Innerhalb einer Sekunde verzerrte sich sein Lächeln zu einer scheußlichen Grimasse. Der Mann an der Tür packte den Staatsanwalt mit seiner Rechten am Hals und schlug ihm die linke Faust in den Magen. Dann schob er ihn ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich zu. Der perplexe Markowski alias Kowalski stürzte über den Tisch und riss ihn um. Die Flasche, die darauf gestanden hatte, fiel ebenfalls zu Boden. Instinktiv versuchte er nach ihr zu greifen, um sie als Waffe zu benutzen. Doch der Angreifer trat sie ihm aus der Hand und begann, den am Boden liegenden Mann mit heftigen Fußtritten zu traktieren. Der Staatsanwalt hob die Hände schützend vor den Kopf und rollte sich wie ein Embryo zusammen. Er vermied es, dem Angreifer ins Gesicht sehen, aber er erkannte den Buckligen mit dem verbrannten Gesicht und den grausamen Augen nur zu gut. »Was willst du?«, stöhnte er. Er erhielt keine Antwort. Stattdessen warf ihm der Bucklige ein Knäuel aus Sakko, Hose und Seidenhemd zu. Mit zitternden Händen streifte Markowski den Bademantel ab und zog, immer noch auf dem Boden liegend, die Kleidungsstücke an. Als er fertig war, kroch er auf allen Vieren zu seinen Schuhen, die an der Badezimmertür standen. Der Bucklige befahl ihm aufzustehen und reichte Markowski dessen Kaschmirmantel, ein Weihnachtsgeschenk seiner Frau. Er zog ihn an und wartete auf weitere Befehle seines Peinigers. Dieser forderte ihn auf, sich das Blut vom Gesicht zu waschen und die Wildlederhandschuhe anzuziehen, um die verletzten Hände zu verbergen. Sie verließen das Zimmer und durchquerten einige Räume, ohne eine Menschenseele zu treffen. Über die Treppe gelangten sie zur Rezeption und gingen am Empfangschef vorbei, der ihnen höflich zunickte. Er schien überrascht, dass der Gast so plötzlich in Begleitung eines »unansehnlichen Zwergs« - so nannte er mangels eines besseren Einfalls Kowalskis Begleiter später - das Hotel verließ. Durch die Glasscheibe zwischen Rezeption und Foyer versuchte er einen Blick ins Gesicht des Staatsanwalts zu erhaschen, doch der Gast trug einen Hut und den Rest des Gesichts verbarg ein Schal. Selbst wenn der Empfangschef es gewagt hätte, den Stammgast nach dem Grund für den plötzlichen Aufbruch zu fragen, hätte er keine Antwort erhalten. Denn der Staatsanwalt gehorchte dem Druck einer stahlharten Militärmesserspitze in seiner Lebergegend.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!