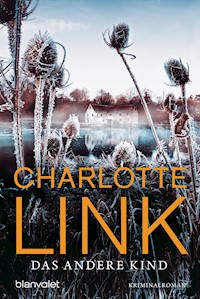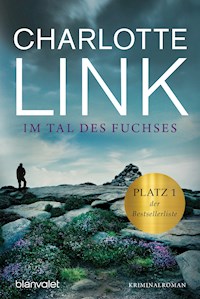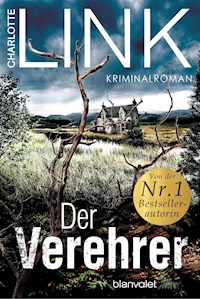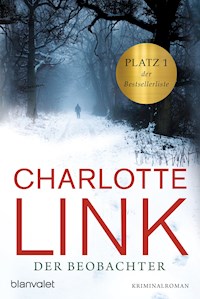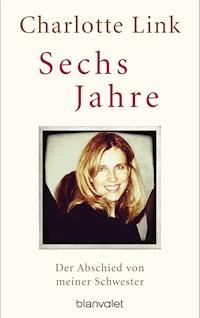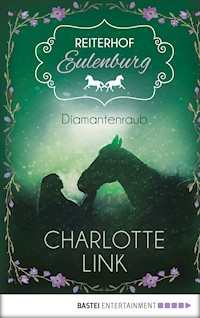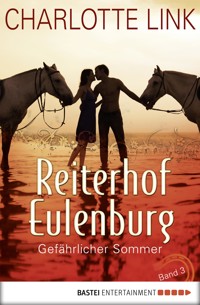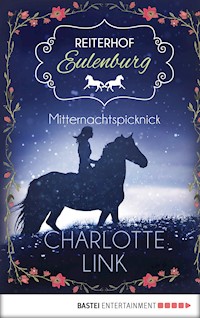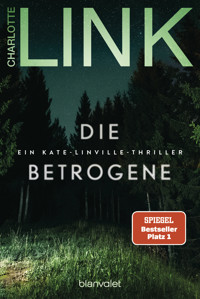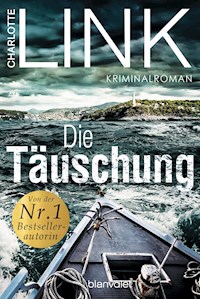
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wissen wir wirklich, mit wem wir verheiratet sind? Und wollen wir es wirklich wissen?
Peter Simon, geschätzt als erfolgreicher Geschäftsmann und geliebt als fürsorglicher Ehemann und Vater, verschwindet spurlos auf einer Reise in der Provence. Als seine junge Frau Laura verzweifelt vor Ort recherchiert, stößt sie nicht nur auf eigenartige Widersprüche, sondern muss schließlich erkennen, dass ihr Mann nicht der war, für den sie ihn hielt. Und dass die Wahrheit mit tödlicher Gefahr verbunden ist …
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Das Frankfurter Ehepaar Laura und Peter Simon hat sich nach herrlichen Ferienerlebnissen in der Provence entschlossen, dort ein eigenes Haus zu erwerben. Besonders Laura ist begeistert von dieser Entscheidung, da sie hofft, in Zukunft mit ihrem beruflich erfolgreichen Mann mehr Zeit in Südfrankreich zu verbringen. Wie jedes Jahr bricht Peter als Erster zum Ferienhaus nach Saint-Cyr auf, um mit seinem besten Freund Christopher einen Segeltörn zu unternehmen. Laura will einige Zeit später nachkommen. Als Peter mit dem Auto Saint-Cyr erreicht, ruft er seine Frau wie vereinbart in Frankfurt an, um sie von seiner Ankunft zu unterrichten – das letzte Lebenszeichen, wie sich zeigt. Denn von nun an ist Peter wie vom Erdboden verschluckt. Laura versucht verzweifelt, zuerst von Frankfurt aus etwas über den Verbleib ihres Mannes herauszufinden, und stößt schon bald auf erste beunruhigende Ungereimtheiten im Umfeld ihres Mannes. Als klar wird, dass sie nur vor Ort weiter recherchieren kann, packt sie die Koffer und meldet sich bei Christopher, dem Freund ihres Mannes, an. Doch auch er hat vergeblich auf die Ankunft von Peter gewartet und kann Laura nicht weiterhelfen. Desgleichen die französischen Freunde in der Provence, von denen sie sich Neuigkeiten erhofft hatte, da Peter in ihrem Lokal zuletzt gesehen wurde.
Als Laura zufällig erfahrt, dass kürzlich ein grausamer Mord an einem weiblichen Feriengast verübt wurde, findet sie dies zwar beunruhigend, bringt es aber nicht mit dem Verschwinden ihres Mannes in Verbindung. Ein verhängnisvoller Fehler – denn wie es scheint, sollte Laura zwischen Freund und Feind zukünftig sehr genau unterscheiden …
Die Meisterin der Täuschungen heißt Charlotte Link. Die Wiesbadenerin schreibt so gut und so britisch, dass selbst ihre englische Kollegin Minette Walters vor Neid erblassen würde! SWR
Psychologisch äußerst ausgefeilt! Focus
Inhaltsverzeichnis
Bericht aus der Berliner Morgenpost vom 15. September 1999
Grausige Entdeckung in einer Mietwohnung in Berlin-Zehlendorf
Ein furchtbarer Anblick bot sich gestern einer Rentnerin, die den Hausmeister einer Wohnanlage in Berlin-Zehlendorf überredet hatte, ihr mit seinem Zweitschlüssel die Wohnung ihrer langjährigen Freundin Hilde R. zu öffnen. Die vierundsechzigjährige, alleinstehende Dame hatte sich seit Wochen nicht mehr bei Freunden und Bekannten gemeldet und auch auf Anrufe nicht reagiert. Nun wurde sie in ihrem Wohnzimmer entdeckt. Sie war mit einem Seil erwürgt worden; der Täter hatte ihre Kleidung mit einem Messer zerschlitzt. Sexuelle Motive liegen offenbar nicht vor, auch war nach Angaben der Polizei kein Diebstahl nachzuweisen. Nichts läßt auf einen Einbruch schließen, so daß davon ausgegangen wird, daß die alte Dame selbst ihrem Mörder die Tür geöffnet hat.
Ersten Autopsieberichten zufolge könnte sich die Leiche bereits seit Ende August in der Wohnung befinden. Vom Täter fehlt jede Spur.
Teil 1
Prolog
Sie wußte nicht, was sie geweckt hatte. War es ein Geräusch gewesen, ein böser Traum, oder spukten noch immer die Gedanken vom Vorabend in ihrem Kopf? Sie neigte dazu, Grübeln, Schmerz und Hoffnungslosigkeit mit in den Schlaf zu nehmen, und manchmal wurde sie davon wach, daß ihr die Tränen über die Wangen liefen.
Aber diesmal nicht. Ihre Augen waren trocken.
Sie war gegen elf Uhr ins Bett gegangen und sehr schwer eingeschlafen. Zu vieles war ihr im Kopf herumgegangen, sie hatte sich bedrückt gefühlt und war in die alte Angst vor der Zukunft verfallen, die sie nur für kurze Zeit überwunden geglaubt hatte. Das Gefühl, eingeengt und bedroht zu werden, hatte sich in ihr ausgebreitet. Für gewöhnlich hatte ihr das Haus am Meer stets Freiheit vermittelt, hatte sie leichter atmen lassen. Noch nie, wenn sie hier gewesen war, hatte sie sich nach der eleganten, aber immer etwas düsteren Pariser Stadtwohnung zurückgesehnt. Zum erstenmal freute sie sich jetzt, daß der Sommer vorüber war.
Es war Freitag, der 28. September. Am nächsten Tag würden sie und Bernadette aufbrechen und heim nach Paris fahren.
Der Gedanke an ihre kleine Tochter ließ sie im Bett hochschrecken. Vielleicht hatte Bernadette gerufen oder im Schlaf laut geredet. Bernadette träumte intensiv, wurde häufig wach und schrie nach ihrer Mutter. Oft fragte sie sich, ob das normal war bei einem vierjährigen Kind, oder ob sie die Kleine zu sehr belastete mit ihren dauernden Depressionen. Natürlich plagten sie Schuldgefühle deswegen, aber sie vermochte es nicht wirklich zu ändern. Es blieb bei gelegentlichen Anläufen, sich selber aus dem Sumpf des Grübelns und der Verlorenheit zu ziehen, doch nie konnte sie einen anhaltenden Erfolg für sich verbuchen.
Außer im letzten Jahr … im letzten Sommer …
Sie sah auf den elektronischen Wecker, der neben ihrem Bett stand und dessen Zahlen intensiv grün in der Dunkelheit leuchteten. Es war kurz vor Mitternacht, sie konnte nur ganz kurz geschlafen haben. Wieder lauschte sie. Es war nichts zu hören. Wenn Bernadette nach ihr rief, dann tat sie das normalerweise ununterbrochen. Trotzdem würde sie aufstehen und nach ihrem Kind sehen.
Sie schwang die Beine auf den steinernen Boden und erhob sich.
Wie immer seit Jacques’ Tod trug sie nachts nur eine ausgeleierte Baumwollunterhose und ein verwaschenes T-Shirt. Früher hatte sie, gerade in der Wärme der provenzalischen Nächte, gern tief ausgeschnittene, hauchzarte Seidennégligés angelegt, elfenbeinfarbene zumeist, weil ihre stets gebräunte Haut und die pechschwarzen Haare damit schön zur Geltung kamen. Sie hatte damit aufgehört, als er ins Krankenhaus kam und sein Sterben in Etappen begann. Sie hatten ihn als geheilt entlassen, er war zu ihr zurückgekehrt, sie hatten Bernadette gezeugt, und dann war der Rückfall eingetreten, innerhalb kürzester Zeit, und diesmal hatte er das Krankenhaus nicht mehr verlassen. Er war im Mai gestorben. Im Juni war Bernadette zur Welt gekommen.
Es war warm im Zimmer. Beide Fensterflügel standen weit offen, nur die hölzernen Läden hatte sie geschlossen. Durch die Ritzen sah sie das hellere Schwarz der sternklaren Nacht, roch die Dekadenz, die der glühend heiße Sommer dem Land vermacht hatte.
Der September war atemberaubend schön gewesen, und ohnehin liebte sie den Herbst hier besonders. Manchmal fragte sie sich, weshalb sie so beharrlich jedes Jahr Anfang Oktober nach Paris abreiste, obwohl es keinerlei Verpflichtungen dort für sie gab. Vielleicht brauchte sie das Korsett eines strukturierten Jahresablaufs, um sich nicht im Gefühl der Realitätslosigkeit zu verlieren. Im Oktober spätestens kehrten alle in die Städte zurück. Vielleicht wollte sie zugehörig sein, auch wenn sie sich in ihren schwarzen Stunden oft bitter für diesen vorgegaukelten Sinn in ihrem Leben anklagte.
Sie trat auf den Gang hinaus, verzichtete jedoch darauf, das Licht anzuschalten. Falls Bernadette schlief, sollte sie nicht geweckt werden. Die Tür zum Kinderzimmer war nur angelehnt, vorsichtig lauschte sie in den Raum hinein. Das Kind atmete tief und gleichmäßig.
Sie hat mich jedenfalls nicht geweckt, dachte sie.
Unschlüssig stand sie auf dem Flur. Sie begriff nicht, was sie unterbewußt so beunruhigte. Sie wachte so oft nachts auf, sie konnte eher jene Nächte als Besonderheit werten, in denen sie durchschlief. Meist wußte sie nicht, was sie hatte aufschrecken lassen. Weshalb war sie in dieser Nacht nur so nervös?
Tief in ihr lauerte Angst. Eine Angst, die ihr Gänsehaut verursachte und ihre Sinne auf eigentümliche Art schärfte. Es war, als könne sie irgendeine in der Dunkelheit wartende Gefahr wittern, riechen, fühlen. Als sei sie ein Tier, das das Herannahen eines anderen Tiers spürt, das ihm gefährlich werden kann.
Jetzt werde nicht hysterisch, rief sie sich zur Ordnung.
Es war nichts zu hören.
Und doch wußte sie, daß jemand anwesend war, jemand außer ihr und ihrem Kind, und dieser Jemand war ihr schlimmster Feind. Die Einsamkeit des Hauses kam ihr in den Sinn, sie war sich bewußt, wie allein sie beide hier waren, daß niemand sie hören könnte, falls sie schrien, daß niemand es bemerken würde, wenn etwas Ungewöhnliches hier vor sich ginge.
Es kann keiner in das Haus hinein, sagte sie sich, überall sind die Läden verschlossen. Die Stahlhaken zu zersägen würde einen Höllenlärm veranstalten. Die Türschlösser sind stabil. Auch sie zu öffnen kann nicht lautlos funktionieren. Vielleicht ist draußen jemand.
Es gab nur einen, von dem sie sich vorstellen konnte, daß er nachts um ihr Haus herumschlich, und bei diesem Gedanken wurde ihr fast übel.
Das würde er nicht tun. Er ist lästig, aber nicht krank.
Doch in diesem Moment wurde ihr klar, daß er genau das war. Krank. Daß sein Kranksein es gewesen war, was sie von ihm fortgetrieben hatte. Daß sein Kranksein sie an ihm gestört hatte. Daß es jene sich langsam verstärkende, instinktive Abneigung ausgelöst hatte, die sie sich die ganze Zeit über nicht wirklich hatte erklären können. Er war so nett. Er war aufmerksam. Es gab nichts an ihm auszusetzen. Sie war bescheuert, ihn nicht zu wollen.
Es war Überlebensinstinkt gewesen, ihn nicht zu wollen.
Okay, sagte sie sich und versuchte tief durchzuatmen, wie es ihr ein Atemtherapeut in der ersten furchtbaren Zeit nach Jacques’ Tod beigebracht hatte, okay, vielleicht ist er da draußen. Aber er kann jedenfalls nicht hier herein. Ich kann mich ruhig ins Bett legen und schlafen. Sollte sich morgen irgendwie herausstellen, daß er da war, jage ich ihm die Polizei auf den Hals. Ich erwirke eine einstweilige Verfügung, daß er mein Grundstück nicht betreten darf. Ich fahre nach Paris. Falls ich Weihnachten hier verbringe, kann schon alles ganz anders aussehen.
Entschlossen kehrte sie in ihr Zimmer zurück.
Doch als sie wieder im Bett lag, wollte die Nervosität, die ihren Körper vibrieren ließ, nicht aufhören. Noch immer waren alle Härchen auf ihrer Haut hoch aufgerichtet. Sie fror jetzt, obwohl es sicher an die zwanzig Grad warm war im Zimmer. Sie zog die Decke bis zum Kinn, und eine Hitzewallung machte ihr das Atmen schwer. Sie stand dicht vor einer Panikattacke, die sich bei ihr immer mit einem fliegenden Wechsel zwischen Hitze und Kälte ankündigte. In der Zeit, in der Jacques starb und auch danach hatte sie oft solche Anfälle erleiden müssen. Seit ungefähr einem Jahr war sie frei davon. Zum erstenmal wurde sie nun wieder von den immer noch vertrauten Symptomen heimgesucht.
Sie fuhr mit den Atemübungen fort, die sie vorher draußen im Gang begonnen hatte, und oberflächlich wurde sie ruhiger, aber in ihrem Inneren glühte ein rotes Warnlämpchen und ließ sie in Hochspannung verharren. Sie wurde das Gefühl nicht los, daß sie keineswegs Opfer einer Hysterie war, sondern daß ihr Unterbewußtsein auf eine greifbare Gefahr reagierte und ihr ununterbrochen zurief, sie solle aufpassen. Zugleich weigerte sich ihr Verstand, derartige Gedanken zuzulassen. Jacques hatte immer gesagt, es sei Unsinn, an Dinge wie Vorahnungen, Stimme des Bauchs oder dergleichen zu glauben.
»Ich glaube nur, was ich sehe«, hatte er oft gesagt, »und ich nehme nur an, was sich als Tatsache beweisen läßt.«
Und ich bin im Moment einfach dabei, durchzudrehen, sagte sie sich.
Im gleichen Augenblick hörte sie ein Geräusch, und es war vollkommen klar, daß sie es sich nicht eingebildet hatte. Es war ein Geräusch, das sie gut kannte: Es war das leise Klirren, das die Glastür, die Wohn- und Schlafbereich in diesem Haus voneinander trennte, verursachte, wenn sie geöffnet wurde. Sie vernahm es an jedem Tag, den sie hier war, an die hundert Mal, entweder weil sie selbst hindurchging, oder weil Bernadette hin- und herlief.
Es bedeutete, daß jemand hier war und daß er keineswegs um das Haus herumschlich.
Er war im Haus.
Sie war mit einem Satz aus dem Bett.
Verdammt, Jacques, dachte sie, ohne die Ungewöhnlichkeit dieses Moments zu beachten, denn es war das erste Mal, daß sie einen kritischen Gedanken ihrem toten Mann gegenüber zuließ, und das auch noch in Gestalt eines Fluchs. Ich wußte vorhin, daß jemand im Haus ist, hätte ich mich darauf doch bloß verlassen!
Sie konnte ihr Zimmer von innen verriegeln und hätte sich damit vor dem Eindringling in Sicherheit bringen können, aber Bernadette schlief im Nebenzimmer und wie hätte sie sich hier einschließen sollen ohne ihr Kind? Sie stöhnte bei der Erkenntnis, daß ein Instinkt, fein wie der eines Wachhunds, sie geweckt und nach nebenan geführt hatte; sie hätte die Chance gehabt, sich Bernadette zu schnappen und mit ihr Zuflucht in diesem Zimmer zu suchen. Sie hatte die Chance vertan. Wenn er bereits diesseits der Glastür war, trennten ihn nur noch wenige Schritte von ihr.
Wie hypnotisiert starrte sie ihre Zimmertür an. Jetzt konnte sie, in ihrer eigenen atemlosen Stille, das leise Tappen von Schritten auf dem Flur hören.
Die Klinke bewegte sich ganz langsam nach unten.
Sie konnte ihre Angst riechen. Sie hatte nie vorher gewußt, daß Angst so durchdringend roch.
Ihr war jetzt sehr kalt, und sie hatte den Eindruck, nicht mehr zu atmen.
Als die Tür aufging und der Schatten des großen Mannes in ihrem Rahmen stand, wußte sie, daß sie sterben würde. Sie wußte es mit derselben Sicherheit, mit der sie kurz zuvor gespürt hatte, daß sie nicht allein im Haus war.
Einen Moment lang standen sie einander reglos gegenüber. War er überrascht, sie mitten im Zimmer stehend anzutreffen, nicht schlafend im Bett?
Sie war verloren. Sie stürzte zum Fenster. Ihre Finger zerrten an den Haken der hölzernen Läden. Ihre Nägel splitterten, sie schrammte sich die Hand auf, sie bemerkte es nicht.
Sie erbrach sich vor Angst über die Fensterbank, als er dicht hinter ihr war und sie hart an den Haaren packte. Er bog ihren Kopf so weit zurück, daß sie in seine Augen blikken mußte. Sie sah vollkommene Kälte. Ihre Kehle lag frei. Der Strick, den er ihr um den Hals schlang, schürfte ihre Haut auf.
Sie betete für ihr Kind, als sie starb.
Samstag, 6. Oktober 2001
1
Kurz vor Notre Dame de Beauregard sah er plötzlich einen Hund auf der Autobahn. Einen kleinen, braunweiß gefleckten Hund mit rundem Kopf und lustig fliegenden Schlappohren. Er hatte ihn zuvor nicht bemerkt, hätte nicht sagen können, ob er vielleicht schon ein Stück weit am Fahrbahnrand entlang getrabt war, ehe er das selbstmörderische Unternehmen begann, auf die andere Seite der Rennstrecke zu wechseln.
O Gott, dachte er, gleich ist er tot.
Die Autos schossen hier dreispurig mit Tempo 130 dahin. Es gab kaum eine Chance, unversehrt zwischen ihnen hindurch zu gelangen.
Ich will nicht sehen, wie sie ihn gleich zu Matsch fahren, dachte er, und die jähe Angst, die in ihm emporschoß, löste eine Gänsehaut auf seinem Kopf aus.
Ringsum bremsten die Autos. Niemand konnte stehen bleiben, dafür fuhr jeder mit zu hoher Geschwindigkeit, aber sie reduzierten ihr Tempo, versuchten, auf andere Spuren auszuweichen. Einige hupten.
Der Hund lief weiter, mit hoch erhobenem Kopf. Es grenzte an ein Wunder, oder vielleicht war es sogar ein Wunder, daß er den Mittelstreifen unbeschadet erreichte.
Gott sei Dank. Er hat es geschafft. Wenigstens so weit.
Der Mann merkte, daß ihm der Schweiß ausgebrochen war, daß das T-Shirt, das er unter seinem Wollpullover trug, nun an seinem Körper klebte. Er fühlte sich plötzlich ganz schwach. Er fuhr an den rechten Fahrbahnrand, brachte den Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Vor ihm erhob sich – sehr düster heute, wie ihm schien – der Felsen, auf dem Notre Dame de Beauregard ihren schmalen, spitzen Kirchturm in den grauen Himmel bohrte. Warum wurde der Himmel heute nicht blau? Gerade hatte er die Ausfahrt St. Remy passiert, es war nicht mehr weit bis zur Mittelmeerküste. Allmählich könnte der verhangene Oktobertag südlichere Farben annehmen.
Der kleine Hund fiel ihm wieder ein; der Mann verließ das Auto und blickte prüfend zurück. Er konnte ihn nirgends entdecken, nicht auf dem Mittelstreifen, aber auch nicht zu Brei gefahren auf einer der Fahrspuren. Ob es ihm geglückt war, die Autobahn auch noch in der Gegenrichtung zu überqueren?
Entweder, dachte er, man hat einen Schutzengel, oder man hat keinen. Wenn man einen hat, dann ist ein Wunder kein Wunder, sondern eine logische Konsequenz. Wahrscheinlich trabt der kleine Hund jetzt fröhlich durch die Felder. Die Erkenntnis, daß er eigentlich tot sein müßte, wird sich seiner nie bemächtigen.
Die Autos jagten an ihm vorbei. Er wußte, daß es nicht ungefährlich war, hier herumzustehen. Er setzte sich wieder in den Wagen, zündete eine Zigarette an, nahm sein Handy und überlegte einen Moment. Sollte er Laura jetzt schon anrufen? Sie hatten vereinbart, daß er sich von »ihrem« Rastplatz melden würde, von jenem Ort, an dem man zum erstenmal das Mittelmeer sehen konnte.
Er tippte stattdessen die Nummer seiner Mutter ein, wartete geduldig. Es dauerte immer eine ganze Weile, bis die alte Dame ihr Telefon erreichte. Dann meldete sie sich mit rauher Stimme: »Ja?«
»Ich bin es, Mutter. Ich wollte mich einfach mal melden.«
»Schön. Ich habe lange nichts mehr von dir gehört.« Das klang vorwurfsvoll. »Wo steckst du?«
»Ich bin an einer Tankstelle in Südfrankreich.« Es hätte sie beunruhigt zu hören, daß er auf dem Seitenstreifen einer Autobahn stand und weiche Knie hatte wegen eines kleinen Hundes, der gerade vor seinen Augen dem Tod von der Schippe gesprungen war.
»Ist Laura bei dir?«
»Nein. Ich bin alleine. Ich treffe Christopher zum Segeln. In einer Woche fahre ich wieder nach Hause.«
»Ist das um diese Jahreszeit nicht gefährlich? Das Segeln, meine ich.«
»Überhaupt nicht. Wir machen das doch jedes Jahr. Ist schließlich nie schiefgegangen.« Er sagte dies in einem bemüht leichten Ton, von dem er fand, daß er völlig unecht klang. Laura hätte jetzt nachgehakt und gefragt: »Ist irgend etwas? Stimmt was nicht? Du klingst merkwürdig.«
Aber seine Mutter würde es nicht einmal registrieren, wenn er im Sterben läge. Es war typisch für sie, besorgte Fragen zu stellen, wie die, ob das Segeln zu dieser Jahreszeit vielleicht gefährlich war. Möglich, daß sie sich tatsächlich Gedanken darum machte. Aber manchmal argwöhnte er, daß sie Fragen dieser Art routinemäßig abschoß und sich für deren Beantwortung schon nicht mehr interessierte.
»Britta hat angerufen«, sagte sie.
Er seufzte. Es bedeutete nie etwas Gutes, wenn sich seine Ex-Frau mit seiner Mutter in Verbindung setzte.
»Was wollte sie denn?«
»Jammern. Du hast wieder irgendeine Zahlung an sie nicht überwiesen, und angeblich reicht ihr Geld vorne und hinten nicht.«
»Das soll sie mir selber sagen. Sie braucht sich nicht hinter dich zu klemmen.«
»Du würdest dich regelmäßig verleugnen lassen, wenn sie dich im Büro anruft, behauptet sie. Und daheim … Sie sagt, sie hätte wenig Lust, immer an Laura zu geraten.«
Er bereute es, seine Mutter angerufen zu haben. Irgendwie gab es stets Ärger, wenn er das tat.
»Ich muß Schluß machen, Mutter«, sagte er hastig, »mein Handy hat kaum noch Saft. Ich umarme dich.«
Warum habe ich das gesagt? überlegte er. Warum dieses alberne Ich umarme dich. So reden wir normalerweise gar nicht miteinander.
Es gelang ihm mit einiger Anstrengung, sich von der Standspur wieder in den Verkehr einzufädeln. Er hatte es nicht allzu eilig, pendelte sich auf einer Geschwindigkeit von hundertzwanzig Stundenkilometern ein. Ob seine Mutter nun auch über diesen letzten Satz nachdachte, der für sie eigenartig geklungen haben mußte?
Nein, entschied er, tat sie nicht. Der letzte Satz war an ihr vermutlich ebenso vorbeigerauscht, wie auch sonst alles, was mit anderen Menschen zu tun hatte, von ihr herausgefiltert wurde.
Er fand einen Radiosender, stellte die Musik auf dröhnende Lautstärke. Mit Musik konnte er sich betäuben, so sicher wie andere mit Alkohol. Es kam nicht darauf an, was er hörte. Es mußte nur laut genug sein.
Gegen achtzehn Uhr erreichte er den Rastplatz, von dem aus er Laura anrufen wollte. Wenn sie zusammen nach Südfrankreich fuhren, hielten sie stets an dieser Stelle an, stiegen aus und genossen den Blick auf die Bucht von Cassis mit ihren sie halbmondförmig umfassenden, sanft ansteigenden Weinbergen und auf die oberhalb der Bucht steil aufragenden Felsen. Fuhr er allein – zu dem alljährlichen Segeltörn mit Christopher –, dann rief er Laura von diesem Platz aus an. Dies gehörte zu den stillschweigenden Übereinkünften zwischen ihnen, von denen es viele gab. Laura liebte Rituale, liebte unverrückbar wiederkehrende Momente zwischen ihnen. Er selber hing nicht so daran, hatte aber auch nicht den Eindruck, daß ihre Vorliebe dafür ihn wirklich störte.
Er fuhr die langgezogene, ansteigende Kurve zum Parkplatz hinauf. Der Ort hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den sonst üblichen Autobahnraststätten. Eher handelte es sich um einen Ausflugsplatz, um eine Art große Picknickterrasse mit steinernen Sitzgruppen, kiesbestreuten Wegen, schattenspendenden Bäumen. Der Blick war atemberaubend. Für gewöhnlich überwältigten ihn das Blau des Himmels und das Blau des Meeres. Heute jedoch würden sich die Wolken nicht mehr lichten. Grau und diesig hing der Himmel über dem Meer. Die Stille war schwül und bleiern. Die Luft roch nach Regen.
Ein trostloser Tag, dachte er, als er das Auto parkte und den Motor abschaltete.
Unweit von ihm saß ein anderer einsamer Mann in einem weißen Renault und starrte vor sich hin. Ein älteres Ehepaar hatte an einem der sechseckigen Tische Platz genommen und eine Thermosflasche vor sich hingestellt, aus der sie nun beide abwechselnd tranken. Aus einem Kleinbus quoll eine Familie, Eltern, dazu offensichtlich die Großeltern und eine unüberschaubare Schar von Kindern jeder Altersgruppe. Die Größeren trugen Pizzakartons, die Erwachsenen schleppten Körbe mit Wein- und Saftflaschen.
Wie idyllisch, dachte er, ein warmer Oktoberabend, und sie machen ein Picknick an einem wunderbaren Aussichtsort. Zwei Stunden können sie hier noch sitzen, dann wird es dunkel und kalt. Sie werden wieder alle in diesem Bus verschwinden und nach Hause fahren und satt und glücklich in ihre Betten fallen.
Er selber hatte eigentlich nie Kinder gewollt – sowohl sein Sohn aus erster Ehe als auch die zweijährige Tochter, die er mit Laura hatte, waren aus Unachtsamkeit entstanden –, aber manchmal überlegte er, wie es sich anfühlen mußte, Teil einer großen Familie zu sein. Er sah das keineswegs verklärt: Es bedeutete, ewig vor dem Badezimmer anstehen zu müssen und wichtige Dinge nicht zu finden, weil ein anderer sie ungefragt ausgeliehen hatte, es bedeutete jede Menge Lärm, Unordnung, Dreck und Chaos. Aber es mochte auch Wärme entstehen, ein Gefühl der Geborgenheit und Stärke. Es gab wenig Platz für Einsamkeit und die Angst vor der Sinnlosigkeit.
Zum zweitenmal tippte er eine Nummer in sein Handy. Er mußte nicht lange warten, sie meldete sich sofort. Offensichtlich hatte sie um diese Zeit mit seinem Anruf gerechnet und sich in der Nähe des Telefons aufgehalten.
»Hallo!« Sie klang fröhlich. »Du bist auf dem Pas d’Ouilliers!«
»Richtig!« Er bemühte sich, ihren heiteren, unbeschwerten Ton zu übernehmen. »Zu meinen Füßen liegt das Mittelmeer.«
»Glitzernd im Abendsonnenschein?«
»Eher nicht. Es ist sehr wolkig. Ich denke, es wird noch regnen heute abend.«
»Oh – das kann sich aber schnell ändern.«
»Natürlich. Da mache ich mir keine Sorgen. Sonne und Wind wären für Christopher und mich jedenfalls am schönsten.«
Sie war wesentlich feinfühliger als seine Mutter. Sie merkte, wie angestrengt er war.
»Was ist los? Du klingst merkwürdig.«
»Ich bin müde. Neun Stunden Autofahrt sind keine Kleinigkeit.«
»Du mußt dich jetzt unbedingt ausruhen. Triffst du Christopher noch heute abend?«
»Nein. Ich will früh ins Bett.«
»Grüße unser Häuschen!«
»Klar. Es wird sehr leer sein ohne dich.«
»Das wirst du vor lauter Müdigkeit kaum bemerken.« Sie lachte. Er mochte ihr Lachen. Es war frisch und echt und schien immer aus ihrem tiefsten Inneren zu kommen. Wie auch ihr Schmerz, wenn sie Kummer hatte. Bei Laura waren Gefühle niemals aufgesetzt oder halbherzig. Sie war der aufrichtigste Mensch, den er kannte.
»Kann sein. Ich werde schlafen wie ein Bär.« Er schaute auf das schiefergraue Wasser. Die Verzweiflung kroch bereits wieder langsam und bedrohlich in ihm hoch.
Ich muß, dachte er, von diesem Ort weg. Von den Erinnerungen. Und von dieser glücklichen Großfamilie mit den Pizzakartons und dem Gelächter und der Unbeschwertheit.
»Ich werde noch irgendwo etwas essen«, sagte er.
»Irgendwo? Du gehst doch sicher zu Nadine und Henri?«
»Das ist eine gute Idee. Eine leckere Pizza von Henri wäre jetzt genau das Richtige.«
»Rufst du später noch mal an?«
»Wenn ich im Haus bin«, sagte er. »Ich melde mich, bevor ich ins Bett gehe. In Ordnung?«
»In Ordnung. Ich freue mich darauf.« Durch das Telefon hindurch und über eintausend Kilometer hinweg konnte er ihr Lächeln spüren.
»Ich liebe dich«, sagte sie leise.
»Ich liebe dich auch«, erwiderte er.
Er beendete das Gespräch, legte das Handy neben sich auf den Beifahrersitz. Die Pizza-Familie verbreitete jede Menge Lärm, selbst durch die geschlossenen Wagenfenster drangen die Fetzen von Gesprächen und Gelächter. Er ließ den Motor wieder an und rollte langsam vom Parkplatz.
Die Dämmerung kam nun schnell, aber es lohnte sich nicht zu warten; es würde keinen Sonnenuntergang über dem Meer geben.
2
Als Peter um Viertel nach zehn noch nicht angerufen hatte, wählte Laura nach einigem Zögern seine Handy-Nummer. Er konnte sehr gereizt reagieren, wenn sie sich nicht an Vereinbarungen hielt – und in diesem Fall hatte die Vereinbarung gelautet, daß er sich wieder melden würde. Aber sie war ein wenig unruhig, konnte sich nicht vorstellen, daß er sich so lange beim Essen aufhielt. Er hatte so müde geklungen vier Stunden zuvor, so erschöpft, wie sie ihn ganz selten bisher erlebt hatte.
Er meldete sich nicht, nach sechsmaligem Klingeln schaltete sich seine Mailbox ein. »Bitte hinterlassen Sie mir eine Nachricht, ich rufe später zurück …«
Es drängte sie, ihm irgend etwas zu sagen, ihm etwas mitzuteilen von ihrer Sorge, ihrer Liebe, ihrer Sehnsucht, aber sie unterließ es, damit er sich nicht bedrängt fühlte. Vielleicht hatte er sich bei Nadine und Henri festgeredet, hörte das Handy nicht, hatte keine Lust, seine Unterhaltung zu unterbrechen, oder hatte das Gerät überhaupt im Auto vergessen.
Wenn ich jetzt bei Henri anrufe, fühlt sich Peter kontrolliert, dachte sie, und wenn ich in unserem Haus anrufe und er schläft vielleicht schon, wecke ich ihn auf.
»Manchmal«, sagte Peter oft zu ihr, »könntest du Dinge doch einfach auf sich beruhen lassen. Auf die eine oder andere Weise lösen sie sich, auch ohne daß du vorher deine ganze Umgebung verrückt gemacht hast.«
Trotzdem blieb sie noch einen Moment vor dem Telefonapparat stehen und überlegte, ob sie Christopher anrufen sollte. Peter hatte gesagt, er wolle an diesem Abend nicht mehr zu ihm, aber vielleicht hatte er es sich anders überlegt.
Es ist mein gutes Recht, anzurufen, dachte sie trotzig.
Christopher würde ihre Sorge verstehen. Er würde gar nichts dabei finden. Und dennoch würde Peter später behaupten, sie habe ihn vor seinem Freund blamiert.
»Christopher muß ja denken, ich bin ein Hund, der an der kurzen Leine gehalten wird. Du wirst nie das Wesen einer solchen Männerfreundschaft verstehen, Laura. Dazu gehört auch ein Stück Freiheit.«
»Ich glaube nicht, daß Christopher das als Problem sieht.«
»Er würde sich dazu nicht äußern. Weil er sich nicht einmischt und überhaupt ein gutmütiger Kerl ist. Aber er macht sich seine Gedanken, glaube mir.«
Und du schreibst deinem Freund Gedanken und Empfindungen zu, die in Wahrheit nur deine eigenen sind, dachte sie.
Sie ging die Treppe hinauf und schaute in Sophies Zimmer. Die Kleine schlief, atmete ruhig und gleichmäßig.
Vielleicht, überlegte Laura, hätte ich doch mitfahren sollen. Zusammen mit Sophie ein paar sonnige Oktobertage im Haus verbringen, während Peter segelt. Ich hätte mich nicht so einsam gefühlt.
Aber sie war noch nie mitgekommen, wenn Peter zu seinem herbstlichen Segeltreff in den Süden fuhr. Natürlich, bis vor vier Jahren hatten sie auch das Haus in La Cadière noch nicht gehabt, sie hätte in ein Hotel gehen müssen, und sie hielt sich nicht gerne allein im Hotel auf. Einmal – das mußte fünf Jahre her sein – hatte sie überlegt, bei Nadine und Henri zu wohnen, in einem der beiden gemütlichen und völlig unkomfortablen Gästezimmer unter dem Dach, die die beiden hin und wieder vermieteten.
»Ich hätte dann Anschluß, während du mit Christopher unterwegs bist«, hatte sie gesagt. Wieder einmal hatte sie geglaubt, die einwöchige Trennung von Peter nicht zu ertragen.
Doch Peter war dagegen gewesen.
»Ich halte es für ungeschickt, dieses eine Mal bei Nadine und Henri zu wohnen. Sonst tun wir es ja auch nicht, und sie denken dann vielleicht, sie sind normalerweise nicht gut genug für uns, aber im Notfall greifen wir auf sie zurück.«
Seitdem sie Besitzer eines eigenen Hauses waren, hätte sich das Problem nicht mehr gestellt, aber Peter hatte auf Lauras Andeutung, sie könne doch vielleicht mitkommen, nicht reagiert, und einen zweiten Anlauf hatte sie nicht nehmen wollen. Diese eine Oktoberwoche gehörte Christopher, und offenbar hätte es Peter schon gestört, Frau und Tochter auch nur in der Nähe zu wissen.
Sie ging ins Schlafzimmer, zog sich aus, hängte ihre Kleider ordentlich in den Schrank, zog das ausgeleierte T-Shirt an, das sie nachts immer trug. Peter hatte es ihr während ihres ersten gemeinsamen Urlaubs in Südfrankreich vor acht Jahren geschenkt. Damals war es noch bunt und fröhlich gewesen, aber inzwischen hatte es so viele Wäschen hinter sich gebracht, daß Laura sich darin nicht mehr sehen lassen wollte. Doch Peter hatte nicht zugelassen, daß sie es aussortierte.
»Zieh es wenigstens nachts an«, bat er, »ich hänge irgendwie daran. Es erinnert mich an eine ganz besondere Zeit in unserem Leben.«
Sie waren frisch verliebt gewesen damals. Laura war siebenundzwanzig gewesen, Peter zweiunddreißig. Er frisch geschieden, sie frisch getrennt. Beide angeschlagen, mißtrauisch, ängstlich, sich auf etwas Neues einzulassen. Peters Ex-Frau war unmittelbar nach vollzogener Scheidung mit dem gemeinsamen Sohn ans andere Ende Deutschlands gezogen, was Peters Besuchsrecht zur Farce machte und ihn in tiefste Einsamkeit gestürzt hatte. Er hatte länger gebraucht als Laura, sich für die gemeinsame Zukunft zu öffnen.
In dem alten T-Shirt ging sie ins Bad hinüber, putzte die Zähne und kämmte die Haare. Im Spiegel konnte sie sehen, daß sie blaß war und einen sorgenvollen Zug um den Mund hatte. Sie dachte an Photos, die sie in demselben T-Shirt acht Jahre zuvor in den Straßen von Cannes zeigten: braungebrannt, strahlend, mit leuchtenden Augen. Von der Liebe in mitreißender Heftigkeit getroffen. Überwältigt und wunschlos glücklich.
»Das bin ich heute auch noch«, sagte sie zu ihrem Spiegelbild, »wunschlos glücklich. Aber ich bin eben älter. Fünfunddreißig ist nicht dasselbe wie siebenundzwanzig.«
An der Ruckartigkeit, mit der sie den Kamm durch die Haare zog, erkannte sie, wie gespannt ihre Nerven waren.
Mein Mann ruft einmal nicht an, dachte sie, wie kann mich das derart aus dem Gleichgewicht werfen?
Von Freundinnen wußte sie, daß andere Männer in dieser Hinsicht viel lockerer waren. Sie vergaßen in der Hälfte aller Fälle, pünktlich oder überhaupt anzurufen, Vereinbarungen einzuhalten oder sich wichtige Termine der Partnerin zu merken. Lauras Mutter Elisabeth sagte immer, Laura habe mit Peter ein Prachtexemplar erwischt.
»Er ist sehr zuverlässig und auf dich konzentriert. Halte ihn nur gut fest. So etwas findest du so leicht nicht noch einmal.«
Sie wußte das. Und sie wollte auch nicht kleinlich sein. Aber gerade weil Peter immer so zuverlässig war, wurde sie ein Gefühl der Beunruhigung nicht los.
Natürlich war sie zudem viel zu fixiert auf ihn – ihre Freundin Anne sagte das auch immer –, aber schließlich …
Das Telefon klingelte und unterbrach ihre quälenden Gedanken.
»Endlich«, rief sie und lief ins Schlafzimmer, wo ein Apparat neben ihrem Bett stand.
»Ich dachte schon, du bist einfach eingeschlafen und hast mich vergessen«, sagte sie anstelle einer Begrüßung.
Am anderen Ende der Leitung konsterniertes Schweigen.
»Ich kann mir eigentlich nicht denken, daß Sie mich meinen«, sagte schließlich Britta, Peters Ex-Frau.
Laura war ihr Versehen sehr peinlich.
»Entschuldigen Sie bitte. Ich dachte, es sei Peter.«
Brittas Stimme hatte wie immer einen anklagenden Unterton. »Demnach ist Peter wohl nicht daheim? Ich müßte ihn sehr dringend sprechen.«
Samstag abend um halb elf, dachte Laura verärgert, nicht gerade die übliche Zeit, nicht einmal für geschiedene Gattinnen.
»Peter ist nach La Cadière gefahren. Er wird erst nächsten Samstag zurückkommen.«
Britta seufzte. »Von Christopher und diesem verdammten Segeln im Herbst kommt er wohl nie mehr los. Das geht doch jetzt schon seit bald fünfzehn Jahren so.«
Britta demonstrierte immer wieder gern, daß sie über Peters Vorlieben und Besonderheiten bestens informiert war und daß sie ihn überhaupt schon viel länger kannte als Laura.
»Gott sei Dank«, fügte sie nun hinzu, »habe ich ja mit all dem nichts mehr zu tun.«
»Soll ich Peter bitten, Sie anzurufen, wenn er sich bei mir meldet?« fragte Laura, ohne auf die letzte Bemerkung Brittas einzugehen.
»Ja, unbedingt. Die Unterhaltszahlung für Oliver ist noch immer nicht auf meinem Konto eingegangen, und wir haben heute schon den sechsten Oktober!«
»Nun, ich finde …«
»Ich meine natürlich die Zahlung für September. Die ich am ersten September hätte bekommen sollen. Ich denke nicht, daß ich mich deswegen zu früh melde. Die Zahlung für Oktober ist übrigens auch noch nicht da.«
»Soviel ich weiß, hat Peter dafür einen Dauerauftrag eingerichtet«, sagte Laura, »vielleicht ist der Bank irgendein Fehler unterlaufen.«
»Den Dauerauftrag gibt es schon seit einem Jahr nicht mehr«, erklärte Britta und konnte ihren Triumph über diesen Wissensvorsprung gegenüber der aktuellen Ehefrau kaum verbergen. »Peter überweist selbst und leider fast immer mit einiger Verspätung. Es ist schon manchmal ärgerlich, wie lange ich auf mein Geld warten muß. Es ist auch für Oliver nicht gut. Es erschüttert das Vertrauen, das er trotz allem noch immer in seinen Vater hat, wenn ich ihm erkläre, daß ich ihm irgend etwas nicht kaufen kann, weil Peter wieder einmal mit dem Unterhalt in Verzug ist!«
Laura mußte sich beherrschen, um ihr nicht eine patzige Antwort zu geben. Sie wußte, daß Britta als Leiterin einer Bankfiliale recht gut verdiente und kaum je in die Verlegenheit kommen dürfte, ihrem Sohn einen Wunsch abschlagen zu müssen, nur weil Peter sein Geld ein paar Tage zu spät überwies. Wenn sie es dennoch tat, so konnte dies nur dem Zweck dienen, das Bild, das Oliver von seinem Vater hatte, negativ zu beeinflussen.
»Ich werde mit Peter sprechen, sowie er sich meldet«, sagte Laura, »er wird Sie dann anrufen. Ich bin sicher, es gibt irgendeine ganz harmlose Erklärung.«
»Vielleicht ruft er ja doch noch heute abend an«, meinte Britta spitz. Aus der Art, wie sich Laura gemeldet hatte, hatte sie natürlich geschlossen, daß Laura dringend auf einen Anruf wartete und schon ein wenig entnervt war. »Ich wünsche es Ihnen jedenfalls. Er kann mich dann morgen zu Hause erreichen. Gute Nacht.« Sie legte auf, noch ehe Laura sich ebenfalls verabschieden konnte.
»Schlange!« sagte Laura inbrünstig und hängte ein.
Peter hätte mir sagen können, daß er den Dauerauftrag gekündigt hat, dachte sie, dann hätte ich jetzt nicht so dumm dagestanden.
Aber hatte sie überhaupt dumm dagestanden? Und war die Kündigung eines Dauerauftrages wichtig genug, daß Peter sich hätte veranlaßt sehen müssen, dies zu erwähnen? Es mochte ihre übliche Empfindlichkeit sein, die wieder einmal das Gefühl aufkommen ließ, schlecht behandelt worden zu sein. Niemand außer ihr hätte so empfunden. Jede andere Frau hätte die Angelegenheit als das gesehen, was sie war: eine Schlamperei mit der Zahlung. Eine Ex-Frau, die Gift spritzte, weil sie sich nicht damit abfinden konnte, daß ihr geschiedener Mann in einer zweiten Ehe glücklich geworden war, während sie selbst wohl für immer allein bleiben würde.
Ich muß aufhören, sagte sich Laura, dieser Frau gegenüber Minderwertigkeitsgefühle zu haben. Sie ist viel älter als ich, sie ist frustriert und wahrscheinlich ziemlich unglücklich. Sie hat sich ihr Leben ganz anders vorgestellt, als es nun verlaufen ist.
Sie schaute noch einmal in Sophies Zimmer, doch dort war alles wie zuvor; die Kleine schlief und hatte heiße, rote Bäckchen, die sie immer bekam, wenn sie sich tief im Traum befand.
Laura ging ins Schlafzimmer. Kurz betrachtete sie das gerahmte Photo von Peter, das auf ihrem Nachttisch stand. Es zeigte ihn an Bord der Vivace, dem Schiff, das ihm und Christopher gemeinsam gehörte. Eigentlich war auch Christopher auf dem Bild gewesen, aber sie hatte ihn weggeschnitten, und man sah am Rand nur noch ein Stück von seinem Arm und seine Hand. Peter trug ein blaues Hemd und hatte einen weißen, grobgestrickten Pullover lässig um die Schultern geknotet. Er lachte. Seine Haut war gebräunt, er sah gesund und zufrieden aus. Im Einklang mit sich selbst, ungekünstelt und unverstellt. Er hatte sein Vivace-Gesicht. So sah er immer aus, wenn er sich an Bord des Schiffs befand. Manchmal war es, als werde er dann ein neuer Mensch.
»Schiffsplanken unter den Füßen«, pflegte er zu sagen, »ein im Wind flatterndes Segel und die Schreie der Möwen. Mehr brauche ich nicht, um glücklich zu sein.«
Jedesmal tat es ihr weh, daß sie in dieser Aufzählung nicht vorkam. Einmal hatte sie gesagt: »Und mich? Mich brauchst du nicht, um glücklich zu sein?«
Er hatte sie groß angeschaut. »Das ist doch eine ganz andere Ebene. Das weißt du doch.«
Sie legte sich ins Bett und zog die Decke bis zum Kinn. Draußen konnte sie den Regen rauschen hören. Es war kalt im Zimmer, sie hatte den ganzen Tag das Fenster offen gelassen, und die Heizung war noch nicht wieder eingeschaltet. Aber sicher würde sie gut schlafen können in der frischen Luft.
Sie seufzte, blickte auf das Leuchtzifferblatt des Weckers neben ihrem Bett. Es war zehn Minuten vor elf.
Sonntag, 7. Oktober
1
Sie schlief fast gar nicht in dieser Nacht. Zeitweise hatte sie den Eindruck, als betrachte sie das Umspringen der Zahlen auf dem Wecker. Vermutlich war es auch so. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie die Uhr an. Es wurde halb eins. Es wurde eins. Zehn nach eins. Zwanzig nach eins. Halb zwei.
Um Viertel vor zwei stand sie auf und ging in die Küche hinunter, um ein Glas Wasser zu trinken. Sie fror in dem leichten T-Shirt, fand aber ihren Bademantel nicht. Die Fliesen in der Küche waren sehr kalt unter ihren nackten Füßen. Sie trank das Wasser in kleinen Schlucken und starrte den Rolladen vor dem Fenster an. Sie wußte, daß ihr Verhalten neurotisch war. Was war schon passiert? Ihr Mann war nicht daheim und hatte vergessen, sie vor dem Einschlafen noch einmal anzurufen. Morgen früh würde er sich melden. Er würde ihr erklären, daß er sich ins Bett gelegt und noch ein wenig gelesen hatte, und daß er darüber plötzlich eingeschlafen sei. Er war zu müde gewesen. Sie erinnerte sich, noch darüber nachgedacht zu haben. Über seine ungewöhnliche Müdigkeit. Er hatte erschöpfter geklungen, als sie ihn je erlebt hatte. Kein Wunder, daß ihm an solch einem Tag ein derartiges Versäumnis unterlief. Daß er anzurufen vergaß. Daß er …
Die Vernunft, mit der sie ihre Unruhe unter Kontrolle hatte bringen wollen, löste sich bereits wieder auf. Die Angst – ein Gefühl hoffnungslosen Alleinseins – schoß wie eine Stichflamme in ihr hoch. Sie kannte dies, es war nicht neu für sie. Die Furcht vor dem Alleinsein hatte sie zeitlebens begleitet, und sie hatte nie gelernt, ihrer Herr zu werden. Sie überfiel sie aus heiterem Himmel, und es standen Laura keinerlei Waffen zur Verfügung, sich zu wehren. Auch jetzt brachen ihr Stolz und ihre Vorsicht, die sie den ganzen Abend über noch bewahrt hatte, zusammen. Sie ließ ihr Wasserglas stehen, lief ins Wohnzimmer, griff nach dem Telefonhörer und wählte Peters Handy-Nummer. Wiederum meldete sich am anderen Ende schließlich nur die Mailbox. Diesmal hinterließ sie eine Nachricht.
»Hallo, Peter, ich bin es, Laura. Es ist fast zwei Uhr nachts, und ich mache mir Sorgen, weil du nicht angerufen hast. Und warum gehst du nicht an dein Telefon? Ich weiß, es ist albern, aber … «, sie merkte, daß ihre Stimme weinerlich wie die eines kleinen Kindes klang, »ich fühle mich so allein. Das Bett ist groß und leer ohne dich. Bitte, melde dich doch!«
Sie legte auf. Das Sprechen hatte sie ein wenig erleichtert. Zudem hatte sie seine Stimme in der Ansage gehört, und auch dies hatte etwas von einer Kontaktaufnahme – wenn sie auch höchst einseitig war.
Sie trank sehr selten Alkohol, aber nun schenkte sie sich etwas von dem Schnaps ein, der für Gäste auf einem silbernen Servierwagen stand. Das Zimmer wurde nur beleuchtet von der Lampe, die draußen im Flur brannte, und wie immer, wenn sie hier drinnen stand, erfreute sich Laura an seiner besonderen Schönheit. Das Wohnzimmer war ihr besonders gut gelungen, und das erfüllte sie mit Stolz. Um die Einrichtung des Hauses hatte sie sich praktisch allein gekümmert, damals vor vier Jahren, als sie es gekauft hatten und in den feinen Frankfurter Vorort gezogen waren. Peter hatte zu dieser Zeit besonders viel zu tun gehabt, hatte ihr alles allein überlassen.
»Geld spielt keine Rolle«, hatte er gesagt und ihr seine Kreditkarte in die Hand gedrückt, »kauf, was dir gefällt. Du hast einen wunderbaren Geschmack. Wie immer du es machst, ich werde es lieben.«
Sie war glücklich gewesen, eine Aufgabe zu haben. Für gewöhnlich wurden ihr die Tage oft ein wenig lang; zwar half sie Peters Sekretärin hin und wieder bei der Buchhaltung, aber diese Tätigkeit füllte sie nicht aus und befriedigte sie nicht. Sie war Künstlerin. Es machte ihr keinen Spaß, Papiere zu ordnen, Belege zu sortieren und Zahlenkolonnen zu addieren. Sie tat es, um Peter zu entlasten. Aber ständig wünschte sie, sie könnte …
Nein. Wie üblich brach sie beim Gedanken an ihre eigenen Wünsche sogleich ab. Es war nicht gut, unrealistischen Träumen nachzuhängen. Ihr Leben war wunderbar, ihr Leben war besser als das vieler anderer Menschen. Sie hatte dieses zauberhafte Haus eingerichtet, sie dekorierte es fast täglich um, liebte es, in kleinen Antikgeschäften oder Kunstgewerbeläden zu stöbern, schöne Dinge zu entdecken und nach Hause zu tragen und an dem Nest zu bauen, das sie sich zusammen mit Peter geschaffen hatte.
Wie schön es ist, dachte sie nun wieder, und wie friedlich. Die neuen Vorhänge sehen wunderschön aus.
Sie hatte sie am Vortag von Peters Abreise geholt, aus einem italienischen Geschäft. Sie waren sündteuer gewesen, aber sie fand, daß sie ihr Geld wert waren. Mit großer Mühe hatte sie sie aufgehängt und abends darauf gewartet, was Peter sagen würde, aber er hatte sie zunächst überhaupt nicht bemerkt. Er war sehr in Gedanken gewesen, als er gegen acht Uhr aus dem Büro kam. Irgend etwas schien ihn heftig zu beschäftigen; Laura nahm an, daß es die bevorstehende Reise war. Jetzt, da sie so im Wohnzimmer stand und ihren Schnaps trank, langsam und widerwillig, weil sie Schnaps eigentlich nicht mochte, sah sie es wieder genau vor sich: Sie standen hier gemeinsam, fast an der gleichen Stelle, an der sie nun allein stand.
»Fällt dir nichts auf?« fragte sie.
Peter sah sich um. Sein Gesicht war müde, er schien geistesabwesend. »Nein. Sollte mir etwas auffallen?«
Sie war natürlich etwas enttäuscht, aber sie sagte sich, daß er in Gedanken längst auf dem Segelboot war, und daß ihm die Vorfreude auf seinen Urlaub auch zustand.
»Wir hatten doch immer gesagt, daß die blauen Vorhänge nicht so schön zum Teppich passen«, half sie ihm auf die Sprünge.
Endlich glitt sein Blick zu den Fenstern.
»Oh«, sagte er, »neue Vorhänge.«
»Gefallen sie dir?«
»Sie sind sehr schön. Wie gemacht für dieses Zimmer.« Irgendwie klang es unecht. Als täusche er nur vor, erfreut zu sein. Aber vielleicht bildete sie sich das auch nur ein.
»Ich habe sie aus diesem italienischen Einrichtungsgeschäft. Weißt du? Ich hatte dir davon erzählt.«
»Ja, richtig. Sehr apart, wirklich.«
»Ich habe dir die Rechnung auf den Schreibtisch gelegt«, sagte sie.
»Okay.« Er nickte zerstreut. »Ich werde jetzt meine Sachen für die Reise packen. Ich will nicht zu spät ins Bett.«
»Könntest du die Überweisung noch fertig machen? Sonst wird es vielleicht ein bißchen spät, bis du wieder zu Hause bist.«
»Alles klar. Ich denke daran.« Er verließ langsam das Zimmer.
Die Überweisung fiel ihr nun auf einmal wieder ein. Paradoxerweise hatte ihr der Alkohol einen klaren Kopf verschafft. Die kurze panische Anwandlung wegen ihres Alleinseins war verschwunden. Sie konnte wieder nüchtern denken, und obwohl die Frage nach der Rechnung nicht wirklich bedeutsam war, ging sie hinüber ins Arbeitszimmer, um nachzusehen, ob sie erledigt war.
Das Arbeitszimmer war ein kleiner Raum zwischen Küche und Wohnzimmer, zum Garten hin ganz verglast und ursprünglich als eine Art Wintergarten gedacht. Laura hatte einen schönen alten Sekretär, den sie vor Jahren in Südfrankreich entdeckt hatte, hineingestellt, dazu ein hölzernes Regal und einen kuscheligen Sessel. Sie teilte sich dieses Zimmer mit Peter: Hier machte sie die Buchhaltung, hier arbeitete Peter an den Wochenenden oder am Abend.
Sie knipste das Licht an und sah sofort, daß die Rechnung noch auf dem Tisch lag. Genau da, wo sie sie hingelegt hatte. Vermutlich hatte Peter sie nicht einmal angesehen, geschweige denn bezahlt.
Es war ein ungünstiger Tag, dachte sie, so kurz vor der Abreise. Da hatte er einfach andere Dinge im Kopf.
Langsam stieg sie wieder die Treppe hinauf. Vielleicht würde der Schnaps ihr helfen, endlich einzuschlafen.
Es blieb bei dem Wunsch. Sie lag wach bis zum Morgengrauen. Um sechs Uhr stand sie auf, vergewisserte sich, daß Sophie noch schlief, und ging zum Joggen. Es regnete noch immer, und der Wind schien kälter geworden zu sein seit dem vergangenen Tag.
2
Es regnete an diesem Sonntagmorgen auch an der Côte de Provence. Nach der langen trockenen, sommerlichen Periode brachte diese zweite Oktoberwoche nun den Wetterwechsel. Die Natur brauchte den Regen zweifellos.
Die Wolken ballten sich an den Bergen des Hinterlandes, hingen schwer über den Hängen. Die Weinberge mit ihrem bunten Laub leuchteten nicht wie sonst in der Herbstsonne, sondern blickten trübe unter nassen Schleiern hervor. Auf Straßen und Feldwegen standen Pfützen. Der Wind kam von Osten, was bedeutete, daß sich das schlechte Wetter zunächst festsetzen würde.
Cathérine Michaud war früh aufgestanden, wie es ihre Gewohnheit war. Blieb sie zu lange wach im Bett liegen, konnte sie allzu leicht ins Grübeln geraten, und das war gefährlich. Am Schluß fing sie an zu weinen oder steigerte sich in das ohnehin stets latent vorhandene Gefühl von Haß und Verbitterung hinein und wußte dann kaum noch wohin mit ihren aufgewühlten Emotionen.
Sie hatte sich einen Kaffee gemacht und war, die Finger an der Tasse wärmend, in ihrer Wohnung auf und ab gegangen, von der Küche ins Wohnzimmer, dann ins Schlafzimmer, dann wieder in die Küche. Das Bad hatte sie gemieden. Cathérine haßte das Bad in dieser Wohnung. Es erinnerte sie an eine Art hohe, enge Schlucht, in die von irgendwoher ganz weit oben ein Streifen fahles Licht einsickerte. Der Boden bestand aus kalten, grauen Steinfliesen, in die der Schmutz ganzer Generationen von Bewohnern eingedrungen war und sich nicht mehr entfernen ließ. Die blaßgelben Kacheln, die einen knappen Meter hoch die Wände ringsum bedeckten, hatten abgeschlagene Ecken, und in eine Kachel, gleich neben dem Waschbecken, hatte irgendeiner von Cathérines Vorgängern ein aggressives Fuck you eingeritzt. Cathérine hatte versucht, direkt darüber einen Handtuchhalter anzubringen, um die Obszönität mit ihrem Badetuch zu verdecken, aber der Haken war nach zwei Tagen herausgebrochen, und das nun in der Wand gähnende Loch machte die Sache nicht besser.
Das Fenster befand sich so weit oben, daß man auf die Toilette steigen mußte, um es zu öffnen. Stand man am Waschbecken vor dem Spiegel, dann fiel das Licht von dort in einem höchst ungünstigen Winkel auf das Gesicht. Man sah immer hoffnungslos grau und elend aus und Jahre älter, als man tatsächlich war.
Der Spiegel war es auch, der Cathérine an diesem Morgen das Bad meiden ließ. Mehr noch als die atemberaubende Häßlichkeit des Raums machte ihr heute ein Blick auf das eigene Gesicht zu schaffen – wie an vielen anderen Tagen allerdings auch. In der vergangenen Woche hatte sie sich noch ein wenig besser gefühlt, aber in der letzten Nacht war sie aufgewacht von einem Brennen im Gesicht, ein Gefühl, als sei nicht ihr Körper, aber ihre Haut von einem Fieber befallen. Sie hatte leise ins Kissen gestöhnt, hatte sich mühsam beherrscht, nicht die Fingernägel ihrer beider Hände in ihre Wangen zu schlagen und sich in ihrer Verzweiflung die Haut von den Knochen zu fetzen. Es war wieder losgegangen. Warum eigentlich hoffte sie immer wieder in den Phasen der Ruhe, die Krankheit habe sie dieses Mal endgültig verlassen, sei zum Erliegen gekommen, habe beschlossen, sich mit dem zu begnügen, was sie bereits angerichtet hatte? Gott – oder wer auch immer dahintersteckte – könnte den Spaß verlieren, könnte endlich zufrieden sein mit seinem Werk der Zerstörung und sich einem neuen Opfer zuwenden. Die Hoffnung hatte sich noch jedes Mal als trügerisch erwiesen. Im Abstand von wenigen Wochen – im Höchstfall mochten es zwei oder drei Monate sein – brach die Akne über Nacht aus; heimtückisch verschonte sie Rücken, Bauch und Beine und konzentrierte sich ganz auf Gesicht und Hals, tobte sich dort aus, wo es für Cathérine keine Möglichkeit gab, die häßlichen eitrigen Pusteln zu verstecken. Sie blühte einige Tage lang und ebbte dann langsam ab, hinterließ Narben, Krater, Erhebungen, Rötungen und undefinierbare Flecken. Cathérine litt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr unter der Krankheit, und heute, mit zweiunddreißig Jahren, sah ihr Gesicht aus, als sei sie Opfer eines grausamen Anschlags geworden. Sie war entstellt, auch in den Phasen, in denen die Akne ruhte.
Mit dicken Schichten von Make-up und Puder konnte sie sie dann jedoch wenigstens notdürftig tarnen. Im Akutzustand hatte das keinen Sinn und verschlimmerte alles nur noch.
Das Jucken in ihrem Gesicht und die engen Wände ihrer düsteren, alten Wohnung machten sie bald so nervös, daß sie beschloß, trotz allem hinauszugehen und in einem Café an der Hafenpromenade zu frühstücken. Ihre Wohnung – in einer der engen, dunklen Gassen der Altstadt von La Ciotat gelegen – war von so bedrückender Atmosphäre, daß sie es manchmal kaum mehr ertragen konnte. Im Sommer, wenn das Land in der Hitze stöhnte, mochten jedoch Schatten und Kühle dort noch angenehm sein. Im Herbst und Winter herrschte eine Stimmung tiefster Depression.
Sie zog einen leichten Mantel an und schlang einen Schal um den Hals, zog ihn dann hinauf und versuchte, Kinn und Mund notdürftig damit abzudecken. Die Gasse, die sie empfing, war feucht und lichtarm. Die Häuser standen sich dicht gegenüber und schienen sich einander zuzuneigen. Der Regen fiel fein und stetig. Mit raschen Schritten und gesenktem Kopf hastete Cathérine durch die Straßen, auf denen sich an diesem frühen Morgen und bei dem schlechten Wetter glücklicherweise kaum Menschen aufhielten. Ein älterer Mann kam ihr entgegen und glotzte sie an. Sie merkte, daß ihr Schal verrutscht war. Sie wußte, wie abstoßend ihre Haut aussah. Fast konnte sie es den Leuten nicht verdenken, daß sie zurückzuckten.
Sie atmete leichter, als sie aus der letzten Häuserreihe heraustrat und das Meer vor sich sah. Träge schwappte es gegen die Kaimauern, grau wie der Himmel, ohne das Leuchten, das ihm sonst entstieg. Die gewaltigen Kräne im Hafen ragten vor der Kulisse des Adlerfelsens empor; Relikte aus dem Krieg, von den Nazis errichtet und so gründlich verankert, daß es ein Vermögen kosten würde, sie zu entfernen; sie blieben also und sorgten in ihrer stählernen Häßlichkeit dafür, daß La Ciotat niemals ein attraktiver Touristenort am Mittelmeer werden konnte, daß ihm für immer der Eindruck einer grauen Arbeiterstadt anhaften würde.
Eine häßliche Stadt, dachte Cathérine, wie geschaffen für eine häßliche Frau.
Sie ging ins Bellevue schräg gegenüber vom Hafen, das einzige Café, das am Sonntag zu dieser frühen Stunde schon geöffnet hatte. Der Wirt kannte sie seit Jahren, sie konnte sich also mit ihrem entstellten Gesicht zeigen. Sie setzte sich in eine der hinteren Ecken und zog den Schal vom Hals.
»Einen café crème«, sagte sie, »und ein Croissant.«
Philipe, der Wirt, musterte sie mitleidig. »Wieder mal schlimm heute, nicht?«
Sie nickte, bemühte sich um einen leichten Ton. »Kann man nichts machen. Die Geschichte behält ihren Rhythmus. Ich war eben wieder fällig.«
»Ich bringe Ihnen jetzt einen richtig schönen Kaffee«, sagte Philipe eifrig, »und mein größtes Croissant.«
Er meinte es gut, aber sein offensichtliches Mitleid tat ihr weh. Es gab nur diese zwei Möglichkeiten, wie Menschen mit ihr umgingen: voller Mitleid oder mit Abscheu.
Manchmal wußte sie nicht, was schwerer zu ertragen war.
Das Bellevue hatte eine überdachte Terrasse zur Straße hin, die in der kalten Jahreszeit mit einer durchsichtigen Kunststoffwand nach vorn geschützt war. Cathérine konnte die Straße beobachten, die sich allmählich etwas stärker bevölkerte. Zwei Joggerinnen, begleitet von einem kleinen, wieselflinken Hund, trabten vorüber; ab und zu kam ein Auto vorbei; ein Mann mit einem riesigen Baguette unter dem Arm schlug den Weg in Richtung Altstadt ein. Cathérine stellte sich vor, wie sehnsüchtig er daheim erwartet wurde, von seiner Frau und seinen Kindern. Ob er eine große Familie hatte? Oder vielleicht war er nur mit einer Freundin zusammen, einer hübschen, jungen Frau, die noch im Bett lag und schlief und die er mit einem Frühstück überraschen wollte. Sie hatten einander geliebt in der Nacht, der Morgen danach war friedlich, und den Regen bemerkten sie kaum. Die junge Frau hatte wahrscheinlich rosige Wangen, und er sah sie ebenso verliebt wie bewundernd an.
Sie haßte solche Frauen!
»Ihr Kaffee«, sagte Philipe, »und Ihr Croissant!«
Schwungvoll stellte er beides vor sie hin, schaute dann sorgenvoll hinaus. »Heute regnet es nur einmal«, prophezeite er.
Sie rührte ein einsames Stück Zucker in ihre einsame Tasse, spürte, daß Philipe noch etwas sagen wollte, und hoffte, er werde es nicht tun, weil es nur wieder zu neuen Schmerzen führen konnte.
»Mit Ihrem Gesicht«, sagte er verlegen und konnte sie dabei nicht ansehen, »ich meine, was sagen die Ärzte denn da? Sie gehen doch sicher zu Ärzten?«
Ihr lag eine patzige Antwort auf den Lippen, aber sie schluckte sie hinunter. Philipe konnte nichts für ihr Elend, und zudem mochte sie sich mit ihm nicht überwerfen. Wenn sie in seine Kneipe nicht mehr gehen konnte, hatte sie keinen Anlaufort mehr außerhalb ihrer Wohnung.
»Natürlich«, sagte sie, »ich war bei unzähligen Ärzten. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was nicht probiert wurde. Aber …« Sie zuckte mit den Schultern. »Man kann mir nicht helfen.«
»Das gibt es doch gar nicht«, ereiferte sich Philipe. »Daß eine Frau so herumlaufen muß … Ich meine, die können zum Mond fliegen und Herzen transplantieren … aber mit so einer Geschichte werden sie nicht fertig!«
»Es ist aber so«, sagte Cathérine und fragte sich, was sie seiner Ansicht nach auf seine Bemerkungen hin erwidern sollte. »Ich kann nur hoffen, daß irgendwann ein Arzt einen Weg findet, mir zu helfen.«
»Woher kommt das denn?« Philipe hatte nun eine Hemmschwelle überschritten, starrte sie unverhohlen an und verbiß sich in das Thema. »Dazu muß es doch eine Theorie geben!«
»Da gibt es viele Theorien, Philipe. Sehr viele.« Sie sah, daß eine Frau mit zwei Kindern den Raum betrat, und hoffte inständig, Philipe werde sich nun diesen neu hinzugekommenen Gästen zuwenden. »Es wird schon alles werden«, meinte sie in abschließendem Ton und hätte am liebsten zu heulen begonnen. Ihr Gesicht brannte wie Feuer.
»Nur den Kopf nicht hängen lassen«, sagte Philipe und ließ sie endlich in Ruhe. Sie atmete tief. Für den Moment tendierte sie wieder einmal dazu, Mitleid schlimmer zu finden als Abscheu.
Die beiden Kinder starrten zu ihr herüber. Sie mochten acht und neun Jahre alt sein, zwei hübsche Mädchen mit dunklen Locken und etwas mißmutigen Gesichtern.
»Was ist mit der Frau?« fragte die Jüngere und zupfte am Ärmel ihrer Mutter. »Mama, was ist denn mit ihrem Gesicht?«
Der Mutter war die laute Frage der Tochter sichtlich peinlich. Sie zischte ihr zu, sie solle den Mund halten. »Jetzt sieh doch nicht dauernd hin. Das tut man nicht. Das ist eine ganz arme Frau, da darf man nicht so taktlos sein!«
Ihr Gesicht brannte heftiger. Sie wagte nicht mehr, von ihrer Kaffeetasse aufzublicken. Der Appetit auf das Croissant war ihr vergangen. Aber auch das Bedürfnis zu heulen. Jetzt spürte sie wieder den Haß, der so häufig neben der Traurigkeit ihr Begleiter war. Den Haß auf alle, die gesund waren, die schön waren, die geliebt wurden, die begehrt wurden, die ihr Leben genießen konnten.
Warum, murmelte sie unhörbar, warum denn nur?
»Darf ich mich zu dir setzen?« fragte eine Männerstimme, und sie schaute hoch. Es war Henri, und obwohl er sie länger kannte als irgendein Mensch sonst, vermochte er für eine Sekunde nicht sein Erschrecken über ihr Gesicht zu verbergen.
ENDE DER LESEPROBE
2. Auflage
Taschenbuchausgabe August 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2002, 2009 bei Verlagsgruppe
Random House GmbH Umschlaggestaltung: bürosüd, München Umschlagfoto: Getty Images / Altrendo Travel
Lektorat: SKW
Herstellung: RF
eISBN 978-3-641-13811-0
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de