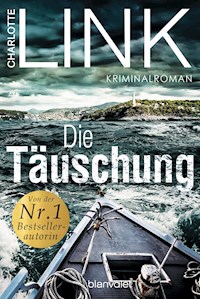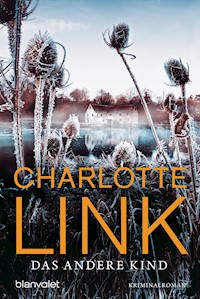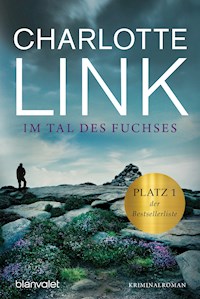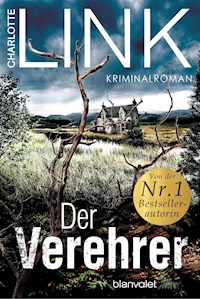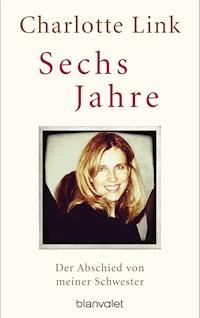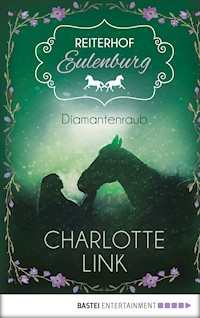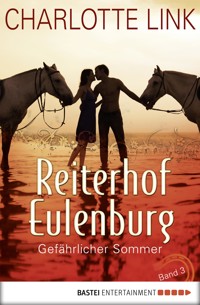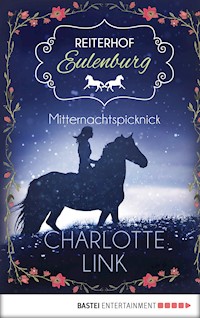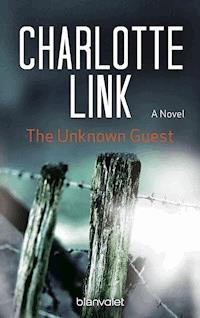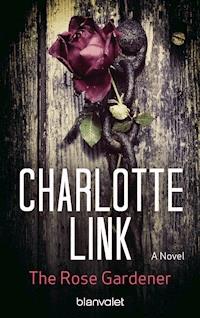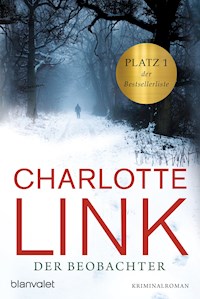
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Er beobachtet das Leben wildfremder Frauen und will alles von ihnen wissen. Doch wehe, du zeigst ihm dabei nicht dein wahres Gesicht …
Er träumt sich an ihre Seite, in ihren Alltag. Identifiziert sich mit ihnen und will alles von ihnen wissen. Als Beobachter. Auf der Flucht vor seinem eigenen Dasein, das aus Misserfolgen besteht.
Nur aus der Ferne liebt er die schöne Gillian Ward. Die beruflich erfolgreiche Frau, glücklich verheiratet, Mutter einer reizenden Tochter, wird von ihm über die Maßen idealisiert. Bis er zu seinem Entsetzen erkennt, dass er auf eine Fassade hereingefallen ist. Denn nichts ist so, wie es scheint …
Gleichzeitig schreckt eine Mordserie die Menschen in London auf. Die Opfer: alleinstehende Frauen. Auf eine rachsüchtige, sadistische Weise umgebracht. Die Polizei sucht einen Psychopathen. Einen Mann, der Frauen hasst …
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Link
Der Beobachter
Roman
Außerdem von Charlotte Link bei Blanvalet lieferbar:
Die Sünde der Engel (37291)
Die Täuschung (37299)
Sturmzeit (37416)
Wilde Lupinen (37417)
Die Stunde der Erben (37418)
Das Haus der Schwestern (37534)
Die Rosenzüchterin (37458)
Das andere Kind (37632)
Am Ende des Schweigens (37640)
Schattenspiel (37732)
Der Verehrer (37747)
1. Auflage
Originalausgabe Januar 2012 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, MünchenCopyright © 2012 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: © bürosüd°, MünchenUmschlagmotive: plainpicture / Tony WatsonLektorat: NB Herstellung: samSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-07072-4
www.blanvalet.de
PROLOG
Er fragte sich, ob seine Frau wohl schon etwas gemerkt hatte … Manchmal sah sie ihn so seltsam an. Misstrauisch. Forschend. Sie sagte nichts, aber das bedeutete nicht, dass sie ihn nicht sehr genau beobachtete. Und sich ihre Gedanken machte.
Sie hatten im April geheiratet, jetzt war September, und sie befanden sich noch in der Phase, in der man vorsichtig miteinander umging und versuchte, die eigenen Macken nicht allzu deutlich zu offenbaren. Dennoch war ihm jetzt schon klar, dass sich seine Frau irgendwann als Nörglerin entpuppen würde. Sie war nicht der Typ, der lautstark stritt, mit Tellern um sich warf oder gar damit drohte, ihn aus dem Haus zu schmeißen. Sie war der Typ, der leise und unaufhörlich und nervenzersetzend lamentierte.
Aber noch beherrschte sie sich. Versuchte, ihm alles recht zu machen. Sie kochte das Essen, das er mochte, stellte das Bier rechtzeitig in den Kühlschrank, bügelte seine Hosen und Hemden und sah sich mit ihm zusammen die Sportsendungen im Fernsehen an, obwohl sie eigentlich auf Liebesfilme stand.
Und dabei belauerte sie ihn. Das glaubte er jedenfalls zu spüren.
Sie hatte ihn geheiratet, weil sie nicht ohne Mann sein konnte, weil sie sich umsorgt, beschützt und aufgehoben fühlen musste. Er hatte sie geheiratet, weil er kurz davor gestanden hatte, ins Abseits zu kippen. Kein fester Job, wenig Geld. Irgendwann würde er den Halt verlieren, das hatte er gespürt. Er hatte bereits begonnen, zu viel zu trinken. Noch schaffte er es, die eine oder andere Gelegenheitsarbeit zu ergattern und von dem Lohn die Miete der trostlosen Wohnung zu bezahlen, in der er lebte. Aber sein Lebensmut sank. Er sah keine Perspektive mehr.
Und dann war Lucy gekommen und mit ihr die kleine Fahrradwerkstatt, die sie von ihrem verstorbenen Mann geerbt hatte, und er hatte zugegriffen. Er hatte immer einen Blick für Chancen gehabt, und er war stolz, kein Mensch zu sein, der lange zögerte.
Jetzt war er verheiratet. Er hatte ein Dach über dem Kopf. Er hatte Arbeit.
Sein Leben funktionierte wieder.
Und nun das. Diese Gefühle, diese Besessenheit, die Unfähigkeit, an etwas anderes zu denken. An etwas anderes als an sie.
Obwohl er das im Grunde vorher gewusst hatte.
Und sie war nicht Lucy.
Sie war blond. Nicht schlecht gefärbt wie Lucy, die schon hier und da graue Haare bekam, sondern echt blond. Die Haare reichten ihr bis zur Taille hinunter und schimmerten in der Sonne wie ein Tuch aus goldfarbener Seide. Sie hatte blaugrüne Augen: Je nachdem, wie hell es draußen war, aber auch abhängig von den Farben ihrer Kleidung oder des Hintergrundes, vor dem sie sich bewegte, schienen sie manchmal blau zu sein wie Vergissmeinnicht oder grün wie ein tiefer See. Dieses intensive Farbenspiel ihrer Augen faszinierte ihn. Er hatte so etwas vorher noch bei niemandem wahrgenommen.
Er mochte auch ihre Hände. Sie waren sehr feingliedrig, sehr schmal. Lange, schlanke Finger.
Er mochte ihre Beine. Zart. Fast zerbrechlich. Alles an ihr war so. Wie aus einem ganz feinen, hellen Holz geschnitzt, von jemandem, der sich viel Zeit genommen, der sich große Mühe gegeben hatte. Nichts an ihr war plump, dick oder grob. Sie war die vollendete Anmut.
Wenn er an sie dachte, brach ihm der Schweiß aus. Wenn er sie sah, konnte er den Blick nicht mehr abwenden, und das war es wahrscheinlich auch, was Lucy aufgefallen war. Er versuchte, am Hoftor zu stehen, wenn sie die Straße hinunterkam. Meistens probierte er irgendein gerade repariertes Fahrrad auf dem Gehweg aus, um einen Vorwand zu haben, sich dort herumzutreiben. Er liebte ihre Bewegungen. Diese federnden Schritte. Sie trippelte nicht, sie schritt weit aus. Es war so viel Kraft in allem, was sie tat. Ob sie lief oder redete oder lachte: ja, unbändige Kraft. Energie.
Schönheit. Ein solches Übermaß an Schönheit und Vollkommenheit, dass er es manchmal fast nicht zu glauben wagte.
War es Liebe, was er empfand? Es musste Liebe sein, nicht bloß Gier, Erregung, all das, was dazugehörte, was aber nur deshalb entstehen konnte, weil er sie liebte. Die Liebe war der Anfang, der Boden, auf dem die Sehnsucht gedieh. Diese Sehnsucht, die er für Lucy nicht aufbrachte. Lucy war eine Notlösung gewesen, und zwar eine, die er nicht aufgeben konnte, weil jenseits von Lucy nach wie vor der soziale Absturz drohte. Lucy stellte eine bittere Notwendigkeit dar. In bittere Notwendigkeiten musste man sich fügen, manchmal verlangte das Leben es so. Er hatte längst gelernt, dass es nichts brachte, sich dagegen zu wehren.
Und dennoch war alles in ihm Auflehnung. Auflehnung und dazwischen immer wieder niederschmetternde Hoffnungslosigkeit. Denn welche Chance hatte er? Er war kein attraktiver Mann, das sah er ohne jede Illusion. Früher ja, aber heute … Den dicken Bauch verdankte er seiner Vorliebe für Bier und fettes Essen. Er hatte schlaffe, aufgeschwemmte Gesichtszüge. Er war achtundvierzig Jahre alt und sah zehn Jahre älter aus, besonders dann, wenn er abends zu viel getrunken hatte, und leider schaffte er es nicht, damit aufzuhören. Er müsste Sport treiben und mehr Gemüse essen, dazu Wasser oder Tee trinken, aber Herrgott noch mal, wenn man dreißig Jahre lang anders gelebt hatte, dann ging das nicht so einfach mit der Umgewöhnung. Er fragte sich, ob ihn diese Elfe, diese Fee, dieses wunderbare Wesen trotzdem würde lieben können. Trotz Bauch und Tränensäcken und obwohl er bei der kleinsten Anstrengung keuchte und schwitzte. Er hatte innere Werte, und vielleicht würde es ihm gelingen, ihr diese zu vermitteln. Denn er hatte längst begriffen, dass er nicht auf sie würde verzichten können. Trotz Lucy und ihrer Eifersucht und trotz des Risikos, das er einging.
Er war ein achtundvierzigjähriger Fettsack mit einem Körper und einer Seele, die in Flammen standen.
Das Problem war: Sie, die Fee, das Wesen, nach dem er sich Tag und Nacht verzehrte, war so viel jünger. So sehr viel jünger.
Sie war neun.
TEIL I
SAMSTAG, 31. OKTOBER 2009
Es gelang Liza, den Ort der Veranstaltung ungesehen zu verlassen, als der Sohn des Jubilars zu einer Rede ansetzte. Er hatte mehrfach mit einer Gabel gegen sein Glas geschlagen, und endlich hatten die rund einhundert geladenen Gäste begriffen. Das Reden und Lachen, das den Raum mit einem Dröhnen zu erfüllen schien, war verstummt, und alle Blicke wandten sich dem nervösen Mann zu, der in diesem Moment nichts so sehr zu bereuen schien wie seinen Entschluss, dem Vater zu dessen fünfundsiebzigstem Geburtstag eine Laudatio zu halten.
Ein paar Männer witzelten, weil der Redner abwechselnd rot und blass wurde und sich dann so verhaspelte, dass er dreimal neu ansetzen musste, ehe er wirklich beginnen konnte. Auf jeden Fall zog er mit seinem ungekonnten Auftritt die gesamte Aufmerksamkeit auf sich.
Der Moment konnte günstiger nicht sein.
Liza hatte sich während der letzten Viertelstunde bereits in die Nähe des Ausgangs vorgearbeitet, und so hatte sie nun nur noch zwei Schritte zu gehen, ehe sie draußen war. Sie schloss die schwere Tür hinter sich, lehnte sich für einen Moment tief atmend gegen die Wand. Wie ruhig es hier draußen war. Wie kühl! Der Raum hatte sich durch die vielen Menschen unnatürlich aufgeheizt. Obwohl sie den Eindruck gehabt hatte, dass niemand so sehr unter der Hitze litt wie sie. Aber überhaupt schien jeder den Abend aus tiefstem Herzen zu genießen. Schöne Kleider, Schmuck, Parfüm, ausgelassenes Lachen. Und sie inmitten des Geschehens und doch getrennt von allen anderen wie durch eine unsichtbare Wand. Sie hatte mechanisch gelächelt, hatte geantwortet, wenn sie etwas gefragt wurde, hatte genickt oder den Kopf geschüttelt und von ihrem Champagner getrunken, aber die ganze Zeit war sie wie betäubt gewesen, hatte das Gefühl gehabt, zu funktionieren wie eine Marionette, die an Fäden hing und von irgendjemandem geführt wurde, ohne zu einer einzigen eigenständigen Bewegung fähig zu sein. Und genau so war es eigentlich seit Jahren: Sie lebte nicht mehr nach ihrem eigenen Willen. Wenn man das, was sie tat, überhaupt noch leben nennen konnte.
Eine junge Angestellte des eleganten Kensington-Hotels, in dem der Geburtstag standesgemäß gefeiert wurde, kam vorbei und verharrte einen Moment, unschlüssig, ob die an der Wand lehnende Frau vielleicht Hilfe brauchte. Liza vermutete, dass sie ziemlich mitgenommen wirkte, jedenfalls dann, wenn sie auch nur ungefähr so aussah, wie sie sich fühlte. Sie richtete sich auf und versuchte zu lächeln.
»Alles in Ordnung?«, fragte die Angestellte.
Sie nickte. »Ja. Es ist nur … es ist ziemlich heiß da drinnen!« Sie machte eine Kopfbewegung in Richtung der Tür. Die junge Frau sah sie mitleidig an, ging dann weiter. Liza begriff, dass sie unbedingt die Toilette aufsuchen und sich herrichten musste. So, wie die gerade geschaut hatte, schien sie ziemlich derangiert auszusehen.
Der marmorgeflieste Raum empfing sie mit sanftem Licht und einer leisen, beruhigenden Musik, die aus verborgenen Lautsprechern erklang. Sie hatte Angst gehabt, jemandem zu begegnen, aber offensichtlich war sie allein. Auch in den Toilettenkabinen schien sich niemand aufzuhalten. Aber bei allein hundert Geladenen auf der Geburtstagsfeier und jeder Menge zusätzlicher Gäste, die sich im Hotel aufhielten, konnte dieser Zustand nicht von langer Dauer sein, das war Liza klar. Jede Sekunde konnte jemand hereinkommen. Ihr blieb nicht viel Zeit.
Sie stützte sich auf eines der luxuriösen Waschbecken und schaute in den hohen Spiegel darüber.
Wie so häufig, wenn sie in einen Spiegel blickte, hatte sie den Eindruck, die Frau nicht zu kennen, die sie sah. Auch dann, wenn sie nicht so gestresst wirkte wie jetzt. Ihre schönen hellblonden Haare, die sie zu Beginn des Abends aufgesteckt hatte, hingen inzwischen wirr an den Seiten hinunter. Ihr Lippenstift klebte wahrscheinlich am Rand ihres Champagnerglases, jedenfalls war nichts mehr davon auf ihrem Mund zu sehen, was ihre Lippen sehr bleich machte. Sie hatte stark geschwitzt. Ihre Nase glänzte, und ihr Make-up war verschmiert.
Sie hatte es gespürt. Geahnt. Deshalb hatte sie seit zwanzig Minuten nichts so sehr ersehnt, wie diesen furchtbaren Raum mit den erstickend vielen Menschen darin verlassen zu können. Sie musste sich jetzt schnell wieder in Form bringen, und dann musste sie versuchen, irgendwie diesen Abend zu überstehen. Er konnte nicht ewig dauern. Der Champagnerempfang war praktisch vorüber. Als Nächstes würde das Buffet eröffnet werden. Gott sei Dank, das war besser als ein gesetztes Essen mit fünf Gängen, das sich über Stunden hinziehen konnte und bei dem jeder, der sich zwischendurch abseilte, sofort auffiel – zumindest seinen beiden Tischnachbarn. Ein Buffet erlaubte viel mehr Möglichkeiten des raschen, diskreten Aufbruchs.
Sie stellte ihre Handtasche vor sich auf die Marmorplatte, nestelte nervös und ungeschickt am Verschluss herum, schaffte es schließlich, Make-up-Tube und Puderdose herauszuangeln. Wenn nur ihre Hände nicht so zitterten! Sie musste aufpassen, dass sie nicht ihr Kleid bekleckerte. Das wäre dann der Höhepunkt dieses furchtbaren Abends und genau das, was ihr noch gefehlt hatte.
Während sie versuchte, die Puderdose zu öffnen, was ihr nicht gelingen wollte, fing sie plötzlich an zu weinen. Es geschah ziemlich unspektakulär: Die Tränen kullerten einfach aus ihren Augen, und sie konnte nichts dagegen machen. Entsetzt hob sie den Kopf, sah dieses fremde Gesicht an, das sich nun auch noch in ein verheultes Gesicht verwandelte. Was das Drama perfekt machte. Wie sollte sie in den Saal zurückkehren mit dicken, roten, verschwollenen Augen?
Fast panisch riss sie ein ganzes Bündel seidenweicher Kosmetiktücher aus dem silbernen Behälter an der Wand und versuchte, die Flut zu stoppen. Aber es hatte beinahe den Anschein, als werde es dadurch, dass sie es zu verhindern suchte, nur heftiger. Ihre Augen liefen einfach über.
Ich muss nach Hause, dachte sie, es hat keinen Sinn, ich muss hier weg!
Und als ob nicht alles schon schlimm genug wäre, vernahm sie nun auch noch hinter sich ein Geräusch. Die Tür, die zum Gang führte, wurde geöffnet. Spitze Absätze klapperten auf dem Marmor. Schemenhaft, verschwommen durch den Tränenschleier, nahm Liza eine Gestalt hinter sich wahr, eine Frau, die den Raum in Richtung der Toiletten durchquerte. Sie presste die Kosmetiktücher gegen ihr Gesicht und versuchte den Anschein zu wecken, als putze sie sich die Nase.
Beeil dich, dachte sie, verschwinde!
Die Schritte hielten plötzlich inne. Einen kurzen Augenblick lang herrschte völlige Stille in dem Raum. Dann drehte die Fremde sich um und kam auf Liza zu. Eine Hand legte sich auf ihre leise bebende Schulter. Sie hob den Blick und sah die andere hinter sich im Spiegel. Ein besorgtes Gesicht. Fragende Augen. Sie kannte die Frau nicht, aber nach ihrer Garderobe zu schließen, gehörte sie ebenfalls zu der Geburtstagsgesellschaft.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie. »Ich möchte nicht aufdringlich sein, aber …«
Die Freundlichkeit, die Sorge, die aus der ruhigen Stimme sprach, waren mehr, als Liza ertragen konnte. Sie ließ die Tücher sinken.
Dann ergab sie sich ihrem Schmerz und versuchte nicht mehr, den Strom ihrer Tränen aufzuhalten.
SONNTAG, 22. NOVEMBER
Es war am späteren Sonntagabend, als Carla die Eigentümlichkeit des Aufzuges und der Aufzugtüren bewusst wahrnahm. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lange zu leben, aber ihre Vorstellungskraft hätte nicht ausgereicht, sich auszumalen, was ihr in dieser Nacht passieren würde.
Sie saß in ihrer Wohnung, etwas verwundert, denn sie hatte plötzlich den sicheren Eindruck, dass es schon seit einigen Tagen so ging: Der Fahrstuhl kam bis zu ihr hinauf in den achten Stock gefahren, hielt an, die Türen öffneten sich automatisch, aber dann passierte nichts weiter. Niemand stieg aus, denn dann hätte sie die Schritte im Gang hören müssen. Es stieg aber offensichtlich auch niemand ein, denn dann hätte man zuvor Schritte gehört. Sie war aber sicher, dass da keine gewesen waren. Sie hätte sie sonst auf irgendeiner Ebene ihres Bewusstseins realisiert. Dieses Haus verschluckte kaum Geräusche. Ein Hochhaus aus den Siebzigerjahren, ein ziemlich schmuckloser Kasten mit langen Gängen im Inneren und einer Vielzahl an Wohnungen. In den größeren wohnten Familien mit Kindern, in etlichen kleineren Wohnungen lebten Singles, die ganz in ihren Berufen aufgingen und praktisch nie zu Hause waren. Hackney gehörte zu den ärmeren Stadtteilen Londons, aber die Gegend, in der Carla wohnte, war nicht allzu schlecht.
Sie überlegte, wann genau sie erstmals den Aufzug hatte ankommen hören, ohne dass jemand ausstieg. Natürlich kam das manchmal vor, war von Anfang an vorgekommen. Es musste nur jemand auf die falsche Taste drücken, seinen Irrtum bemerken und doch früher aussteigen, dann fuhr der Fahrstuhl dennoch bis nach ganz oben, öffnete seine Türen, schloss sie dann wieder und wartete, bis er in ein anderes Stockwerk gerufen wurde. Aber in der letzten Zeit hatte es sich gehäuft. Ungewöhnlich gehäuft.
Vielleicht seit einer Woche? Vielleicht seit vierzehn Tagen?
Sie schaltete den Fernseher aus, die Talkshow, die gerade lief, interessierte sie ohnehin nicht.
Sie ging zur Wohnungstür, schloss auf, öffnete sie. Betätigte den Lichtschalter gleich neben der Klingel und tauchte damit den Gang in ein grelles, weißes Licht. Wer hatte hier nur diese Lampen eingebaut? Man hatte die Gesichtsfarbe einer Leiche in ihrem Schein.
Sie blickte den langen, stillen Gang entlang. Nichts und niemand war zu sehen. Die Aufzugtüren hatten sich wieder geschlossen.
Vielleicht irgendein Scherzkeks. Irgendein Halbwüchsiger, der hier im Haus wohnte und grundsätzlich auf die Acht drückte, ehe er ausstieg. Was er davon hatte, war Carla allerdings schleierhaft. Aber vieles von dem, was Menschen bewegte, was Menschen taten oder anstrebten, war ihr schleierhaft. Am Ende, dachte sie mitunter, befand sie sich doch schon ein ziemlich großes Stück außerhalb der Gesellschaft. Allein, verlassen und seit fünf Jahren in Rente. Wenn man morgens allein aufstand und allein frühstückte, den Tag lesend oder fernsehend in einer kleinen Wohnung verbrachte und sich nur gelegentlich zu einem Spaziergang aufraffte, abends wieder allein aß und dann erneut vor dem Fernseher saß, dann entfernte man sich aus der Normalität. Man verlor den Kontakt zu den Menschen, deren Alltag aus Beruf, Kollegen, Ehepartnern, Kindern und allen damit verbundenen Sorgen, Anstrengungen und natürlich auch Freuden bestand. Womöglich wirkte sie auf andere schon viel wunderlicher, als ihr das selbst klar war.
Sie schloss die Wohnungstür wieder, lehnte sich von innen dagegen, atmete tief. Als sie in das Hochhaus eingezogen war – eines der wenigen in Hackney, wo es sonst eher viktorianische, größtenteils ziemlich heruntergekommene Bauten gab –, hatte sie zunächst geglaubt, hier werde alles besser. Sie hatte gehofft, sich in einem Haus voller Menschen weniger einsam zu fühlen, aber nun war das Gegenteil der Fall. Jeder hier strampelte sich durch seinen Alltag, keiner schien den anderen wirklich zu kennen, man lebte in größtmöglicher Anonymität. Einige Wohnungen standen zudem leer. Oben, im achten Stock, wohnte seit einiger Zeit außer Carla überhaupt niemand mehr.
Sie ging ins Wohnzimmer zurück, überlegte, ob sie den Fernseher wieder einschalten sollte. Sie unterließ es, schenkte sich stattdessen noch etwas Wein nach. Sie trank jeden Abend, aber sie hatte sich selbst die Regel auferlegt, es nie vor acht Uhr zu tun. Bislang glückte es ihr, sich daran zu halten.
Sie zuckte zusammen, als sie das Geräusch des Aufzuges wieder vernahm. Er fuhr nach unten. Jemand hatte ihn offenbar herangerufen. Das war immerhin ein Zeichen von Normalität. Menschen im Haus kamen und gingen. Sie war nicht allein.
Vielleicht sollte ich mir aber doch eine andere Wohnung suchen, dachte sie.
Viel Spielraum ließ ihr Geldbeutel nicht zu. Ihre Rente war bescheiden, große Sprünge konnte sie nicht machen. Außerdem war fraglich, ob sie woanders weniger einsam sein würde. Vielleicht lag es nicht an dem Haus. Vielleicht lag es an ihr selbst.
Da sie die Stille plötzlich nicht mehr zu ertragen glaubte, zog sie sich das Telefon heran und tippte hastig die Nummer ihrer Tochter ein, schnell genug, ehe Furcht oder Schüchternheit ihr Vorhaben im Keim ersticken konnten. Sie hatte eigentlich immer ein gutes Verhältnis zu Keira gehabt, aber seitdem diese verheiratet war und nun auch noch ein Baby hatte, bröckelte der Kontakt immer stärker. Den jungen Leuten fehlte es an Zeit, sie waren vollauf mit sich und ihrem Leben beschäftigt.
Woher noch die Energie nehmen, sich um die Mutter mit dem gescheiterten Lebensentwurf zu kümmern?
Carla konnte es manchmal selbst nicht glauben: die Ehe nach achtundzwanzig Jahren geschieden. Ihr Mann finanziell vollkommen verschuldet, da er auf zu großem Fuß gelebt und sein Leben über Jahre nur noch auf Schulden aufgebaut hatte. Er hatte sich aus dem Staub gemacht, ehe ihn seine Gläubiger zur Rechenschaft ziehen konnten; seit Jahren gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Carla selbst war verstört, häufig am Jammern. Ihre Tochter Keira hatte sich aus dem ganzen Schlamassel, in den die berufliche Pleite ihres Vaters die Familie gestürzt hatte, immerhin in eine gesicherte bürgerliche Existenz und bis in eine der zahllosen Reihenhaussiedlungen von Bracknell, eine knappe Dreiviertelstunde südwestlich vom Londoner Stadtzentrum gelegen, gerettet, indem sie nach einem Mathematikstudium eine Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht und einen Mann mit sicherer Stelle in der Verwaltung geheiratet hatte. Carla wusste, dass sie sich eigentlich für sie freuen müsste.
Keira meldete sich beim zweiten Klingeln. Sie klang gestresst, im Hintergrund schrie ihr kleiner Sohn.
»Hallo, Keira, ich bin es, Mummie. Ich wollte nur mal hören, wie es so geht.«
»Oh, hallo, Mum«, sagte Keira. Sie wirkte nicht begeistert. »Ja, es ist alles okay. Der Kleine schläft nur wieder mal nicht ein. Er schreit wirklich ständig. Ich bin ziemlich zermürbt inzwischen.«
»Sicher bekommt er Zähne.«
»Ja, so ist es.« Keira schwieg einen Moment, dann fragte sie pflichtschuldig: »Und wie geht es dir?«
Eine Sekunde lang war Carla versucht, einfach die Wahrheit zu sagen: dass es ihr schlecht ging, dass sie sich völlig vereinsamt vorkam. Aber sie wusste, dass ihre Tochter das nicht hören wollte, dass sie sich überfordert gefühlt und sofort gereizt reagiert hätte.
»Ach, na ja, ich bin eben oft ziemlich allein«, sagte sie daher nur. »Seit ich in Rente bin …« Sie ließ den Rest des Satzes ungesagt. Die Dinge ließen sich eben nicht ändern.
Keira seufzte. »Du müsstest dir irgendeine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen. Ein Hobby, das dich mit Gleichgesinnten zusammenbringt. Und wenn es ein Kochkurs ist, den du belegst, oder ein Sport, den du anfängst! Hauptsache, du kommst unter Menschen.«
»Ach, zwischen lauter alten Frauen beim Seniorenturnen herumzuhüpfen …«
Keira seufzte erneut, diesmal deutlich ungeduldig. »Es muss ja nicht das Seniorenturnen sein. Meine Güte, es wird so vieles angeboten. Da wirst du doch etwas finden, das selbst deinen Ansprüchen gerecht wird!«
Carla fühlte sich für einen Moment versucht, ihrer Tochter anzuvertrauen, dass sie es einige Zeit zuvor schon einmal bei einer Selbsthilfegruppe für allein lebende Frauen probiert hatte, dass es ihr aber auch dort nicht gelungen war, dauerhafte Freundschaften zu schließen. Wahrscheinlich jammerte sie zu viel. Niemand hielt es lange mit ihr aus. Besser, Keira erfuhr von diesem Projekt erst gar nichts.
»Ich glaube, mich deprimiert eben alles«, sagte sie. »Wenn ich mitten am Tag schwimmen gehe oder koche, dann wird mir nur noch bewusster, dass ich kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr bin. Dass ich nicht mehr arbeite und auch keine Familie mehr zu versorgen habe. Und wenn ich wieder nach Hause komme, wartet sowieso niemand auf mich.«
»Du würdest aber bestimmt nette Frauen kennenlernen, mit denen du hin und wieder etwas unternehmen könntest.«
»Die meisten haben dann wahrscheinlich eine Familie und überhaupt keine Zeit für mich.«
»Ja, natürlich, weil du die einzige geschiedene, allein lebende Rentnerin in ganz England bist«, erklärte Keira schroff. »Willst du für den Rest deines Lebens jeden Abend vor dem Fernseher in deiner Wohnung sitzen und Trübsal blasen?«
»Und meiner Tochter auf die Nerven gehen?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Das Haus ist bedrückend«, sagte Carla. »Keiner kümmert sich hier um den anderen. Und dauernd fährt der Aufzug hier hoch zu mir, und dann steigt niemand aus.«
Keira schien irritiert. »Wie?«
Carla wünschte, sie hätte das nicht gesagt. »Na ja, es ist mir einfach aufgefallen. Dass es ziemlich häufig geschieht, meine ich. Außer mir wohnt hier oben ja niemand. Aber dauernd kommt der Aufzug.«
»Dann schickt ihn irgendjemand nach oben. Oder das System ist einfach so ausgelegt. Dass er zwischendurch automatisch alle Stockwerke abklappert.«
»Bis vor ein oder zwei Wochen war das aber nicht so.«
»Mum …«
»Ja, ich weiß. Ich werde langsam wunderlich, das denkst du doch. Mach dir keine Sorgen. Irgendwie kriege ich mein Leben schon in den Griff.«
»Ganz bestimmt. Mum, der Kleine schreit ständig, und …«
»Ich mache schon Schluss! Es wäre schön, wenn ihr mich mal wieder besuchen würdet, du und der Kleine. Vielleicht an irgendeinem Wochenende?«
»Ich schau mal, ob das klappt«, sagte Keira unverbindlich, dann verabschiedete sie sich rasch und ließ Carla mit dem Gefühl zurück, gestört zu haben, lästig gewesen zu sein.
Sie ist meine Tochter, dachte sie trotzig, es ist normal, dass ich sie gelegentlich anrufe. Und dass ich es ihr sage, wenn es mir nicht besonders gut geht.
Sie blickte auf ihre Armbanduhr. Es war erst kurz nach zehn.
Dennoch beschloss sie, ins Bett zu gehen. Vielleicht noch ein bisschen zu lesen. Und zu hoffen, dass sie rasch einschlief.
Sie wollte gerade ins Bad gehen, um sich die Zähne zu putzen, als sie den Aufzug wieder vernahm. Er kam nach oben.
Sie blieb mitten im Flur stehen. Lauschte.
Ich wünschte wirklich, irgendjemand würde hier oben außer mir noch wohnen, dachte sie.
Der Aufzug hielt, die Türen öffneten sich.
Carla wartete. Darauf, dass nichts sein würde. Kein Laut, nichts.
Aber diesmal hörte sie etwas. Diesmal verließ jemand den Aufzug. Da waren Schritte. Sie vernahm sie ganz deutlich. Schritte draußen in dem vermutlich hell erleuchteten Gang.
Carla schluckte trocken. Sie spürte ein Kribbeln auf der Haut.
Jetzt mach dich bloß nicht verrückt! Erst hast du dich aufgeregt, weil niemand ausstieg, und jetzt regst du dich auf, weil es offenbar doch jemand tut.
Die Schritte kamen näher.
Zu mir, dachte Carla, da kommt jemand zu mir.
Wie paralysiert stand sie vor ihrer Wohnungstür.
Jemand befand sich auf der anderen Seite.
Als die Klingel schrillte, löste sich der Bann. Die Klingel war Normalität.
Einbrecher klingeln nicht, dachte Carla.
Dennoch spähte sie vorsichtshalber durch den Türspion.
Sie zögerte.
Dann öffnete sie.
MITTWOCH, 2. DEZEMBER
1
Gillian ging in die Küche zurück. »Das war Darcys Mutter«, erklärte sie. »Darcy kommt heute nicht in die Schule. Sie hat eine Halsentzündung.«
Das Läuten des Telefons hatte Becky nicht aus der Lethargie reißen können, mit der sie über ihrer Müslischüssel hing und missmutig auf Obst und Flocken starrte, die sich dort in der Milch mischten.
Gerade eben erst zwölf Jahre alt geworden, dachte Gillian, und schon muffig und lustlos wie ein Teenager auf dem Höhepunkt der Pubertät. Waren wir nicht früher anders?
»Hm«, machte Becky uninteressiert. Auf dem Stuhl neben ihr saß Chuck, ihr schwarzer Kater. Die Familie hatte ihn während eines Urlaubs in Griechenland als ein halb verhungertes Bündel Elend am Straßenrand gefunden und in ihr Hotel geschmuggelt. Die restlichen Ferien hatten im Wesentlichen aus dem Problem bestanden, Chuck täglich ungesehen aus dem Hotel hinaus und zum Tierarzt zu bringen und ihn hinterher wieder ebenso heimlich auf das Zimmer zu schaffen. Gillian und Becky hatten ihm stundenlang mit einer Pipette flüssige Nahrung eingeflößt, und zwischendurch schien alles dagegenzusprechen, dass er überlebte. Becky hatte nur noch geweint, aber obwohl alles so schwierig und nervenzehrend gewesen war, waren sie und ihre Mutter einander sehr nah gewesen in der gemeinsamen Sorge.
Am Ende hatte Chucks Lebenswillen gesiegt. Er war mit seiner neuen Familie nach England gereist.
Gillian setzte sich ihrer Tochter gegenüber an den Tisch. Nun musste sie Becky zur Schule fahren. Gemeinsam mit Darcys Mutter bildeten sie eine Fahrgemeinschaft, und diese Woche war Darcys Mutter an der Reihe. Aber natürlich nicht an einem Tag, an dem ihre eigene Tochter gar nicht zur Schule ging.
»Ich habe bei der Gelegenheit etwas Interessantes erfahren«, sagte Gillian, »nämlich dass ihr heute eine Mathearbeit schreibt!«
»Kann sein.«
»Nein, das kann nicht sein, das ist so! Ihr schreibt heute eine Arbeit, und ich hatte keine Ahnung davon.«
Becky zuckte mit den Schultern. Sie hatte einen Kakaobart auf der Oberlippe. Sie trug schwarze Jeans, die so eng waren, dass sich Gillian fragte, wie sie es geschafft hatte, in sie hineinzukommen, dazu einen ebenfalls schwarzen hautengen Pullover und ein schwarzes Tuch mehrfach um den Hals geschlungen. Sie tat alles, um cool zu wirken, aber mit dem Kakao am Mund sah sie einfach aus wie ein kleines Mädchen in einer seltsamen Maskerade. Natürlich hütete sich Gillian, ihr das zu sagen.
»Warum hast du nichts davon erwähnt? Ich habe dich jeden Tag gefragt, ob ihr irgendwann einen Test schreibt. Du hast behauptet, dass nichts ansteht. Weshalb?«
Becky zuckte erneut mit den Schultern.
»Könntest du mir bitte eine Antwort geben?«, fragte Gillian scharf.
»Weiß nicht«, nuschelte Becky.
»Du weißt was nicht?«
»Warum ich es nicht gesagt habe.«
»Ich vermute, du hattest keine Lust zu üben«, stellte Gillian resigniert fest.
Becky schaute sie böse an.
Was mache ich bloß falsch, fragte sich Gillian, was mache ich falsch, dass sie mich manchmal fast hasserfüllt ansieht? Warum wusste Darcys Mutter Bescheid? Warum wussten wahrscheinlich alle Mütter Bescheid?
»Putz deine Zähne«, sagte sie, »und dann komm. Wir müssen los.«
Auf der Fahrt zur Schule sprach Becky kein einziges Wort, sah nur zum Fenster hinaus. Gillian lag es auf der Zunge, sie zu fragen, ob sie sich die Arbeit zutraute, ob sie sich einigermaßen in dem Stoff auskannte, aber sie wagte es nicht. Sie fürchtete die patzige Antwort und hatte das ungute Gefühl, dann möglicherweise in Tränen auszubrechen. Das passierte ihr immer öfter in der letzten Zeit, und sie fand keinen rechten Weg, sich dagegen zu wehren. Sie war drauf und dran, zu einer Heulsuse zu mutieren, die mit ihren Lebensumständen haderte und sich vor dem provozierenden Verhalten ihrer zwölfjährigen Tochter fürchtete. Wie konnte man als Frau von zweiundvierzig Jahren so unsouverän sein?
Becky verabschiedete sich vor der Schule mit ein paar unfreundlichen Worten und stakste dann auf ihren mageren Beinen über die Straße. Ihre langen Haare wehten hinter ihr her, der Rucksack (»Man trägt heute keine Schulranzen mehr, Mum!«) schaukelte auf ihrem Rücken. Sie drehte sich nicht zu ihrer Mutter um. In der Vorschule hatte sie ihr immer noch Kusshände zugeworfen und dabei über das ganze Gesicht gestrahlt. Wie hatte sie sich innerhalb weniger Jahre so sehr verändern können? Natürlich fühlte sie sich an diesem Morgen in der Defensive. Sie wusste, dass die Mathearbeit völlig danebengehen würde und dass es ein Fehler von ihr gewesen war, sich um das Üben zu drücken. Sie musste irgendwohin mit ihrem Ärger über sich selbst.
Gillian fragte sich, ob sie alle so waren. So aggressiv. So uneinsichtig. So mitleidslos.
Sie startete das Auto, fuhr aber nur eine Straße weiter und parkte dort am Bordstein. Öffnete das Fenster ein Stück weit und zündete sich eine Zigarette an. In den Gärten ringsum lag Raureif über den Gräsern. In der Ferne sah sie den Fluss wie ein Band aus Blei dahingleiten, die Themse, die hier schon sehr breit und dem Rhythmus von Ebbe und Flut unterworfen war und dem Meer zustrebte. Der Wind roch nach Algen und die Möwen schrien. Es war kalt. Ein unwirtlicher, grauer Wintermorgen.
Sie hatte einmal mit Tom darüber gesprochen. Fast zwei Jahre war das jetzt her. Genauer, sie hatte versucht, mit ihm darüber zu sprechen. Über die Frage, ob sie als Mutter etwas falsch machte. Oder ob die anderen Kinder genauso waren. Er hatte keine Antwort darauf gewusst.
»Wenn du etwas mehr Kontakt zu den anderen Müttern hättest«, hatte er schließlich gesagt, »dann wüsstest du es vielleicht. Du wüsstest, ob du etwas falsch machst. Du wüsstest vielleicht sogar, wie man es richtig machen könnte. Aber aus irgendeinem Grund weigerst du dich, dir ein Netzwerk aufzubauen.«
»Ich weigere mich nicht. Ich komme einfach nicht richtig klar mit den anderen Müttern.«
»Das sind aber ganz normale Frauen. Die tun dir doch nichts!«
Natürlich hatte er recht. Das war nicht der Punkt. »Aber sie akzeptieren mich auch nicht. Es ist immer so, als ob … ich irgendwie eine andere Sprache sprechen würde. Alles, was ich sage, scheint verkehrt zu sein. Es passt nicht zu dem, was sie sagen …« Ihr war klar gewesen, wie sich das für Tom, den großen Rationalisten, anhören musste. Wie Unfug. Kompletter Unfug.
»Unfug!«, hatte er dann auch prompt gesagt. »Ich glaube, du bildest dir das alles nur ein. Du bist eine intelligente Frau. Du bist attraktiv. Du bist beruflich erfolgreich. Du hast einen einigermaßen gut aussehenden Mann, der ebenfalls nicht ganz erfolglos ist in seinem Beruf. Du hast ein hübsches, gescheites und gesundes Kind. Woher rühren bloß deine Komplexe?«
Hatte sie Komplexe?
Gedankenverloren schnippte sie die Asche ihrer Zigarette aus dem Wagenfenster.
Es gab keinen Grund, Komplexe zu haben. Zusammen mit Tom hatte sie vor fünfzehn Jahren eine Firma in London aufgebaut, die auf Steuer- und Wirtschaftsberatung spezialisiert war. Sie hatten ungeheuer schuften müssen, um das Unternehmen in Schwung zu bringen, aber die Arbeit hatte sich gelohnt: Inzwischen beschäftigten sie sechzehn Mitarbeiter. Tom hatte immer wieder betont, dass er das alles ohne Gillian nie geschafft hätte. Seit Beckys Geburt arbeitete Gillian nicht mehr täglich im Büro, hatte aber immer noch ihre eigenen Kunden, die sie betreute. Drei- oder viermal in der Woche fuhr sie mit dem Zug nach London und erledigte ihren Job. Sie besaß die Freiheit, sich ihre Zeit völlig selbstständig einzuteilen. Wenn Becky sie brauchte, ging sie einfach einen Tag lang nicht ins Büro, holte liegengebliebene Arbeit dafür am darauffolgenden Wochenende nach.
Alles war gut. Sie hätte zufrieden sein können.
Sie blickte in den Rückspiegel und sah ihre dunkelblauen Augen und über ihrer Stirn die rotblonden Locken. Ihre wilden, langen Haare ließen es nicht zu, dass sie jemals wirklich ordentlich aussah, und sie konnte sich nur zu gut erinnern, wie sehr sie als Kind darunter gelitten hatte: unter den Locken. Der rötlichen Farbe. Den unvermeidlich damit einhergehenden Sommersprossen im Gesicht. Dann war sie an die Universität gekommen und hatte Thomas Ward kennengelernt, ihren ersten Freund, der dann auch der Mann ihres Lebens werden sollte, die große Liebe. Er hatte ihre Haarfarbe bewundert und ihre Sommersprossen einzeln gezählt, und plötzlich hatte sie angefangen, sich selbst schön zu finden und das Besondere an ihrem Aussehen zu schätzen.
Daran solltest du auch manchmal denken, dachte sie, an all das Gute, das durch Tom in dein Leben gekommen ist. Du bist mit einem wunderbaren Mann verheiratet.
Sie hatte ihre Zigarette zu Ende geraucht und überlegte, ob sie ins Büro fahren sollte. Es wartete eine Menge Arbeit auf sie, und aus Erfahrung wusste sie, dass Arbeit am besten gegen das Grübeln half. Sie beschloss, zu Hause noch eine letzte Tasse Kaffee zu trinken, sich dann umzuziehen und auf den Weg nach London zu machen.
Sie startete ihren Wagen.
Vielleicht sollte sie sich wieder einmal mit Tara Caine treffen. Ihre Freundin arbeitete als Staatsanwältin in London und war – laut Tom, der sie nicht besonders mochte – eine radikale Feministin. Auf jeden Fall taten Gillian die Gespräche mit ihr gut.
Bei ihrem letzten Treffen hatte Tara ihr auf den Kopf zugesagt, dass sie in einer handfesten Depression steckte.
Vielleicht hatte sie recht.
2
Samson hatte lange nach unten gelauscht, und erst als er ganz sicher war, dass sich niemand im Treppenhaus aufhielt, huschte er auf Strümpfen hinunter. Er wollte möglichst schnell und ungesehen in seine Schuhe und in seinen Anorak kommen und dann nach draußen entschwinden, aber als er gerade vornübergebeugt dastand und sich die Schnürsenkel zuband, ging die Küchentür auf und seine Schwägerin Millie erschien. Die Art, wie sie sich auf ihn zubewegte, erinnerte Samson an einen Raubvogel, der eine Beute erspäht hat.
Er richtete sich auf.
»Hallo, Millie«, sagte er unsicher.
Millie Segal gehörte zu den Frauen, denen, noch ehe sie überhaupt die vierzig erreicht haben, bereits die zweischneidige Beschreibung Sie ist sicher einmal hübsch gewesen anhaftete. Sie war blond, hatte eine gute Figur und gleichmäßige Gesichtszüge, aber es hatten sich so tiefe Kerben und Falten in ihre Haut eingegraben, Folgen exzessiven Bräunens und zu vieler Zigaretten, dass sie älter aussah, als sie tatsächlich war, und außerdem verhärmt und seltsam verbittert wirkte. Letzteres lag weniger an dem ungesunden Lebenswandel als an der Tatsache, dass sie eine zutiefst unzufriedene Frau war. Frustriert. Samson hatte manchmal mit seinem Bruder darüber gesprochen. Dieser hatte ihm erklärt, dass Millie in der festen Überzeugung lebte, vom Schicksal benachteiligt zu sein, und zwar nicht, weil ihr jemals irgendetwas Tragisches zugestoßen war, sondern weil sie in der Summe unzähliger kleiner täglicher Ungerechtigkeiten und Enttäuschungen die gesamte große Benachteiligung ihrer Person sah.
Wenn Gavin, ihr Mann, sie fragte, was es denn genau sei, was ihr so sehr das Leben vergälle, dann antwortete sie immer: »Alles. Einfach alles zusammen.«
Unglücklicherweise wusste Samson, dass er selbst in diesem Alles zusammen keine kleine Rolle spielte.
»Dachte ich mir doch, dass ich dich gehört habe«, sagte Millie. Sie war noch nicht angezogen. Wenn sie erst später arbeiten musste, schlüpfte sie morgens rasch in einen Jogginganzug und machte ihrem Mann das Frühstück, ehe dieser zu seiner Frühschicht aufbrach. Gavin arbeitete als Busfahrer. Oft musste er schon um fünf Uhr aus dem Bett. Millie kochte ihm dann Kaffee, briet Speck mit Rühreiern, schob Weißbrot in den Toaster und schmierte die Sandwiches, die er mit zur Arbeit nahm. Sie konnte eine recht angenehme Fürsorglichkeit an den Tag legen, aber Samson war überzeugt, dass sie dabei nicht von echter Warmherzigkeit getrieben wurde. Gavin zahlte für das üppige Frühstück nämlich einen hohen Preis: Er musste sich die ganze Zeit über ihr Nörgeln und Jammern und ihre Vorwürfe anhören, und Samson hatte schon manchmal überlegt, ob sein Bruder sich nicht viel lieber allein mit einer Tasse Kaffee und einem selbstgestrichenen Marmeladentoast zu dieser frühen Stunde in die Küche setzen und friedlich seine Zeitung lesen würde.
»Ich bin gleich weg«, sagte Samson und schlüpfte in seinen Anorak.
»Hat sich etwas wegen einer Arbeit ergeben?«, fragte Millie.
»Noch nicht.«
»Bemühst du dich überhaupt?«
»Natürlich. Aber die Zeiten sind schwierig.«
»Du hast diese Woche noch nichts zum Haushaltsgeld dazugegeben. Ich muss schließlich einkaufen. Und beim Essen bist du dann weniger zurückhaltend.«
Samson kramte seinen Geldbeutel aus der Hosentasche, zog einen Schein hervor. »Reicht das erst einmal?«
»Viel ist es nicht«, sagte Millie, nahm aber natürlich das Geld. »Besser als nichts.«
Was will sie eigentlich?, fragte sich Samson. Nur wegen des Geldes hat sie mich nicht abgefangen.
Er sah sie fragend an.
Millie sagte jedoch nur: »Gavin kommt heute Mittag. Wir essen um zwei. Ich habe erst nachmittags Dienst.«
»Ich komme nicht zum Essen«, sagte Samson.
Sie zuckte mit den Schultern. »Musst du wissen.«
Da ganz offensichtlich nichts weiter anstand, nickte er ihr kurz zu, dann öffnete er die Haustür und trat hinaus in den kalten Tag.
Eine Begegnung mit Millie machte ihn immer nervös, unsicher und beklommen. Er bekam schlecht Luft in ihrer Gegenwart. Hier draußen ging es ihm sogleich besser.
Er hatte einmal ein Gespräch zwischen Millie und seinem Bruder angehört, und seitdem wusste er, dass Millie nichts so ersehnte wie seinen Auszug aus dem gemeinsamen Haus. Nicht, dass ihm das vorher nicht klar gewesen wäre, Millie hatte nie einen Zweifel daran gelassen, dass sie ihn als Störenfried empfand, aber es fühlte sich noch einmal anders an, wenn man sie so unverblümt darüber reden hörte. Zudem hatte er nicht gewusst, dass sie auch seinen Bruder deswegen massiv unter Druck setzte.
»Ich wollte mit dir in einer Ehe leben, in einer ganz normalen Ehe«, hatte sie gezischt. »Und was ist das hier jetzt? Eine Art Wohngemeinschaft?«
»So kannst du das nicht bezeichnen«, hatte Gavin geantwortet, unbehaglich und mit der Erschöpfung eines Menschen, der ein unerquickliches Thema schon viel zu oft hat abhandeln müssen. »Er ist mein Bruder. Er ist ja nicht irgendein Untermieter!«
»Wäre er das bloß! Dann würden wir wenigstens noch Miete bekommen. Aber so …«
»Es ist auch seinHaus, Millie. Wir haben es beide von unseren Eltern geerbt. Er hat dasselbe Recht, hier zu wohnen, wie wir.«
»Das ist keine Frage des Rechts!«
»Sondern?«
»Des Taktgefühls. Des Anstands. Ich meine, wir beide, wir sind verheiratet. Wir werden vielleicht irgendwann einmal Kinder haben. Eine richtige Familie sein. Er ist allein. Er ist das fünfte Rad am Wagen. Jeder andere Mensch würde doch merken, dass er stört, und würde sich etwas anderes suchen.«
»Wir können ihn nicht zwingen. Wenn er geht, dann müsste ich ihn entweder auszahlen, was ich nicht kann, oder wir müssten ihm Miete zahlen, wenigstens anteilig. Meine Güte, Millie, du weißt doch, was ich verdiene! Es würde verdammt eng für uns.«
»Als dein Bruder dürfte er gar kein Geld von dir nehmen.«
»Aber er müsste ja dann irgendwo Miete zahlen. Er ist arbeitslos. Wie soll er das machen?«
»Dann lass uns ausziehen!«
»Willst du das wirklich? Ein Häuschen mit Garten kannst du dir dann aber abschminken. Nichts gegen eine Etagenwohnung, aber bist du sicher, dass du damit zurechtkommst?«
Samson, der draußen vor der Tür gestanden, gelauscht und geschwitzt hatte, hatte ein wenig verächtlich sein Gesicht verzogen. Damit würde sie natürlich nicht zurechtkommen. Millie ging das Prestige über alles, womöglich sogar über die Befreiung aus der gemeinsamen Wohnsituation mit dem ungeliebten Schwager. Millie stammte aus einfachen Verhältnissen. Die Ehe mit einem Hauseigentümer in einem gutbürgerlichen Stadtteil war der große soziale Aufstieg in ihrem Leben – auch wenn es sich nur um ein schmales Reihenhaus an einer viel befahrenen Straße handelte. Sie liebte es, ihre Freundinnen einzuladen und mit dem tatsächlich von ihr sehr schön angelegten und gut gepflegten Garten zu protzen. Sie würde es nicht fertigbringen, diese Welt zu verlassen. Nein, Millie wollte nicht ausziehen. Sie wollte, dass Samson auszog.
Auf den letzten Satz ihres Mannes hatte sie dann auch nichts erwidert, aber das Schweigen war äußerst beredt gewesen.
Samson schüttelte den Gedanken an jenes bedrückende Gespräch ab und machte sich auf seinen Weg durch die Straßen. Er folgte dabei einem ganz bestimmten System und einem genauen Zeitplan, und heute lag er bereits fünf Minuten zurück – weil er so lange gezögert hatte, sich durch das Treppenhaus nach unten zu wagen, und weil er dann auch noch von Millie aufgehalten worden war.
Er hatte seine Arbeit im Juni verloren. Er hatte als Fahrer eines Heimservices für Tiefkühlkost gearbeitet, aber Tiefkühlgerichte waren teuer, die Wirtschaftskrise verunsicherte die Menschen, die Aufträge waren dramatisch zurückgegangen. Schließlich hatte die Firma die Anzahl ihrer Fahrer reduzieren müssen. Samson hatte es kommen sehen, und er war der Mitarbeiter, der zuletzt eingestellt worden war. Es hatte ihn als Ersten getroffen.
Er schritt zügig voran. Das Haus, das er und Gavin von den Eltern geerbt hatten, lag an jenem Ende der Straße, das auf eine viel befahrene Durchgangsstraße mündete, daher lauter war und weniger vornehm. Schmalbrüstige Häuser, handtuchschmale Gärten. Dieselbe Straße bot in der entgegengesetzten Richtung, die zum Thorpe Bay Golfclub hin führte, ein ganz anderes Bild: größere Häuser, verziert mit Türmchen und Erkern, großzügige Grundstücke mit hohen Bäumen, gepflegten Hecken, von schmiedeeisernen Zäunen oder hübschen, niedrigen Steinmauern umgeben. Imposante Autos, die in den Einfahrten parkten. Es herrschte dort eine angenehme, friedliche Ruhe.
Southend-on-Sea lag vierzig Meilen östlich von London und zog sich weitläufig am nördlichen Ufer der Themse entlang, bis hin zum Übergang des großen Flusses in die Nordsee. Die Stadt bot alles, was das Herz begehrte: Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten, Theater und Kinos, den obligatorischen Vergnügungspark an der Uferpromenade, lange Sandstrände, Segel- und Surfclubs, Pubs und vornehme Restaurants. Viele Familien, denen London zu teuer war und die es überdies für ihre Kinder als in jeder Hinsicht gesünder empfanden, nicht in der riesigen Metropole aufwachsen zu müssen, zogen hier hinaus. Southend umfasste mehrere Stadtteile, darunter auch Thorpe Bay, wo Samson wohnte. Thorpe Bay bestand zu einem großen Teil aus den weiten, sanft gewellten Wiesen des Golfclubs und aus großzügigen Tennisanlagen, die sich gleich hinter dem Strand, getrennt nur von einer Straße, befanden. Wer hier wohnte, schien mitten in einer Idylle gelandet zu sein: baumbestandene Straßen, liebevoll angelegte Gärten, gepflegte Häuser. Der Wind, der vom Fluss kam, trug den Geruch nach Salz und Meer in sich.
Samson war hier aufgewachsen. Er konnte sich nicht vorstellen, jemals woanders zu leben.
Kurz bevor er die Thorpe Hall Avenue erreichte, begegnete ihm die junge Frau mit dem großen Mischlingshund. Sie führte das Tier jeden Morgen spazieren. Um diese Uhrzeit befand sie sich bereits auf dem Rückweg. Samson hatte sie mehrfach zu ihrem Haus verfolgt und war sich einigermaßen sicher, was ihre Lebensumstände anging: kein Mann, keine Kinder. Ob sie geschieden oder nie verheiratet gewesen war, vermochte er nicht zu sagen. Sie wohnte in einer recht kleinen Doppelhaushälfte, besaß allerdings einen großen Garten. Sie schien von daheim aus zu arbeiten, denn außer zum Einkaufen und zum Hundespaziergang verließ sie ihr Haus tagsüber nicht. Sie erhielt allerdings häufig Lieferungen von Kurierdiensten. Samson schloss daraus, dass sie für eine Firma arbeitete, deren Aufträge sie zu Hause ausführen konnte. Vielleicht hatte sie ein Schreibbüro. Vielleicht erstellte sie Gutachten oder Redaktionen für einen Verlag. Er hatte mehrfach registriert, dass sie für einige Tage verreist war. In dieser Zeit wohnte eine Freundin bei ihr und führte auch den Hund aus. Offensichtlich musste sie sich gelegentlich bei ihrem Arbeitgeber blicken lassen.
Ein Stück weiter kehrte eine ältere Dame den Gehweg vor ihrem Haus. Diese Dame war sehr häufig draußen anzutreffen. Heute fegte sie das Laub zusammen, die allerletzten wenigen Blätter, die von dem Baum in ihrem Garten über den Zaun gesegelt waren. Sie kehrte die Straße oft selbst dann, wenn es nach menschlichem Ermessen absolut nichts zu tun gab. Samson wusste, dass sie alleinstehend war. Selbst einem weniger gründlichen Beobachter als ihm wäre ihr Bedürfnis aufgefallen, irgendetwas zu tun, das sie für eine Weile auf der Straße sein ließ, um wenigstens den einen oder anderen Morgengruß zu erhaschen. Sie erhielt nie Besuch, hatte also entweder keine Kinder oder zumindest nur solche, die sich nicht um sie kümmerten. Auch waren ihm nie Freunde aufgefallen, irgendwelche Bekannte, die sie aufgesucht hätten.
»Guten Morgen«, sagte sie atemlos, kaum dass sie ihn erblickt hatte.
»Guten Morgen«, murmelte Samson. Er hatte es sich zum eisernen Grundsatz gemacht, in keinerlei Kontakt mit den Menschen zu treten, die er beschattete, denn es war wichtig für ihn, nicht aufzufallen. Aber bei dieser Frau brachte er es nicht fertig, grußlos vorüberzugehen. Zudem hätte er sich damit vielleicht noch nachdrücklicher in ihr Gedächtnis gebohrt. Der unfreundliche Mann, der hier jeden Morgen vorbeiläuft … So war er in ihrer Erinnerung wenigstens positiv besetzt.
Er hatte jetzt die Häuserreihe erreicht, die sich gegenüber einer hübschen, im Sommer dicht belaubten Grünanlage befand. Eines der Häuser gehörte der Familie Ward. Samson wusste über diese Leute mehr als über alle anderen, weil Gavin die Hilfe von Thomas Ward in Anspruch genommen hatte, als es damals nach dem Tod der Eltern Probleme wegen der Nachlasssteuer gab. Ward und seine Frau arbeiteten als Wirtschafts- und Finanzberater in London, und Ward hatte den verzweifelten Gavin seinerzeit zu äußerst kulanten Bedingungen beraten, weshalb dieser bis heute nichts auf ihn kommen ließ. Obwohl Thomas Ward ansonsten genau das Bild abgab, das beiden Brüdern nicht unbedingt sympathisch war: das ziemlich große Auto, die Anzüge aus feinem Zwirn, die dezenten, aber zweifellos teuren Krawatten …
»Man darf Menschen eben nicht nach ihrem Äußeren beurteilen«, sagte Gavin stets, wenn die Rede auf Ward kam. »Ward ist in Ordnung, da gibt es gar nichts!«
Samson wusste, dass Gillian Ward nicht täglich in die Londoner Firma fuhr. Es war ihm nicht gelungen, eine echte Regelmäßigkeit in ihren Arbeitszeiten zu entdecken. Wahrscheinlich gab es keine. Aber natürlich hatte sie ja auch noch die zwölfjährige Tochter, um die sie sich kümmern musste, Becky, die häufig so verschlossen und trotzig wirkte. Samson hatte den Eindruck, dass Becky ziemlich rebellisch sein konnte. Sie machte ihrer Mutter das Leben bestimmt nicht immer leicht.
Er stutzte, als er plötzlich Gillians Wagen sah, der die Straße hinunterkam, in die Garageneinfahrt einbog und dort stehen blieb. Das war ausgesprochen merkwürdig. Er wusste, dass sie und die Mutter einer Klassenkameradin einander wochenweise abwechselnd die Kinder zur Schule fuhren, aber in dieser Woche war die andere dran, da war er völlig sicher. Vielleicht hatte sie die Kinder gar nicht zur Schule gebracht, bloß wo war sie dann gewesen? Zu dieser frühen Stunde?
Er blieb stehen. Ob sie vorhatte, ins Büro zu fahren? Mit dem Auto bis zur Bahnhaltestelle, entweder Thorpe Bay oder Southend Central, dann weiter mit dem Zug bis Fenchurch Station in London. Er war ihr mehrfach gefolgt, daher kannte er ihren Weg genau.
Er beobachtete, wie sie im Haus verschwand. Das Licht in der Diele ging an. Da die hübsche, rot lackierte Haustür der Wards ein rautenförmiges Fenster in der Mitte aufwies, konnte man von der Straße aus durch den Flur hindurch bis in die gegenüberliegende Küche blicken. Einmal hatte er durch dieses praktische Fenster beobachtet, wie sich Gillian morgens erneut an den Frühstückstisch gesetzt hatte, nachdem ihre Familie schon verschwunden war, wie sie sich noch eine Tasse Kaffee eingeschenkt und diese dann in langsamen, kleinen Schlucken leer getrunken hatte. Neben ihr hatte die Zeitung gelegen, aber sie hatte nicht hineingeschaut. Sie hatte nur an die gegenüberliegende Wand gestarrt. Damals hatte er zum ersten Mal gedacht: Sie ist nicht glücklich!
Dieser Gedanke hatte ihn geradezu schmerzhaft getroffen, denn die Wards waren ihm lieb geworden. Sie passten absolut nicht in das Muster der Menschen, die er bevorzugt beschattete, nämlich alleinstehende Frauen, und er hatte sich schon recht beunruhigt gefragt, weshalb er sich trotzdem an ihnen festgebissen hatte. An einem Sommerabend, an dem er sich in den Straßen herumgedrückt und in den Garten der Wards gestarrt, die kleine Familie lachend und plaudernd beim Grillen auf der Terrasse beobachtet hatte, war ihm plötzlich die Erleuchtung gekommen: Sie waren perfekt. Das zog ihn so magisch an. Die absolut perfekte Familie. Der gut aussehende, gut verdienende Vater. Die attraktive, intelligente Mutter. Das hübsche, lebhafte Kind. Der niedliche schwarze Kater. Ein schönes Haus. Ein gepflegter Garten. Zwei Autos. Kein Reichtum, kein Geprotze, aber solider Mittelstand. Eine Welt, die in Ordnung war.
Die Welt, von der er immer geträumt hatte.
Die Welt, in die er nie gelangen würde, aber er hatte festgestellt, dass es ihn tröstete, wenigstens als Zaungast an ihr teilzunehmen.
Er trat näher an das Haus heran, direkt an das Gartentor, und versuchte, in die Küche zu spähen. Tatsächlich konnte er Gillian sehen, die am Tisch lehnte. Aha, sie hatte sich wieder einmal einen Kaffee nachgeschenkt. Hielt den dicken Keramikbecher in den Händen, trank mit diesen kleinen, nachdenklichen Schlucken, die er schon einmal beobachtet hatte.
Worüber dachte sie bloß immerzu nach? Sie schien oft ganz versunken in ihre Gedanken.
Er ging eilig weiter, er konnte es sich nicht leisten, allzu lange an einer Stelle zu verharren, jedenfalls nicht mitten auf der Straße. Zu gern würde er herausfinden, worin Gillians Kummer bestand, und ihm war klar, warum: weil er hoffte, sich dann selbst beruhigen zu können. Es musste etwas Vorübergehendes sein. Nichts, bitte nichts, was mit ihrer Ehe, mit ihrer Familie zu tun hatte. Vielleicht waren ihre Mutter oder ihr Vater krank und sie machte sich Sorgen. Irgendetwas in dieser Art.
Er lief die Thorpe Hall Avenue hinunter, an den langgestreckten Parkanlagen und Tennisplätzen von Thorpe Bay Garden vorbei, überquerte die Thorpe Esplanade, wo der hektische frühmorgendliche Verkehr nur langsam abflaute, und war nun am Strand. Der kalt, verlassen und winterlich vor ihm lag. Keine Menschenseele war zu sehen.
Er atmete tief durch.
Er fühlte sich so erschöpft wie andere nach einem langen und harten Arbeitstag, und er wusste, woran das lag: daran, dass er Gillian gesehen hatte. Dass er ihr fast direkt begegnet wäre. Dieser Umstand, auf den er sich zuvor nicht hatte einstellen können, hatte ihn emotional so sehr gestresst, dass er, wie ihm jetzt nachträglich erst klar wurde, geradezu im Laufschritt an den Strand geeilt war. Nur fort. In die Stille. Dort konnten sich seine Nerven beruhigen.
Er beobachtete so viele Menschen. Prägte sich ihre Tagesabläufe ein, ihre Gewohnheiten, versuchte, ihre genauen Lebensumstände zu ergründen. Er hätte niemandem erklären können, was ihn so sehr daran faszinierte, aber es war wie ein Sog, in den man geriet. Es war unmöglich, aufzuhören, wenn man einmal damit angefangen hatte. Er hatte von Computerfreaks gelesen, die sich im Second Life ein Parallelleben aufgebaut hatten, und tatsächlich schienen diese Menschen und das, was sie antrieb, am stärksten mit ihm selbst verwandt zu sein. Ein Leben neben dem eigentlichen Dasein. Schicksale, in die man sich hineinträumen konnte. Rollen, in die man schlüpfte. Manchmal war er der erfolgreiche Thomas Ward mit dem schönen Haus und dem teuren Auto. Manchmal war er ein cooler Typ, der weder stotterte noch rot wurde und der die hübsche Frau mit dem Hund zu einem Date bat – natürlich ohne sich einenKorb einzuhandeln. Er brachte damit Glanz und Freude in seinen Alltag, und wenn das gefährlich war oder grenzwertig – und ihm schwante, dass ein Psychologe eine Menge bedenklicher Bezeichnungen für sein Hobby gefunden hätte –, so war es doch die einzige Möglichkeit, die ihm blieb, mit der Tristesse, die ihn umgab, umzugehen.
Aber allmählich veränderte sich etwas, und das beunruhigte ihn.
Er ging ein paar Schritte den Strand entlang. Hier war es windiger als oben in den Straßen, und er war schnell ziemlich durchgefroren. Er hatte seine Handschuhe vergessen und blies sich immer wieder warmen Atem in seine Hände. Natürlich blieb er bei seinen klar abgezirkelten Beobachtungsrundgängen. Er hatte sogar in seinem Computer eine Datei über seine Objekte angelegt, und er vergaß an keinem Abend, pflichtschuldig alles zu notieren, was er gesehen und erlebt hatte. Aber er tat es nicht mehr mit derselben Hingabe wie früher. Und er begriff auch, warum das so war: Es lag an den Wards, besonders an Gillian Ward. Die Wards wurden immer wichtiger für ihn. Sie wurden zu seiner Familie. Sie waren ständig in seinen Tagträumen, es gab nichts, was er nicht über sie wissen, was er nicht mit ihnen zusammen erleben wollte.
Wahrscheinlich war es eine zwangsläufige Entwicklung, dass sein Interesse an den anderen Menschen, die ihn einmal so gefesselt hatten, langsam erlahmte. Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass dies nicht gut war. Er verstand jetzt, warum er sich von Anfang an einen größeren Kreis an Objekten, deren Leben er beobachtete und schriftlich festhielt, gesucht hatte: damit nicht der Einzelne zu viel Bedeutung bekam. Damit er teilnehmen konnte an ihrem Leben, sich jedoch nicht darin verlor.
Mit Gillian könnte ihm das passieren.
Der Wind, der von Nordosten blies, war wirklich kalt. Kein Tag, um ihn am Strand zu verbringen. Im Sommer hatte es Spaß gemacht, von morgens bis abends durch die Straßen zu streifen und der bedrückenden Atmosphäre daheim zu entgehen. Jetzt im Winter sah das natürlich anders aus. Der einzige Vorteil war, dass es früh dunkel wurde und er spätestens ab fünf Uhr sehr bequem in die hell erleuchteten Räume der Häuser blicken konnte. Dafür fror man sich jedoch alle möglichen Körperteile ab.
Er hob den Kopf in den Wind, witterte wie ein Tier. Er fand, dass die Luft nach Schnee roch. Sie hatten nicht oft Schnee hier im Südosten Englands, aber er würde wetten, dass sie in diesem Jahr eine weiße Weihnacht bekämen. Obwohl sich bis dahin natürlich noch eine Menge ändern konnte.
ENDE DER LESEPROBE