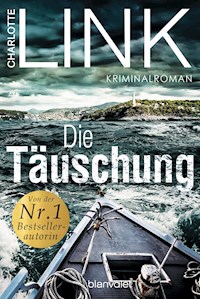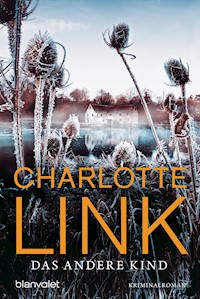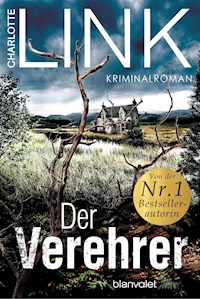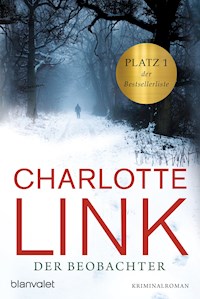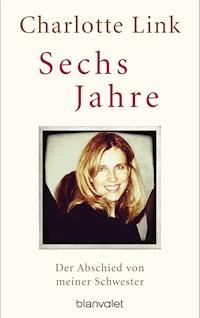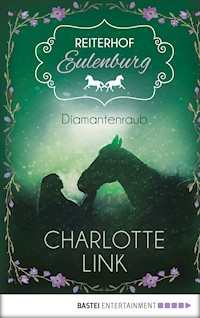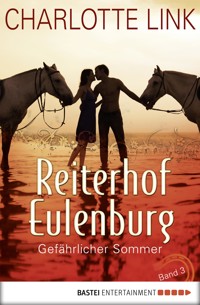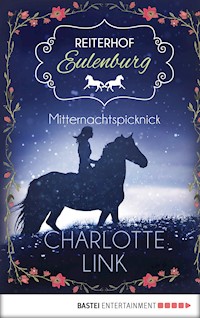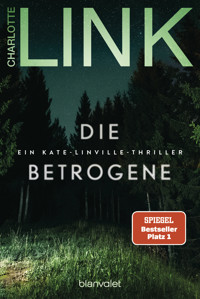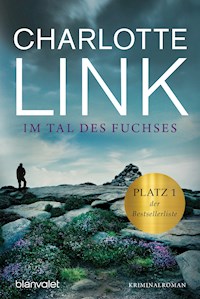
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was, wenn dein Entführer spurlos verschwindet und niemand weiß, wo du bist?
Ein sonniger Augusttag, ein einsam gelegener Parkplatz zwischen Wiesen und Feldern. Vanessa Willard wartet auf ihren Mann, der noch eine Runde mit dem Hund dreht. In Gedanken versunken, bemerkt sie nicht das Auto, das sich nähert. Als sie ein unheimliches Gefühl beschleicht, ist es schon zu spät: Ein Fremder taucht auf, überwältigt, betäubt und verschleppt sie. In eine Kiste gesperrt, wird sie in einer Höhle versteckt, ausgestattet mit Wasser und Nahrung für eine Woche. Doch noch ehe der Täter seine Lösegeldforderung an ihren Mann stellen kann, wird er wegen eines anderen Deliktes verhaftet. Und überlässt Vanessa ihrem Schicksal …
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Link
Im Tal des Fuchses
Roman
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2012 by Blanvalet Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Lektorat: Nicola Bartels Herstellung: Sabine Müller Umschlaggestaltung: bürosüd Umschlagmotiv: Corbis/Julian Calverley Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN: 978-3-641-07987-1 V004 www.blanvalet.de
OKTOBER 1987
Der Junge war nicht sicher, ob er wirklich einen Fuchs gesehen hatte oder ob es ein anderes Tier gewesen war, aber er beschloss schließlich einfach, dass es sich um einen Fuchs gehandelt haben müsste, denn dieser Gedanke gefiel ihm am besten. Als flacher, dunkler Schatten war er durch das kleine Tal geglitten, zwischen den Gräsern, den niedrigen Büschen, den Steinen hindurch, und als er die andere Seite erreicht hatte, die einzige Seite, an der das Tal nicht durch sanft ansteigende Wiesenhänge, sondern durch eine schroffe Felswand begrenzt wurde, tauchte er zwischen dem Gestein unter und war verschwunden. Von einer Sekunde zur anderen schien ihn die Wand verschluckt zu haben.
Der Junge schaute fasziniert zu. Es hatte so ausgesehen, als gebe es in dem Felsen einen Eingang, eine Spalte, die ausreichte, dass ein nicht allzu kleines Tier, immerhin ein Fuchs, ohne jede Mühe einfach hineinhuschen konnte. Er wollte dem Geheimnis auf den Grund gehen. Er ließ sein Fahrrad ins Gras fallen und rannte den Hügel hinab. Er kannte sich gut aus in der Gegend, er kam oft zu dem kleinen stillen Tal, obwohl er über fünf Meilen mit dem Fahrrad zurücklegen musste. Das Tal war schwer zu finden, weil es keine Wege gab, die dorthin führten. Aber darum war man hier auch so ungestört. Man konnte in der Sonne liegen oder auf einem Stein sitzen, in den Himmel blicken und einfach seinen Gedanken nachhängen.
Der Junge erreichte die Stelle, an der der Fuchs verschwunden war. Vor allem als er noch jünger gewesen war, war er an der Felswand oft hinauf- oder hinabgeklettert und hatte sich vorgestellt, er besteige den Mount Everest. Inzwischen war er zehn, und solche Spiele erschienen ihm kindisch, aber er entsann sich noch gut der abenteuerlichen Gefühle, die der Steilhang in ihm ausgelöst hatte. Allerdings hatte er dabei nie etwas entdeckt, das ihn hätte vermuten lassen, es könnte eine Art Öffnung in der Wand geben.
Sein Herz klopfte schnell, als er zwischen dem hohen Farn, der hier in dicken Büscheln wuchs und noch tropfend nass war vom Regen der vergangenen Nacht, nach einem Eingang suchte. Er war sich ganz sicher, dass der Fuchs genau hier, an dieser Stelle, verschwunden war. Mit dem Fuß stieß der Junge gegen den Felsen. Ein paar Steine bröckelten ab und rollten in den Farn.
Vor ihm lag die Felsspalte. Er hatte sie nie zuvor sehen können, weil der Farn sie verdeckte, aber es handelte sich um eine deutliche Öffnung in der Wand. Groß genug auf jeden Fall für einen Fuchs. Der Junge schnaufte vor Aufregung. Er steckte seinen Arm in den Spalt, fürchtete, sofort wieder gegen eine Begrenzung zu stoßen, aber tatsächlich schien es einen Hohlraum im Felsen zu geben.
Er zog den Arm zurück und trat erneut, diesmal erheblich kräftiger, gegen den Fels. Wieder bröckelten Steine, darunter auch dickere Brocken, zu Boden. Jetzt war die Öffnung schon um einiges größer. Der Junge kniete nieder und schaufelte die Steine beiseite. Er hatte nie zuvor bemerkt, dass die Felsbrocken an dieser Stelle ziemlich locker waren. Hatte jemand sie aufeinandergeschichtet? Er blickte nach oben. Vielleicht hatte es hier vor langer Zeit einmal einen Erdrutsch gegeben, Teile des Felsens waren abgesplittert und hinuntergestürzt. Sie hatten den Eingang in den Berg verschlossen.
Er hatte jetzt genug Steine beiseitegeräumt, um einen Höhleneingang freizulegen, der groß genug für ihn war. Einen Moment lang ruhte er sich schwer atmend aus. Obwohl der Tag kalt und feucht war, war der Junge inzwischen vollkommen verschwitzt. Es war anstrengend gewesen, die zum Teil ziemlich großen und schweren Steine zu bewegen. Hinzu kam die Aufregung. Er zitterte am ganzen Körper.
Dann kroch er in die Öffnung hinein.
Kaum hatte er den Eingang hinter sich gelassen, konnte er sich zu seiner vollen Größe aufrichten. Ein erwachsener Mensch würde hier womöglich nur mit eingezogenem Kopf stehen können, aber für einen Jungen seines Alters gab es sogar noch Platz. Er folgte einem kurzen Gang, der sich bald darauf zu einer Art Höhle verbreiterte. Das Tageslicht reichte hier nur noch schwach hin, der Junge konnte kaum etwas erkennen. Was er undeutlich wahrnahm, waren Wände, teils felsig, teils aus Erde, Wurzeln, die von der niedrigen Decke hingen, dünne Rinnsale von Wasser, die zu Boden tropften und dort zwischen Geröll und Lehm versickerten. Er wagte kaum zu atmen vor Spannung, vor Entzücken. Er hatte eine Höhle entdeckt. Eine Höhle in einem Felsen, zugänglich durch einen Geheimgang, den offenbar niemand vorher je gefunden hatte.
Er drehte sich um und zwängte sich zwischen den engen Wänden hindurch wieder zurück zum Eingang. Von dem Fuchs hatte er keine Spur mehr gesehen, aber vielleicht hatte er ihn in der Dunkelheit auch einfach nicht entdecken können. Er musste jetzt unbedingt sofort nach Hause radeln und eine Taschenlampe holen, dann würde er zurückkommen und die Höhle ganz genau erforschen. Er würde auch ein paar Sachen mitbringen – Buntstifte, Briefmarken, einen Plastikbecher – und sie im Inneren der Höhle deponieren. Das würde sein Test sein. Er würde jeden Tag kommen und die Sachen kontrollieren. Wenn alles unverändert blieb, hatte er irgendwann den Beweis, dass wirklich nur er von der Existenz dieses geheimen Ortes wusste.
Draußen angekommen wäre er am liebsten sofort zu seinem Fahrrad gerannt, aber er beherrschte sich und machte sich zunächst die Mühe, alle Steine wieder aufeinanderzuschichten und den Eingang sorgfältig zu verschließen. Er holte sogar feuchte Erde von weiter her und schmierte sie in die Ritzen, damit niemand sehen konnte, dass hier Geröll nur locker übereinanderlag. So gut er konnte, richtete er den niedergetretenen Farn auf. In Zukunft musste er besser aufpassen, er musste sich vorsichtig und geschmeidig bewegen, damit er nicht einen deutlich sichtbaren Trampelpfad hinterließ, der direkt zum Eingang führte. Die Höhle sollte sein Geheimnis bleiben, niemand sonst durfte sie entdecken. Er würde niemanden einweihen, seine Mutter und seinen Stiefvater schon gar nicht, aber auch nicht seine Freunde in der Schule. Er hatte auch nie jemandem etwas von diesem Platz erzählt, zu dem er so gerne kam, und nun hatte der Ort eine viel größere Bedeutung bekommen.
Mein Tal, dachte er, meine Höhle.
Der Fuchs hatte ihm den Weg gezeigt, und so schoss ihm der Name durch den Kopf, den er diesem Flecken Erde, der nur ihm gehörte, geben wollte:
Fox Valley.
Das Tal des Fuchses.
Das hörte sich geheimnisvoll an, fand er, und irgendwie besonders.
Das Tal des Fuchses.
Zufrieden betrachtete er seine Arbeit. Niemand konnte erkennen, dass es hier eine Öffnung im Felsen gab. Niemand würde sein Versteck jemals finden. Und er würde viel Zeit hier verbringen und den Gang vielleicht noch etwas vergrößern und die Höhle befestigen und sich einen wunderbaren Zufluchtsort für alle Zeiten schaffen.
Er lief zu seinem Fahrrad.
»Ich bin bald wieder da«, flüsterte er.
AUGUST 2009
1
Auf der ganzen Fahrt aus dem Norden von Wales hinunter in den Süden hatten sie wieder die lange, entnervende und fruchtlose Diskussion geführt, in die sie sich während der vergangenen Wochen ständig verstrickten. Als sie den Pembrokeshire Coast National Park verließen und Fishguard erreichten, stritten sie sogar richtig. Vielleicht wäre sonst alles ganz anders gekommen. Hätten sie bloß das Thema friedlich zu klären versucht, wäre nur einer von ihnen auf die Idee gekommen zu sagen: »Jetzt lass uns den schönen Tag nicht verderben. Reden wir über etwas anderes. Heute Abend setzen wir uns in Ruhe zusammen, trinken ein Glas Wein und besprechen das alles.«
Aber sie waren aus der Spirale, in der sie sich verfangen hatten, nicht herausgekommen, und alles mündete in eine Tragödie, aber das hatte niemand voraussehen können. Der Streit schwelte seit Langem und ging, wie Vanessa fand, im Grunde um … gar nichts. Matthew, ihr Mann, arbeitete in einer Firma in Swansea, die Computersoftware entwickelte und über viele Jahre extrem erfolgreich gewesen war. In der jüngsten Zeit hatte sich die Situation verschlechtert, die Konkurrenz war stärker geworden, der Markt härter und schneller, und in der Firma wurden Umstrukturierungsmaßnahmen diskutiert, die im Kern darauf hinausliefen, dass man erwog, jüngere Mitarbeiter an anderen Stellen abzuwerben und gegen die eigenen Leute, die sich als nicht mehr wirklich konkurrenzfähig erwiesen, einzutauschen. Matthew war überzeugt – Vanessa bezeichnete es alsfixe Idee –, dass man ihn entlassen würde. Zumindest sah er die Möglichkeit. Und da er ein Angebot aus London bekommen hatte, dort in einer anderen Firma einzusteigen, sah er nicht ein, weshalb er der drohenden Gefahr nicht zuvorkommen, kündigen und nach London gehen sollte.
»Weil du dann zum Beispiel keine Abfindung bekommst«, hatte Vanessa entgegengehalten.
»Okay. Aber was nützt mir die Abfindung, wenn die Stelle in London dann besetzt ist und ich arbeitslos bin?«
»Dann findest du etwas anderes!«
»Und wenn nicht?«
Das Problem war natürlich ein anderes, das Problem war London. Vanessa arbeitete als Dozentin für Literatur an der Universität Swansea. Sie sah nicht ein, dass sie ihre Stelle, ihre Studenten, ihr gesamtes Umfeld aufgeben und ihrem Mann nach London folgen sollte, nur weil dieser einer Kündigung zuvorkommen wollte, die bislang ausschließlich in seiner Phantasie existierte.
»Du verhältst dich wie ein Pascha aus dem vorletzten Jahrhundert«, sagte sie wütend. »Du bestimmst, und ich gehe brav mit dir, wo immer du hinmöchtest. Aber so funktionieren Partnerschaften heutzutage nicht mehr. Ich gehe nicht nach London, Matthew. Und wenn du dich auf den Kopf stellst!«
Er seufzte.
»Nach fünfzehn Jahren Swansea«, sagte er, »wäre da eine Veränderung so schlecht?«
»Nein. Aber nicht ausgerechnet jetzt. Und nicht nur, weil es dir gerade in den Kram passt!«
Max, der große, langhaarige Schäferhund, der auf dem Rücksitz lag, hob den Kopf und winselte. Matthew warf einen Blick in den Rückspiegel. »Ich fürchte, Max muss raus. Bis wir daheim sind, hält er nicht durch.«
Vanessa erwiderte nichts. Sie presste die Lippen so fest aufeinander, dass sie zu einem weißen Strich wurden. Kurz entschlossen bog Matthew bei der nächsten Gelegenheit von der Hauptstraße ab und folgte der Landstraße, die sie wieder zum Coast Park hinführte. Der Abend brach herein, die Sonne stand schon tief. Ein warmer, klarer, wunderbarer Augustabend. Rotgoldenes Licht lag über den Feldern ringsum. Sie bemerkten einen einsamen Wanderer, der gerade über ein Weidengatter kletterte, aber ansonsten war keine Menschenseele zu sehen. Der Nationalpark, der sich über viele Meilen direkt am Meer entlangzog, sich aber auch tief ins Landesinnere erstreckte, war ein Touristenmagnet. Im Sommer waren hier ständig Menschen unterwegs, zu Fuß, zu Pferd oder auf dem Mountainbike, dies jedoch vor allem in der Gegend direkt an der Küste. Abseits vom Meer hingegen konnte man stundenlang wandern, manchmal ohne einem anderen Menschen zu begegnen.
Sie kamen an einem kleinen Parkplatz vorbei, der ein Stück unterhalb der Straße lag und einen schönen Ausblick über die Landschaft bot. Es gab einen Picknicktisch mit zwei Bänken und einen Abfallkorb aus Metall. Der Abfallkorb war völlig leer, offenbar kamen selten Menschen hierher.
Matthew hielt an. »Komm«, sagte er, »lass uns ein Stück mit Max laufen. Das wird uns guttun.«
Vanessa schüttelte den Kopf. »Geh du allein. Ich brauche ein bisschen Abstand. Ich möchte nachdenken. Ich warte hier.«
»Sicher?«
»Ja. Sicher.«
Sie stiegen aus. Warme Luft schlug ihnen entgegen. Die Klimaanlage im Wagen hatten sie auf zwanzig Grad gestellt, draußen mussten es noch an die vierundzwanzig Grad sein. Es gab keine einzige Wolke am lichtblauen Himmel. Es war einer jener Sommertage, von denen man den ganzen Winter über träumen konnte.
Weißt du noch, dieser herrliche Augustsonntag? Dieser einsame Rastplatz am Ende der Welt … Nichts als Ruhe und Wärme …
Nein, so würden sie nicht sprechen, dachte Vanessa. Jenen Sonntag würden sie wohl stets nur mit ihrem Streit in Verbindung bringen. Wie auch immer sich die Dinge am Ende entschieden, sie würden sich an eine lange Fahrt von Holyhead hinunter nach Swansea erinnern und daran, dass sie die meiste Zeit über debattiert hatten. Und dass Matthew schließlich allein eine Runde mit Max gedreht hatte, während sie, Vanessa, am Auto blieb, weil sie so zornig auf ihn war, dass sie nicht mitgehen mochte.
Es gab einen Trampelpfad, der zunächst ein kleines Stück in ein Tal hinunterführte, dann jedoch einen scharfen Bogen nach links um den Hügel herum schlug und von dort an vom Parkplatz aus nicht mehr zu sehen war. Vanessa blickte Matthew und Max nach, wie sie um die Ecke verschwanden; Max, der sich noch ein paar Mal unruhig nach seinem Frauchen umgesehen hatte, schließlich in großen Sprüngen vorneweg, Matthew langsamer hinterher. An Matthews sehr geraden Schultern konnte sie ablesen, wie verärgert auch er noch war. Klar, er fühlte sich unverstanden. Brachte aber selbst keinerlei Verständnis auf. Wahrscheinlich würde er nun ziemlich lange mit dem Hund unterwegs sein. Matthew brauchte immer Bewegung, wenn er Stress hatte, meistens kam er dann aber viel gelöster und ausgeglichener zurück.
Sie schlenderte langsam vom Auto zu dem Picknicktisch hinüber, setzte sich auf die Bank, deren Holz warm war von der Sonne. Das Abendlicht war so sanft, dass es nicht mehr blendete. Sie blickte über das flache Tal, das weit war, wellig und sehr grün. Eine Steinmauer zog sich an seiner Nordseite entlang, dann schloss sich eine kleine Baumgruppe an. Ansonsten gab es nur flache Ginsterbüsche, die jetzt von einem etwas verstaubten Grün waren. Im April, wenn sie blühten, musste die Gegend wie überschwemmt sein von gelben Farbklecksen.
Wie schön es hier war! Vanessa überlegte, dass sie viel öfter hierherkommen sollten. Die einzelnen Gebiete des Nationalparks lagen gar nicht so weit von Swansea entfernt, aber sie konnte es an einer Hand abzählen, wie oft sie und Matthew in den vergangenen fünfzehn Jahren den Weg dorthin gefunden hatten. Und dann hatte es sie immer an die Küste zum Schwimmen gezogen. Vielleicht sollten sie für den Herbst ein Wanderwochenende planen. Auch Max würde sich freuen, er ging so gerne spazieren. Na ja, vielleicht bereiteten sie da auch schon ihren Umzug nach London vor.
London.
Ich will nicht weg von allem, was ich kenne, dachte sie, und ich will auch keine Wochenendbeziehung, Matthew in London und ich in Swansea … Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe …
Gleichzeitig fragte sie sich, ob dieses Festhalten am Vertrauten die richtige Einstellung war für eine siebenunddreißigjährige Frau. Musste man in ihrem Alter nicht noch beweglicher sein? Flexibler? Erlebnishungriger?
Neugieriger?
Sie war so sehr in ihre Gedanken vertieft, dass sie kaum merkte, wie die Zeit verstrich. Zwei- oder dreimal hörte sie ein Auto oben auf der Landstraße vorbeifahren, sonst blieb alles ruhig. Gerade als sie endlich auf die Uhr schaute und feststellte, dass Matthew und Max nun schon seit fast zwanzig Minuten fort waren, hörte sie erneut ein Auto kommen. Es wurde langsamer, als es die Höhe des Rastplatzes erreicht hatte, beschleunigte dann, bremste jedoch ein Stück weiter schon wieder ab. Vanessa wandte sich um, sah aber nichts. Eine mit Hecken bewachsene kleine Anhöhe trennte den Rastplatz von der Straße, erst wenn ein Auto um eine weitere Biegung gefahren war, konnte man es von hier aus sehen. In diesem Moment tauchte es auf. Ein weißer Kastenwagen mit irgendeiner Aufschrift an der Seite, die sie aber auf diese Entfernung nicht lesen konnte. Vanessa erkannte, dass der Wagen sehr langsam fuhr. Jetzt wendete der Fahrer mitten auf der Straße und kam wieder zurück. Er verließ Vanessas Sichtfeld, aber sie hörte ihn noch immer. Der Wagen schien am Rastplatz geradezu vorüberzuschleichen, beschleunigte dann. Bremste wieder. Vanessa runzelte die Stirn. Wendete er erneut? Wieso fuhr dieses Auto dort oben ständig auf und ab? Und handelte es sich um dasselbe Fahrzeug, das sie schon vorher einige Male gehört, aber nicht weiter beachtet hatte? Sie hörte es schon wieder näher kommen, langsamer werden. Diesmal jedoch bog es offenbar auf den Parkplatz ein. Vanessa drehte sich wieder um, konnte aber nichts sehen. Sie hörte, dass eine Autotür schlug. Anscheinend hatte das Auto in der Auffahrt geparkt, war nicht bis auf den eigentlichen Rastplatz gefahren. Vielleicht jemand, der nur rasch pinkeln wollte und gesehen hatte, dass eine Frau auf der Picknickbank saß.
Sie versuchte die Unruhe, die sich ihrer bemächtigen wollte, zu ignorieren und schaute über das Tal.
Matthew könnte wirklich langsam zurückkommen, dachte sie.
Sie wünschte, Max würde bellend um die Ecke schießen. Sie hätte den großen Hund jetzt gerne an ihrer Seite gehabt. Gleichzeitig nannte sie sich hysterisch. Nur weil ein Auto ein paarmal hin und her fuhr … Nur weil sie sich hier mit einem Mal so mutterseelenallein vorkam …
Obwohl sie keinen Laut vernommen hatte, zwang sie eine plötzliche Nervosität, sich ruckartig umzuwenden. Es war ein unerklärbares Gefühl von Bedrohung gewesen, es hatte ihre Härchen am Körper aufgestellt und ihr trotz der Wärme ein Frösteln über beide Arme gejagt.
Ein Mann stand direkt hinter ihr.
Keine zwei Schritte von ihr entfernt. Er war geräuschlos herangekommen.
Sie sprang auf. Sie war nicht ganz sicher, ob sie dabei auch einen Schrei ausstieß, aber sie hielt es für möglich.
Der Typ war absolut unheimlich.
Es ging ihm anscheinend darum, sein Gesicht zu verbergen, denn trotz des noch sehr warmen Abends trug er eine schwarze Baseballkappe, die er sich tief in die Stirn gezogen hatte, eine völlig undurchsichtige kohlschwarze Sonnenbrille, ein schwarzes Halstuch, das er so hochgeschoben hatte, dass es fast den Mund bedeckte. Vanessa konnte eigentlich nur seine Nase sehen. Sein Körper steckte in einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Rollkragenpullover. Er hatte Handschuhe an.
Sie schluckte trocken.
»Was …?«, begann sie.
In der nächsten Sekunde hatte der Mann eine blitzschnelle Bewegung auf sie zugemacht. So unvermittelt, dass Vanessa keine Chance zur Gegenwehr oder gar zum Ausweichen blieb. Etwas Nasses wurde gegen ihr Gesicht gepresst, ein stechender Geruch umfing sie, reizte ihre Bronchien zu heftigem Husten. Der Geruch verursachte ihr Schmerzen und Übelkeit und raubte ihr dann von einem Moment zum nächsten die Sinne. Sie fuchtelte kraftlos mit den Armen wie eine schlaffe Gummipuppe, die an Fäden aufgehängt ist, und dann verlor sie auch schon das Bewusstsein.
Sie stürzte in völlige Finsternis.
In eine endlose Nacht.
2
Er war schweißgebadet. Obwohl er sich längst des dicken Pullovers, der Mütze, des Halstuches und der Handschuhe entledigt und die Sachen irgendwo nach hinten in den Wagen geworfen hatte. Er trug nur noch die Jogginghose, dazu ein weißes Muskelshirt. Seine ausgelatschten Turnschuhe.
Aber er schwitzte so, dass er spürte, wie ihm das Wasser den Rücken hinunterrann.
Er merkte, dass er zu schnell fuhr, und nahm hastig den Fuß vom Gas. Es hätte ihm noch gefehlt, ausgerechnet jetzt einer Polizeistreife aufzufallen. Zwar war er nicht alkoholisiert, aber vielleicht hätte man ihn gefragt, weshalb er an diesem Abend zwischen der Westküste und Swansea unterwegs war. Obwohl dies an sich nicht verdächtig war. Und nicht verboten.
Entspann dich, Ryan, sagte er zu sich selbst. Du hast den Sonntag am Meer verbracht und bist nun auf dem Heimweg. Daran ist nichts Seltsames.
Trotzdem fuhr er langsamer. Und trotz der eigenen beschwichtigenden Gedanken hörte er nicht auf zu schwitzen, und auch sein schneller, harter Herzschlag beruhigte sich nicht.
Seit Tagen versuchte er, seine mahnende, warnende innere Stimme zu überhören, die Stimme, die ihm unaufhörlich zuraunte, dass er sich mit seinem Vorhaben vollkommen übernahm. Dass Entführung und Erpressung nicht nur eine Nummer, sondern mindestens zehn Nummern zu groß für ihn waren. Ryan Lee war bei Gott kein unbeschriebenes Blatt, bestens polizeibekannt und zweifach vorbestraft wegen Einbruch und Körperverletzung. Er hatte zwar immer wieder probiert, seinen Lebensunterhalt durch redliche Arbeit zu verdienen, war aber jedes Mal auf irgendeine Art gescheitert; meist daran, dass es ihm nicht gelang, dauerhaft pünktlich morgens aus dem Bett und an seinen Arbeitsplatz zu kommen. Dann folgte die Kündigung, und er geriet wieder einmal auf die schiefe Bahn. Insofern war ihm ein Leben außerhalb oder höchstens am Rande der Legalität nur zu bekannt.
Aber es gab schiefe Bahnen und schiefe Bahnen.
Es war eine Sache, ein paar Computer aus einem Elektrofachgeschäft zu klauen, ein Auto zu knacken, einer alten Dame die Handtasche zu entwenden oder eine deftige Schlägerei vom Zaun zu brechen.
Eine andere Sache war es, eine Frau zu überfallen, zu betäuben, zu verschleppen und zu verstecken, um von ihrem Ehemann hunderttausend Pfund Lösegeld zu verlangen.
Dabei konnte so vieles danebengehen, dass ihm, wenn er sich seinen Ängsten auch nur eine Sekunde lang hingab, ganz schwindelig wurde. Zum Beispiel würde er den Ehemann natürlich als Erstes warnen: Keine Polizei! Aber vieles sprach dafür, dass dieser sich dennoch sofort mit den Bullen in Verbindung setzte. Dann hatte er, Ryan, nicht einen einzelnen Mann gegen sich, der noch dazu geschockt und verstört war, sondern den ganzen Polizeiapparat der Region. Die Geldübergabe würde unter diesen Umständen der gefährlichste Moment sein, denn es war klar, dass sie genau dabei versuchen würden, ihn zu schnappen. Sein einziger Trumpf war die Geisel. Diese würde man nicht gefährden wollen.
Er merkte, dass er inzwischen zu langsam fuhr, auffallend langsam, und steigerte das Tempo wieder. Seine Hände waren so nass, dass sie am Lenkrad abzurutschen drohten. Er musste an die Frau denken. Vanessa hieß sie. Dr. Vanessa Willard. Dozentin an der Universität Swansea. Sie hatte ihm bereitwillig ihren Namen und ihren Beruf genannt, den Namen ihres Mannes, die gemeinsame Wohnadresse in Mumbles, einem Vorort von Swansea. Die Telefonnummer. Alles, was er wissen wollte. Ihr war noch übel gewesen vom Chloroform, das er ihr mithilfe eines Tuches ins Gesicht gepresst und das dafür gesorgt hatte, dass sie eine ganze Stunde fest schlief. Er hatte sie einigermaßen problemlos in sein Auto schleifen und etliche Meilen weit in eine andere Gegend transportieren können, einigermaßen nur deshalb, weil er drei Tage zuvor, am Donnerstagabend, in eine sehr heftige Kneipenschlägerei verwickelt gewesen war, von der ihm noch immer der rechte Arm höllisch wehtat. Trotzdem hatte er die Frau das letzte Stück bis zu der Höhle getragen. Der schwierigste Part war dann gewesen, sie durch den flachen Gang in das Innere des Felsens zu schaffen. Er konnte sich nur geduckt vorwärtsbewegen, und zudem war es inzwischen auch draußen dämmrig geworden, sodass fast kein Schimmer Tageslicht mehr ins Innere drang. Er hatte zwar eine Taschenlampe dabei, aber er hatte keine Hand frei, sie zu halten. Erster Fehler. Ein Stirnband mit Glühbirne zu besorgen, wie es Bergarbeiter verwendeten, hätte unbedingt zu seinen Vorbereitungen gehören müssen.
Er hatte schnell erkannt, dass die Sache mit der Beleuchtung bei Weitem nicht der einzige Fehler gewesen war. Denn schließlich war die Frau aufgewacht, und nachdem sie sich übergeben hatte – was vom Chloroform herrührte –, hatte sie nach ihrem Mann gerufen, und er hatte herausgefunden, dass der Mann vorhin ganz in der Nähe des Rastplatzes gewesen war. Er hatte nur den Hund, einen Schäferhund, ausgeführt, sie hatte ihn jeden Moment zurückerwartet. Ihm war ganz kalt und gleich darauf heiß vor Entsetzen geworden. Nachdem er bei seinem ziellosen Herumfahren die einsame Frau auf dem Rastplatz entdeckt hatte, war er mehrfach die Landstraße auf und ab gefahren und hatte überprüft, dass sich sonst niemand in der Gegend aufhielt. Außerdem hatte er gecheckt, ob sie tatsächlich das geeignete Objekt für seinen Plan darstellte. Der große teure BMW hatte ihn überzeugt, zudem die Art, wie die Frau gekleidet war: lässig zwar in Jeans und T-Shirt, aber es schien sich um jene gekonnte Schlichtheit zu handeln, für die man eine ordentliche Stange Geld hinlegen musste. Er brauchte keine Millionäre, nicht bei hunderttausend Pfund, aber an Sozialhilfeempfänger durfte er auch nicht aus Versehen geraten.
Sie war perfekt, absolut perfekt, hatte er entschieden.
Um dann zu erfahren, dass er fast von einem Mann und einem Schäferhund überrascht worden wäre. Wenn er genau überlegte, hatte es in diesem Moment mit den Schweißausbrüchen angefangen, die bis jetzt nicht aufhören wollten.
Du hättest vorsichtiger sein müssen, sagte er sich ständig, viel aufmerksamer. Viel misstrauischer. Viel sorgfältiger.
Vanessa hatte in dem Felsenloch gekauert, immer noch mit ihrem Brechreiz kämpfend und völlig unter Schock stehend, sodass er es gewagt hatte, sie loszulassen und die Taschenlampe einzuschalten. Sein Halstuch hatte er vor Mund und Nase gezogen. Vanessa sah sich um, erkannte, dass sie sich unter der Erde befand, sah die längliche Holzkiste mit dem aufgeklappten Deckel und drehte durch. Auf allen vieren versuchte sie, den Gang nach draußen zu erreichen, während sie mörderisch schrie und wie eine Raubkatze um sich schlug, als er sie an ihrem rechten Bein zu packen bekam. Er wusste, dass sich hier weit und breit kein Mensch aufhielt und daher niemand sie hören konnte, trotzdem machte ihn ihr Gebrüll nervös. Er war sehr stark dank des Muskeltrainings, das er regelmäßig betrieb, daher hatte die Frau, die zudem noch unter den Nachwirkungen der Betäubung litt, keine Chance. Dennoch lieferte sie ihm einen beachtlichen Kampf. Sie wehrte sich wie eine Rasende, kratzte, biss und schlug, und er war nur froh über seine Maskerade, die es verhinderte, dass man später Blutspuren an ihm finden konnte. Mit einem gezielten Faustschlag hätte er sie sofort außer Gefecht setzen können, aber zu diesem Zeitpunkt kannte er ihren Namen und ihre Adresse noch nicht; er brauchte diese Informationen und hätte sie von einer Bewusstlosen nicht bekommen. Auch mochte er ihr nicht wehtun. Sie tat ihm leid, und für sie wie für sich hoffte er, die ganze Geschichte werde schnell und reibungslos über die Bühne gehen.
Es war ihm gelungen, ihre Handgelenke zu umklammern und sie dadurch ruhigzustellen. Im selben Moment fiel sie wie ein Häufchen Elend in sich zusammen. In ihren weit aufgerissenen, flackernden Augen stand namenloses Entsetzen.
»Ich will Geld«, sagte er zu ihr. Seine Stimme klang für ihn selbst dumpf und ungewohnt unter dem dicken Tuch. »Nur das. Wenn deine Angehörigen gezahlt haben, hole ich dich sofort hier raus. Gehört das Auto, mit dem du unterwegs warst, dir?«
Sie konnte nur leise krächzen. »Meinem Mann und mir.«
Es war wirklich ein Glück, dass es diesen Ehemann gab. Ryan hätte sich sonst mit Eltern oder Geschwistern, die womöglich über ganz Großbritannien verstreut lebten, auseinandersetzen müssen. Mit der Existenz eines Ehemanns war zumindest die Zuständigkeit geklärt. Und auf jeden Fall war nicht die schlimmste Variante eingetreten: dass sie nämlich völlig allein war und es niemanden gab, den man erpressen konnte. Diese Möglichkeit hatte Ryan am meisten gefürchtet.
»Wie heißt dein Mann?«, fragte er.
Sie machte zwei vergebliche Anläufe, ehe ihre Stimme ihr erneut gehorchte. Sie hatte so sehr geschrien, dass sie völlig heiser war.
»Matthew«, brachte sie schließlich hervor, »Matthew Willard.«
»Und du bist?«
»Vanessa. Dr. Vanessa Willard. Ich bin Dozentin an der Universität Swansea. Ich verdiene nicht besonders viel Geld.«
»Wo wohnt ihr?«
Sie nannte ihm die Adresse und die Telefonnummer. Er speicherte das alles in seinem Gedächtnis. Aufschreiben erschien ihm zu gefährlich.
»Wir … sind wirklich keine Millionäre«, sagte sie. »Sie … müssen mich verwechseln.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich will hunderttausend Pfund. Die wird dein Mann beschaffen können.«
Sie schien verwirrt. Sicher hatte sie mit einer Millionenforderung gerechnet. Aber woher sollte sie auch alle Hintergründe und Umstände kennen?
Der schwierigste Moment kam, als er ihr klarmachte, dass sie sich in die Kiste legen musste und er den Deckel verschließen würde. Diesmal versuchte sie nicht zu fliehen, aber sie begann zu hyperventilieren, und zwar so heftig, dass er im ersten Moment glaubte, sie habe einen Asthmaanfall.
»Bitte«, stieß sie schließlich hervor. »Bitte nicht! Bitte, tun Sie mir das nicht an, bitte! Bitte!«
Er versicherte ihr, dass sie es gut haben würde. »Es gibt genug Luftlöcher. Du hast eine Taschenlampe. Ich habe Zeitschriften dort hineingelegt. Genügend Wasser und Essen. Und vielleicht zahlt dein Mann schon morgen. Dann bist du sofort draußen.«
»Ich bin doch hier in einer Höhle unter der Erde. Warum reicht das nicht? Warum …?«
Er erklärte ihr, dass er die Höhle mit Steinen verschließen würde, dass sie aber durchaus in der Lage wäre, diese Steine in geduldiger Arbeit beiseitezuschaffen, und dass er das nicht geschehen lassen konnte. »Ich werde jeden Tag nach dir sehen«, versprach er. Das war eine Lüge. Die Strecke war von Swansea aus zu weit, und er würde das Risiko aufzufallen nicht eingehen. Da konnte er ja gleich die Polizei zu dem Versteck führen. Aber für den Moment war es ratsam gewesen, ihr irgendetwas Tröstliches zu erzählen.
Sie hatte geweint, als sie sich in die Kiste legte, und dabei gezittert wie Espenlaub. Er hatte sie schluchzen gehört, als er den Deckel an sechs Stellen mit Schrauben, deren Gewinde er vorgebohrt hatte, verschloss. Zum Glück hatte sie nicht mehr sehen können, dass auch er dabei zitterte. Es hätte sie noch mehr beunruhigt zu erkennen, dass er sich selbst der ganzen Geschichte keineswegs nervlich gewachsen fühlte.
Er erreichte jetzt die ersten Ausläufer von Swansea und schaltete einen Gang zurück. Der Wagen gehörte zu einer Wäschereikette, für die er seit einem halben Jahr arbeitete. Endlich wieder einmal ein Job, aber einer, der anstrengend war und wenig einbrachte. Seine Aufgabe war es, die Wäsche in verschiedenen Hotels und Restaurants in Swansea und der weiteren Umgebung einzusammeln und später gewaschen und gebügelt wieder auszuteilen. Dafür hatte man ihm den weißen Kastenwagen mit der Aufschrift Clean! zur Verfügung gestellt. Das war der einzige Vorteil, den diese Arbeit ihm brachte: ein Auto in seinem Besitz zu haben. Zwar durfte er es eigentlich nicht für private Fahrten nutzen – und die Entführung und Verschleppung einer Frau zählten ganz klar zur privaten Nutzung –, aber bis jetzt hatte es noch niemand kontrolliert, und er füllte immer wieder den Tank nach seinen Spitztouren auf und hoffte, dass er nicht erwischt werden würde.
In Swansea herrschte an diesem Sonntagabend um kurz vor halb zehn wenig Verkehr, und Ryan gelangte ohne Probleme in die Stadt. Wie so oft in seinem Leben hatte er gerade keine eigene Wohnung, lebte mal hier, mal dort, zurzeit bei Debbie, einer Freundin, mit der er einige Jahre lang eine Beziehung gehabt hatte, ehe sie sich wegen seiner permanenten Kollisionen mit dem Gesetz von ihm getrennt hatte. Dennoch standen sie einander nahe, daher hatte sie ihn aufgenommen, als er keine Bleibe fand. Debbie arbeitete im Schichtdienst für ein Gebäudereinigungsunternehmen und war selten zu Hause.
Ryan wusste, dass Debbie auch jetzt nicht daheim sein würde, weil sie an diesem Wochenende für die Arbeit in einem größeren Gebäudekomplex eingeteilt war, der vor allem Kinos und Fast-Food-Läden beherbergte. Er würde schnell duschen und ein Bier trinken, und hoffentlich würde der Alkohol seine Anspannung, seine auf der Lauer liegende Panik auflösen. Sodann würde er eine Telefonzelle aufsuchen und Matthew Willard anrufen. Natürlich musste er damit rechnen, dass Willard bereits die Polizei verständigt hatte, als er Vanessa nicht mehr auf dem Parkplatz angetroffen hatte, aber er vermutete, dass die Beamten nach so kurzer Zeit noch nicht wirklich in die Gänge gekommen waren. Ging man Vermisstenmeldungen bei Erwachsenen nicht erst vierundzwanzig Stunden später nach? Oder sogar achtundvierzig? Oder war das nur ein Gerücht, das sich hartnäckig hielt?
Sein Herzschlag, der gerade dabei gewesen war, sich ein klein wenig zu beruhigen, begann schon wieder in einem wirren und unregelmäßigen Rhythmus zu galoppieren. Er hatte so viele Dinge nicht bedacht, er war absolut dilettantisch an die Umsetzung seines Planes herangegangen. Wenn die Polizei nun doch schon bei Willard daheim war? Wenn eine Fangschaltung installiert worden war?
Er musste unbedingt daran denken, das Gespräch so kurz wie möglich zu halten. Die durften die Telefonzelle, aus der er anrief, keinesfalls identifizieren.
Ihm wurde schwindelig, als ihm aufging, in welchen Wahnsinn er sich gestürzt hatte.
Aber er hatte geglaubt, keine andere Wahl zu haben. Genau genommen hatte er auch keine, nachdem ihm Damon zweimal die Nachricht hatte zukommen lassen, er wolle sofort die zwanzigtausend Pfund zurückhaben, die Ryan ihm schuldete. Danach hatte er ein paar Schlägertypen geschickt, die Ryan noch auf andere Art erinnern sollten – nach diesem Besuch hatte er sich für zehn Tage krankmelden müssen, weil er sich kaum mehr hatte bewegen können. Er kannte Damon: Er würde nicht lockerlassen. Und irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft würde Ryan mit dem Gesicht nach unten im Hafenbecken von Swansea treiben, das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Er war realistisch genug zu wissen, dass er Damon nicht entkommen konnte. Er würde ihn aufspüren, überall auf der Welt. Damon war mächtig, skrupellos und gerissen. Er kannte keine Moral, kein Mitleid. Er war unfähig, eine Niederlage hinzunehmen.
Damon war hochgradig gefährlich, und Ryan hatte begriffen: Er musste zwanzigtausend Pfund auftreiben, darin bestand seine einzige Chance.
Genauso gut hätte er eine Million Pfund anstreben können. Der eine wie der andere Betrag war völlig abwegig für ihn.
So war der Plan der Entführung entstanden. Er hatte sich der Höhle im Fox Valley entsonnen, die er als Kind entdeckt, seit fast zwanzig Jahren aber nicht mehr aufgesucht hatte. Als er nun wieder dort hinkam, stellte er fest, dass offenbar tatsächlich niemand außer ihm von ihrer Existenz wusste. Es gab nicht die geringsten Spuren anderer Menschen. Mit zusätzlichen Steinen, die er mühsam heranschleppte, hatte er damals den Eingang absolut perfekt getarnt – natürlich nicht in der Absicht, dort einmal ein Versteck für ein Entführungsopfer einzurichten. Es war eher so gewesen, dass ihm der Gedanke gefiel, einen Ort auf der Welt zu haben, den niemand kannte, der ihm allein gehörte.
Aus alldem war jetzt eine Situation entstanden, die mit seiner einst kindlichen Freude an einem Geheimnis nichts mehr zu tun hatte. Wenn etwas schiefging, saß er für viele Jahre im Knast, so viel stand fest. Ryan hatte es bislang stets geschafft, mit Bewährungsstrafen davonzukommen. Er hatte eine höllische Angst vor dem Gefängnis. Aber ihm war klar, dass seine spezielle Lebensweise ihn irgendwann genau dorthin bringen würde, und daher hatte er auch beschlossen, nicht nur zwanzigtausend Pfund zu erpressen, sondern hunderttausend. Zwanzig, um sich Damon, den Kredithai, mit dem er sich leichtsinnigerweise eingelassen hatte, ein für alle Mal vom Hals zu schaffen. Und achtzig, um damit fortzugehen und sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Eines, in dem es keine Schlägereien, keine Diebstähle, keine Betrügereien mehr gab. Was genau er machen wollte, wusste er noch nicht. Aber die wahnsinnige Vorstellung, achtzigtausend Pfund sein Eigen zu nennen, verlieh ihm ein überwältigendes Gefühl völliger Unangreifbarkeit. Mit so viel Geld war man sicher. Da stellte man etwas auf die Beine, irgendetwas. Darüber brauchte er sich im Vorfeld nicht den Kopf zu zerbrechen. Im Moment gab es Wichtigeres, worauf er sich konzentrieren musste.
Direkt vor Debbies Wohnung fand man selten einen Parkplatz, daher stellte Ryan das Auto in der Glanmorgan Street ab und machte sich auf den Weg die Paxton Street hinunter. Er mochte die Gegend, in der Debbie wohnte, nicht besonders, manchmal fand er es dort richtig trostlos. Aber es war ohnehin klar, dass er in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin nicht ewig würde bleiben können. Sosehr er Debbie noch immer mochte.
Er spürte sofort, dass etwas nicht stimmte, aber da es nicht einen einzigen konkreten Anhaltspunkt für sein ungutes Gefühl gab, sagte er sich, dass er an einer Einbildung litt. Seine Nerven waren ziemlich angespannt, kein Wunder, nach allem, was an diesem Tag geschehen war. Vermutlich würde jeder in seiner Situation die Flöhe husten hören.
Dennoch war es merkwürdig. Dunkel und verlassen lag die Straße vor ihm. In einigen der Häuser ringsum brannte noch Licht. Aber kein Mensch ließ sich blicken, alles war friedlich, wie ausgestorben, absolut ruhig. Zu ruhig für einen so warmen Abend? Er hob den Kopf, als nehme er Witterung auf wie ein Tier auf der Jagd.
Verdammt, Ryan, bleib cool, sagte er zu sich, du hast ein paar teuflisch anstrengende Tage vor dir, und wenn du dabei andauernd durchdrehst, kannst du die ganze Nummer am besten gleich vergessen!
Er zwang sich, näher auf das Haus, in dem Debbie wohnte, zuzugehen.
In all den Jahren, in denen er sich nun schon stets am Rande des Gesetzes – und oft genug sogar jenseits des Gesetzes – bewegte, hatte er ein Gespür für Bullen entwickelt. Er roch es förmlich, wenn sie in der Nähe waren. Ganz selten einmal hatte er sich in diesem Punkt getäuscht. Er sagte sich jedoch, dass es diesmal ganz sicher nicht sein konnte. Er hatte etwas Schlimmes getan, aber es war einfach unmöglich, dass die Polizei ihm auf der Spur war. Selbst wenn Willard seine Frau schon als vermisst gemeldet und ein riesiges Theater veranstaltet hatte, war es unwahrscheinlich, dass man dort bereits von einer Entführung ausging. Würde man nicht eher glauben, Vanessa Willard habe ihren Mann verlassen? Sich vielleicht mit einem Liebhaber auf und davon gemacht?
Er blieb jäh stehen, als ihm eine erschreckende Möglichkeit durch den Kopf schoss: Was, wenn er gesehen worden war? Wenn irgendjemand ihn beobachtet hatte, wie er die bewusstlose Frau in sein Auto schleifte?
Unmöglich, dachte er. Er hatte sich immer wieder umgeblickt, die Straße, die Landschaft zu jeder Sekunde im Visier gehabt. Da war weit und breit niemand gewesen. Andererseits hatte er sich auch eingebildet, im Vorfeld der Entführung alles genauestens abgecheckt zu haben, und ihm war glatt entgangen, dass Matthew Willard und sein Hund in der Nähe herumstreiften.
Trotzdem. Es war ein abwegiger Gedanke, dass sie an ihm dran sein sollten. Es war seine Nervosität, die ihm gerade einen Streich spielte.
Er ging weiter. Er hatte das Auto, das gegenüber dem Haus parkte, in dem sich eine Obdachlosenunterkunft befand, nicht beachtet, obwohl es im Halteverbot stand, aber nun plötzlich befiel ihn genau deshalb eine seltsame Unruhe. Er wandte sich noch einmal um und sah, dass das Auto nicht leer war wie die vielen anderen Wagen, die entlang der Straße auf den regulären Parkplätzen standen. Da saßen zwei Typen drin, und in dieser Sekunde wusste Ryan, dass ihn das Gefühl einer lauernden Gefahr nicht getrogen hatte.
Er drehte auf dem Absatz um und rannte die Straße hinunter. Er konnte eine Autotür knallen hören und dann den Ruf: »Halt! Stehen bleiben! Polizei!«
Er scherte sich nicht darum. Er rannte weiter, vernahm Schritte hinter sich. Sie folgten ihm. Mal sehen, wer sich besser in der Gegend auskannte.
Am Ende der Straße bog er nach links in die Oystermouth Road ab, wusste aber, dass er ihr nicht lange folgen konnte, da es kaum Möglichkeiten zum Untertauchen gab. Er würde auch nicht auf die andere Seite wechseln, denn dort begannen die großen Parkplätze, an die sich dann die Marina anschloss, und dort hatte er weites, offenes Gelände vor sich, ehe er den Hafen erreichte. Er musste versuchen, sich vom Wasser fort in Richtung Innenstadt zu bewegen und dort ein Versteck zu finden. Er war schnell, das wusste er, oft genug hatte er selbst hartnäckige Verfolger schließlich abgehängt. Weil er eine tolle Kondition hatte, weil er Haken schlagen konnte wie ein Hase, weil er Swansea wie seine Westentasche kannte. Allerdings war ihm der verdammte Polizist ungewöhnlich dicht auf den Fersen, obwohl er erst noch aus dem Auto hatte springen müssen und obwohl Ryan einen beachtlichen Vorsprung gehabt hatte. Ebendieser Vorsprung war beängstigend stark geschmolzen.
Ryan erhöhte sein Tempo. Er keuchte ein wenig, aber noch nicht zu sehr. Sein Arm, der bei der Schlägerei neulich so viel abbekommen hatte, schmerzte höllisch, aber darum kümmerte er sich nicht. Er konzentrierte sich jetzt vollständig auf seine Flucht, kannte sich mit der Situation gut genug aus, um zu wissen, dass er jetzt keine Energien auf die Frage verwenden durfte, was eigentlich passiert war, aber dennoch bohrte sie in seinem Hinterkopf, beharrlich und nicht zum Verstummen zu bringen: Wie konnte das geschehen? Wie konnte das geschehen?
Es gelang ihm nicht, einen komfortablen Abstand zwischen sich und seinen Verfolger zu bringen, im Gegenteil, fast hatte es den Anschein, als werde der Polizist immer schneller. Welchen verfluchten Sprinter hatten die da bloß ausgegraben? Und wo war eigentlich der zweite Bulle geblieben? Es hatten zwei Personen in dem Auto gesessen. Wahrscheinlich hatten sie den längst abgehängt.
Mit einem zackigen Haken, den er durch nichts vorher in seinen Bewegungen angekündigt hatte, bog Ryan nach links, setzte mit einem Hechtsprung über ein Absperrgitter und gelangte in die Recorder Street, die die Häuser und kleinen Gärten hinter dem Haus, in dem Debbie wohnte, zusammen mit der Oystermouth Road in einem Karree umschloss. Keine optimale Variante, und er hätte sie nie gewählt, wäre der andere nicht so nah gewesen. Rechterhand, jenseits des West Way, befand sich der große Tesco-Parkplatz, der zu dieser Stunde am Sonntagabend ziemlich leer war und keine Möglichkeit zum Untertauchen bot. Er musste jetzt schnell einen Hinterhof finden und dann versuchen, über Mauern, Schuppendächer und Gartenhäuschen zu turnen, in der Hoffnung, dass er darin wenigstens dem Bullen überlegen war. Wenn er ihn los war, galt es, ein Versteck zu finden, dann konnte er weiter überlegen. Die Entführung musste er abbrechen, ganz klar, Vanessa Willard schnellstmöglich befreien und dann …
Der Schatten tauchte so unvermittelt vor ihm auf, dass Ryan weder stehen bleiben noch ausweichen konnte. Er knallte frontal mit der Person zusammen, die aus einem schmalen Durchgang zwischen den Häusern auf einmal erschienen war, und während sie beide zu Boden gingen und er die Stimme des anderen hörte, die »Polizei!« sagte, wurde Ryan bewusst, dass er diesmal seine Gegner gründlich unterschätzt hatte und dass dies sein allerdümmster Fehler während der letzten zwölf Stunden gewesen war. Der eine konnte schneller rennen als gedacht, und der andere kannte sich offenbar bestens aus, hatte sogar gewusst, dass es durch die Gärten hinter Debbies Haus eine Möglichkeit gab, direkt in die Recorder Street zu gelangen. Gemeinsam hatten sie ihn genau in die Falle getrieben, in der er jetzt steckte. Jemand drehte seinen Arm auf den Rücken und zog ihn langsam auf die Füße. Handschellen schlossen sich um seine Gelenke.
»Ryan Lee, Sie sind vorläufig festgenommen. Wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung.«
Wie bitte?
In welchem idiotischen Film war er denn jetzt gelandet?
3
Die Antwort auf diese Frage bekam er auf dem Polizeirevier.
Die Kneipenschlägerei vom vergangenen Donnerstag. Der Typ, den er gar nicht näher kannte, der irgendwelchen Stuss von sich gegeben und ihn so wütend gemacht hatte. Er hatte dem Idioten ganz schön zugesetzt, dessen entsann er sich dunkel, aber doch nicht so, dass daraus eine schwere Körperverletzung wurde. Der ganze Abend mit seinen Geschehnissen, Bildern und Eindrücken wogte nur dunkel durch seine Erinnerungen, denn er hatte extrem viel getrunken, war nach der Schlägerei nach Hause gewankt, hatte dort weitergetrunken und zu später Stunde einen völligen Filmriss gehabt, aber das alles konnte doch nicht … so wild gewesen sein, wie die es jetzt darstellten?
»Ist es … ist es denn wirklich so schlimm?«, fragte er ungläubig. Die paar Kinnhaken …
Einer der beiden Polizisten, die ihn festgenommen hatten, nickte nachdrücklich. »Oh ja. Abgesehen von etlichen ausgeschlagenen Zähnen und einer gebrochenen Nase hat er eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schädelbasisbruch erlitten. Nicht gerade eine Bagatelle, würde ich sagen.«
»Schädelbruch?«
»Er ist mit dem Hinterkopf auf eine Tischkante gekracht. Nachdem Sie ihn niedergeschlagen haben.«
»Das wollte ich nicht«, beteuerte Ryan. »Es war eine ganz normale Schlägerei, und ich habe auch eine Menge abbekommen …« Zum Beweis zeigte er seinen in allen Variationen von Lila schimmernden Oberarm, aber natürlich kam er damit nicht gegen einen Schädelbruch an.
»Er hat mich provoziert«, fügte er schwach hinzu.
Niemanden interessierte das besonders. Provokation hin oder her, er hatte einen jungen Mann krankenhausreif geschlagen, und es war noch nicht sicher, welche Schäden letzten Endes bei dem Opfer zurückbleiben würden. Es gab jede Menge Zeugen, denn die Kneipe war überfüllt gewesen. Durch geduldiges Befragen der Gäste hatten die Beamten sehr bald Ryans Namen und schließlich auch seinen Aufenthaltsort in Debbies Wohnung herausgefunden. Dass er sich seiner Festnahme durch Flucht hatte entziehen wollen, machte seine Lage noch prekärer.
Er steckte, wie ihm selbst klar war, bis zum Hals in der Scheiße.
Man hatte ihn über seine Rechte belehrt. Unter anderem hätte er einen Angehörigen oder Bekannten draußen über seine Festnahme informieren dürfen, aber darauf verzichtete er. Es wären nur seine Mutter, zu der er schon seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr hatte, oder Debbie in Frage gekommen; die eine hätte mit Schrecken und Entsetzen, die andere mit unverhohlener Wut reagiert, und beidem mochte er sich nicht aussetzen. Es schien ihm jedoch angebracht, von seinem Recht auf einen Anwalt unverzüglich Gebrauch zu machen.
Aaron Craig tauchte tatsächlich noch an diesem schon ziemlich späten Sonntagabend in dem Revier auf, recht ungehalten, dass ihm sein Wochenendausklang auf so unschöne Weise vermasselt wurde. Der sechsundfünfzigjährige Jurist hatte sich drei Jahrzehnte zuvor voller Idealismus und mit ganzer Kraft in sein persönliches Projekt, der juristischen Begleitung und Unterstützung jugendlicher Straftäter, speziell solcher, die aus problematischen familiären Verhältnissen stammten, gestürzt. Sein Ziel war es gewesen, ihnen nicht nur vor Gericht zu helfen, sondern ihnen darüber hinaus Freund, Mentor, Wegweiser zu sein. Inzwischen hatte sich sein Idealismus ziemlich erschöpft. Er hatte zu vielen Schützlingen auf die Beine geholfen und war anschließend bitter enttäuscht worden, sodass aus dem feurigen, hoch motivierten Weltverbesserer längst ein müder und schroffer Zyniker geworden war. Ryan Lee hatte er vertreten, seitdem dieser im Alter von siebzehn Jahren bei seinem ersten Ladendiebstahl erwischt worden war, und schon lange glaubte er nicht mehr, dass aus dem mittlerweile einunddreißigjährigen Mann jemals ein anständiger Bürger oder auch nur ein halbwegs vernünftiger Zeitgenosse werden würde. Dennoch fühlte er sich verantwortlich und opferte seinen Sonntagabend, als er hörte, in welchen Ärger sich sein Schützling diesmal hineingeritten hatte.
Nach Ryans kurzer Vernehmung – bei der er alles zugab, jedoch darauf beharrte, keinesfalls eine so schwere Verletzung seines Gegners beabsichtigt zu haben – sprach Aaron noch unter vier Augen mit ihm. Er bemühte sich dabei nicht, Ryans Situation zu beschönigen.
»Das sieht richtig böse für dich aus«, sagte er. »Richtig böse, darüber musst du dir im Klaren sein. Der Junge ist verdammt schwer verletzt, Mann! Du hast mitbekommen, wie alt er ist? Neunzehn. Du hast einen neunzehnjährigen Jungen so verprügelt, dass er jetzt wochenlang im Krankenhaus liegen wird, und das alles nur, weil er betrunken war und ein wenig herumgepöbelt hat!«
»Er hat mich beleidigt«, sagte Ryan.
»Er hat viele, die in dem Pub saßen, dumm angemacht. Das ist die einheitliche Aussage, du hast es doch gerade gehört. Er war sturzbesoffen, torkelte von Tisch zu Tisch und laberte irgendwelchen Blödsinn. Niemand nahm das ernst. Der Einzige, der aufsprang und durchdrehte, warst du!«
Ryan schwieg. Was sollte er dazu auch sagen?
Aaron seufzte. »Diesmal rückst du ein, Ryan. Ich werde es nicht verhindern können.«
Ryan sah ihn flehentlich an. »Aaron – bitte, du musst mir helfen! Ich meine … schwere Körperverletzung … Läuft es wirklich darauf hinaus?«
»Ich fürchte, ja«, sagte Aaron. »Dein Opfer lag blutüberströmt und bewusstlos in der Ecke, als du mit ihm fertig warst, und dann wurden noch die Gehirnerschütterung und der Schädelbruch festgestellt, und niemand weiß, unter welchen Folgeschäden der Junge vielleicht sein Leben lang leiden wird. Das Ganze wird definitiv als schwere Körperverletzung verfolgt werden. Wenn wir Glückhaben, gelingt es mir, den Paragraphen 20 für dich herauszuschlagen, dessen Vorteil im Kern darin besteht, dass man dir zuerkennt, nicht vorsätzlich oder aufgrund einer besonders bösartigen Gesinnung gehandelt zu haben. Du warst selbst betrunken, du fühltest dich provoziert und so weiter. Du konntest nicht ahnen, dass er auf diese Tischkante knallen würde. Ich versuche es, Ryan. Ich tue mein Bestes.«
»Und wenn das nicht klappt?«, fragte Ryan verzagt.
»Dann wird es der Paragraph 18. Etwas vereinfacht ausgedrückt: die vorsätzliche schwere Körperverletzung. Das können bis zu fünfundzwanzig Jahre Freiheitsstrafe werden.«
»Fünfundzwanzig Jahre? Aaron, ich hatte nicht mal eine Waffe. Ich …«
»Das ist unerheblich«, erklärte Aaron.
Ryan spürte, wie sich sein Hals zuschnürte. Es fiel ihm immer schwerer zu schlucken. »Wenn sie mir … also wenn sie mir glauben, dass ich das alles nicht wollte … Wie lange muss ich dann …?«
»Bis zu fünf Jahre. Und ich vermute, die werden auch verhängt. Ich kann mir keinen Richter vorstellen, der bei dir Milde walten lässt. Du hattest bereits zwei Bewährungsstrafen. Dein übriger krimineller Kleinkram füllt einen ganzen Polizeiordner. Du bist aktenkundig seit deiner Jugend. Soll ich dir sagen, was der Richter in dir sehen wird? Einen hoffnungslosen Fall. Den man endlich mal mit der Realität konfrontieren muss.«
Ryan sank in sich zusammen. Ihm war klar, dass Aaron recht hatte. Er hatte es zu weit getrieben. Wegen nichts und wieder nichts. Er hatte den Typen nicht mal gekannt. Und ihm war inzwischen auch längst klar, dass er nicht einmal von einer ernsthaften Provokation sprechen konnte, die ihn zu seiner Tat animiert hatte. Denn es stimmte, was die Zeugen der Polizei gegenüber zu Protokoll gegeben hatten: Der dünne betrunkene Junge hatte nahezu jeden im Raum angepöbelt. Teilweise hatte man ihn nicht einmal richtig verstehen können. Aber nur einen hatte er damit in einen Ausbruch unkontrollierbarer Aggressionen getrieben: Ryan Lee. Der es nicht schaffte, seine verdammt niedrig angesetzte Schwelle zur Gewalt endlich etwas höher zu hängen.
»Ich hatte dir doch zu einem Anti-Aggressions-Training geraten«, sagte Aaron, »aber ich vermute, es ist bei deinem bloßen Versprechen, es zu versuchen, geblieben?«
Ryan blickte zu Boden. Er hatte es wirklich vorgehabt. Er wusste, dass er zu schnell ausrastete und dass er dringend etwas dagegen unternehmen musste. Aber letztlich hatte er sich nicht aufraffen können.
»Tja«, sagte Aaron, »dann sind wir nun also nach vielen Jahren an der Stelle angelangt, wo du in den sauren Apfel beißen musst. Hilft nichts, Junge. Vielleicht kommst du raus und hast endlich kapiert, wie das Leben läuft!«
»Meinst du, ich muss die volle Strafe absitzen?«
»Wenn du dich richtig anstrengst im Knast, wenn du dich wirklich gut und tüchtig und reumütig zeigst, dann erwartet dich mit Sicherheit eine vorzeitige Entlassung wegen guter Führung. Nach vielleicht zwei Jahren.«
Zwei Jahre. Eine Ewigkeit …
»Aber«, sagte Ryan, »bis zur Verhandlung werde ich auf freiem Fuß sein?«
So war es in den beiden anderen Fällen, in denen es zu einer Anklage gegen ihn gekommen war, gewesen: Aaron hatte es jedes Mal geschafft, ihm den Antritt der Untersuchungshaft zu ersparen.
Zu seinem schieren Entsetzen aber schüttelte der Anwalt auch bei dieser Frage, die Ryan eher als Feststellung gemeint hatte, den Kopf.
»Sieht nicht gut aus. Ich fürchte, die lassen dich nicht mehr raus.«
»Aber …«
»Ich versuche es, aber meiner Ansicht nach liegen leider ausreichend Gründe für die Anordnung einer Untersuchungshaft vor. Besonders schwer wiegt natürlich, dass du zurzeit ohne festen Wohnsitz bist und dass du dich deiner Festnahme durch Flucht zu entziehen versucht hast. Tut mir leid, aber auch da hast du ganz schlechte Karten.«
»Ich muss raus!«, sagte Ryan beschwörend. Ihm brach schon wieder der Schweiß aus, wie am frühen Abend, als er nach Swansea zurückgefahren war. Verdammter Mist, Vanessa Willard lag in einer Kiste in einer Höhle, und wenn sie sparsam mit ihren Vorräten umging, hatte sie eine knappe Woche lang zu essen und zu trinken. Dann war Schluss. Ganz abgesehen von den Qualen, die sie in dieser Woche ertragen musste – eingeschlossen in der Enge und Dunkelheit, voller Angst –, würde dann ein erbärmliches, langsames, entsetzliches Sterben beginnen.
Er musste sie rauslassen. Er musste sie unbedingt befreien, ehe er für mindestens zwei Jahre in den Knast ging.
»Aaron, bitte. Es ist sehr wichtig. Kannst du nicht … kannst du nicht für mich bürgen? Dass ich nicht türme? Ich schwöre dir, dass ich zur Verhandlung erscheine! Bitte!«
»Ich versuche alles«, sagte Aaron. »Du kannst dich auf mich verlassen. Aber ich kann dir nichts versprechen.«
»Wann komme ich vor den Haftrichter?«
»Schnell. Innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden.«
»Es ist wichtig, dass ich rauskomme!«
»Ryan!« Aaron lehnte sich über den Tisch und sah seinem Schützling direkt in die Augen. »Ryan, das entscheiden andere, und du hast dabei nichts zu bestimmen und nichts zu erbitten! Dir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig, als zu warten, was kommt, und ich rate dir, dich dabei ruhig, unauffällig und vor allem höflich zu verhalten, denn alles andere verschlechtert deine Lage nur. Die britische Justiz hat dir jede Menge Chancen eingeräumt in den letzten vierzehn Jahren, und du musst einfach akzeptieren, dass es jetzt niemanden mehr gibt, der dir noch großartig entgegenkommt. Was soll ich darum herumreden? Du hast es versiebt! Du ganz allein!«
»Aaron! Nur einen Tag! Ich muss nur einen Tag raus!«
»Weshalb?«
»Weil …« Er stockte. Die Frage war, was geschehen würde, wenn er Aaron Craig jetzt einweihte. Als sein Anwalt war er an die Schweigepflicht gebunden. Sollte es ihm gelingen, Ryan vor dem Antritt der U-Haft zu bewahren – was er offensichtlich für äußerst unwahrscheinlich hielt –, konnte Ryan selbst losfahren und Vanessa befreien, vorausgesetzt, Aaron ließ sich darauf ein, dass man unter diesen Umständen die Frau möglicherweise weitere vierundzwanzig Stunden lang in der Höhle verharren ließ. Anderenfalls musste Aaron selbst tätig werden. Es gab zwei Möglichkeiten: Aaron fuhr in das Fox Valley und befreite Vanessa, was aber kaum möglich war, ohne dass er dabei in Erscheinung trat. Er konnte nicht einfach die Schrauben öffnen, das Weite suchen und Vanessa sich selbst überlassen. Die Frau mochte sich inzwischen im Inneren der Kiste verletzt haben, oder sie stand unter einem schweren Schock. Aaron würde nichts übrig bleiben, als sie in ein Krankenhaus zu bringen oder direkt den Rettungsdienst herbeizurufen. Die Polizei würde kaum davon ausgehen, dass es der Anwalt gewesen war, der Vanessa Willard entführt und eingesperrt hatte, und gerade wenn er den Mund hielt, konnte sich jeder schnell zusammenreimen, dass er soeben für einen Mandanten, der ein abscheuliches Verbrechen geplant und mit seiner Durchführung begonnen hatte, tätig geworden war. Wie lange würde es dauern, bis sie dann auf seiner, Ryans, Spur waren? Der Mann, der an diesem Abend verhaftet worden war und sofort nach Craig verlangt hatte.
Die eigentliche Gefahr stellte jedoch Vanessa Willard dar, und zwar auch im Fall der zweiten Möglichkeit, die darin bestand, dass Aaron durch einen anonymen Anruf die Polizei direkt ins Fox Valley schickte. Ryan hatte keine Ahnung, wie viel Vanessa mitbekommen, was sie genau gesehen hatte. Immerhin war er auf der Landstraße, die oberhalb jenes Rastplatzes entlangführte, immer wieder auf und ab gefahren. Was, wenn Vanessa der weiße Kastenwagen mit der Aufschrift Clean! aufgefallen war? Da Clean! eine Wäschereikette war, die sich über ganz Großbritannien erstreckte, würde die Polizei selbst dann, wenn sie ihre Nachforschungen zunächst auf Pembrokeshire und den Großraum Swansea beschränkte, eine große Menge an Fahrzeugen überprüfen müssen. Ryan hatte diese Gefahr, die sich in jedem Fall nach Vanessas Freilassung ergeben hätte, immer gesehen, hatte jedoch vorgehabt, sein Fahrzeug so gründlich zu säubern, dass man es mit Vanessa Willard nicht in Verbindung bringen konnte. Die Chance hatte er nun nicht mehr. Im Kastenwagen musste es wimmeln von Spuren – Haare, Fasern, Hautschuppen, was auch immer. Auch lagen noch sein Pullover, die Handschuhe, die Baseballkappe auf der Rückbank des Autos. Er war blöd genug gewesen, sie nicht gleich zu beseitigen, und Vanessa würde sie identifizieren können. Ryan wäre sofort überführt, die Beweise gegen ihn erdrückend. Und eines wusste er, musste es nicht einmal erfragen: Was immer Aaron Craig für ihn zu tun bereit wäre – das Beseitigen von Spuren an einem Tatort würde nicht darunterfallen.
»Es gibt einfach noch ein oder zwei wichtige Dinge zu erledigen«, sagte er. »Ich möchte nicht so gerne darüber sprechen.«
»Kann ich das übernehmen?«
»Nein«, sagte Ryan und blickte zur Seite. Vielleicht hatte er gerade begonnen, Vanessa Willards Todesurteil zu unterschreiben.
Es blieb nur eine geringe Chance.
Ein Termin beim Haftrichter, der positiv für ihn ausging.
4
Knapp vierundzwanzig Stunden später, am Montagnachmittag, stand Ryan vor dem Magistrates’ Court, wo über seine Freilassung oder seinen Verbleib im Gewahrsam bis zur Hauptverhandlung entschieden werden sollte, und wie Aaron Craig vorausgesehen hatte, hielt man es dort für allzu bedenklich, jemanden wie Ryan Lee auf freien Fuß zu setzen – vor allem angesichts der Schwere der ihm zur Last gelegten Tat. Der Umstand, dass er abgehauen war, als ihn die Polizisten zum Stehenbleiben aufforderten, machte die ganze Angelegenheit nicht besser, vor allem aber auch die Tatsache, dass er keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, stattdessen seit Monaten ständig wechselnd bei verschiedenen Bekannten, zuletzt bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin, gelebt hatte. Aaron argumentierte mit dem Job als Fahrer der Wäscherei, den sein Mandant immerhin seit beinahe einem halben Jahr zufriedenstellend ausübte, und übernahm es auch, für seinen Verbleib in Swansea sowie sein pünktliches Erscheinen zur Hauptverhandlung zu bürgen. Er zog die wenigen Register, die ihm überhaupt blieben, aber er scheiterte. Der Haftrichter kannte Ryan Lee und hatte von ihm und seinen ewigen Eskapaden endgültig genug; abgesehen davon ließen ihm die Umstände, wie sie einmal waren, ohnehin praktisch keine Wahl.
Er ordnete Untersuchungshaft an. Ryan wurde in das Gefängnis von Swansea überstellt mit der Aussicht, dass ihm sehr rasch der Prozess gemacht werden würde.
Er wusste, dass dies der Moment war, da er sich seinem Anwalt anvertrauen musste. Aaron Craig war jetzt die einzige Chance, die Vanessa Willard noch blieb.
An seinen Ängsten und Sorgen hatte sich jedoch nichts geändert, sie waren höchstens noch größer und bedrückender geworden. Wenn er wegen der Körperverletzung noch mit fünf Jahren davonkam, jedoch darüber, dass er Aaron einweihte, in der Sache Vanessa Willard aufflog, dann standen ihm zehn Jahre bevor. Oder zwölf. Oder mehr. Er wusste es nicht genau, aber ihm schwante, dass man für das, was er getan hatte, keinesfalls glimpflich davonkommen würde.
Am Ende der ersten Woche hatte er eine grauenhafte Zeit hinter sich. Das Gefängnis entpuppte sich für ihn genau als die Hölle, die er sich vorgestellt hatte, wobei er wusste, dass er vorläufig nur den Vorgeschmack bekam: Denn die Untersuchungshaft war komfortabler und mit mehr Privilegien ausgestattet, als es die eigentliche Haft später sein würde. Am schlimmsten aber war, dass er an nichts und niemanden als an Vanessa denken konnte: Er war kriminell, labil und aggressiv, aber willentlich würde er einem anderen Menschen nicht antun, was er Vanessa Willard antat, wenn er nicht schnellstens dafür sorgen konnte, dass sie aus ihrer Situation befreit wurde. Er kannte diese Frau nicht, aber die ganze Woche über hatte er ihr Schicksal so intensiv mit erlitten, dass es ihm schon fast vorkam, als verschmelze er langsam zu einer Einheit mit ihr. Er konnte ihre Schreie hören, vernahm, wie ihre Stimme immer heiserer und brüchiger wurde. Er konnte sehen, wie sie versuchte, sich aus der Kiste zu befreien, wie ihre Fingernägel abbrachen und sie sich Splitter unter die Haut trieb, während sie verzweifelt an dem Deckel der Kiste kratzte. Er spürte, wie die Panik immer wieder Besitz von ihr ergriff und sie fast in den Wahnsinn trieb. Er sah die Momente vor sich, in denen sie sich selbst zu beruhigen versuchte, in denen sie sich Mut zusprach, Kräfte zu sammeln versuchte, sich mit autogenem Training oder Yoga in eine mentale Situation zu versetzen bemühte, die es ihr möglich machte, irgendwie über die Verzweiflung zu triumphieren. Er stellte sich vor, wie sie dann wieder zusammenbrach, sich schreiend in ihrem Gefängnis wälzte, den Kopf anschlug, brüllte wie ein Tier, gepeinigt, gefoltert, rasend in ihrer Todesangst.
Er verlor fast drei Kilo Gewicht in dieser Woche und wachte nachts von seinen eigenen Schreien auf.
Am Samstag wusste er, dass Vanessa, selbst wenn sie sehr sparsam gewesen war, keine Vorräte mehr haben konnte.
Am Sonntag musste er davon ausgehen, dass sie nun seit mindestens vierundzwanzig Stunden nichts mehr hatte trinken können. Er redete sich ein, dass er Aaron nicht dadurch verärgern sollte, dass er ihn am Wochenende ins Gefängnis zitierte, und nahm sich vor, ihn am nächsten Tag kommen zu lassen, sich ihm anzuvertrauen und ihn zu bitten, die nötigen Schritte in die Wege zu leiten, um Vanessa zu befreien.
Am Montagfrüh verweigerte er sein Frühstück. Nach einer durchwachten Nacht war er am Ende seiner Kräfte. Er hatte vorwärts und rückwärts überlegt, wie es mit Vanessas Rettung funktionieren sollte, und das Ergebnis sah düster für ihn aus – noch mehr allerdings für Vanessa. Die Gefahr, die sich für ihn daraus ergab, dass er ihre Befreiung veranlasste, ohne zuvor gründlich alle Indizien, die ihn als Täter überführen konnten, beseitigt zu haben, erschien Ryan übermächtig.