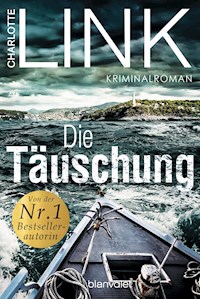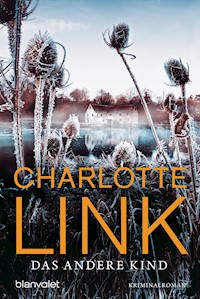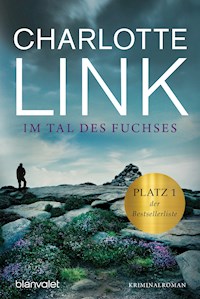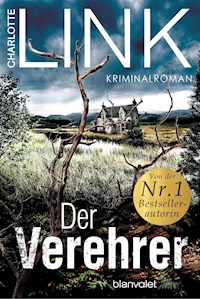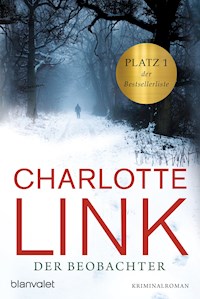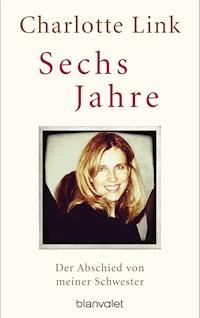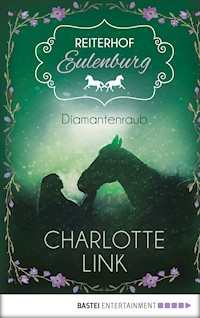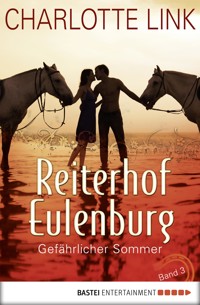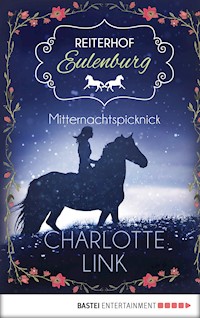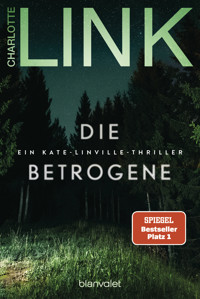
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Kate-Linville-Reihe
- Sprache: Deutsch
Einsam wacht, wer um die Schuld weiß ...
Um ein glückliches Leben betrogen – so fühlt sich Kate Linville, Polizistin bei Scotland Yard. In ihrer Einsamkeit gibt es nur einen Menschen für sie: ihren geliebten Vater. Als er ermordet aufgefunden wird, verliert Kate ihren letzten Halt. Sie macht sich selbst auf die Spur dieses mysteriösen Verbrechens, und entlarvt dabei die Vergangenheit ihres Vaters als Trugbild.
Zur gleichen Zeit bricht eine Familie aus London in die Ferien nach Yorkshire auf. Nicht ahnend, dass die Ermittlungen um Kates ermordeten Vater sie dort in Lebensgefahr bringen werden: Ein flüchtiger Verbrecher ist in den Hochmooren auf der Suche nach einem Versteck ...
Weitere dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle warten auf Kate Linville und Caleb Hale – lesen Sie auch »Die Suche«, »Ohne Schuld«, »Einsame Nacht« und »Dunkles Wasser«! Alle Bücher sind unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CHARLOTTE LINK
Die Betrogene
Außerdem von Charlotte Link bei Blanvalet lieferbar:
Die Sünde der Engel
Die Täuschung
Sturmzeit
Wilde Lupinen
Die Stunde der Erben
Das Haus der Schwestern
Die Rosenzüchterin
Das andere Kind
Am Ende des Schweigens
Schattenspiel)
Der Verehrer
Der Beobachter
Der fremde Gast)
Im Tal des Fuchses
Das Echo der Schuld
Die letzte Spur
Sechs Jahre
Charlotte Link
Die Betrogene
Roman
1. Auflage
Originalausgabe Oktober 2015 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © 2015 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Trevillion Images/Vesna Armstrong
Lektorat: NB
Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-13247-7
www.blanvalet.de
FREITAG, 14. SEPTEMBER 2001
Es war noch heiß wie im Sommer. Am Mittag war er von der Schule heimgekommen. Und hatte sich sofort sein Fahrrad geschnappt. Dieses tolle, schnelle, metallicblaue Fahrrad, das er zu seinem Geburtstag im Juli bekommen hatte. Fünf Jahre alt war er geworden, und Anfang September hatte er mit der Schule begonnen. Es machte ihm Spaß, dorthin zu gehen. Die Lehrer waren nett, die Mitschüler auch. Er kam sich sehr erwachsen vor. Das Beste war, dass er das großartigste Fahrrad von allen hatte. Wenn auch Gavin, sein Banknachbar, ständig prahlte, ein noch besseres Fahrrad zu haben, aber das stimmte nicht. Er hatte es gesehen. Es war nicht halb so gut wie seines.
»Sei um sechs Uhr spätestens zurück!«, hatte ihm seine Mutter noch hinterhergerufen. »Und pass auf dich auf!«
Er hatte nur cool genickt. Sie machte sich ständig Sorgen. Wegen des Verkehrs, wegen böser Menschen, die Kinder entführten, wegen Gewittern, in die man geraten konnte.
»Das ist doch nur, weil wir dich so lieb haben«, sagte sie, wenn er sich deswegen beschwerte.
Er war vorsichtig gefahren, bis er aus der Stadt heraus war. Er war kein Baby, er wusste, worauf man achten musste. Aber jetzt lag seine Rennstrecke frei vor ihm. Er hatte sie vor ein paar Wochen entdeckt, und seitdem kam er fast jeden Tag hierher. Eine schmale Landstraße, auf der kaum Autos fuhren. Zwischen Wiesen und Feldern und ohne Anfang und Ende, wie es schien. An sonnigen Tagen wie diesem war sie ein weißes, staubiges Band zwischen den flachen Feldern, die bis zum Horizont reichten. Im Sommer stand hier sicher das Getreide hoch und nahm die Sicht, aber jetzt war alles abgeerntet. Das verstärkte den Eindruck von Endlosigkeit. Und von Freiheit.
Er war ein berühmter Rennfahrer. Er fuhr einen Ferrari. Er lag ganz vorne im Rennen. Aber die anderen waren ihm dicht auf den Fersen. Der pure Nervenkitzel. Er musste alles geben. Der Sieg war zum Greifen nahe, aber jetzt hieß es, mit aller Kraft zu kämpfen. Die anderen waren auch gut. Aber er war der Beste. Gleich würde er auf dem Siegerpodest stehen und den Champagner in die Menschenmenge versprühen, die ihm begeistert zujubelte. Alle Fernsehkameras richteten sich auf ihn. Die Stimme des Sportkommentators überschlug sich. Er trat in die Pedale. Er machte sich ganz flach. Er lag fast auf der Lenkstange. Der Fahrtwind griff ihm in die Haare.
Er hätte schreien mögen, so schön war das Leben.
Bis auf seine fiktiven Verfolger war nur er hier. Weit und breit sonst niemand. Nur er. Und die Endlosigkeit dieser Straße.
Er hatte keine Ahnung, dass er nicht mehr allein war.
Er hatte keine Ahnung, dass ihm nur noch zwei Minuten blieben, ehe alles vorbei war. Seine Karriere als berühmtester Rennfahrer aller Zeiten.
Und das Leben, wie er es kannte.
SAMSTAG, 22. FEBRUAR 2014
Es hätte eine gute Chance gegeben, mit heiler Haut davonzukommen.
Richard Linvilles Schlafzimmer befand sich unter dem Dach des Hauses, es verfügte über eine abschließbare Tür und über einen Telefonanschluss. Als er in den frühen Morgenstunden dieser kalten und nebligen Februarnacht aus dem Schlaf schreckte und sicher war, ein Geräusch gehört zu haben, das er nicht einordnen konnte, das aber verdächtig wie das Splittern einer Glasscheibe klang, hätte er mit einem Sprung aus dem Bett und bei der Tür sein, diese verschließen und sodann die Polizei anrufen können.
Aber er war nicht der Mann, der sofort um Hilfe rief, nur weil er etwas Seltsames in der Nacht wahrgenommen hatte, was genauso gut eine Täuschung sein konnte. Vor seiner Pensionierung war er Detective Chief Inspector bei der North Yorkshire Police gewesen, und er ließ sich nicht so leicht einschüchtern.
Befremdlichen Dingen ging er zunächst einmal selbst auf den Grund.
Lautlos und zudem für sein Alter erstaunlich leichtfüßig, schwang er sich aus dem Bett, tastete im Dunkeln nach der obersten Schublade seines Nachttisches, zog sie auf und nahm die Pistole heraus, die ganz hinten unter einem Stapel Stofftaschentücher lag. Im Dienst hatte er keine Waffe getragen, aber als ehemaliger Kriminalbeamter wusste er, dass er auch im Ruhestand eine gewisse Gefährdung seiner Person nicht ausschließen konnte. Er hatte zu viele Menschen gejagt, geschnappt und vor den Richter gebracht, und natürlich hatte er Feinde. Mancher hatte seinetwegen jahrelang hinter Gittern gesessen. Er hatte sich eine Pistole angeschafft, und es war eine reine Vorsichtsmaßnahme, dass er nachts nicht schlafen wollte, ohne sie in griffbereiter Nähe zu haben.
Er schlich aus dem Zimmer, blieb auf dem Treppenabsatz stehen und lauschte nach unten. Nichts war zu hören außer dem leisen Blubbern des Wassers in den Heizungsrohren. Kein ungewöhnliches Knarren oder Quietschen, nichts mehr, was auf gesplittertes Glas hindeutete. Wahrscheinlich hatte er sich geirrt, oder er hatte geträumt. Wie gut, dass er sich nicht lächerlich gemacht und nach den Kollegen von einst gerufen hatte.
Dennoch, bevor er ins Bett zurückkehrte, wollte er sich vergewissern.
Geschmeidig und ohne ein Geräusch zu verursachen, bewegte er sich die Treppe hinunter. Er würde im März einundsiebzig Jahre alt werden, und er war stolz darauf, dass sein Körper noch kaum Alterserscheinungen zeigte. Er führte das darauf zurück, dass er immer viel Sport getrieben hatte, auch heute noch jeden Tag bei Wind und Wetter große Strecken lief und seine nicht allzu gesunden Ernährungsvorlieben zumindest mit dem völligen Verzicht auf Zigaretten und dem weitgehenden Verzicht auf Alkohol kompensierte. Die meisten Menschen, die ihn trafen, hielten ihn für jünger, als er war, und bei vielen Frauen hätte er noch immer gute Chancen gehabt. Ihm lag bloß nichts daran. Brenda, die Frau, mit der er einundvierzig Jahre lang verheiratet gewesen war, war drei Jahre zuvor nach endlosen Kämpfen an Krebs gestorben.
Er war unten angekommen. Rechts von ihm befand sich die Haustür, die er wie jeden Abend sorgfältig verschlossen hatte. Vor ihm lag das Wohnzimmer, dessen Erkerfenster nach vorne zur Straße hinausging. Richard spähte hinein. Alles still, dunkel, leer. Die Vorhänge waren nicht zugezogen. Nächte sind nie ganz schwarz, und für gewöhnlich konnte man auch nachts die Kirche von Scalby sehen, die sich am Ende der Straße auf einem baumbestandenen Hügel erhob. Heute jedoch war der Nebel zu dicht. Er lag wie ein Berg aus dicker Watte über den Straßen und verhinderte sogar den Blick auf das gegenüberliegende Haus. Einen kurzen Moment lang hatte Richard den gespenstischen Eindruck, ganz alleine und von allem und jedem verlassen auf der Welt zu sein. Aber dann rief er sich zur Ordnung: Blödsinn. Alles war wie immer. Es lag nur am Nebel.
Gerade als er sich umwandte, vernahm er erneut ein Geräusch. Es klang wie ein leises Knirschen und war ganz und gar nicht in die üblichen Geräusche des nächtlichen Hauses einzuordnen. Es schien aus der Küche zu kommen und hörte sich an, als sei jemand auf Glassplitter getreten. Was zu dem Klirren von Glas passen würde, das irgendwie in Richards Schlaf gedrungen war.
Er entsicherte seine Waffe und bewegte sich den Flur entlang auf die Küchentür zu. Ihm war klar, dass er im Begriff stand, genau das zu tun, wovon die Polizei den Menschen dringend abriet, wovon auch er selbst immer wieder abgeraten hatte: Wenn Sie glauben, dass Einbrecher in Ihrem Haus sind, dann versuchen Sie bloß nicht, auf eigene Faust zu handeln. Bringen Sie sich in Sicherheit, indem Sie entweder das Haus verlassen oder sich irgendwo einschließen, und rufen Sie dann telefonisch Hilfe herbei. Verhalten Sie sich dabei so leise und unauffällig wie möglich. Den Tätern sollte nicht klar werden, dass sie bemerkt worden sind.
Aber das galt natürlich nicht für ihn. Er war die Polizei, auch wenn er nicht mehr im Berufsleben stand. Außerdem hatte er eine Waffe und konnte ausgezeichnet damit umgehen. Das unterschied ihn von den meisten anderen Bürgern.
Er hatte die Küchentür erreicht. Sie war geschlossen, das war sie in Winternächten immer. Die Tür, die von der Küche in den Garten führte, war alt und ließ viel zu viel Kälte hinein, die dann wenigstens nicht in den Rest des Hauses dringen sollte. Richard wusste, dass sie längst ausgetauscht gehörte. Schon Brenda hatte deswegen oft gejammert. Wegen der Kälte – aber auch wegen des Sicherheitsrisikos. Im Unterschied zu der sehr stabilen Haustür war diese Gartentür ziemlich leicht zu knacken.
Er lauschte. Er hielt die Pistole schussbereit. Er konnte seinen eigenen Atem hören.
Sonst nichts.
Aber da war etwas. Da war jemand. Er wusste es. Er wäre als Polizist nicht so erfolgreich gewesen, hätte er nicht im Laufe der Jahre dieses untrügliche Gespür für drohende Gefahren entwickelt.
Jemand war in der Küche.
Spätestens jetzt hätte er sich um Hilfe bemühen müssen. Denn er hatte keine Ahnung, um wie viele Personen es sich bei den Einbrechern handelte. Womöglich stand er einem einzigen Mann gegenüber. Vielleicht hatte er es aber mit zwei oder drei Leuten zu tun, und dann würde ihm selbst sein Vorteil, bewaffnet zu sein, sehr schnell nichts mehr nützen. Er hätte später nicht zu sagen gewusst, weshalb er alle Vorschriften in den Wind schlug und sich einem unkalkulierbaren Risiko aussetzte. Altersstarrsinn? Selbstüberschätzung? Oder wollte er sich irgendetwas beweisen?
Tatsächlich sollte ihm nicht mehr allzu viel Zeit bleiben, diese Frage zu klären.
Beides geschah nun absolut zeitgleich: Er wollte vorsichtig die Klinke der Küchentür hinunterdrücken. Und im selben Moment spürte er unmittelbar neben sich, aus dem in tiefer Dunkelheit liegenden Esszimmer heraus, eine Bewegung und dann einen so heftigen Schlag auf den Arm, dass er einen Schmerzenslaut ausstieß. Verzweifelt versuchte er noch, seine Pistole festzuhalten, aber der Schlag hatte einen Nerv getroffen, auf eine Art, dass sekundenlang alle Muskeln gelähmt waren. Die Waffe fiel zu Boden und rutschte scheppernd in das Esszimmer hinein. Richard machte eine Bewegung zur Seite, wollte hinterher, obwohl er wusste, wie zwecklos dieses Ansinnen war: Sein Feind befand sich ja genau dort, im Esszimmer, und ihm ging auf, dass sein allergrößter Fehler während der letzten Minuten darin bestanden hatte, es als gegeben anzunehmen, dass der oder die Einbrecher durch die Küche ins Haus eingedrungen waren – weil sich dort die unsicherste Stelle befand. Aber auch das Esszimmer hatte eine Tür, die zum Garten hinausführte, und offensichtlich hatte man dort die Scheibe eingeschlagen. Richard hatte während seiner Dienstjahre viele junge Polizisten ausgebildet, und das erste Credo, das er ihnen vermittelte, hatte stets gelautet: Nehmt nichts jemals als gegeben hin. Alles muss überprüft werden, jede nur denkbare Option. Euer Leben und das anderer Menschen können davon abhängen.
Er konnte es nicht fassen, dass er in dieser Nacht gegen nahezu jeden seiner Grundsätze verstoßen hatte.
Dann ließ ihn auch schon ein kräftiger Schlag in den Magen in den Knien einknicken, und gleich darauf krachte eine Faust gegen seine Schläfe. Ihm wurde schwarz vor Augen, nur einen Moment lang, aber das reichte, um ihn zu Boden kippen zu lassen. Er verlor nicht die Besinnung, obwohl sich die Welt plötzlich rasant drehte und ein Schwindelgefühl in auf- und abschwellenden Wellen über ihn hinweglief. Er versuchte, auf die Beine zu kommen, aber ein Tritt in seine Rippen ließ ihn auf den Boden fallen. Gleich darauf fühlte er sich von kräftigen Händen gepackt und nach oben gezogen.
Dieser Gegner war sehr stark. Und sehr entschlossen.
Die Küchentür wurde aufgestoßen, das Licht eingeschaltet und Richard in die Küche geschoben. Mit der einen Hand hielt ihn der Einbrecher fest, mit der anderen zog er einen Stuhl unter dem Tisch hervor, stellte ihn in die Mitte des Raums. Richard blinzelte geblendet. Im nächsten Moment schon saß er auf dem Stuhl, noch immer um Atem ringend, denn vor allem der letzte Tritt in seine Rippen hatte ihm vorübergehend die Luft genommen. Er spürte, dass sein linkes Auge zuschwoll und dass eine klebrige Flüssigkeit, vermutlich Blut, aus seiner Nase floss. Er konnte so schnell kaum denken, wie die Dinge mit ihm geschahen, geschweige denn, dass er irgendetwas zu seiner Verteidigung hätte unternehmen können.
Seine Arme wurden grob hinter die Stuhllehne gezerrt, seine Handgelenke gefesselt. So brutal und so eng, dass sie sich fast augenblicklich taub anfühlten. Gleich darauf schnitt ein dünner Draht in seine nackten Fußknöchel, die unter seiner Schlafanzughose hervorsahen. Kabelbinder, wie er etwas später feststellen konnte, und das hieß, dass es nicht die mindeste Chance gab, sich dieser Fesseln aus eigener Kraft zu entledigen. Der Steinboden unter seinen nackten Füßen fühlte sich eiskalt an.
Ich hätte Hausschuhe anziehen sollen, dachte er.
Ein seltsamer Gedanke in seiner Lage. Er hatte weit gewichtigere Probleme.
Er blickte auf und stellte fest, dass er es nur mit einer Person zu tun hatte, wobei die Anzahl der Gegner in seiner jetzigen Lage keine Rolle mehr spielte. Ein überdurchschnittlich großer Mann. Sein Körperbau verriet, dass er vergleichsweise jung sein musste – um die dreißig Jahre wahrscheinlich. Er sah so aus, als verbringe er viel Zeit beim Krafttraining oder vielleicht sogar beim Boxen. Er wirkte ausgesprochen aggressiv.
Noch etwas fiel Richard auf, aber er hätte noch nicht sicher zu sagen gewusst, ob er es zu seinen Gunsten oder eher dagegen interpretieren sollte: Der junge Mann trug Handschuhe und hatte eine Strickmütze über sein Gesicht gezogen. Er war also klug genug, sowohl das Hinterlassen von Fingerabdrücken als auch von möglichen DNA-Spuren zu vermeiden. Zudem gab er sich seinem Opfer gegenüber nicht zu erkennen. Der Typ verriet damit eine gewisse Professionalität, und im Allgemeinen war es so, dass die Chance auf einen guten Ausgang bei einem professionellen Täter höher war; ein solcher verlor nicht so schnell die Nerven und richtete aus reiner Panik ein Blutbad an. Zudem sprach die Tatsache, dass er seine Identität verbarg, dafür, dass er die Möglichkeit sah, Richard könnte diese Nacht überleben. Aus irgendeinem Grund, aus einem Instinkt heraus, hatte Richard jedoch den Eindruck, dass sein Überleben nicht geplant war. Der junge Mann agierte wohl einfach vorsichtig, um sich gegen jede Eventualität zu wappnen.
Richard war in einen Albtraum mit ungewissem Ausgang geraten.
Er glaubte nicht, dass der Mann es auf einen Raubzug durch das Haus abgesehen hatte. Einfache Diebe suchten nach seiner Erfahrung nicht offensiv die Konfrontation mit den Hausbewohnern. Der Mann wäre eher wieder leise und schnell durch die Esszimmertür hinaus in den Garten verschwunden, als er ihn die Treppe hinuntertappen hörte. Zeit genug hätte er gehabt. Er hätte ihm nicht auflauern, ihn niederschlagen und damit ein Risiko eingehen müssen.
Der Einbruch hatte etwas mit ihm zu tun. Wäre er nicht aufgewacht, wäre der Eindringling nach oben gekommen und hätte ihn in seinem Bett überfallen. Das Schicksal hatte ihm eine Chance eingeräumt; er hatte sie verspielt.
Was, verdammt, hatte der Typ mit ihm zu tun?
»Schau mich an, du Dreckskerl«, sagte der junge Mann. Hochaufragend stand er vor Richard. Jeans, kurzärmeliges T-Shirt, ungeachtet der winterlichen Temperaturen draußen. Seine Oberarmmuskeln spielten. Der Kerl war stark wie ein Bär.
Richard hob den Blick. Sein linkes Auge schwoll immer schneller zu, aber mit dem rechten konnte er noch gut sehen.
»Kennst du mich?«, fragte der Fremde.
Das genau war es, was Richard seit ein paar Minuten geradezu fieberhaft überlegte, wobei die Tatsache, dass er das Gesicht des anderen nicht sehen konnte, die Sache nicht leichter für ihn machte.
»Wie soll ich das wissen?«, fragte er daher. »Sie verbergen Ihr Gesicht!«
Als Antwort darauf schoss die Faust des anderen auf ihn zu und krachte gegen sein Kinn. Richard sah Sternchen und fühlte, dass er dicht davor stand, das Bewusstsein zu verlieren. Der Schmerz erreichte ihn mit einer kurzen Zeitverzögerung und war dann so heftig, dass er es nicht schaffte, ein lautes Stöhnen zu unterdrücken. Es fühlte sich an, als sei etwas gebrochen. Ein Kieferknochen vielleicht. Er versuchte zu schlucken, was ihm erst nach einigen Anläufen gelang. Er schluckte dicke Klumpen Blut.
»Was … wollen … Sie?«, stieß er hervor.
»Du erinnerst dich wirklich nicht?«, fragte der Mann. »Mein Gesicht spielt keine Rolle, verstehst du? Es reicht, wenn du dich an ein paar widerwärtige Hinterhältigkeiten deines perversen Lebens erinnerst. Dann müsste dir dämmern, wen du vor dir hast.«
Jemanden, den er irgendwann im Laufe seiner Dienstjahre ins Gefängnis gebracht hatte? Aber das waren so viele gewesen.
Richard wagte nicht zu antworten, er starrte sein Gegenüber nur verzweifelt an.
»Hast du wirklich geglaubt, du kommst einfach so davon?«
Richard formulierte mühsam seine Antwort. »Ich … weiß nicht … wer … Sie sind.«
Er wappnete sich innerlich gegen den nächsten Schlag, aber er blieb aus. Der Fremde wippte auf seinen Fußballen auf und ab.
»Keine Ahnung, das kleine Arschloch. Du hast echt keine Ahnung, stimmt’s?«
»Nein«, bestätigte Richard, und schon traf ihn die Faust erneut, diesmal in den Magen, und so, dass ihm sekundenlang die Luft wegblieb. Er rang um Atem, dann lehnte er sich, so weit er konnte, nach vorne und spuckte Blut auf den Fußboden.
Der wird mich umbringen. Das ist der einzige Grund, weshalb er hier ist.
Aber er war nicht zufällig in sein Haus eingedrungen, davon war er überzeugt. Er hatte sich nicht irgendein Haus ausgeguckt und überlegt, er würde dessen Bewohner gerne überfallen, ein wenig quälen und foltern und dann töten. In seinen Jahren als Polizist hatte Richard derartige Motivationen durchaus erlebt und war manchmal fassungslos gewesen, durch wie viel Willkür und Zufall manche Menschen zu Opfern schrecklicher Verbrechen wurden. Aber darum ging es hier nicht. Er spürte den persönlichen Hass, der ihm entgegenschlug. Auch wenn er den jungen Mann nicht kannte – dieserschien ihn sehr wohl bewusst ausgewählt zu haben. »Bitte«, stöhnte er, »sagen Sie mir doch …«
Ein Tritt gegen sein Schienbein ließ ihn aufheulen. Der Typ trug Stiefel mit Spikes. Richard spürte das Blut aus seiner Schlafanzughose rinnen.
Seine einzige Chance, das wusste er, bestand darin, herauszufinden, was ihn mit diesem Mann verband. Wenn er mit ihm reden könnte. Es half fast immer, mit Menschen zu sprechen. Aber natürlich musste man dazu wissen, worüber man sprechen konnte.
Er nahm all seinen Mut zusammen. Alles tat ihm weh, seine Rippen, sein Magen, sein Bein, sein Gesicht. Er hatte furchtbare Angst, dass er wieder geschlagen würde, wenn er es wagte, den Mund aufzumachen, aber er war verloren, wenn er es nicht tat.
»Ich … weiß wirklich nicht, was … Sie mir vorwerfen«, sagte er. Das Formulieren der Worte fiel ihm schwer. Auch seine Lippen schwollen inzwischen an, und er hatte noch immer das Gefühl, ständig Blut zu schlucken. »Bitte … ich möchte es wissen. Wir könnten … darüber reden …«
Die Faust schoss auf ihn zu, und reflexartig ließ er den Kopf zur Seite fallen. Der Schlag streifte ihn nur, aber gleich darauf griff sein Gegner mit einer Hand in seine Haare und hielt seinen Kopf fest. Er zerrte ihn mit einem so kräftigen Ruck nach hinten, dass Richard glaubte, sein Genick würde brechen. Gleich darauf traf die andere Faust seine ohnehin gebrochene Nase, sein zugeschwollenes Auge, seinen Mund. Wieder und wieder krachte sie in sein Gesicht.
Ich sterbe, dachte er, ich sterbe, ich sterbe.
Der andere hörte auf, als Richard kurz davor stand, die Besinnung zu verlieren. Er fühlte, dass ihn nur der Bruchteil einer Sekunde davon getrennt hatte, und bedauerte, dass es nicht passiert war. Eine Ohnmacht war sein einziger Wunsch in diesem Moment. Neben dem, dass sein Sterben schnell gehen möge.
Er glühte vor Schmerzen. Er bebte und zitterte vor Schmerzen. Er bestand aus nichts anderem mehr als aus Schmerzen. Er fieberte, und er bekam kaum Luft. Er fragte sich, wieso er überhaupt noch lebte.
Er sah sich vor seinem inneren Auge: ein alter Mann in einem karierten Flanell-Pyjama, der auf einem Küchenstuhl saß, gefesselt an Händen und Füßen, mit einem zu Brei geschlagenen Gesicht, blutend und stöhnend. Eine knappe Viertelstunde hatte ausgereicht, ihn in dieses zum Tode verurteilte Wrack zu verwandeln.
Er dachte auch kurz an Kate. Er wusste, was sein Tod für sie bedeuten würde. Er war der einzige Mensch, den sie hatte, und es erfüllte ihn mit abgrundtiefer Trauer, dass er sie nun verlassen würde. Sie war sein einziges Kind … diese einsame, unglückliche Frau, die es einfach nicht schaffte, Freunde zu finden, das Herz eines Mannes zu erobern, eine Familie zu gründen. Oder wenigstens in ihrem Beruf glücklich zu werden. Sie hatten nie darüber gesprochen, wie allein und traurig sie sich fühlte. Kate hatte ihm gegenüber immer so getan, als sei ihr Leben weitgehend in Ordnung, und er hatte ihren offensichtlichen Wunsch, diese Fassade aufrechtzuerhalten, respektiert. Er hatte nie gesagt, dass er wusste, wie schlecht es ihr ging. Jetzt, in diesen vermutlich letzten Minuten seines Lebens, ging ihm auf, dass das ein Fehler gewesen war. Ihre gemeinsame Zeit hatten sie im Wesentlichen damit zugebracht, einander etwas vorzumachen, und sie damit im Grunde vergeudet.
Wie es schien, würde er keine Gelegenheit mehr haben, diesen Fehler zu korrigieren.
Er hob mühsam den Kopf, der auf seine Brust gesunken war. Aus seinen zu schmalen Schlitzen verquollenen Augen sah er, dass der Mann begonnen hatte, ohne jede Hast eine Küchenschublade nach der anderen aufzuziehen und darin herumzukramen. Schließlich hatte er offenbar gefunden, was er suchte: eine Plastiktüte aus dem Supermarkt.
Richard verstand. Er öffnete den Mund, um zu schreien, aber es kam nur ein schwaches, verzweifeltes Krächzen heraus. Nein, sollte das heißen, nein, bitte nicht!
Im nächsten Moment wurde die Tüte über seinen Kopf gestülpt. Mit irgendetwas – Bindfaden oder Klebeband oder was auch immer – wurde sie um seinen Hals herum befestigt.
Richard wollte etwas sagen. Er wusste es jetzt. Er wusste, um wen es sich bei seinem Angreifer handeln musste. Er begriff, um welche Geschichte in seinem Leben es ging. Wie hatte er so lange im Dunkeln tappen können?
Es war zu spät. Er konnte nicht mehr sprechen. Er atmete nur noch. Wild, unvernünftig, panisch, hastig, immer schneller.
Er atmete den letzten wenigen Sauerstoff, der ihm blieb.
MONTAG, 28. APRIL
1
Jonas Crane war nicht sicher, ob er nicht seine Zeit vertat, aber er hatte Stella versprochen, den Termin bei Dr. Bent wahrzunehmen, und nun würde er das auch durchziehen, ganz gleich, wie wenig Zutrauen er in dieses Unterfangen hatte. Er war im Unterschied zu seiner Frau kein überzeugter Anhänger der homöopathischen Medizin, allerdings auch kein erklärter Gegner. Den einen half es vielleicht, den anderen nicht. Stella kehrte von Besuchen bei Dr. Bent immer äußerst entspannt und glücklich zurück. Bei der Sache mit dem Kind hatte er allerdings auch nicht helfen können, niemand hatte letztlich geholfen. Manchmal sollte wohl etwas nicht sein im Leben.
Jonas hatte ziemlich lange warten müssen, was ihn nervös gemacht und verärgert hatte. Er war für elf Uhr bestellt worden, es war zwanzig Minuten vor zwölf, als er schließlich an die Reihe kam. Stella hatte ihn vorgewarnt. »Er nimmt sich sehr viel Zeit für seine Patienten. Daher kann es manchmal ganz schön dauern, bis man drankommt. Dafür hat man selbst dann auch genügend Zeit bei ihm. Er scheucht einen nicht einfach aus dem Zimmer, nur weil der Nächste wartet.«
Sie schien das großartig zu finden, Jonas hingegen hielt diese Vorgehensweise für höchst zweifelhaft. Er sagte sich aber, dass er noch Glück gehabt hatte, einen Vormittagstermin zu bekommen. Arm dran waren die Leute am späten Nachmittag, wenn sich die gesamte Abfolge schon so verzögert und verschoben hatte, dass man sich über vierzig Warteminuten, wie er sie erlebte, vermutlich noch freuen konnte.
Immerhin, auch er fand Dr. Bent sehr sympathisch. Engagiert und klug. Konzentriert. Ein Arzt, der seine Patienten ernst nahm und wirklich helfen wollte.
Er studierte den EKG-Ausdruck, den Jonas ihm mitgebracht hatte. »Das sieht doch gut aus.«
»Ja, das ist ja das Problem«, sagte Jonas. Er versuchte, nicht daran zu denken, dass er um ein Uhr eine wichtige berufliche Verabredung hatte und dafür noch durch halb London fahren musste. Er war jetzt endlich an der Reihe, und er musste sich auf diese Geschichte konzentrieren. »Es scheint alles in Ordnung zu sein. Ich war jetzt schon bei ziemlich vielen Ärzten. Herz, Kreislauf, Blutdruck … alles okay. Hier«, er zog ein weiteres zusammengefaltetes Papier aus der Innentasche seines Jacketts und schob es über den Schreibtisch, »das Ergebnis einer großen Blutuntersuchung vor zwei Wochen. Alles bestens.«
»In der Tat«, stimmte Dr. Bent zu. Er musterte Jonas aufmerksam. »Sie scheinen sehr gesund zu sein. Trotzdem – da ist etwas, das Sie irritiert?«
»Nun ja«, sagte Jonas. Der Moment hätte peinlich sein können. Ein zweiundvierzigjähriger, augenscheinlich kerngesunder Mann saß hier bei einem höchst frequentierten Arzt und würde ihm gleich erklären, dass er überzeugt war, krank zu sein, obwohl bislang niemand dafür irgendwelche Indizien gefunden hatte. Chronischer Hypochonder? Beginnende Midlife-Krise? Er spürte aber, dass Dr. Bent ihn nicht verurteilen würde, und er begann zu begreifen, weshalb Stella ihn so dringend empfohlen hatte: Er vermittelte einem das Gefühl, dass man ihm alles sagen konnte, ohne sich zu blamieren oder seinen Unmut zu erregen.
»Ich bin … etwas besorgt. Seit einiger Zeit … also seit Anfang des Jahres ungefähr habe ich diese seltsamen Symptome. Schwindelgefühle. Plötzlich taube Ohren. Ein Prickeln im linken Arm, dann den Eindruck, als ob er abstürbe. Erst dachte ich, es sei ein sich ankündigender Herzinfarkt. Das konnte jedoch ausgeschlossen werden. Tatsächlich wurde überhaupt nichts gefunden, was diese Beschwerden auslösen könnte. Aber es hört nicht auf. Ich meine, ich bin natürlich beruhigt, dass sich offenbar nichts Schlimmes dahinter verbirgt. Trotzdem, es ist irritierend. Stella meinte jedenfalls, ich könnte das nicht auf sich beruhen lassen.«
Dr. Bent lächelte. »Wie geht es Stella?«
»Gut. Danke.«
»Und dem kleinen Sammy?«
»Auch gut. Sehr gut sogar. Er wird in ein paar Tagen fünf Jahre alt. Er fiebert seinem Geburtstag entgegen.«
»Sind Sie noch immer glücklich mit dieser Entscheidung? Ein Kind adoptiert zu haben?«
»Ja. Absolut. Es war das Beste, was wir tun konnten. Und es hat endlich diese ewigen, vergeblichen Mühen beendet …« Er sprach nicht weiter. Dr. Bent wusste ja Bescheid.
Dieser nickte. »Acht Versuche mit künstlicher Befruchtung, nicht wahr?«
»Ja. Über Jahre. Wir waren so am Ende schließlich … Dass Stella irgendwann einwilligte, damit aufzuhören, dass sie sich zu der Adoption entschloss, hat unsere Beziehung gerettet. Und unser Bankkonto. Wir hätten auch finanziell nicht länger durchgehalten.«
»Finanziell haben Sie sich saniert? Das Ganze ist ja nun etliche Jahre her.«
Jonas schüttelte den Kopf. Es tat, stellte er fest, tatsächlich gut, einmal ganz offen sein zu dürfen. Er musste nicht Mr. Ich-habe-alles-bestens-im-Griff sein. Er konnte einfach sagen, wie es war.
»Nein. Wir haben immer noch ziemlich hohe Schulden. Unser Haus ist ja sowieso noch lange nicht abbezahlt, aber ich musste dann eine zusätzliche Hypothek aufnehmen, um Bournhall bezahlen zu können.« Bournhall war die Klinik, in der sie versucht hatten, ein Kind zu zeugen. Gegründet von den Ärzten, die das erste Retortenbaby, Louise Brown, geschaffen hatten. Im Falle von Stellas und Jonas’ Kinderwunsch hatten sie allerdings keinen Erfolg erzielt. »Ich zahle das nach und nach ab und schaffe das mit Ach und Krach. Es darf beruflich nichts schiefgehen bei mir, darauf kommt es jetzt an.«
»Sie arbeiten als freier Drehbuchautor?«
»Ja.«
»Und sind gut im Geschäft?«
»Ja, schon, aber …« Er hob hilflos die Schultern.
Dr. Bent betrachtete ihn ruhig. »Aber wenn einen Tag lang das Handy nicht klingelt, werden Sie unruhig. Wenn die Mails der Fernsehproduktionen ausbleiben. Wenn eine Einschaltquote schlecht ist. Aber ich vermute, Sie fühlen sich einer Katastrophe nahe, selbst wenn gerade alles gut läuft. Je besser Sie dastehen, umso schlimmer die Angst, den eigenen Ansprüchen nicht genügen zu können. Abzustürzen. Stimmt’s?«
Jonas starrte ihn an. Er fragte sich, wie es diesem Mann hatte gelingen können, nach nur wenigen Minuten des Zusammenseins hinter seine Fassade zu blicken. Seine Ängste so klar und genau benennen zu können.
»Ja«, bestätigte er, »ja, so ist es. Ich lebe in der ständigen Erwartung einer Katastrophe.«
Er lauschte dem Wort kurz hinterher. Katastrophe. War das zu dramatisch? Nein. Es traf seine Gefühlslage genau. Er erwartete die Katastrophe. Den finanziellen Kollaps. Den beruflichen Absturz. Das totale Scheitern. Das Versagen auf der ganzen Linie.
Katastrophe, Kollaps, Absturz, Scheitern, Versagen … Waren das die Ängste, die sein bewusstes Denken zeitweise und sein Unterbewusstsein ständig beherrschten? Dann brauchte er sich vermutlich nicht groß zu wundern.
»Können Sie schlafen?«, fragte Dr. Bent.
»Schlecht. Wenig. Ich schlafe einigermaßen gut ein am Abend, aber gegen zwei Uhr nachts werde ich wach. Herzrasen, Panikgefühle. Dann das Grübeln. Meist liege ich wach, bis der Wecker klingelt.«
Dr. Bent hatte sich die ganze Zeit über Notizen gemacht. Nun legte er seinen Stift zur Seite, stützte beide Arme auf den Schreibtisch und blickte Jonas sehr ernst an.
»Mr. Crane, Sie müssen den Katastrophenmodus verlassen. Das ist absolut wichtig. Körperlich sind Sie noch gesund, aber Sie bekommen massive Warnsignale gesendet. Die Schlafstörungen, das Herzrasen, der Schwindel, der taube Arm. Das ist ernst. Ganz egal, was diese Ergebnisse hier«, er wies auf die Blätter mit dem EKG und dem Blutbild, »auch aussagen mögen. Es ist noch nicht fünf vor zwölf, aber es ist zehn vor zwölf, und Sie sollten jetzt die Notbremse ziehen.«
Den Katastrophenmodus verlassen.
»Wie soll das gehen?«, fragte Jonas.
»Es geht«, versicherte Dr. Bent. »Es geht, aber es ist nicht einfach.«
»Wie konnte das passieren? Ich meine, dass man sich dann und wann Sorgen macht, ist normal. Aber Sie haben recht, ich lebe auch dann in der Erwartung größten Unheils, wenn gerade gar kein Anhaltspunkt da ist. Das war früher nicht so. Es hat sich … irgendwie eingeschlichen. Ich habe es gar nicht wirklich gemerkt.«
Dr. Bent nickte. »So etwas ist auch nicht von heute auf morgen da. Die Belastungen summieren sich langsam, und man geht noch gut mit ihnen um und glaubt, dass man alles im Griff hat. Wenn dann der Körper schlagartig signalisiert: Ich kann nicht mehr!, ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen. Ihre letzten Jahre waren nicht einfach, Mr. Crane, das habe ich ja über Stella mitbekommen. Jahrelang haben Sie und Ihre Frau gehofft, ein Kind zu bekommen. Schließlich die aufreibenden Bemühungen, es über künstliche Befruchtung zu schaffen. Die vielen Enttäuschungen. Die hohen Kosten. Dann ein Adoptionsverfahren, was auch alles andere als einfach ist. Daneben mussten Sie im Beruf funktionieren, umso mehr, als sich die Schulden zu türmen begannen. Ich vermute, gerade diese finanziellen Probleme haben Sie weitgehend mit sich selbst ausgemacht, um Ihre Frau nicht noch mehr zu belasten, aber das hat es für Sie erschwert.«
Jonas nickte. Genauso war es gewesen.
»Können wir uns das leisten, Jonas?«, hatte Stella vor dem fünften, sechsten, siebten, achten Versuch bang gefragt, und er hatte lächelnd geantwortet: »Gar kein Problem. Meine Auftragslage ist gut. Mach dir keine Sorgen!«
Sie war völlig fertig gewesen von den wahnsinnigen Hormonspritzen, den ewigen Untersuchungen, Eizellentnahmen, Retransfers der befruchteten Eizellen, von dem Warten und Hoffen und von den Enttäuschungen. In medizinischer Hinsicht war das Ganze für ihn als Mann viel einfacher gewesen, daher hatte er es für seine Pflicht gehalten, die anderen Sorgen von Stella fernzuhalten. Das war sein Part, und wie es schien, hatte dieser ihn aufgefressen.
»Ich werde Ihnen Tropfen verschreiben, die Sie bitte jeden Morgen vor dem Frühstück nehmen«, sagte Dr. Bent und riss ein Blatt von seinem Rezeptblock. »Aber darüber hinaus …«
»Ja?«
»Meinen Sie, es könnte Ihnen gelingen, für ein paar Wochen vollkommen auszusteigen?«
»Aussteigen?«
»Wann haben Sie zum letzten Mal Urlaub gemacht, Mr. Crane? Und ich meine wirklichen Urlaub? Ohne Handy, Laptop und sonstiges. Ohne ständige Präsenz, ständige Erreichbarkeit?«
Jonas überlegte. »Ich glaube – noch nie. Seit man ständig erreichbar ist. Wenn wir in die Ferien fuhren, nahm ich mein Büro sozusagen immer mit. Und machte nahtlos weiter.«
»Genau das meine ich. Ich habe etliche Patienten, Mr. Crane, die genau dieselben Symptome zeigen wie Sie. Sie sind keineswegs ein ungewöhnlicher Fall. Das digitale Zeitalter hat uns eine Menge Annehmlichkeiten beschert, aber es hat auch dazu geführt, dass wir praktisch keinen Ort mehr finden, an dem wir alles loslassen, an dem wir uns nur auf uns und den Augenblick besinnen können. Pausenlos checken wir unsere Mails, bis in den späten Abend hinein, und ab den frühen Morgenstunden geht es weiter. Wir tauchen nicht mehr weg und sind einfach einmal nur bei uns.«
Jonas schwante, was nun kam. »Sie raten mir zu einer Auszeit? Irgendwohin gehen, weg sein, nicht erreichbar sein?«
»Sämtliche Patienten von mir, die das probiert haben, waren begeistert von dem Ergebnis. Sie fühlten sich wie neu geboren. Sie hatten ihre Mitte wiedergefunden, konnten Wichtiges von Unwichtigem trennen. Auch wichtige von unwichtigen Problemen. Sie waren zur Ruhe gekommen.«
»Und das hält dann ein Leben lang?«
»Man sollte es immer wieder einmal wiederholen. Aber das kommt dann von alleine. Wichtig ist der erste Schritt.«
Jonas konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. »Ich werde verrückt, wenn ich irgendwo in der Einöde sitze und nicht erreichbar bin!«
»Die ersten Tage vielleicht. Aber dann kommt die Ruhe. Sie werden es sehen.«
»Am besten wäre es also, irgendwo ein Haus zu mieten. In der Mitte von Nirgendwo. Ohne Telefon und sonstige Möglichkeiten. Das meinen Sie?«
»Manche gehen auch in ein Kloster«, sagte Dr. Bent, aber Jonas schüttelte den Kopf. »Das ist nichts für mich. Aber so eine Art einsame Insel … Kann ich meine Familie mitnehmen?«
»Noch sinnvoller wäre es ohne. Aber für den Anfang ist das besser als nichts. Spätestens beim zweiten Versuch suchen Sie wahrscheinlich freiwillig die völlige Einsamkeit.«
Jonas erhob sich und griff das Rezept, das Dr. Bent ihm über den Tisch reichte. »Danke, Doktor. Die Tropfen nehme ich auf jeden Fall. Über … das andere muss ich nachdenken. Ich glaube Ihnen, was Sie sagen. Aber ich kann mir noch nicht wirklich vorstellen, dass es mir gelingt, Ihren Vorschlag umzusetzen.«
»Befassen Sie sich einfach mit dem Gedanken«, sagte Dr. Bent. »Sie werden feststellen, dass er sich zunehmend verlockend anfühlt.«
Sollte mich wundern, dachte Jonas. Er blickte auf die Uhr und erschrak. »Schon so spät! Ich muss los. Ein wichtiger Termin, wissen Sie?«
»Alles Gute«, sagte Dr. Bent.
Eines war klar: Auch Hamzah Chalid lebte im Katastrophenmodus, und er täte zweifellos gut daran, irgendeinen Weg zu finden, aus dieser Lebenskonstellation herauszugelangen. Seine dunkelbraunen Augen irrten beständig hin und her, er schien nicht in der Lage zu sein, seinen Blick auch nur für eine halbe Minute konzentriert auf sein Gegenüber zu richten. Er zuckte zusammen, wenn irgendwo eine laute Stimme erklang, und als einer Kellnerin in dem Café, das Jonas als Treffpunkt vorgeschlagen hatte, eine Kaffeetasse zu Boden fiel, fing Hamzah unkontrolliert zu zittern an. Er war ein kleiner, magerer Mann, knapp über fünfzig Jahre alt. Seine schwarzen Haare begannen über der Stirn und an den Schläfen grau zu werden. Er schien unablässig zu erwarten, dass jede Sekunde ein furchtbares Unheil über ihn hereinbrechen würde.
Als seien sie noch immer hinter ihm her. Die Schergen des inzwischen toten Diktators Saddam Hussein.
Jonas kannte Hamzahs Geschichte, die in einer filmischen Dokumentation erzählt werden sollte, zu der er das Drehbuch schreiben würde. Man war mit dem Auftrag an ihn herangetreten, und er hatte sofort zugesagt, obwohl er etwas in dieser Art noch nie gemacht hatte. Er schrieb Krimis für das Fernsehen, entweder solche, deren Handlung er selbst erfand, oder andere, für die er Romanhandlungen adaptierte und umarbeitete. Eine Geschichte mit politischem Hintergrund war noch nie dabei gewesen, zudem hatte er sich noch nie an etwas gewagt, das zumindest teilweise den Charakter einer Dokumentation haben würde. Aber man hatte ihm viel Geld angeboten, und das war ausschlaggebend gewesen.
Obwohl er wusste, dass er sich im Moment einer solchen Herausforderung eher nicht hätte aussetzen sollen.
Er kannte Hamzahs Geschichte, die Produktionsfirma hatte ihm eine Zusammenfassung zukommen lassen:
Hamzah Chalid war im September 1998 mitten in der Nacht von der Geheimpolizei in seinem Haus verhaftet und ins Gefängnis verschleppt worden. Er wusste lange Zeit nicht genau, was ihm vorgeworfen wurde, gewann aber schließlich den Eindruck, dass es mit einem Freund von ihm zu tun hatte, der sich offenbar in sehr unvorsichtiger Weise öffentlich regimekritisch geäußert hatte und ebenfalls inzwischen im Gefängnis saß. Jeder, der mit ihm in näherem Kontakt gestanden hatte, war damit in das Visier der Staatssicherheitsorgane geraten. Hamzah wurde gefoltert und trug dabei Verletzungen davon, die ihn für sein ganzes weiteres Leben zu einem gesundheitlich schwer angeschlagenen Mann machten. Schließlich hielt man ihn jedoch für politisch offenbar unbedenklich und entließ ihn wieder. Hamzah war nicht mehr derselbe; er litt unter Panikattacken, Essstörungen und schweren Depressionen und schaffte es nicht, sein normales Leben, wie er es vorher geführt hatte, wieder aufzunehmen. Häufig musste er zum Arzt, wurde krankgeschrieben, fehlte bei der Arbeit. Ob es dieser Umstand war, der ihn wieder in irgendeiner Weise hatte verdächtig erscheinen lassen, erfuhr er nie; es erreichte ihn eines Tages jedoch eine Warnung, dass seine erneute Verhaftung unmittelbar bevorstehe. Hamzah floh in buchstäblich letzter Minute durch ein rückwärtiges Fenster seiner Wohnung, als die Geheimpolizei schon vor der Haustür stand. Er fand Unterschlupf bei Freunden, wurde jedoch von einem zum anderen gereicht, weil jeder um sein eigenes Leben fürchtete. Es kam schließlich zu jener Szene, die ihm bis zum heutigen Tag beständig im Kopf herumging. Er erzählte sie Jonas gleich als Erstes in dem Café, obwohl Jonas sie natürlich auch schon kannte.
»Ich wurde wieder einmal von einem Versteck zum nächsten gebracht. Im Auto eines Bekannten. Hinten im Fußraum kauernd, eine Decke über mir. Wir hielten an einer Ampel. Alles schien ganz normal. Unter meiner Decke war es dunkel und viel zu warm. Stickig. Alle Geräusche drangen nur dumpf und aus weiter Ferne an mein Ohr …«
»Aber Sie spürten plötzlich eine Gefahr …«, hakte Jonas vorsichtig ein. Er hatte die Geschichte aufmerksam gelesen.
»Ja. Ich spürte die Gefahr. Ich spürte sie. Ich kann bis heute nicht erklären, was mich gewarnt hat. Es war eine plötzliche Gewissheit in mir: Sie sind da. Sie sind ganz nah. Ich fing an zu zittern. Ich konnte kaum noch atmen …« Hamzah stockte. Seine Augen waren noch dunkler geworden, seine Haut noch bleicher. Schweiß trat auf seine Stirn.
»Das Unterbewusstsein. Sensoren, die Sie in der Zeit seit Ihrer ersten Verhaftung entwickelt hatten«, erklärte Jonas. »Wilde Tiere verfügen über diesen Instinkt. Sie wittern eine Gefahr, lange bevor tatsächlich etwas zu sehen oder zu hören ist. Ihr Instinkt hat großartig funktioniert in diesem Moment, Mr. Chalid.«
Hamzah hatte die Decke von sich geworfen, die Wagentür aufgestoßen und war hinausgesprungen. Das Glück wollte es, dass sie gerade an einer Kreuzung standen, an die unmittelbar ein kleiner, unübersichtlich bewachsener Park angrenzte. Hamzah tauchte in den Büschen unter. Wie er später erfuhr, war das Auto der Geheimpolizei bereits nur von zwei weiteren Fahrzeugen getrennt hinter ihnen gewesen. Der Zugriff wäre ein oder zwei Minuten später erfolgt. Hamzah war erneut im allerletzten Moment entkommen.
Später hatten ihn Schleuser über die Grenze nach Pakistan gebracht. Auch dabei hatte er etliche Abenteuer bestehen müssen und wäre einmal um ein Haar Spitzeln der Regierung in die Hände gefallen. Schließlich hatte es ihn nach England verschlagen, wo er Asyl beantragt und schließlich bewilligt bekommen hatte. Seine Geschichte war spannend, und nachdem jemand ihn an einen Journalisten vermittelt hatte, war in einer Zeitung darüber berichtet worden. Jetzt interessierte sich eine Filmproduktion für ihn. Jonas hatte den Eindruck, dass Hamzah den Ereignissen geradezu entgegenfieberte: Er durfte erzählen. Man hörte ihm aufmerksam zu. Man nahm ihn wahr. Man nahm vor allem das Unrecht wahr, das ihm geschehen war. Hamzah war ein tief traumatisierter Mensch, dem sein normales Leben genommen worden war. Er hatte überlebt, ein lebenswertes Leben bislang jedoch nicht wiedergefunden. Er wurde mit den Geschehnissen nicht fertig, hatte nie verstanden, weshalb die Welt nicht aufgeschrien hatte bei Geschichten wie seiner. Jetzt, jetzt endlich wollte er den Schrei hören. Dann würde alles besser, er würde abschließen können, er würde einen Weg in die Zukunft finden.
Jonas bezweifelte, dass sich Hamzahs Hoffnungen erfüllen würden, mochte das jedoch vorerst nicht thematisieren. Der Film würde nie das Echo finden, das sich der Iraker davon versprach. In seinem Land war so viel geschehen seither … Den Diktator von einst gab es längst nicht mehr, andere Probleme und Krisen beherrschten die Region. Hamzah und seine Geschichte waren für die Öffentlichkeit im Grunde Schnee von gestern. Der Aufmerksamkeitswert war zweifellos vorhanden und würde etliche Zuschauer vor die Bildschirme locken, aber er würde weder Diskussionen auslösen noch Zeitungen füllen. Hamzah träumte davon, in Talkshows zu gehen und zu berichten, Vorträge zu halten und Interviews zu geben. Er träumte davon, Heilung zu finden, wenn er mit dem Schrecken, der ihn beherrschte, nicht mehr alleine wäre.
»Sie werden ganz bestimmt das Drehbuch schreiben?«, fragte er mehrmals. »Der Film wird doch ganz bestimmt gedreht werden?«
»Wie es jetzt aussieht, wird das alles wie geplant funktionieren«, sagte Jonas. »Machen Sie sich keine Sorgen.«
Hamzah drehte sich immer wieder um, musterte die Gäste im Café eindringlich, saugte sich an Passanten fest, die draußen vor dem Fenster vorbeigingen.
»Dieser Instinkt, wissen Sie«, sagte er, »dieser Instinkt, der mir damals in Bagdad das Leben gerettet hat … Ich kann ihn nicht mehr ausschalten. Er ist immer da. Er ist immerzu hellwach.«
»Verständlich«, sagte Jonas höflich. Was Hamzah jedoch als Instinkt bezeichnete, war natürlich längst keiner mehr. Hamzah witterte inzwischen Feinde, die nicht da waren. Er war in ein völlig neurotisches Verhalten, vielleicht sogar in eine Psychose abgeglitten. Er glaubte sich umzingelt von den Häschern eines längst toten Diktators. Als er seine Kaffeetasse zum Mund führte, zitterten seine Hände so sehr, dass der Kaffee auf seinen Schoß schwappte. Kaum hatte er die Tasse wieder abgesetzt, sah er sich erneut hektisch um.
Dr. Bents Bezeichnung Katastrophenmodus kam Jonas erneut in den Sinn, und auch der Gedanke, dass er selbst und der bedauernswerte Hamzah Chalid am Ende gar nicht so weit voneinander entfernt waren. Sie wurden beide beherrscht von Ängsten, die zumindest in ihrer augenblicklichen Situation nicht real waren, von ihnen jedoch als real empfunden wurden. Hamzah und Saddam Hussein. Jonas und der berufliche und soziale Zusammenbruch. Zwei völlig unterschiedliche Geschichten, zwei nach außen hin völlig unterschiedliche Männer.
Und doch lebten sie beide mit einer kleinen Zeitbombe in ihrem Inneren, deren Vorhandensein nur sie allein spürten, deren Ticken nur sie allein hörten.
»Wie wird es nun weitergehen?«, fragte Hamzah.
»Ich werde ein Treatment schreiben«, erklärte Jonas. »Eingeteilt bereits in Bilder und Szenen. Ich habe ja eine ausführliche Wiedergabe Ihrer Geschichte vorliegen. Sie bekommen das fertige Treatment dann natürlich sofort zu lesen. Anschließend sollten wir uns erneut treffen, um alles noch einmal durchzusprechen, und dann mache ich mich an die Feinarbeit.«
»Wann wird das sein? Ich meine, wann werden Sie das Treatment fertig haben?«
Jonas unterdrückte ein Seufzen. Es würde nicht leicht werden mit Hamzah.
»Es wird eine Weile dauern. Noch ist ja auch nicht endgültig entschieden, ob das Ganze überwiegend eine Dokumentation oder mehr ein Spielfilm sein soll und wie genau das Mischverhältnis aussehen wird. Ich habe nächste Woche einen Termin mit dem Produzenten. Da werden wir auch über diese Frage sehr intensiv sprechen.«
Hamzah nickte, wirkte aber unglücklich. Jenseits seiner ständigen Angst vor einer drohenden Gefahr gehörte es offenkundig inzwischen zu seinem Charakterbild, immer das Schlechteste anzunehmen und keinerlei Vertrauen mehr aufbringen zu können.
»Das alles soll doch kein Schnellschuss werden«, sagte Jonas, »sondern eine wirklich solide Geschichte, und da darf man nichts überstürzen.«
»Wir bleiben aber in Kontakt?«, vergewisserte sich Hamzah. Sicher war ihm die Vorstellung, monatelang in seinem Londoner Dachzimmer zu sitzen und nicht zu wissen, was geschah, unerträglich, und Jonas konnte das nachvollziehen.
»Natürlich. Nichts geschieht über Ihren Kopf hinweg und ohne dass Sie informiert werden. Sie sind schließlich die Hauptperson bei all dem!« Der letzte Satz war eine fromme Lüge. Niemand bei der Produktion sah Hamzah Chalid als Hauptperson oder überhaupt als wichtige Person. Er hatte die Rechte an seiner Geschichte verkauft, und nun hatte er selbst für niemanden mehr eine besondere Bedeutung. Im Gegenteil, man wäre nur froh, wenn er sich weitgehend heraushielte. Es war so ähnlich wie mit den Romanautoren, deren Bücher man verfilmte: Sie lamentierten wegen jeder Veränderung, die man vornahm, wollten dies anders und jenes, regten sich auf und machten nichts als Ärger. Man wünschte, sie würden einfach Ruhe geben und im Hintergrund bleiben. Meist waren sie jedoch nicht allzu leicht einzuschüchtern oder gar völlig mundtot zu machen. Das sah bei diesem höchst verunsicherten, ständig am Rande des Nervenzusammenbruchs schwebenden Flüchtling anders aus. Um ihn würde sich schon überhaupt niemand groß scheren. Letzten Endes, das sah Jonas jetzt schon voraus, würde er vermutlich der Einzige sein, der sich aus reinem Mitleid seiner annahm. Er ahnte, dass Hamzah wie eine Klette an ihm haften würde. Und wenn das alles in eine bittere Enttäuschung mündete, würde Jonas das Drama abbekommen.
Er schob den Gedanken beiseite. Zu früh, zu unabsehbar. Es brachte nichts, jetzt schon über mögliche Entwicklungen nachzudenken.
Der Begriff Hauptperson hatte Hamzah ein wenig aufgemuntert. Seine Augen blickten nicht ganz so trostlos mehr drein. Er trank seinen Kaffee zu Ende, schaute sich dann wieder hektisch um.
»Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben«, sagte er.
»Ja, ich auch«, sagte Jonas. Er winkte der Kellnerin, bezahlte für sich und Hamzah.
»Sie hören von mir«, versprach er, während er aufstand.
Auch Hamzah erhob sich. Jonas stellte fest, dass der Mann nur gebeugt stehen konnte. Er musste an die Folterungen denken, die er erlebt hatte. Diese Welt war so weit weg von seiner eigenen, schwer vorstellbar, schwer nachzuvollziehen. Einen Moment lang fühlte er sich beschämt.
Die beiden Männer verabschiedeten sich draußen auf der Straße voneinander. Der Apriltag war bewölkt, die Luft jedoch warm. Jonas sah Hamzah nach, der langsam davonhumpelte.
Er selbst ging in Richtung seines Autos.
Noch zwei Termine. Dann würde er nach Hause fahren und endlich an seine eigentliche Arbeit gehen können: das Schreiben.
2
Stella und Sammy kamen zu Hause an, und Sammy, der schon im Wagen die ganze Zeit über geredet hatte, hörte auch nicht auf, als sie ins Haus und in die Küche gingen und nachdem er auf seinen erhöhten Stuhl an der Theke geklettert war. Stella hatte ihn von seiner Spielgruppe abgeholt, wo an diesem Vormittag der Geburtstag eines Freundes von Sammy gefeiert worden war, was Sammy – falls das überhaupt notwendig gewesen war – wieder nachdrücklich an seinen eigenen bevorstehenden Geburtstag erinnert hatte. Am Freitag war es so weit, und es war auch eine große Party geplant. Sammy schnurrte zum hundertsten Mal seine sich ständig erweiternde Wunschliste hinunter und entwarf die verrücktesten Spiele für seine Party. Stella genoss es, ihn so zu erleben, so voller Vorfreude und überschäumend von Energie und Einfallsreichtum. Er hätte in der Spielgruppe zu Mittag essen können, aber sie holte ihn meistens ab, vor allem an Tagen, an denen Jonas nicht da war. Warum sollte sie sich alleine hinsetzen und ziemlich lustlos einen Joghurt löffeln? Da machte es ihr mehr Spaß, mit ihrem Sohn zu essen und sich an ihm zu freuen. Für heute hatte sie Pommes frites und Chickennuggets geplant. Sein absolutes Lieblingsessen.
Während sie die Tiefkühlfritten auf ein Backblech schüttete, hörte sie mit einem halben Ohr Sammys Geplapper zu. Ansonsten dachte sie wieder einmal über ihre eigene Zukunft nach. Sie hatte nicht mehr gearbeitet, seitdem Sammy da war, aber im September würde er in die Schule kommen, und das, so fand sie, war ein guter Zeitpunkt, ihr eigenes Leben neu zu gestalten. Ewig wollte sie nicht mehr daheim bleiben, aber sie wusste, die Rückkehr ins Berufsleben würde nicht ganz einfach aussehen. Sie hatte als Producerin bei einer Filmproduktion gearbeitet. Sie vermisste ihren Job, machte sich aber wenige Illusionen darüber, dass er mit einem Familienleben nicht immer leicht vereinbar sein würde. Eine halbe Stelle war auf dem Papier gut und schön, in der Praxis häufig nicht durchzuhalten. Andererseits arbeitete Jonas über lange Strecken zu Hause. Wenn sie sehr gut planten, sich im Vorfeld immer wieder rechtzeitig und sorgfältig absprachen …
»Und Luftballons«, sagte Sammy gerade. »Mummy! Hast du gehört? Wir hängen überall im Haus Luftballons auf, ja?«
»Klar, das machen wir. Und im Garten. Wenn das Wetter schön ist.«
Die Pommes frites waren im Backofen. Stella schaltete gerade den Thermostat ein, als das Telefon klingelte.
Später erinnerte sie sich immer wieder an diese Szene. An das Klingeln, das ihr zunächst ganz normal vorgekommen war, im Nachhinein jedoch einen irgendwie hässlichen Klang angenommen hatte. Das Klingeln, das eine friedliche, alltägliche Szene durchschnitt: die freundliche, helle Küche. Blumen am Fenster. Die Pommes frites im leise brummenden Backofen. Sammy auf seinem Hochstuhl, planend und plappernd. Draußen rollte ein Auto langsam durch die Siedlung. Ein paar erste Sonnenstrahlen durchbrachen die Wolkendecke, die den Tag bislang in ein etwas milchiges, trübes Licht getaucht hatte.
Sie ging ohne Hast zu dem Telefonapparat, der im Wohnzimmer stand. Jonas vermutlich. Wenn er unterwegs war, meldete er sich immer zwischendurch, und heute hatte sie seit dem frühen Morgen noch nichts von ihm gehört. Inzwischen musste er bei Dr. Bent fertig sein. Sie war gespannt auf seinen Bericht.
Sammy redete in der Küche unvermindert weiter. »Und dann ein Bananenkuchen mit Schokoladenüberzug und …«
»Hallo«, meldete sie sich.
Ein kurzer Moment des Schweigens. Dann eine Stimme: weiblich, jung, etwas schüchtern. Was aber durch eine fröhliche, aufgesetzt wirkende Forschheit überspielt wurde.
»Hallo! Stella? Hier ist Terry. Terry Malyan. Erinnern Sie sich an mich?«
Und ob sie sich erinnerte.
Sammys leibliche Mutter. Von der sie gehofft hatte, sie werde sie nie im Leben wiedersehen müssen.
Sie saß in der Küche, Sammy gegenüber, aber sie nahm ihren Sohn, der eine wahre Ketchup-Orgie auf seinem Teller feierte, kaum wahr. Irgendwie hatte sie es geschafft, das Essen fertig zuzubereiten und den Tisch zu decken, aber sie hatte sich schon dabei wie in Trance bewegt. Und die ganze Zeit über fragte sie sich, woher das Gefühl der Bedrohung rührte.
Terry Malyan.
»Am 2. Mai wird Sammy ja fünf Jahre alt«, hatte sie am Telefon gesagt mit dieser seltsam aufgesetzten, forcierten Stimme. »Und da dachte ich, es wäre eine wunderbare Gelegenheit, ihn einmal wiederzusehen!«
Terry hatte sich fast fünf Jahre lang nicht gerührt. Weder angerufen noch geschrieben. Nicht an Sammys Geburtstag, nicht an Weihnachten. Zu Sammys erstem Geburtstag hatte Stella ihr Fotos geschickt, darauf jedoch keine Reaktion erhalten. Schließlich hatte sie diese Frau abgehakt.
Und dies als Erleichterung empfunden.
»Wir sind zufällig am Wochenende sowieso in London …«
Ach ja, zufällig? Und was hieß überhaupt wir?
»Mein Freund und ich. Mein Freund hat beruflich dort zu tun.«
Sprach sie von Sammys Vater? Stella hatte ihn nie kennengelernt, er war schon seinerzeit, als es um die Adoption ging, nicht in Erscheinung getreten. Ein damals siebzehnjähriger Schüler, wie sie wusste, der völlig entsetzt und schockiert war über das Ergebnis seiner ersten sexuellen Erfahrung, die während des Aufenthaltes in einem Feriencamp an der walisischen Küste mit einer sechzehnjährigen Schülerin in einem Zelt stattgefunden hatte und ein Volltreffer geworden war: in Gestalt des kleinen Jungen, der neun Monate später zur Welt kam.
Stella erinnerte sich noch gut an den Anruf der sie betreuenden Mitarbeiterin des Jugendamts im April 2009. »Wir haben ein Kind für Sie. Es wird Anfang Mai geboren. Die Eltern sind fest entschlossen, es sofort zur Adoption freizugeben. Sie sind selbst noch halbe Kinder, gehen zur Schule und sind mit der Situation vollkommen überfordert.«
Das Ganze war von Anfang an als eine »verdeckte Adoption« geplant gewesen, auf etwas anderes hätten sich Stella und Jonas nicht eingelassen. Die leiblichen Eltern würden die Adoptiveltern nicht kennen, umgekehrt würde es genauso sein. Sollte das Kind später die leiblichen Eltern kennenlernen wollen, würde ihm der Einblick in die Akten natürlich gewährt sein; bis dahin würde es jedoch keinerlei Kontakt geben. Stella und Jonas hatte nie vorgehabt, ihr Kind darüber im Unklaren zu lassen, dass es adoptiert war, aber sie wollten keine ständigen Besuche, keinen Austausch, keine Einmischung. Auch keine innere Zerrissenheit des Kindes zwischen den verschiedenen Eltern.
»Nein, nicht Sammys Vater«, hatte Terry gesagt. »Von dem habe ich nie wieder etwas gehört. Ich bin seit einem halben Jahr mit meinem neuen Freund zusammen. Neil Courtney. Wir werden wahrscheinlich heiraten.«
»Mummy, hörst du mir zu?«, fragte Sammy und blickte seine Mutter über den Tisch hinweg an. Er war von einem Ohr zum anderen mit Ketchup verschmiert und sah aus, als wäre er in einen Farbeimer gefallen.
Stella versuchte zu lächeln. »Klar höre ich dir zu.«
Neil Courtney. Terrys neuer Freund. Dem Terry offensichtlich das Kind zeigen wollte, das sie geboren und für das sie sich jahrelang nicht interessiert hatte.
Oder war dieser neue Mann in ihrem Leben die treibende Kraft? Aber welcher Mann interessierte sich schon brennend für den Sohn seines Vorgängers, einen Sohn, der zudem im Leben der Mutter keinerlei Rolle gespielt hatte?
ENDE DER LESEPROBE