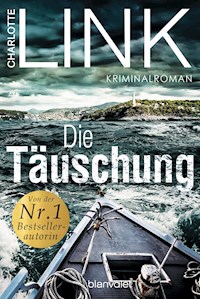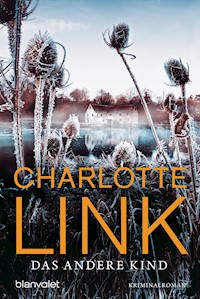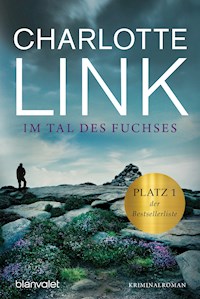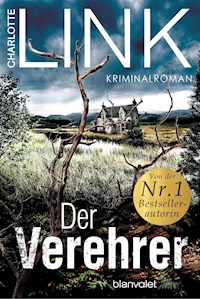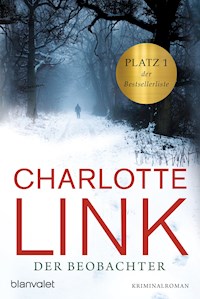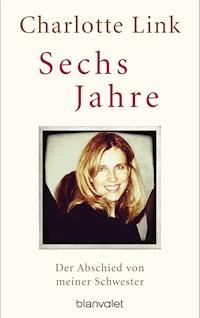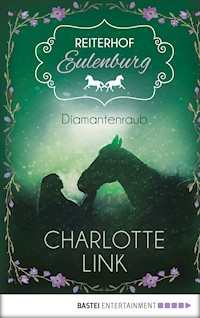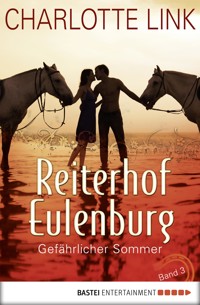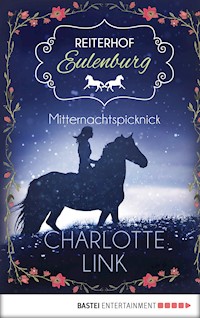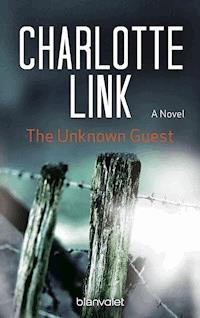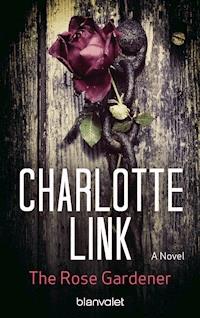9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sturmzeittrilogie
- Sprache: Deutsch
Deutschland 1914. In Europa gärt es, auf dem Familiengut der Degnellys in Ostpreußen blickt man jedoch noch voller Zuversicht in die Zukunft. Vor allem die 18-jährige Tochter Felicia träumt von einem aufregenden, glücklichen Leben. Ein Traum, der sich in einer harten Zeit bewähren muss, denn die nächsten Jahre bringen auch für Felicia das Ende ihrer vertrauten Welt. Dennoch liebt sie das Leben, das Risiko und vor allem zwei sehr gegensätzliche Männer. Inmitten der Wirren des Krieges entwickelt sie sich zu einer unabhängigen Geschäftsfrau, die hoch spielt und tief fällt. Bei all dem begleiten sie ihr tiefes Gefühl der Verantwortung für ihre Familie – und der Wille, sich von Niederlagen nie entmutigen zu lassen. Ein Wille, der auch die Frauen der nachfolgenden Generationen prägen wird …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 769
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Deutschland 1914. In Europa gärt es, auf dem Familiengut der Degnellys in Ostpreußen blickt man jedoch noch voller Zuversicht in die Zukunft. Vor allem die 18-jährige Tochter Felicia träumt von einem aufregenden, glücklichen Leben. Ein Traum, der sich in einer harten Zeit bewähren muss, denn die nächsten Jahre bringen auch für Felicia das Ende ihrer vertrauten Welt. Dennoch liebt sie das Leben, das Risiko und vor allem zwei sehr gegensätzliche Männer. Inmitten der Wirren des Krieges entwickelt sie sich zu einer unabhängigen Geschäftsfrau, die hoch spielt und tief fällt. Bei alldem begleiten sie ihr tiefes Gefühl der Verantwortung für ihre Familie – und der Wille, sich von Niederlagen nie entmutigen zu lassen. Ein Wille, der auch die Frauen der nachfolgenden Generationen prägen wird …
Autorin
Charlotte Link, geboren in Frankfurt/Main, ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre Kriminalromane sind internationale Bestseller, auch Die Betrogene und zuletzt Die Entscheidung eroberten wieder auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. Allein in Deutschland wurden bislang über 28 Millionen Bücher von Charlotte Link verkauft; ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Charlotte Link lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt/Main.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
CHARLOTTE LINK
STURMZEIT
Band 1
Roman
I. BUCH
1
Der Junitag verdämmerte in rotgoldenem Abendlicht. Über den blassblauen Himmel zogen ein paar zerrupfte Wolken, in den Wiesen zirpten Grillen, und die Blätter der Bäume rauschten leise. Die Tannenwälder am Horizont wurden dunkler, die Schatten über den Wiesen länger. Die Stämme der Kiefern leuchteten kastanienfarben.
»Morgen«, sagte Maksim, »fahre ich nach Berlin zurück.«
Unvermittelt hatte der strahlende Abend seinen Glanz verloren. Felicia Degnelly, die neben Maksim am Ufer eines Baches saß, blickte erschrocken auf. »Morgen? Aber warum denn? Der Sommer hat doch gerade erst angefangen!«
Maksims Antwort war ausweichend. »Ich treffe Freunde. Wichtige Freunde.«
»Genossen!«, sagte Felicia spöttisch, aber ihr Spott sollte nur verbergen, wie verletzt sie war. Die Genossen kamen vor ihr, vor dem gemeinsamen Sommer auf dem Lande, vor Abenden wie diesem.
Sie sah Maksim von der Seite an und dachte voller Erbitterung: Du weißt ja nicht, was du willst!
Im Innersten aber war ihr klar, dass er es genau wusste. Seine Gedanken waren gefesselt von einer Idee, nicht von ihr. Er sagte nie, was andere Männer sagten, wenn sie mit ihr zusammen waren, etwa: »Du bist sehr hübsch!« oder »Ich glaube, ich könnte mich in dich verlieben!« Nein, von ihm kamen seltsame Worte wie Umsturz, Weltrevolution, Umverteilung des Eigentums, Enteignung der besitzenden Klasse. Dass es eine Welt für ihn gab, zu der sie keinen Zutritt fand und zu der er ihr auch keinen Zutritt erlauben würde, hatte sie schon vor fast zwei Jahren begriffen, am Kaisergeburtstag in Berlin, als sie durch die Straßen gingen und die jubelnden Menschen betrachteten, als in Maksims Gesicht Wut und Zynismus rangen. Plötzlich hatte er etwas vor sich hingemurmelt (später erfuhr sie, dass es ein Zitat von Marx war): »Dieser Mensch ist nur König, weil sich andere Menschen wie Untertanen zu ihm verhalten.«
Sie hatte ihn angeschaut. »Was sagst du?«
Auf einmal hatte ein verachtungsvoller, beinahe brutaler Zug um seinen Mund gelegen. »Egal«, erwiderte er und musterte geringschätzig ihr schönes Kleid und ihren neuen Hut (beides trug sie seinetwegen), »egal, du wirst es doch nie verstehen. Nie!«
Er hatte recht. Sie verstand ihn nicht. Sie verstand nicht, dass er sich für eine Idee begeistern konnte, während sie sich für das Leben begeisterte. Er wollte die Welt verändern zum Besten der Menschheit, und sie – ja, sie wollte eigentlich nur das Beste für sich selbst. Und sie wollte Maksim Marakow.
Er war der Sohn eines Russen und einer Deutschen, hatte seine Jugend abwechselnd in Petrograd und Berlin verbracht und alle Sommer auf dem Landsitz von Verwandten bei Insterburg in Ostpreußen, unweit von Lulinn, dem Gut, das Felicias Großeltern gehörte. Er war vier Jahre älter als Felicia, und von Anfang an waren sie wie magisch angezogen aufeinander zugegangen. Beide dunkelhaarig, mit hellen Augen und gleichmäßigen Gesichtszügen, hielten die meisten Leute sie für Geschwister. Kamen sie zusammen, so tauchten sie in eine fremde Welt, und über ihrer Kindheit lag der Zauber geheimer Spiele, die niemand störte. Die Obstgärten von Lulinn, die Wälder und Seen ringsum, die Wiesen waren Szenenbilder ihrer ungeschriebenen Zwei-Mann-Stücke. Irgendwann aber, in irgendeinem Sommer, betraten sie wieder ihre Bühne und erkannten einander kaum mehr. Felicia kam in eleganten Kleidern, trug die Haare aufgesteckt und hatte sich ein etwas gekünsteltes Lachen angewöhnt. Maksim erschien in abgetragenen Anzügen, sah blass und übernächtigt aus. Beide waren sie erwachsen geworden, aber ihre ersten Schritte auf diesem Weg hatten sie in entgegengesetzte Richtungen getan. Ihre letzte Gemeinsamkeit bezogen sie aus Erinnerungen, aber es sah nicht so aus, als werde es Gemeinsamkeiten in der Zukunft geben. Und auf einmal erkannte Felicia: Ich liebe ihn. Ich werde ihn immer lieben.
Sie liebte diese dunkle, fremde Welt, die sie nicht verstand. Sie liebte seine abweisenden Augen und seine verächtlichen Worte, die er für das etablierte Bürgertum hatte. Sie liebte seine zynischen Bemerkungen über den Kaiser, und sie liebte die lebendige Freude seines Gesichtes, wenn er von der Revolution sprach. Sie liebte das alles – aber sie begriff nicht den Ernst, die Leidenschaft, die dahinterstand. Sie begriff nicht, dass ihre beiden Welten einander ausschlossen.
Sie war achtzehn Jahre alt, hatte ein gesundes Selbstvertrauen, und es wäre ihr nicht im Traum eingefallen, das Kapital zu lesen, nur um über etwas reden zu können, was sie doch nicht berührte.
Sie setzte auf ihre Augen, ihren Mund, ihr glänzendes Haar, auf tiefausgeschnittene Kleider und geheimnisvolle Parfüms.
Sie saßen schweigend, bis die Sonne unterging, und in ihrem Schweigen lag der Abschied von einer Zeit, die fast unmerklich vorbeigegangen war. Schließlich stand Maksim auf, griff Felicias Hand und zog sie neben sich hoch. »Es wird kalt«, sagte er, »wir sollten nach Hause gehen.«
Sie standen einander dicht gegenüber, Felicia mit einem breitrandigen Hut aus blaulackiertem Stroh auf dem Kopf.
Sie hob ihr Gesicht, öffnete leicht die Lippen, erwartungsvoll, weil es ihr unsinnig schien, einen Moment wie diesen zu vertun. Sekundenlang konnte sie in Maksims Augen etwas von der alten Zärtlichkeit entdecken, dann erlosch sie schon wieder, und mit einem etwas mühsamen Lachen erklärte er: »Nein. Ich mach dich nicht unglücklich, und mich schon gar nicht.«
Was redete er da? Von welchem Unglück sprach er?
»Na, dann nicht«, sagte sie schnippisch, »wenn du von nun an wie ein Mönch leben willst, dann tu’s doch!«
»Ich will meinen Weg gehen, Felicia. Und du wirst deinen gehen, und ich glaube nicht, dass sich diese Wege jemals kreuzen werden.«
»Heißt das, wir sehen einander nie wieder?«
»Wir sehen uns nicht so wieder, wie du dir das vorstellst.«
»Warum nicht?«
Mit einer zornigen Bewegung riss Maksim einen Zweig von einem Baum und zerbrach ihn in kleine Stücke. »Wirst du das denn nie verstehen, Felicia?«
»Danke, ich habe längst verstanden. Du musst ja das internationale Finanzmonopol stürzen, und da bleibt dir natürlich für nichts sonst Zeit. Lieber nächtelang Marx anhimmeln, als einmal ein Mädchen küssen! Ein aufregendes Leben, wirklich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei!« Sie drehte sich um und rannte davon. Sie kannte den Weg im Schlaf, und irgendwie gelangte sie über Wurzeln und Äste hinweg, ohne zu stürzen. Natürlich hatte sie erwartet, er werde ihr nachkommen, aber nach einer Weile stellte sie fest, dass er offenbar gar nicht daran dachte. Vor Wut und Verletztheit kamen ihr die Tränen. Erst an der Auffahrt von Lulinn riss sie sich zusammen, putzte die Nase und trocknete das Gesicht.
Das Herrenhaus von Lulinn war zweihundert Jahre zuvor erbaut worden, obwohl die Familie Domberg seit dreihundert Jahren auf diesem Grund und Boden saß. Das erste Haus war eines Nachts in Flammen aufgegangen – eine wahnsinnige Vorfahrin, so hieß es, habe das Feuer aus Eifersucht gelegt –, und das neue war an seiner Stelle aus der Not des Augenblickes heraus recht schmucklos und einfach entstanden: ein großes Gebäude aus grauem Stein, mit vielen Fenstern, Efeu umkletterte es, zu seinen Füßen lag ein blühender Rosengarten, und auf sein Portal führte eine eichengesäumte Allee, an die sich rechts und links weite Koppeln anschlossen, auf denen Trakehner, der Stolz des alten Domberg, grasten. Jetzt lag alles im Dunkeln, in den Eichen ging der Wind, die Pferde bewegten sich als dunkle Schatten wie Elfen über die Wiesen. Felicia blieb stehen und sah sich hoffnungsvoll um. Manchmal kam ein Wagen vorbei, dann brauchte man die lange Allee nicht zu Fuß zu gehen.
Aber diesmal blieb alles still. Mit einem Seufzer wollte sie sich auf den Weg machen, da vernahm sie ein Rascheln im nahen Erlengebüsch. Eine dunkle Gestalt huschte hervor.
»Nicht erschrecken, Fräulein, nicht erschrecken. Ich bin es, Jadzia!«
»Ach Gott, Jadzia, hast du mich erschreckt! Was treibst du dich denn da im Gebüsch herum?«
Jadzia war Dienstmädchen auf Lulinn, eine alte Polin, von der Großvater Domberg immer sagte, man wisse bei ihr nicht, ob sie sich für ihre Herrschaft vierteilen ließe oder sie alle eines Nachts in ihren Betten ermorden würde. Sie ging eigene, geheimnisvolle Wege, manchmal war sie verschwunden, dann tauchte sie unversehens wieder auf. Entweder, so hieß es, war sie Schmugglerin oder Sozialistin – oder beides.
»Ich weiß etwas«, sagte sie.
»Was denn?« Es konnte ja immerhin etwas Interessantes sein. Jadzia trat näher. »Den österreichischen Thronfolger haben sie erschossen. Heute, in Sarajewo. Täter soll gewesen sein Serbe!«
Wenn es weiter nichts war! »Ach«, sagte Felicia gleichgültig.
»Wird gäbn Krieg«, fuhr Jadzia fort, »großer Krieg!«
»Sicher nicht, Jadzia. Warum sollte daraus ein Krieg entstehen?«
Jadzia murmelte etwas auf Polnisch. Felicia ging weiter. Sarajewo – wo lag das überhaupt? Sie hatte nie von diesem Ort gehört. Im Übrigen war es ihr auch gleichgültig. Sie dachte über Maksim nach und darüber, weshalb sie ihn anderen vorzog. Es war so, dass sie all die netten jungen Männer, die sie sonst kannte, zum Sterben langweilig fand. Sie waren so schrecklich aufmerksam und gut erzogen; sie verstand sie – und verachtete sie. Sie hatten nichts Rätselhaftes an sich und waren damit keine Herausforderung. Gerade danach aber suchte sie. Sie wollte Abenteuer, und in Maksim schien ihr die Erfüllung dieses Wunsches zu liegen.
Felicias Bruder Johannes wurde an diesem 28. Juni 1914 fünfundzwanzig Jahre alt.
Außerdem wurde er an diesem Tag zum Oberleutnant ernannt. Und sein Urlaub begann.
Am frühen Morgen hatte er gemeinsam mit seinem Freund Phillip Rath das langweilige Garnisonsnest am Rhein, wo seine Kompanie stationiert war, verlassen, um zu dem alljährlichen Familiensommer auf Lulinn zu reisen. Sie machten in Berlin Station; zum einen, um sich auszuruhen, zum anderen, damit Phillip seine Familie, die ebenfalls in Berlin lebte, kurz sehen konnte. Am Abend trafen sie sich bei Johannes, in der augenblicklich leeren Wohnung seiner Eltern in der Schlossstraße. Phillip brachte seine Schwester Linda mit, eine achtzehnjährige puppenhafte Schönheit, die mit Felicia zur Schule gegangen und seit einem halben Jahr mit Johannes verlobt war. Außerdem waren sie in Begleitung eines Mannes, den Johannes nicht kannte: Alex Lombard aus München.
»Unsere Väter waren Geschäftspartner«, erklärte Phillip, »daher kennen wir uns etwas. Ich traf Alex vorhin zufällig, und da er nichts vorhatte, habe ich ihn mitgenommen.«
Johannes und Alex schüttelten einander die Hände. Unvermittelt dachte Johannes: ein interessanter Mann. Sicher mindestens zehn Jahre älter als ich.
»Lombard«, sagte er stirnrunzelnd, »sind Sie …«
»Die Textilfabrik aus München, ja.« Alex grinste. »Die gehört allerdings meinem Vater. Ich bin hin und wieder so wie jetzt sein Handlungsreisender, wenn ich mich nicht gerade in der Rolle des missratenen Sohnes wohler fühle.«
Die vier jungen Leute verbrachten einen vergnügten Abend. Johannes hatte Sekt gekauft, das Grammophon spielte, und durch die geöffnete Balkontür floss warme Nachtluft. Alex machte den Alleinunterhalter. Er konnte urkomische Geschichten erzählen, Menschen, die er in seinem Leben getroffen hatte, treffend parodieren, sich selbst, andere und die Welt als solche so dreist ins Lächerliche ziehen, dass man sich hätte biegen können vor Lachen – wären nicht seine Ironie eine Spur zu beißend, sein Spott ein wenig zu giftig gewesen. Seine Zuhörer schwankten stets zwischen Belustigung und Betroffenheit. Irgendjemand hat dich mal irgendwann sehr verletzt, dachte Johannes, und ich habe auch das Gefühl, du trinkst etwas zu viel.
Seine schicksalhafte Wende nahm der Abend gegen Mitternacht, als die Gäste gerade beschlossen hatten zu gehen und Alex Lombard draußen auf dem Flur plötzlich wie angewurzelt stehen blieb.
»Ach«, sagte er, »das habe ich vorhin gar nicht gesehen!«
Es war ein Bild, das seine Aufmerksamkeit fesselte, ein Ölgemälde, das ein junges Mädchen zeigte. Das Mädchen saß auf der Seitenlehne eines Sofas, sehr lässig und wie zufällig. Es trug ein blasslilafarbenes Kleid, hielt einen weißen Strohhut in den Händen, und am Ausschnitt des Kleides war eine weiße Rose befestigt. Die lockigen, dunkelbraunen Haare fielen bis zur Taille hinab. Das Mädchen entsprach keineswegs dem Schönheitsideal seiner Zeit, das zartere und lieblichere Frauen verlangte, blass und fein wie zerbrechliches Porzellan. Diese hier jedoch erschien weder lieblich noch zerbrechlich. Sie hatte ein schmales Gesicht mit einer geraden Nase und einem schöngeformten Mund, der sehr zuversichtlich lächelte. Die hohe, weiße Stirn gab dem Gesicht etwas unerwartet Vornehmes.
»Wer ist das?«, fragte Alex fasziniert.
»Meine Schwester Felicia«, erwiderte Johannes, »mein Onkel Leo hat sie gemalt, und ich glaube, er hat sie sehr gut getroffen.«
»Felicia«, sagte Alex, und er sprach den Namen, als ließe er ihn auf der Zunge zergehen. Er vertiefte sich wieder in das Bild, unbekümmert um die lächelnden Blicke, die sich Johannes und Phillip zuwarfen. Er konnte sich Felicias Stimme vorstellen, ihre Bewegungen und wie es klingen musste, wenn sie lachte. In allem, was sie tat, mussten ein Schuss Ironie und eine unbändige Lust am Provozieren mitschwingen, überhaupt kam sie ihm vor wie eine einzige Provokation. Sie war ebenso höhere Tochter wie Femme fatale, und beide Rollen vermochte sie wahrscheinlich recht überzeugend zu spielen. Sie war die Aristokratin mit Hut und Handschuhen und teurem Schmuck, sie war aber auch die Bäuerin, die barfuß am Rande eines staubigen Feldweges kauerte und sich mit einem großen Ahornblatt kühle Abendluft zufächelte.
Doch das eigentliche Rätsel lag in ihren Augen.
Sie waren von einem reinen, hellen Grau, ohne den geringsten Anflug eines mildernden Blaus oder Grüns darin. Kühle Augen, die in vollkommenem Widerspruch zu dem Lächeln des Mundes standen. Eigenartig entrückte Augen, abweisend und herrschsüchtig. Geheimnisvolle Augen, die nichts preisgaben und so aussahen, als ließen sie es nicht zu, dass ihre Besitzerin jemals ganz erforscht und erkannt würde.
Dieses Mädchen gibt sich niemandem ganz, dachte Alex. Er hatte plötzlich das eigenartige Gefühl, in einen Spiegel zu schauen, und scheuchte seine Gedanken hastig fort: So ein Unsinn! Romantisches Gewäsch. Ein ganz normales Mädchen, und der Maler hat sie wohl nicht besonders gemocht und ihr deshalb so kalte Augen gegeben.
»Hübsch«, sagte er daher nur beiläufig, »eine hübsche Schwester haben Sie, Herr Oberleutnant!«
»Sie verdreht jedem Mann den Kopf, der ihr über den Weg läuft«, entgegnete Johannes, »aber anstatt endlich zur Ruhe zu kommen und zu heiraten, hängt sie ihr Herz an einen fanatischen Sozialisten, der für sie nur Verachtung übrighat.«
»Passt«, sagte Alex, »Frauen wie sie ertragen es nicht, angebetet zu werden.«
Sie hatten unterdessen die Wohnung verlassen und standen im Treppenhaus mit seinen breiten Stufen und roten Läufern. Linda und Johannes hielten einander bei den Händen und konnten sich nicht trennen, während sich Alex und Phillip in ein Gespräch über deutschen und französischen Wein vertieften. In der Wohnung im Erdgeschoss ging die Tür auf, und der alte Amtsgerichtsrat, der dort wohnte, streckte den Kopf hinaus. Er war sehr einsam und lag ständig auf der Lauer, um jemanden der Familie Degnelly zu erwischen und in ein Gespräch zu verwickeln. Jetzt, zu dieser mitternächtlichen Stunde, glühten seine Augen begeistert.
»Haben Sie schon gehört, was passiert ist?«, fragte er.
Johannes, der ein schlechtes Gewissen wegen der lauten Grammophonmusik hatte, lächelte verbindlicher als sonst. »Nein. Was ist denn geschehen?« Wahrscheinlich hatte die Nachbarskatze Junge bekommen, oder etwas ähnlich Welterschütterndes war geschehen.
»Auf das österreichische Thronfolgerpaar wurde ein Attentat verübt. In Sarajewo. Sie sind beide tot. Der Täter kam wohl aus dem serbischen Untergrund.«
Johannes ließ Lindas Hand los. Phillip und Alex verstummten.
»Was?«, fragte Johannes schließlich.
»Ja, ja. Alle Extrablätter verkünden es. Erzherzog Franz Ferdinand ist tot!«
»Aber das ist ja …« Für einen Moment standen sie alle wie versteinert. Dann murmelte Phillip: »Der nächste Krieg wird von irgendeiner ganz lächerlichen Angelegenheit auf dem Balkan ausgelöst werden.«
»Was?«
»Bismarck. Bismarck hat das mal gesagt.«
Alex grinste. »Die lächerliche Angelegenheit auf dem Balkan. Ja, Freunde, ich schätze, das ist sie. Dann gute Nacht.«
Er setzte seinen Hut auf und ging pfeifend die Treppe hinunter, während hinter ihm lebhaftes Stimmengewirr einsetzte.
»Bei den Serben und Kroaten hat es schon zu lange gebrodelt. Österreich wird sich diese Provokation nicht gefallen lassen.«
»Dann hängen wir mit drin. Deutschland hat ein Bündnis mit Österreich. Andererseits weiß kein Mensch, ob die serbische Regierung beteiligt war, und wegen eines Attentäters …«
»Mein Vater sagt immer, wenn ein Krieg ausbricht, dann an der französischen Grenze, weil die Franzosen Elsass-Lothringen in Wahrheit noch nicht aufgegeben haben.«
»Da hat er sicher recht, Linda.«
»Was meint ihr, werden die Österreicher …«
»Könntest du dir vorstellen zu sterben?«, fragte Christian unvermittelt. Sein Freund Jorias, der vor sich hin gedöst hatte, schrak auf. »Was meinst du?«
»Na ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Wenn es Krieg gibt und wenn er lange genug dauert, dann werden wir bestimmt auch noch eingezogen. Nächstes Jahr machen wir unser Fähnrichexamen, und dann wären wir schon so weit. Es ist auf einmal … so eine verrückte Vorstellung!«
Jorias nickte langsam. Die Lokomotive stieß einen schrillen Pfiff aus, dumpf rumpelten die Räder über die Geleise. Die beiden Jungen sahen zum Fenster hinaus, aber es war schon tief in der Sommernacht, und sie konnten nur das Spiegelbild ihres schwach erleuchteten Abteils sehen.
»Jetzt dauert es nicht mehr lange bis Insterburg«, sagte Christian, und in seiner Stimme klang aufgeregte Freude. Er war Felicia Degnellys jüngerer Bruder, gerade sechzehn geworden, und er gehörte zu denen, auf die das Reich mit Stolz blickte: Er war ein Kadett. Er durchlief jenen Weg, auf dem Kinder bereits zu Soldaten gemacht und im Sinne bester preußischer Traditionen erzogen wurden, gedrillt bis zum Umfallen, gebildet wie kleine Professoren, infiziert aber vor allem mit einer heiligen Liebe zum Kaiser, zum Vaterland – und zum Tod.
Christian und sein Freund Jorias, der keine Eltern mehr hatte und daher in das Familienleben der Degnelly-Familie miteinbezogen war, hatten erst vor Kurzem das Vorkorps in Köslin verlassen und bereiteten sich in der Hauptkadettenanstalt Lichterfelde auf ihr Fähnrichexamen vor. Sie trugen graue Uniformen mit engen, steifen Kragen, blütenweiße Handschuhe und voller Stolz die weißen Schulterklappen der HKA.
Sie sahen sehr erwachsen aus, aber Offizierslaufbahn hin oder her – sie waren sechzehn! Und es war Sommer, die Ferien begannen. Lulinn wartete. Für gewöhnlich, wenn sie in diesem Zug saßen, drehten sich die Gespräche nur um die kommenden fünf Wochen, diesmal jedoch verhielten sich beide recht schweigsam. Obwohl der Zug sie Kilometer für Kilometer von Berlin fortführte, obwohl die Freiheit winkte und sie den Rest dieser Nacht schon in ihrer heißgeliebten Dachkammer auf Lulinn schlafen würden, spukten in ihrer Erinnerung noch allzu deutlich die Worte ihres Hauptmannes, mit denen er mittags vor die Kompanie getreten war. »Der österreichische Thronfolger und seine Gemahlin sind in Sarajewo ermordet worden, wahrscheinlich von einem serbischen Attentäter. Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch während Ihres Urlaubs Seine Majestät der Kaiser den Zustand drohender Kriegsgefahr ausrufen wird. In diesem Fall finden Sie sich bitte unverzüglich, und ohne auf weiteren Befehl zu warten, hier im Kadettenkorps ein!«
Drohende Kriegsgefahr, drohende Kriegsgefahr … die Räder schienen diese Worte immer wieder zu singen.
Ich habe eigentlich keine Angst, dachte Christian, nein, es ist nur so unwirklich. Ich kann mir den Krieg nicht vorstellen.
»Noch jemand in Königsberg zugestiegen?« Der Schaffner war plötzlich aufgetaucht und sah sich suchend um. Er musterte die beiden Jungen wohlwollend. »Ah – das ist die Jugend, auf die Deutschland stolz sein kann! Die Hüter und Bewahrer brandenburg-preußischer Tradition! Sind Sie denn auch bereit, für Kaiser und Vaterland auf dem Feld der Ehre zu sterben?«
Er redet so, als wären wir schon im Krieg, dachte Jorias unbehaglich. Aber man war nicht umsonst seit Jahren auf Fragen wie diese eingeschworen.
»Jawohl!«, sagten die beiden Kadetten wie aus einem Mund, dann sahen sie einander an, und es war, als riefen sie einander zu: Aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Der Sommer beginnt doch gerade erst …
2
Der alte Ferdinand Domberg pflegte zu sagen, es gebe mancherlei Schlimmes, was einem Mann in seinem Leben widerfahren könne, aber das Schlimmste sei zweifellos, Vater von Töchtern zu werden.
Söhne konnten einen Mann zur Weißglut treiben, sicher (er hatte zwei solche Exemplare; Victor, der Älteste, konnte vor Selbstgerechtigkeit kaum aus den Augen schauen, und Leo, der Jüngste, vertat sein Leben als mittelloser Maler), aber hin und wieder konnte man sie anschreien und böse Worte zu ihnen sagen und sich das Herz erleichtern, indem man ihnen alle Strafen des Himmels an den Hals wünschte.
Töchter hingegen … Sie ließen sich viel schwerer beschimpfen, und man wusste nie, was sie dachten, und sie handelten sowieso immer anders, als sie sprachen. Selbst wenn sie zu seinen Vorhaltungen mit bekümmerter Miene schwiegen, wusste er, dass sie ihm in Wahrheit nicht einmal zuhörten. Was seine beiden Töchter anging, so hatten sie ihn vor Jahren schwer gekränkt, indem sie beide Männer heirateten, mit denen er nicht einverstanden gewesen war. Elsa, immerhin die Mutter seiner Lieblingsenkelin Felicia, hatte ihm ihren Auserwählten, einen Berliner Arzt, nicht einmal vorgestellt, sondern ihn erst nach der Hochzeit gewissermaßen als unabänderliche Tatsache präsentiert. Und Belle, die jüngere, die vor nichts und niemandem Respekt hatte, war mit einem Baltendeutschen dahergekommen. Schlimmer noch, mit einem hohen Offizier der russischen Armee. Ferdinand zeigte in all den Jahren keine Bereitschaft, diese Geschmacklosigkeit zu verzeihen, und jedes Jahr kam es während einer der gemeinsamen Mahlzeiten zu dem peinlichen Moment, da er seine Töchter vor versammelter Mannschaft durchdringend ansah und laut sagte: »Es ist wohl so, dass man als Frau nehmen muss, was man eben kriegen kann, nicht?«
Es war ein heißer Juliabend, und der alte Herr blickte sehr missmutig drein. Er saß im Esszimmer von Lulinn, unter Hirschgeweihen und Ahnenbildern, schluckte seine Herztropfen und betrachtete zornig den gedeckten Abendbrottisch. Zehn Minuten über die festgesetzte Zeit; die vielen eigenwilligen Mitglieder seiner Familie hielten es offenbar nicht für nötig, pünktlich zu kommen. Nur seine Frau Laetitia saß in einem Lehnstuhl am Fenster, und seine Tochter Elsa lehnte daneben an der Wand. Beide blickten hinaus in den leuchtenden Sommerabend, und Elsa hatte ganz offenbar wieder ihre Melancholie. Sie war eine zarte, blasse Frau, von der kein Mensch wusste, wie sie, eine so empfindsame Person, einer so raubeinigen Familie hatte entspringen können. In diesen Tagen litt sie um ihren Sohn Johannes. Wegen Sarajewo war er nicht nach Lulinn gekommen, sondern »hielt sich in Berlin bereit«, wie er schrieb. Bereit wofür?, fragte sich Elsa bekümmert.
Der alte Domberg knurrte wütend. »Früher war es üblich, dass solche, die zu spät kommen, eben nichts mehr kriegen«, sagte er zornig, »aber heutzutage wird gewartet, bis auch der Letzte einzutreffen geruht. Eine Schande ist das!« Er schlug mit der Faust auf den Tisch, dass das Geschirr schepperte. Laetitia wandte sich ihm zu. In ihrer Jugend hatte sie zu den schönsten Mädchen der östlichen Provinzen gehört, und noch im Alter erkannte man die grandiose Beauté, die sie einst gewesen war. Sie hatte die schmalen eisgrauen Augen, die den meisten Frauen ihrer Familie zu eigen waren, eine gerade Nase und schmale Lippen. Sie sprach mit tiefer, rauchiger Stimme und galt als unumschränkte Herrscherin auf Lulinn. »Reg dich nicht auf, Ferdinand«, sagte sie, »du hast ein schwaches Herz, vergiss das nicht. Victor und Gertrud sind übrigens gerade ins Haus gekommen. Sie müssen gleich hier sein.«
Ferdinands Gesicht verfinsterte sich noch mehr, wie immer, wenn der Name seiner Schwiegertochter fiel. Mit Victor, seinem Ältesten, hatte Ferdinand ehrgeizige Pläne gehabt. Er sollte die vornehmste Frau aus der besten Familie heiraten; stattdessen kam er eines Tages mit Gertrud an, einem unansehnlichen dicklichen Mädchen, das kaum den Mund aufbrachte. Die ganze Familie rätselte, was ein gutaussehender Mann wie Victor an dieser verkniffenen Frau aus kleinbürgerlichen Verhältnissen fand.
Ferdinand hatte sich bis zu diesem Tag nicht mit ihr abgefunden. »Seit unseren Zeiten, Laetitia, ist es mit der Familie bergab gegangen«, sagte er gehässig. Laetitia teilte seine Ansicht über Gertrud durchaus, scheute jedoch aus einer gewissen Loyalität heraus davor zurück, dies so unverblümt zu zeigen. Gertrud gehörte zur Familie, und eine Familie, davon war Laetitia überzeugt, konnte nur stark sein, wenn sie zusammenhielt.
So erwiderte sie nichts, sondern wandte ihr Gesicht wieder dem Fenster zu. »Dort kommt Belle«, sagte sie lebhaft, »mit Nicola! Wie süß die Kleine aussieht!«
Belle, eigentlich auf den Namen Johanna Isabelle getauft und zeitlebens von der Familie nur »Belle« gerufen, war eine große und schwere Frau, fast ein wenig zu füllig, aber so schön, dass jedes Pfund an ihr kostbar schien. Sie trug ein helles Musselinkleid, ihr goldbraunes Haar leuchtete im Abendsonnenlicht. An der Hand führte sie ihre sechsjährige Tochter Nicola.
Belle lebte seit ihrer dramatischen Hochzeit mit Oberst Julius von Bergstrom in Petersburg. Sie führte ein aufwendiges gesellschaftliches Leben, ging am Zarenhof ein und aus, und Ferdinand verfärbte sich jedes Mal vor Wut, wenn er daran dachte, dass seine Enkelin Nicola zwischen lauter Russen aufwachsen musste, Slawen, von denen er immer sagte, dass sie noch mal Unglück über Deutschland bringen würden.
»Möchte wissen, was Belle tut, wenn es Krieg gibt«, brummte er, »sie muss sich doch wie eine Verräterin fühlen mit ihrem Russen, den sie da geheiratet hat!«
»Er ist kein Russe«, widersprach Laetitia, »er ist Deutscher.«
»Baltendeutscher. Die Balten werden auf russischer Seite kämpfen.«
»Es gibt aber gar keinen Krieg.«
»Ach, es gibt keinen, wie? Und wie soll Österreich auf den Mord von Sarajewo reagieren?«
»Wie auch immer, Russland wird sich nicht einmischen. Man wird sich dort nicht auf die Seite der Königsmörder schlagen.«
»Wenn einem das den Grund liefert, in Ostpreußen einzufallen, dann schon«, entgegnete Ferdinand, der die geheime Überzeugung hegte, es sei dieses herrliche grüne Land zwischen Ostsee und Memel, um das jeder Kampf geführt werde. Was konnte es Schöneres geben auf der Erde als diese sanften Hügel, die fruchtbaren Wiesen, die tiefen Wälder und weiten Seen unter einem Himmel, der blauer war als irgendwo sonst in Europa. Worum kämpfen, wenn nicht um die endlosen Kornfelder, die sich leise im Wind wiegten, um die hundertjährigen Eichen, die zehn Männer gemeinsam nicht umfassen konnten? In jedem Frühjahr, in dem er den Schrei der heimkehrenden Wildgänse vernahm, begriff Ferdinand Domberg in einer seinem Wesen sonst völlig fremden Demut, dass es eine Gnade war, hier leben zu dürfen.
Doch jetzt war es Sommer, die Wiesen sahen aus wie schaumige Wogen von Blumen, und Ferdinand dachte nicht an Gnade, sondern an Recht. Sie sollten nur kommen, die slawischen Horden, wagen sollten sie es, einen einzigen Fuß auf den Boden von Lulinn zu setzen. Zum zweiten Mal an diesem Abend schlug er mit der Faust auf den Tisch. »Wo, zum Teufel, ist Felicia?«, fragte er. Elsa, die bislang ihren Blick nicht von dem rauschenden Laub eines Apfelbaumes gewandt hatte, sah ihn an. »Sie wollte ausreiten«, erklärte sie, »mit irgendwelchen Jungen aus der Nachbarschaft. Sie ist bestimmt bald zurück.«
»Was für Jungen?«
»Von den umliegenden Gütern. Sie kennt sie von Jagdgesellschaften und Bällen. Alle aus guter Familie.«
»Maksim Marakow ist nicht dabei?« Ferdinands Blick wurde lauernd.
Elsa schüttelte arglos den Kopf. »Der ist in Berlin, soviel ich weiß …«
»Na ja … Zwischen Marakow und Felicia ist nicht alles so harmlos. Gertrud hat sie einmal belauscht, und es soll recht vertraulich zugegangen sein.«
»Gertrud ist ein Scheusal«, entgegnete Elsa kurz.
In minutenlanger Einmütigkeit schwiegen alle, dann bohrte Ferdinand weiter. »Ich würde ja nichts sagen, mir ist es gleich, mit wem sie sich amüsiert. Aber über Marakow gibt es Gerüchte. Er soll ein Sozialist sein!«
»Und wenn schon!« Elsa hatte keine Lust, über Maksim zu reden. »Zwischen den beiden ist nichts.«
Laetitia lächelte. Elsa kannte ihre Tochter schlecht. Sie selber hatte eine besondere Beziehung zu Felicia, sie war ihre Lieblingsenkelin, weil sie sich selbst in ihr wiederfand. Sie war ebenso unabhängig gewesen, so berechnend liebenswürdig, so heftig in das Leben verliebt. Felicia konnte ihr nichts vormachen. Sie wusste, dass die Sache mit Maksim Marakow nicht ausgestanden war. Es gab seit einiger Zeit einen neuen Zug im Gesicht der Enkelin, in den Augen ein Wissen, das nichts mit der Schulweisheit einer frischgebackenen Abiturientin zu tun hatte.
Ferdinand, dem die Hitze des Tages zu schaffen gemacht hatte und den die Unpünktlichkeit seiner Kinder vor allem deshalb fast rasend machte, weil sie ihm bewies, dass er seine beste Zeit als gefürchteter Diktator auf Lulinn überschritten hatte, suchte weiterhin Streit. Bislang hatte er nur gequengelt, nun ging er zum Angriff über. »Du solltest vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, mit wem deine Tochter ihre Zeit verbringt, Elsa«, sagte er anzüglich, »oder willst du, dass mit ihr dasselbe geschieht wie mit dir?«
Elsa fuhr herum, totenblass im Gesicht. Auf ihrer Nase bildeten sich in Sekundenschnelle feine Schweißperlen. »Dass du es noch wagst, davon zu sprechen, Vater!«, sagte sie tonlos.
Zum dritten Mal an diesem Abend fiel Ferdinands Faust krachend auf den Tisch. »Glaubst du im Ernst, ich ließe mir von dir vorschreiben, worüber ich sprechen darf und worüber nicht?«, schrie er.
Laetitia erhob sich. Ihr Mund war nur noch ein dünner Strich. »Wir waren übereingekommen, diese Sache niemals wieder zu erwähnen«, sagte sie hart.
Ferdinand, den sie heute noch ebenso leicht einschüchtern konnte wie zu Beginn ihrer Ehe, brummte etwas Unverständliches. Laetitia wandte ihren gefürchteten stahlharten Blick Elsa zu, doch in der hatte sie schon immer einen widerspenstigen Gegner gehabt. Elsa wurde noch um eine Schattierung blasser, aber sie wich nicht aus. »Übereinkunft«, sagte sie, »hieß nach deinem Verständnis immer, dass du etwas bestimmst und die übrigen Menschen sich fügen.«
Laetitia gab um nichts nach. »Ach, so siehst du das! Dabei hätte ich fast gedacht, es sei auch in deinem Interesse, wenn wir dieses … Missgeschick von damals möglichst stillschweigend übergehen.«
»Missgeschick? Du nennst es Missgeschick, wenn … oh Gott …« Elsa musste sich setzen. Sie hatte nicht weinen wollen, aber plötzlich konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten. Zusammengekrümmt saß sie am Fenster und schüttelte sich vor Schluchzen, während ihre Mutter vergeblich versuchte, ihr ein Taschentuch zwischen die zitternden Finger zu schieben. Ihr strenges, ebenmäßiges Gesicht versteinerte wie stets, wenn sie an den Tag vor beinahe dreißig Jahren erinnert wurde, an dem die damals sechzehnjährige Elsa ein Telegramm von ihrer großen Jugendliebe, dem charmanten Manuel Stein, erhielt, in dem er ihr mitteilte, er habe sich mit einem jungen Mädchen aus Kiel verlobt, sei überglücklich und werde so bald wie möglich heiraten. Elsa, die von dem Tag an, da er zur Marine gegangen war, die dumpfe Ahnung eines endgültigen Abschieds gehegt hatte, brach zusammen. Laetitia versuchte, sie zu trösten, indem sie ihr immer wieder versicherte, Manuel sei ein Luftikus, und er habe ihr keinen größeren Gefallen tun können, als sie zu verlassen. Ferdinand tobte, weil er Elsas Schmach als persönliche Niederlage empfand, und die ganze Familie war nur froh, dass Manuel weit weg war, da Ferdinand sich sonst unweigerlich mit ihm duelliert hätte und am Ende noch vor einem Gericht gelandet wäre.
»Du wirst noch viele Männer kennenlernen, Elsa«, hatte Laetitia gesagt, »oh, es gibt so viele! Du brauchst es deinem Vater nicht zu erzählen, aber bevor ich ihn traf, war ich mit einem bezaubernden Jungen zusammen, den ich zu gern geheiratet hätte. Unsere Väter waren dagegen, und die Sache zerschlug sich. Und du siehst«, sie hatte auf ihre unverwüstliche Art gelächelt, »es hat mir nicht das Herz brechen können!«
Elsa hatte ihre Mutter verzweifelt angesehen. »Aber ich bekomme ein Kind von ihm, Mutter«, hatte sie leise gesagt.
Das hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Selbst Laetitia brauchte einige Tage, um sich von dieser Nachricht zu erholen. Ferdinand bekam einen Tobsuchtsanfall, zerschmiss eine Bodenvase aus dem sechzehnten Jahrhundert und entließ von einem Moment zum anderen drei alte, treue Knechte, die schon unter seinem Vater auf Lulinn gearbeitet hatten. »Das hast du also getrieben, wenn du angeblich mit dem jungen Stein ausgeritten bist!«, schrie er. »Wie weit seid ihr gekommen? Bis zur nächsten Scheune? Oh Gott, in meinem Heu!«
Laetitia sah ein, dass alles Geschrei nichts nutzte. Sie verurteilte Elsas Verhalten nicht; die beiden waren jung, da geschah so etwas, und sie selber hatte früher keineswegs bis in das baldachingeschmückte, handgeschnitzte, gewaltige Ehebett der Dombergs hinein Enthaltsamkeit geübt. So etwas kam in den besten Familien vor, musste aber natürlich sorgfältig vertuscht werden. »Das Kind darf nicht zur Welt kommen«, sagte sie bestimmt, »das siehst du ein, Liebling, nicht wahr?«
»Nein. Nein, das sehe ich überhaupt nicht ein. Es ist Manuels Kind, und ihm wird nichts geschehen.«
Laetitia rang die Hände, Ferdinand fluchte, aber nichts half. Da packte Laetitia eines Tages ihre Koffer und die von Elsa, nahm die Tochter an die Hand und erklärte: »Wir fahren nach Wien!«
»Nach Wien? Warum das?«
Laetitia hüllte sich während des ganzen Weges in geheimnisvolles Schweigen. Auf Elsas drängende Fragen antwortete sie schließlich nur: »Es ist besser, wenn du das Kind weit fort von daheim bekommst. Wir entgehen den Blicken und Fragen unserer Nachbarn.«
»Aber ich werde mit dem Kind zurückkehren. Was sagen wir dann?«
»Wir werden sehen«, entgegnete Laetitia ausweichend.
In Wien quartierten sie sich bei einer Freundin von Laetitia ein, die verschwiegen und absolut vertrauenswürdig sein sollte. Elsa blieben die Wochen in der dunklen, allzu üppig und beengend eingerichteten Wohnung ein Leben lang als Albtraum im Gedächtnis haften. Es war Mai, die Kirschbäume blühten, die Sonne strahlte, aber Elsa durfte kaum einen Fuß auf die Straße setzen, weil Laetitias Freundin zwar verschwiegen, aber auch überaus prüde war und nicht wollte, dass die Nachbarschaft etwas von dem heimlichen Besuch erfuhr. Elsa lief wie eine gefangene Katze in ihrem Zimmer hin und her, dachte an Manuel und hoffte zu sterben.
Sie brachte ihr Kind, einen Sohn, beinahe vier Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt, in einem Krankenhaus, das den prosaischen Namen Landesgebäranstalt trug und adeligen, ledigen jungen Damen die Gelegenheit gab, »unter der Maske« zu entbinden, was bedeutete, ihr Kind zu gebären, ohne dem Arzt oder einer der Schwestern Namen, Alter oder irgendetwas über die eigene Herkunft sagen zu müssen. Es schockierte Elsa, als sie bei ihrer Entlassung ein Papier unterschrieb, auf dem sie lediglich als »Nummer 33 des Jahres 1885« aufgeführt war. Sie ging ohne ihren Sohn zu Laetitias Freundin zurück, weil der Arzt ihr gesagt hatte, das Kind sei kränklich und müsse noch einige Wochen in seiner Obhut bleiben. Laetitia sagte, sie könnten die großzügige Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen und müssten nach Insterburg zurückfahren.
»Aber ich kann nicht ohne mein Kind gehen«, widersprach Elsa.
Laetitia überlegte. »Der Kleine muss noch wochenlang hierbleiben. Ich weiß etwas, Liebes. Wir beide fahren heim, und wir laden unsere liebe Gastgeberin ein, in etwa fünf oder sechs Wochen nachzukommen. Wir können uns für ihre Güte revanchieren, und sie kann bei dieser Gelegenheit gleich deinen Sohn mitbringen. Bis dahin kann er sich erholen.«
Elsa, vom Kummer um Manuel und durch die lange Gefangenschaft zermürbt, willigte ein. Sie reiste mit ihrer Mutter zurück nach Ostpreußen, brach beim Anblick von Lulinn wegen zahlloser Erinnerungen an einen vergangenen Sommer in Tränen aus, zog sich in die Einsamkeit ihres kleinen, freundlichen Zimmers zurück und wartete auf ihr Kind. Die Wochen vergingen, sie hörte weder etwas von der Freundin noch von dem Kind.
Schließlich konnte Laetitia Elsa nicht mehr vertrösten. Von der Tochter in die Enge getrieben, gab sie zu, was der eigentliche Sinn der Landesgebäranstalt für ledige Mütter war: Nicht nur, dass die Damen dort unerkannt und im Geheimen entbinden konnten, die Last um das unerwünschte Neugeborene wurde ihnen gleich ganz und gar abgenommen, indem die Stadt Wien die Säuglinge für ein reichliches Geld, das die Familie der Mutter zu zahlen hatte, übernahm.
Elsa begriff nicht sofort: »Was?«, fragte sie ungläubig.
Laetitia nickte begütigend. »Die Stadt sorgt für das Kind. Du brauchst dich um nichts mehr zu kümmern.«
»Die Stadt? Was heißt das, die Stadt?«
»Es gibt dort Pflegestellen, die …«
»Pflegestellen? Du meinst Waisenhäuser? Mutter, wie konntest du …«
»Deinem Kind geht es gut, Elsa, da kannst du beruhigt sein. Dein Vater hat viel Geld bezahlt, damit es …«
Elsa sah ihre Mutter fassungslos an. »Du hast mein Kind verkauft … an eine Stadt! Du hast …«
Laetitia vernahm den schrillen Ton in Elsas Stimme. Gleich würde sie anfangen zu schreien. Sie stand auf und schloss das Fenster. »Nicht verkauft, Elsa. Wir haben es in Pflege gegeben und viel Geld bezahlt, damit es in gesicherten Verhältnissen aufwächst. Viele junge Frauen in deiner Lage tun das.«
Vor Elsas Augen flimmerte es. »Das kann nicht wahr sein«, flüsterte sie, »das tust du nicht. So etwas kannst du nicht tun!«
»Ich habe es für dich getan. Damit du frei bist. Lieber Himmel, Elsa, ich habe die Moralisten nicht erfunden, aber es gibt sie, und wir müssen uns mit ihnen arrangieren. Du bist zu jung, um für einen unbedachten Schritt ein Leben lang bezahlen zu müssen. Jetzt steht dir wieder alles offen. Du kannst heiraten, und du wirst wieder Kinder haben.«
Elsa, die mit glasigen Augen, ohne etwas zu verstehen, gelauscht hatte, öffnete den Mund zum Schrei. Laetitia kam ihr zuvor.
»Die Angelegenheit ist vorüber«, sagte sie scharf, »vergiss Manuel und vergiss das Kind. Es kommt eine Zeit, da bist du mir dankbar!«
Elsa dachte nicht daran, dankbar zu sein. Sie weigerte sich, ihr Zimmer zu verlassen, hörte auf zu essen und blieb schließlich nur noch im Bett. Ferdinand ließ die schönsten Delikatessen aus Königsberg kommen, aber selbst die verschmähte sie.
Ihre Geschwister, denen niemand die Wahrheit gesagt hatte, die aber ahnten, worum es ging, versuchten alles, um sie aufzumuntern, doch Elsa blieb teilnahmslos.
»Was sollen wir denn tun?«, fragte Laetitia verzweifelt.
Elsa schlug die Augen auf, die übergroß waren in dem mageren Gesicht und in tiefen Höhlen lagen. »Ich will mein Kind«, sagte sie.
Laetitia begriff, dass ihre Tochter entschlossen war zu sterben, wenn ihr Wunsch nicht erfüllt würde. Sie packte zum zweiten Mal ihre Koffer und reiste nach Wien, um Nachforschungen über ihren Enkel anzustellen. Was sie herausbekam, war niederschmetternd: Elsas Sohn war in einem Waisenhaus während einer Keuchhustenepidemie gestorben.
Elsa weinte nicht, als sie es erfuhr. Sie stand mühsam auf, trank ein paar Schlucke Milch und aß etwas Brot. Vier Tage lang sprach sie kein Wort, aber sie aß und aß, so lange, bis sie etwas von ihren alten Kräften wiedergefunden hatte. Dann verließ sie Lulinn, mit zwei Reisetaschen und der festen Absicht, nie wieder dorthin zurückzukehren. Zwei Jahre lang hörte die Familie nichts von ihr. Dann stand sie eines Tages vor der Tür; mit ihrem Mann, dem jungen Berliner Arzt Dr. Rudolf Degnelly, und ihrem kleinen Sohn Johannes auf dem Arm. Sie war viel älter geworden, ihr Gesicht trug den melancholischen Ausdruck, den es nie wieder verlieren sollte, wenigstens aber schien sie nicht mehr so todessehnsüchtig wie einst.
»Weiß dein Mann, was geschehen ist?«, fragte Laetitia.
Elsa nickte. »Er weiß alles. Aber sonst soll es nie jemand erfahren. Auch nicht meine Kinder.«
Elsa kam von da an jedes Jahr nach Ostpreußen, in den Sommermonaten, in denen sich auch ihre Geschwister dort trafen. Sie schien diese Aufenthalte nicht zu genießen, hielt aber eisern an ihnen fest.
»Ihre Wurzeln sind hier«, sagte Ferdinand, »das kann sie nicht vergessen.«
Er hatte damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Laetitia, die beobachtete, wie sich Elsa mit einer trotzigen Sehnsucht ihrer Schwermut hingab, begriff, dass auch böse Erinnerungen einen Menschen an einen Ort fesseln können.
Heute, an diesem Abend, war es das erste Mal seither, dass Elsa weinte. Ihr krampfhaftes Schluchzen dauerte jedoch nur einige Minuten. Dann richtete sie sich kerzengerade auf, ergriff Laetitias Taschentuch und trocknete sich energisch die Augen. »Entschuldige bitte«, sagte sie, »es wird nicht wieder vorkommen.«
Ferdinand sah sie erleichtert an. Mit weinenden Frauen wusste er nichts anzufangen. Ihm war klar, dass er einen Fehler gemacht hatte, aber solange er lebte, hatte er sich für nichts entschuldigt, und er tat es auch jetzt nicht. Eine ungemütliche Stille senkte sich über den Raum, doch dann wurde plötzlich die Tür aufgerissen, und von einem Augenblick zum anderen hallten die Wände wider von einem Dutzend lebhaft durcheinanderschwirrender Stimmen. Victor stolzierte wie ein Gockel herein, gefolgt von seiner sauertöpfischen vierzehnjährigen Tochter Modeste und der grämlich dreinblickenden Gertrud, die sich unpassenderweise in weiße Spitze gehüllt hatte und wie eine überalterte Braut aussah. Belle sang ein zweideutiges Liebeslied vor sich hin, was allseits ein leichtes Stirnrunzeln hervorrief, und ihre Tochter Nicola hielt einen großen, leuchtend bunten Wiesenblumenstrauß in den Händen, den sie mit einer anmutigen Bewegung Laetitia in die Arme warf, ehe sie ihrem Großvater auf den Schoß kletterte und ihn auf die Nase küsste. Leo, im maßgeschneiderten Anzug mit elfenbeinfarbenem Seidenhemd (beides bestimmt noch nicht bezahlt, dachte Elsa), schwenkte einen Umschlag. »Ein Telegramm aus Berlin!«, rief er. »Für die holde Elsa!«
»Von Rudolf?«
Leo schüttelte den Kopf. »Nein. Von einem anderen Mann. Elsa, wie viele Eisen hast du eigentlich im Feuer?«
Laetitia und Belle lachten, Gertrud wurde rot. »Es ist geschmacklos und unverschämt«, zischte sie Victor zu.
Elsa ergriff das Telegramm. »Von Johannes. Was kann er wollen?«
Jadzia trat ein, in jeder Hand einen großen Krug mit eiskalter Buttermilch. Sie zündete die Kerzen auf dem Tisch an, brachte frisches Brot und eine Schüssel mit Quark. Alle setzten sich. Eine friedvolle Stimmung breitete sich aus, während draußen die Sonne hinter den Hügeln versank: Der Einzige, der hin und wieder poltern musste, war Ferdinand. »Christian und Jorias fehlen. Und Felicia auch. Sie kriegen nichts mehr, wenn sie so unpünktlich kommen.«
Niemand nahm ihn ernst. Zumindest Felicia, das wussten alle, könnte mitten in der Nacht erscheinen, sie würde von Ferdinand noch immer mit offenen Armen empfangen. Sie glich Laetitia in ihrer Jugend so völlig, dass Ferdinand noch einmal die gleichen feurigen Gefühle empfand wie ein halbes Jahrhundert zuvor.
»Was schreibt denn Johannes?«, erkundigte sich Laetitia. Elsa legte das Telegramm nachdenklich neben ihren Teller. »Er will seine Linda noch in diesem Monat heiraten.«
»Linda?«, fragte Ferdinand stirnrunzelnd. »Wer ist denn das? Welche Familie? Wo kommt sie her?«
»Du kennst sie, Vater. Sie war ein- oder zweimal in den Ferien hier. Sie ist die Schwester von Phillip Rath, dem besten Freund von Johannes. Ein wirklich entzückendes Mädchen, nur …« Alle hörten auf zu essen und sahen Elsa an.
»Was denn?«, fragte Belle.
Elsa lächelte hilflos. »Es geht so schnell. Ich verstehe nicht, warum er es so überstürzt …«
»Ach was, ich verstehe das sehr gut«, brummte Ferdinand, »er ist ein junger Mann und sehr verliebt, und er möchte dieses Mädchen haben, ehe sein Urlaub zu Ende ist und er in seine Kaserne am Ende der Welt zurückmuss!«
»So ist es«, sagte Laetitia dankbar. Ferdinand hatte seine Taktlosigkeit gegenüber Elsa von vorhin wiedergutgemacht, indem er eine harmlose Erklärung fand für etwas, das sie plötzlich alle mit einer dumpfen Bedrückung umfing. Jeder verstand, weshalb Johannes so überstürzt heiraten wollte, vielen jungen Leuten ging das jetzt so. Die Soldaten fürchteten nicht das Ende ihres Urlaubs, sie fürchteten den Beginn eines Krieges.
Am Anfang der Eichenallee von Lulinn zügelte Felicia ihr Pferd und sah sich nach den beiden jungen Männern um, die ihr, ebenfalls zu Pferd, gefolgt waren. Die Sonne ging gerade unter, und abendliche Schatten breiteten sich über die Wiesen. Felicia, die ein Reitkostüm aus blauem Tuch trug, warf den Kopf zurück. Ihre Haare hatten sich bei dem schnellen Ritt gelöst und fielen ihr wirr und lockig über die Schultern. Sie atmete schnell und strich ihrem Pferd über den nassen Hals.
»Weiß Gott, ich hab es schon wieder nicht geschafft«, sagte sie, »sie sitzen alle längst beim Abendessen, und Großvater wird fluchen und toben, weil ich kein einziges Mal pünktlich sein kann. Am liebsten würde ich euch beide bitten, mitzukommen und mich zu beschützen!«
Die beiden Männer lachten. Jeder in der Gegend wusste, dass Felicia den alten Domberg spielend leicht um den Finger wickeln konnte.
»Wir werden hier warten. Und wenn wir dich um Hilfe schreien hören, springen wir durchs Fenster«, sagte einer der beiden Begleiter. Sie waren Brüder, Benjamin und Albrecht Lavergne vom Nachbargut Skollna. Albrecht leistete gerade seinen Militärdienst ab, Benjamin war Student in Heidelberg. Die Sommermonate verbrachten sie daheim, und seit Maksim abgereist war, waren sie beinahe jeden Tag mit Felicia zusammen. Als Kinder hatten sie oft zusammen gespielt; später waren sie gemeinsam zu den Jagdgesellschaften in der Rominter Heide geritten, wenn sich dort im Herbst Kaiser und Adel trafen. Heute hatten sie einen Ausflug zum See gemacht und fühlten sich nun ebenso hungrig wie müde und glücklich.
Nachdem die jungen Leute sich verabschiedet und eine Verabredung für den nächsten Tag getroffen hatten, setzte Felicia ihren Weg allein fort. Wie immer, wenn sie die Allee heraufkam, fühlte sie sich von einem Glücksgefühl ergriffen, in dem sich Unruhe und Ärger auflösten. Schon als Kind war es so gewesen. Welchen Kummer sie auch mit sich herumtrug, er zerrann, wenn sie zwischen den Eichen entlangritt.
Sie zügelte ihr Pferd noch einmal, als sie neben sich auf der dunklen Wiese zwei Gestalten auftauchen sah. Es waren ihr jüngerer Bruder Christian und sein Freund Jorias, beide in grasbefleckten weißen Hemden und knöchellangen Hosen, unter denen nackte, schmutzige Füße hervorsahen. Die Haare über den sonnenverbrannten Gesichtern sträubten sich in alle Richtungen, die bloßen Arme trugen Spuren von Brombeerranken und Disteln.
»Hallo, Felicia!«, rief Christian. »Dass du hier entlangreitest, ist wohl ein sicheres Zeichen, dass wir zu spät sind.«
»Das stimmt. Und wo kommt ihr her? Ihr seht recht abenteuerlich aus.«
Die beiden blickten an sich hinunter. »Ach, wir waren überall«, erklärte Jorias, »zuletzt an einem Teich, den wir dieses Jahr das erste Mal entdeckt haben.« Er schwenkte das Fischernetz, das er über der Schulter trug. Felicia warf einen Blick in den leeren Eimer, den Christian gerade abstellte.
»Nun, das war ja von grandiosem Erfolg gekrönt«, meinte sie anzüglich. Sie wusste, dass sowohl Christian als auch Jorias gefangene Fische ins Wasser zurückwarfen, weil sie es nicht fertigbrachten, sie zu töten. Natürlich liebten sie es nicht, darüber zu sprechen. Sie murmelten irgendetwas Verlegenes und spielten mit den Zehen im Gras, das feucht wurde vom Abendtau.
Felicia betrachtete die beiden zärtlich. Sie sahen so jung aus, ohne ihre Kadettenuniformen. Fast noch wie die zwei kleinen Jungen, die früher auf Lulinn herumgestromert waren. Dass sie nicht mehr Indianer spielen, ist auch alles, dachte Felicia liebevoll, gar nicht vorzustellen, dass sie einmal richtig erwachsene Männer sein werden, die heiraten und Kinder haben. Für mich werden sie immer so bleiben, wie sie heute sind!
Langsam kamen sie auf das Herrenhaus zu. Felicia ließ ihr Pferd im Schritt trotten, damit die Jungen nebenhergehen konnten. Aus den Fenstern des Esszimmers fiel Kerzenschein in die Dunkelheit. Ein Knecht eilte herbei, um Felicias Pferd in den Stall zu bringen. Felicia strich sich über ihr Reitkostüm.
»Wir müssen uns wohl noch umziehen«, meinte sie, »Tante Gertrud fängt ja an zu schreien, wenn sie uns so sieht!«
»Auf ein paar Minuten kommt es jetzt nicht mehr an«, sagte Jorias, »Ärger kriegen wir sowieso.« Einträchtig betraten sie das Haus. Jadzia kam ihnen wie ein geheimnisvoller, kleiner Schatten entgegen. In der Hand hielt sie einen Strauß roter Rosen.
»Schöne Blumen«, flüsterte sie, »sind von Boten gebracht worden für Fräulein Felicia!«
»Was, für mich?«
»Aus Insterburg. Von fremdes Herr!« Jadzia hatte die beiliegende Karte offenbar schon eingehend studiert.
Felicia griff aufgeregt danach. »Oh … sicher von Maksim!«, entfuhr es ihr.
Christian lachte. »Der ist doch in Berlin.«
»Bote hat erzählt Nachricht«, fuhr Jadzia fort. Sie sah sich vorsichtig um. »Österreich hat gestellt Ultimatum an Serbien. Will Serbien unter Kontrolle. Oh … wird geben Krieg! Wird Deutschland gehen auf Seite von Österreich, wird Russland gehen auf Seite von Serbien. Großer Krieg!«
»Ach Unsinn, Jadzia«, sagte Felicia ärgerlich. Sie hatte gerade entdeckt, dass die Blumen nicht von Maksim kamen, sondern von einem Mann, den sie überhaupt nicht kannte. Alex Lombard. »Ich war kürzlich in Berlin Gast Ihres Bruders, Oberleutnant Degnelly«, schrieb er, »ich sah Ihr Bild in der Wohnung. Da ich geschäftlich in Insterburg war, wollte ich mich auf diese Weise bei Ihnen vorstellen.«
»Wie merkwürdig«, murmelte Felicia, »er kennt mich doch gar nicht!«
Jorias und Christian begannen eifrig über das österreichische Ultimatum zu diskutieren. »Serbien begibt sich nicht freiwillig unter österreichische Kontrolle«, rief Jorias, »nie!«
»Aber sie riskieren auch keinen Krieg.«
»Wenn sie tatsächlich mit russischer Hilfe rechnen können …«
Felicia hörte nicht zu. Sie stieg langsam die Treppe hinauf. Ihre Finger spielten mit den Rosen, deren tiefrote Blüten im Dämmerlicht fast schwarz aussahen. Rote Rosen … was hatte dieser fremde Mann in ihrem Bild gesehen, dass er ihr rote Rosen schickte?
Gut zu wissen, dass es andere Männer gibt als Maksim Marakow, dachte sie, und ihre Fantasie begann sich mit dem geheimnisvollen Alex Lombard intensiv zu beschäftigen. Ob ich ihn jemals kennenlernen werde?
Unter den Linden vor der Universität fand eine Demonstration statt. Unwillkürlich verhielt Maksim seinen Schritt. Es waren zehn Frauen, die dort Plakate trugen und Flugblätter verteilten, Studentinnen, wache, intelligente Gesichter. Es hatten sich mindestens fünfzig Passanten eingefunden, die das Geschehen beobachteten. In einiger Entfernung standen zwei Polizisten, die unschlüssig schienen, ob sie eingreifen sollten. Als sich Maksim durch die Menge drängte, konnte er von allen Seiten leise gemurmelte oder ungeniert laute Kommentare hören. »Suffragetten! So was gehört eingesperrt!« – »Was diese Weiber brauchen, sind Männer, die ihnen beibringen, dass sie Frauen sind!« – »Heiraten sollten sie und Kinder kriegen. Das würde ihnen die Flausen austreiben!« – »So was wie die nimmt doch kein Mann!«
Maksim stand jetzt in der vordersten Reihe. Eine Frau mit großen dunklen Augen trat auf ihn zu und reichte ihm ein Flugblatt. Unter dem missbilligenden Murren der Menge ergriff Maksim das Papier und überflog den Text. Die Verfasserin prangerte in scharfen Worten die Diskriminierungen an, denen Frauen noch immer an der Universität ausgesetzt waren. Offiziell wurden sie zwar zum Studium zugelassen, aber es gab Professoren, die sich weigerten, Frauen an ihren Seminaren teilnehmen zu lassen, oder die während ihrer Vorlesungen die Zuhörerinnen so bissig und anzüglich traktierten, bis diese freiwillig den Hörsaal verließen.
»Wir fordern gleiches Recht für Männer und Frauen an deutschen Hochschulen!«
»Richtig«, sagte Maksim, »es ist unbedingt richtig, sich dafür einzusetzen.«
»Ach nein«, entgegnete die dunkeläugige Frau ironisch, »wie großzügig von Ihnen!«
Maksim kam sich plötzlich idiotisch vor. »Verzeihen Sie. Was ich sagen wollte, war eigentlich nur …«
»… dass Sie ein Mann von liberaler Weltanschauung sind, ich verstehe.«
Maksims Augen tauchten wie hypnotisiert in ihre. Er senkte seine Stimme, schloss damit alle Menschen ringsum aus und machte sie beide inmitten der lauten Menge zu Komplizen.
»Ein Mann von sozialistischer Weltanschauung!«
»Oh …« Sie lächelte. Maksim begriff, was ihn an ihren Augen so faszinierte. Sie waren fiebernd, hungrig, fanatisch. Das waren die Augen, nach denen er, ohne es zu wissen, immer gesucht hatte. »Ich heiße Maksim Marakow«, sagte er unvermittelt und dachte gleich darauf: Sie empfindet mich wahrscheinlich als ziemlich plump und aufdringlich.
»Ich bin Maria Iwanowna Laskin«, entgegnete sie gelassen, »Mascha. Meine Freunde nennen mich Mascha.«
Ohne ein weiteres Wort drehte sie sich um, ließ Maksim stehen und reihte sich wieder in die Kette der Demonstrantinnen ein.
3
Felicia fing an, das Leben auf Lulinn äußerst ungemütlich zu finden. Jeder sprach nur noch über den Krieg. Ob sie morgens ins Esszimmer kam, wo Laetitia und Belle bei einer letzten Tasse Tee saßen, ob sie hinunter in die Küche ging, wo Jadzia zwischen Schüsseln und Pfannen hin und her eilte, ob sie sich ein Pferd aus dem Stall holte und die Knechte aufscheuchte, die Zigaretten rauchend auf einem Heuballen saßen, überall war man gerade dabei, über den Krieg zu reden. Serbien hatte sich in seiner Antwort an Österreich bereit erklärt, gegen die Feinde Österreichs im eigenen Land mit scharfen Maßnahmen vorzugehen, aber es beharrte auf seiner Souveränität. Österreich brach daraufhin die diplomatischen Beziehungen ab und ordnete eine Teilmobilmachung an. Was sollte Deutschland tun? Wie würden die Russen reagieren? Und was war mit England, mit Frankreich? Die Meinungen gingen hin und her. Ferdinand humpelte am Arm seines Sohnes Victor über den Hof und schimpfte ohne Unterlass. Seine Wut gründete sich auf die unausweichliche Erkenntnis, dass jeder künftige deutsche Krieg ohne ihn würde stattfinden müssen, womit ein Sieg zweifellos von vornherein ausgeschlossen war. Mit seinem Spazierstock zeichnete er gigantische Schlachtpläne in den Sand vor dem Hauptportal, ließ imaginäre Divisionen zu Dutzenden aufmarschieren, die eine russische Invasion in Ostpreußen zurückschlagen sollten. Es kam zu einer regelrechten Familienkrise, als der tollpatschigen Modeste eines Tages das Pferd durchging und mitten durch Großvaters mühevoll ausgearbeitete deutsche Rettung galoppierte. Sekundenschnell war alles zerstört. Ferdinand belegte Modeste mit Schimpfwörtern, die zu vulgär waren, als dass irgendjemand aus der Familie sie später hätte wiederholen können. Gertrud stellte sich vor ihre Tochter und verlangte eine Entschuldigung. Daraufhin brach Ferdinands jahrelang aufgestauter Zorn gegen sie los. Lautstark erklärte er ihr, wer sie war und was sie war, so erbarmungslos und so treffend, dass sich Gertrud nie wieder ganz davon erholte und die übrige Familie beinahe Mitleid mit ihr bekam.
»Bevor der Krieg anfängt, schlagen wir uns hier noch die Köpfe ein«, sagte Laetitia schließlich, »Schluss jetzt! Ich will kein böses Wort mehr hören!«
Jadzia heizte die Stimmung noch mehr an, als sie gerade in diesem Augenblick das Zimmer betrat und Tante Belle ein Telegramm übergab. Es kam von Belles Mann aus Petersburg. »Er möchte, dass Nicola und ich sofort nach Hause kommen«, sagte sie, nachdem sie es gelesen hatte, »er meint, man wisse nicht, wie lange noch Personenzüge fahren.« Sie sah sorgenvoll und bekümmert aus, was alle betroffen machte, denn Belle war sonst fast immer strahlender Laune. Ferdinand geriet wieder außer sich. »Ja, geh nur, geh!«, rief er. »Geh nur nach Petersburg, wo du dich offensichtlich zu Hause fühlst! Geh zu deinem Mann und freu dich darauf, dass er demnächst auf deutsche Soldaten schießen wird!«
Belle ging zur Tür. »Ich denke auch daran, dass reichsdeutsche Soldaten auf ihn schießen werden«, sagte sie, »und beides finde ich äußerst unerfreulich.«
»Ich werde ebenfalls abreisen«, verkündete Elsa, »ich muss natürlich in Berlin sein, wenn Johannes heiratet. Und ich …« Sie brach ab, doch jeder wusste, was sie hatte sagen wollen. Es hätte ihr das Herz gebrochen, ihn nicht mehr zu sehen, ehe der Krieg ausbrach. Christian und Jorias beschlossen nach kurzem Überlegen, sich anzuschließen. Sie hatten die Worte ihres Hauptmannes noch im Gedächtnis, und es schien ihnen, als herrsche jetzt die akute Kriegsgefahr, von der er gesprochen hatte.
Elsa bestritt natürlich, dass irgendetwas akut sei. »Ihr bleibt hier und genießt eure Ferien«, sagte sie, »in einem Krieg haben Kinder sowieso nichts zu suchen!«
Die beiden sahen sie empört an. »Mutter, das ist nicht dein Ernst!«, rief Christian. »Wir müssen …«
»Jeder hat an seine Pflicht zu denken«, knurrte Ferdinand, »die Soldaten gehören in ihre Kasernen, ganz gleich, wie alt sie sind. So, da gibt es nichts mehr zu reden!«
»Und wer denkt an mich?«, fragte Felicia. »Wer denkt an mich, wenn ihr alle abreist?«
»Du kommst natürlich mit.«
»Nein. Ich will nicht mit. Ich will bis zum Herbst hierbleiben. Berlin im Sommer ist heiß und stickig!«
»Du weißt ja nicht, was du redest«, mischte sich Leo ein, der heute wieder seinen lila Hut schräg auf dem Kopf trug und überhaupt nicht hierherzupassen schien, »du kennst die Sommernächte von Berlin nicht! Geh nur erst in tiefer, warmer Nacht Arm in Arm mit einem Mann unter den Linden entlang, atme den süßen Duft des Lebens und der Liebe, und …«
»Leo, ich lege nicht den geringsten Wert darauf, dass Felicia nachts mit einem Mann durch Berlin strolcht«, unterbrach ihn Elsa, »dann soll sie lieber hierbleiben. Aber merk dir eines, Felicia: Sowie sich die Lage zuspitzt, kommst du auf der Stelle nach Hause. Ich habe keine Lust, jedes meiner Kinder an einem anderen Ort zu wissen, wenn hier plötzlich die Hölle los ist!«
So war es auf Lulinn plötzlich still geworden; nur wenige Spuren noch zeugten von der Fröhlichkeit der letzten Wochen. Christians und Jorias’ Fischernetz lehnte einsam in einer Ecke, ein paar grellrote Schuhe von Tante Belle lagen im oberen Flur herum und brachten Jadzia zum Stolpern. Felicia fand eine Seidenfliege, die Leo gehörte, lila-grün gestreift und allzu auffallend. Leo, der sich auf dem Land immer langweilte, war ebenfalls abgereist; Felicia hatte ihn zum Bahnhof nach Insterburg gebracht und ihm nachgewinkt. Er hatte sich zum Fenster seines Abteils hinausgelehnt, sein Taschentuch geschwenkt und die rote Rose gelöst, die an seinem Revers befestigt war. In hohem Bogen warf er sie Felicia zu Füßen. »Auf Wiedersehen!«, rief er. »Auf Wiedersehen, liebste Felicia, vergiss deinen alten Onkel nicht!« Die Lokomotive pfiff schrill. Felicia hob die Rose aus dem Staub auf und verließ langsam den Bahnhof.
Von den jungen Leuten war nur Modeste auf Lulinn zurückgeblieben. Sie war so dickfellig und stumpf wie ihre Mutter Gertrud, hatte ewig fettige Haare und einen schlechten Teint. Sie kicherte viel und bildete sich ein, jeder Knecht auf Lulinn habe es auf sie abgesehen. »Wie sie mich mit ihren Blicken verfolgen«, flüsterte sie Felicia zu, »richtig peinlich, nicht? Soll ich dir ein Geheimnis anvertrauen?«
Felicia blickte sie mürrisch an. »Nein«, sagte sie, was Modeste nicht im Mindesten abschreckte. »Einer von den Stallburschen hat mich neulich abends geküsst!« Sie kicherte. »Aufregend, nicht? Hat dich schon mal ein Mann geküsst?« Die Frage kam etwas ängstlich, denn Modeste hoffte, hier einen Vorsprung zu haben. Sie fürchtete immer, neben ihrer Berliner Cousine als Landpomeranze zu wirken.
Felicia dachte an den Juniabend im Wald, an Maksims leise Stimme. »Ich mach dich nicht unglücklich. Und mich schon gar nicht!« Sie stand abrupt auf, würdigte Modeste keines Blickes mehr und ging davon.
Als Einziger war ihr Benjamin Lavergne von Skollna geblieben. Dessen Bruder war vorzeitig in seine Kaserne zurückgekehrt, und Benjamin rang mit sich, ob er sich überhaupt noch für das nächste Semester einschreiben sollte. »Wenn es Krieg gibt, kann ich doch nicht in Heidelberg im Hörsaal sitzen!«, sagte er zornig. »Nicht wenn alle anderen kämpfen!« Er warf sich auf den Rücken und starrte in den blauen Sommerhimmel. Er und Felicia hatten einen Ausflug zum See gemacht und dort Federball gespielt. Nun lagen sie müde im Gras. Felicia hatte Schuhe und Strümpfe ausgezogen, ihren Hut an einen Ast gehängt. Gelangweilt zerrieb sie eine Kamillenblüte zwischen den Fingern. »Jetzt fang nicht schon wieder damit an«, sagte sie, »es ist ja noch gar nicht raus, ob es Krieg gibt. Ihr Männer könnt es wohl gar nicht erwarten, in die Gewehre der anderen hineinzulaufen!«
»Das verstehst du nicht, Felicia. Wenn die anderen an der Front sind, kann ich nicht hinter meinen Lehrbüchern sitzen!«
»Doch, kannst du. Und jetzt hör auf mit dem Gerede, oder ich werf dich ins Wasser, damit du wieder einen klaren Kopf bekommst. Was meinst du denn«, sie sah zu ihm hin und lächelte, »was meinst du denn, was aus uns Mädchen werden soll, wenn ihr Männer euch alle auf und davon macht? Das Leben wird ja sterbenslangweilig!«
Benjamin richtete sich auf. Sein Gesicht nahm einen gespannten Ausdruck an. »Meinst du das wirklich so?«, fragte er.
Felicia pflückte eine leuchtend rote Mohnblume und reichte sie ihm. »Natürlich«, sagte sie, »ich wäre untröstlich, wenn du mich auch noch im Stich ließest. Dann könnte ich wirklich gleich nach Berlin zurückfahren.«
»Felicia …« Er griff nach ihrer Hand.