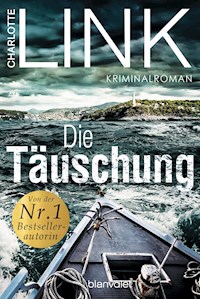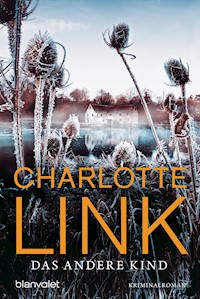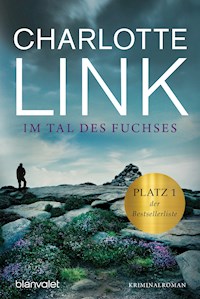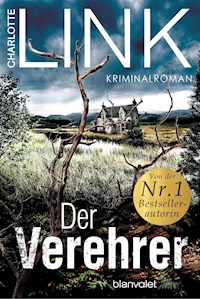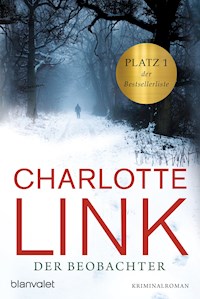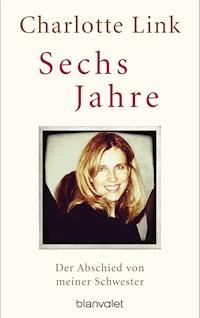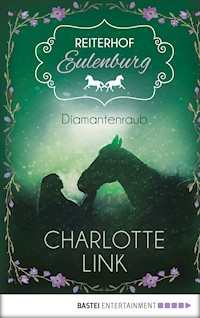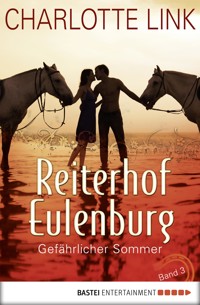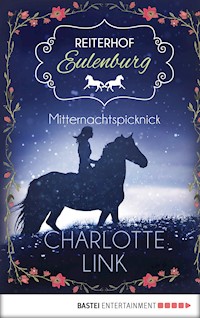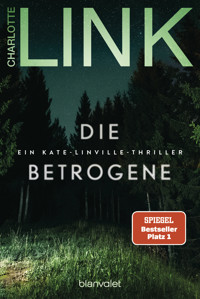10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vier grausame Morde. Drei Freunde mit einem dunklen Geheimnis. Eine furchtbare Wahrheit drängt ans Licht …
Stanbury House, Yorkshire: Als Jessica nach einem Spaziergang zum Ferienhaus zurückkehrt, fällt ihr sofort die ungewöhnliche Stille auf, die über dem Anwesen liegt. Wie in einem bösen Traum entdeckt sie im Garten und im Haus ihre Freunde und ihren Mann Alexander – ermordet. Eine der wenigen Überlebenden ist Evelin, Tims Ehefrau, die traumatisiert im Badezimmer kauert.
Die Polizei verdächtigt einen Mann, der auf geheimnisvolle Weise mit den Opfern in Verbindung zu stehen scheint. Während Jessica all die Geheimnisse und Widersprüche zu ergründen versucht, bemerkt sie nicht die Gefahr, in der sie plötzlich schwebt …
Millionen Fans sind von den fesselnden Spannungsromanen Charlotte Links begeistert. Psychologisch komplexe Figuren, dunkle Geheimnisse und raffiniert komponierte Kriminalfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 866
Veröffentlichungsjahr: 2011
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Stanbury House, Yorkshire: Als Jessica nach einem Spaziergang zum Ferienhaus zurückkehrt, fällt ihr sofort die ungewöhnliche Stille auf, die über dem Anwesen liegt. Wie in einem bösen Traum entdeckt sie im Garten und im Haus ihre Freunde Patricia und Leon, Tim und auch ihren Mann Alexander – ermordet. Die einzige Überlebende ist Evelin, Tims Ehefrau, die traumatisiert im Keller kauert.
Die Polizei verdächtigt einen Mann, der auf geheimnisvolle Weise mit den Opfern in Verbindung zu stehen scheint. Während Jessica all die Geheimnisse und Widersprüche zu ergründen versucht, bemerkt sie nicht die Gefahr, in der sie plötzlich schwebt. Viel zu spät erst begreift sie die furchtbare Wahrheit, die sich hinter dem jahrelangen Schweigen von Stanbury verbirgt …
Autorin
Charlotte Link, geboren in Frankfurt/Main, ist die erfolgreichste deutsche Autorin der Gegenwart. Ihre Kriminalromane sind internationale Bestseller und erobern auf Anhieb die SPIEGEL-Bestsellerliste. Allein in Deutschland wurden bislang über 32 Millionen Bücher von Charlotte Link verkauft; ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt. Charlotte Link lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Frankfurt/Main.
Weitere Informationen unter: www.charlotte-link.de
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Charlotte Link
Am Ende des Schweigens
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Ausgabe 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2003 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotive: Steve Stenson/Arcangel Images; www.buerosued.de
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-05193-8V009
www.blanvalet.de
www.penguinrandomhouse.de
ERSTER TEIL
Eine eigenartige Stille lag über Stanbury.
Eine große und umfassende Stille, so als habe die Welt aufgehört zu atmen.
Wahrscheinlich, dachte sie, sind alle weggegangen. Zum Einkaufen vielleicht.
Obwohl das seltsam war, denn niemand hatte am Morgen etwas davon gesagt, und für gewöhnlich wurden derlei Vorhaben besprochen. So wie einfach alles zwischen ihnen immer besprochen wurde. Außer den Dingen, die das Gerüst zum Einsturz bringen könnten. Aber dazu zählte nicht, wenn jemand einkaufen ging.
Doch diese Stille reichte tiefer.
Sie überlegte, was so anders war, aber sie kam nicht darauf. Vielleicht lag das auch daran, dass sie so müde war. Die Ereignisse der letzten Tage, die Schwangerschaftsübelkeit, die sie immer wieder befiel, die ungewöhnliche Wärme. Sie konnte sich nicht erinnern, dass je ein April so anhaltend warm gewesen war. Gerade hatte es so ausgesehen, als werde es ein wenig kühler, aber nun kehrte die drückende Schwüle schon wieder zurück.
Sie war weiter gelaufen, als sie es vorgehabt hatte, fast um das ganze Anwesen herum, durch das kleine Waldstück im Westen und über die Hügel im Süden. Erst jetzt merkte sie, wie stark sie schwitzte, dass ihr Gesicht nass war und ihre Haare im Nacken klebten, dass ihr Atem keuchend ging. Barney, ihr junger Hund, schoss wie ein Gummiball vor ihr her und war so munter, als sei er noch keine fünf Minuten an diesem Tag gelaufen. Normalerweise hatte auch sie eine gute Kondition, aber sie hatte schlecht geschlafen in der Nacht, und in den vergangenen Wochen hatte sie sich häufig übergeben. Jetzt, gegen Ende des dritten Monats, schien es besser zu werden, aber sie fühlte sich sehr geschwächt.
Sie war auch einfach zu warm angezogen. Ihre Jacke hatte sie sich schon um die Hüften gebunden, vorhin, als sie über die hoch gelegenen Wiesen gestapft war. Sie hatte sich einige Male dabei ertappt, wie sie sich vorsichtig umschaute. Sie hatte ihn mehrfach getroffen während ihrer langen, einsamen Spaziergänge. Als habe er auf sie gewartet, weil er sicher sein konnte, dass sie käme. Er hatte in ihr eine Verbündete gewittert, und vielleicht lag er damit gar nicht so falsch. Was natürlich bedeutete, dass sie gegen das oberste Gebot der Gruppe verstieß, aber seit einigen Tagen fragte sie sich ohnehin, ob es die Gruppe für sie noch gab, oder besser: ob sie noch dazugehören wollte.
Sie passierte das hohe schmiedeeiserne Tor, das zur Auffahrt des Anwesens führte. Wie so häufig stand es offen; da die Mauer, die den Besitz umschloss, über weite Strecken zerbröckelt oder gar nicht mehr vorhanden war, machte es ohnehin keinen Sinn, hier pingelig zu sein.
Sie sah sich hoffnungsvoll um: Falls sie alle weggefahren waren, kam vielleicht jetzt jemand zurück und konnte sie die Auffahrt entlang bis zum Haus mitnehmen. Der Weg schlängelte sich über fast einen Kilometer und stieg stetig ganz leicht an. Noch bis vor einem Jahr hatten rechts und links viele Bäume gestanden und Schatten gespendet, aber einige waren von einer Krankheit befallen worden, und man hatte sie fällen lassen müssen. Der Weg hatte dadurch viel von seinem Charme verloren, die Baumstümpfe sahen sehr traurig aus, und die Wildnis dahinter, die stets eine romantische Stimmung vermittelt hatte, wirkte auf einmal verwahrlost.
Es gibt schon eine Menge Zerfall hier, dachte sie.
Weit und breit ließ niemand sich blicken, und nachdem sie noch einmal kurz innegehalten und tief durchgeatmet hatte, machte sie sich daran, die letzte Etappe zu bewältigen. Der Baumwollpullover, den sie trug, klebte an ihrem Rücken, und ihre heißen Füße in den knöchelhohen Turnschuhen fühlten sich dick geschwollen an. Der Gedanke an eine Dusche und an ein Glas eiskalten Orangensaft bekam fast obsessiven Charakter.
Und dann würde sie für den Rest des Tages die Beine hochlegen und sich nicht mehr aus ihrem Liegestuhl fortbewegen.
Obwohl der Spaziergang schön gewesen war, wirklich schön. England im Frühling ließ einem das Herz aufgehen. Sie hatte den kleinen, zerrupften Wölkchen nachgeblickt, die über den lichtblauen Himmel trieben, und sie hatte den milden, verheißungsvollen Wind gerochen, in dem Blütenduft schwang, sie hatte ein paar Schafe gestreichelt, die frei über die Hochmoore liefen und sich ihr zutraulich näherten. Wilde Narzissen blühten in den Tälern und an den Hängen und gossen leuchtendes Gelb über die karge Landschaft. Die Vögel sangen, jubilierten, trällerten in allen Tönen …
Die Vögel!
Sie blieb stehen. Auf einmal wusste sie es. Wusste, woher diese unwirkliche Stille über Stanbury rührte.
Die Vögel waren verstummt. Nicht ein einziger erhob seine Stimme.
Sie konnte sich nicht erinnern, je ein so vollkommenes Schweigen erlebt zu haben.
Von einem Moment zum anderen erkaltete der Schweiß auf ihrer Haut, und sie zog fröstelnd die Schultern hoch. Was brachte Vögel zum Schweigen an einem so schönen, so sonnigen Tag? Etwas musste ihren Frieden gestört haben, so heftig und so nachhaltig, dass es keine Freude mehr gab, die sie heraussingen konnten. Eine Katze vielleicht, eine räuberische, mordlustige Katze, die einen von ihnen gefangen und getötet hatte, und seine Todesschreie waren in diese lastende, atemlose Stille gemündet.
Obwohl ihre Erschöpfung um nichts nachgelassen hatte, beschleunigte sie ihre Schritte. Sie verspürte ein erstes Seitenstechen, wäre gern gerannt wie Barney und hatte doch nicht die Kraft. Noch ein paar Monate, und sie würde unförmig angeschwollen sein und wahrscheinlich watscheln wie eine Ente. Ob sie danach wieder so schlank wäre wie früher? Unsinnigerweise ging ihr dieser Gedanke auf den letzten Metern zum Haus immer wieder durch den Kopf, obwohl sie eigentlich wusste, dass die Frage nach ihrer Figur sie im Augenblick gar nicht interessierte. Eher war es so, dass sie sie in den Vordergrund drängte, um nicht über etwas anderes nachdenken zu müssen. Darüber, weshalb sie fror, obwohl ihr heiß war, und warum sie ein Kribbeln auf der Kopfhaut spürte und warum sie auf einmal meinte, sich so beeilen zu müssen.
Darüber, warum der helle Frühlingstag plötzlich nicht mehr richtig hell war.
Sie konnte den Giebel des Hauses sehen, einen Teil der schönen Fassade im Tudorstil, die Reflexe des Sonnenlichts in den Bleiglasscheiben. In alter Gewohnheit zählte sie die Fenster unter dem Dach durch – das tat sie immer, wenn sie den Weg hinaufkam; das vierte von links gehörte zu ihrem Zimmer –, und undeutlich konnte sie dahinter den Strauß von Narzissen erkennen, den sie gestern Abend noch gepflückt und in einer Vase dorthin gestellt hatte.
Sie blieb stehen und lächelte.
Der Anblick der Blumen hatte ihr ihren Frieden zurückgebracht.
Dann sah sie Patricia, die vor dem Holztrog kniete, der mitten in dem gepflasterten Hof stand. Ein Trog, aus dem früher Schafe oder Kühe getrunken hatten und den jemand vor Jahren auf dem Gelände von Stanbury gefunden und angeschleppt hatte. Seitdem pflanzten sie Blumen hinein, Frühlingsblumen, Sommerblumen, Herbstblumen, und im Winter steckten Tannenzweige darin, um die sich eine Lichterkette schlang.
»Hallo«, sagte sie, »ist das nicht plötzlich unfassbar warm geworden?«
Patricia hatte sie offenbar nicht gehört, denn sie antwortete nicht und bewegte auch nicht den schmalen, sehr kindlich wirkenden Körper, der in ausgebeulten Jeans, einem blau-weiß karierten Hemd und Gummistiefeln steckte.
Barney knurrte leise und rührte sich auf einmal nicht mehr von der Stelle.
Sie trat ein paar Schritte näher.
Patricia kniete nicht vor dem hölzernen Trog, wie es zuerst den Anschein gehabt hatte, sondern hing über dem Rand, mit dem Gesicht nach unten in der frischen, feuchten Erde. Ihr linker Arm fiel seitlich herab und wirkte dabei auf eigenartige Weise verdreht. Der andere Arm lag neben ihrem Kopf, und die Finger ihrer Hand krallten sich in die Erde, als gebe es dort einen Halt oder irgendetwas, das festzuhalten sich lohnte.
Unter ihr, auf den Pflastersteinen, hatte sich eine Blutlache gebildet, was im Widerspruch zu der ersten unwillkürlichen Vermutung stand, Patricia könnte von einer plötzlichen Kreislaufschwäche oder Übelkeit überwältigt worden sein.
Etwas viel Schrecklicheres war geschehen. Etwas, das zu schrecklich war, es überhaupt zu Ende zu denken.
Sie wusste, dass sie sich ansehen musste, was man Patricia angetan hatte, und zog deren Körper vorsichtig von dem Trog weg, was nicht weiter schwierig war, da Patricia kaum größer war und wenig mehr wog als ein Teenager. Der Kopf kippte zur Seite, als hinge er nur noch an einem seidenen Faden. Alles war blutbesudelt, das Hemd, die langen Haare, der Trog; und was die Erde darin so sichtlich nass und schwer machte, war vermutlich ebenfalls Blut.
Jemand hatte Patricia die Kehle durchgeschnitten und sie dann achtlos dort liegen gelassen, wo sie gerade gearbeitet hatte, wo sie die Tannenzweige von Weihnachten entfernt und neue Erde aufgefüllt hatte, wo sie dabei gewesen war, frische Blumen zu pflanzen. Sie war erstickt, verblutet, hatte im Todeskampf die Finger in die Erde gegraben.
Die Luft roch nach Blut.
Vor Entsetzen hatten die Vögel aufgehört zu singen.
Nie wieder, dachte sie, würde die Stille dieses Moments Stanbury verlassen. Nie wieder würde ein lautes Wort angebracht sein oder gar ein Lachen oder das fröhliche Geschrei von Kindern …
Bei diesem Gedanken strich sie unwillkürlich über ihren Bauch und fragte sich, welchen Schaden es bei dem Baby anrichten würde, dass seine Mutter einen Schock erlitten hatte – denn sicher hatte sie das: Ein Schock war das Mindeste, was man erlitt, wenn man eine Freundin mit durchgeschnittener Kehle in einer ehemaligen Schaftränke fand –, und ob sie es nun womöglich verlor.
Erst dann überlegte sie, ob der, der das hier getan hatte, wohl verschwunden war oder ob er sich noch irgendwo in der Nähe aufhielt. Und bei diesem Gedanken konnte sie plötzlich die Beine nicht mehr bewegen. Sie stand wie gelähmt, und alles, was sie in dieser tödlichen Stille hörte, war ihr eigener angsterfüllter, keuchender Atem.
Samstag, 12. April – Donnerstag, 24. April
1
Phillip Bowen sah sich voll Erstaunen mit der Erkenntnis konfrontiert, dass er noch nie in seinem Leben wirklich gehasst hatte. Auch wenn er natürlich früher schon einige Male geglaubt hatte, Hass zu empfinden – auf Sheila zum Beispiel, wenn er sie trotz all ihrer Versprechungen und Beteuerungen wieder und wieder mit der Nadel im Arm erwischt hatte –, so begriff er nun, dass diese Emotionen etwas mit Wut, Schmerz, Zorn und Trauer zu tun gehabt haben mussten, nicht aber mit Hass.
Denn den fühlte er jetzt, als er vor dem Haus stand, an dem ihm nicht ein einziger Ziegelstein gehörte, und es war ein so starkes, machtvolles Gefühl, dass er es als vollkommen neu und erstmalig in seinem Leben erkannte.
Das Haus war von einfacher Bauweise, schlicht und schnörkellos, mit geraden, klaren Linien und genau so, wie er sich sein Traumhaus immer vorgestellt hätte, wäre er irgendwann einmal in der Situation gewesen, darüber nachzudenken. Es gab ein Stockwerk und ein Dachgeschoss mit kleinen Gauben und Bleiglasfenstern. Neben der schweren Haustür aus Eichenholz kletterte Efeu empor und verlor sich dann irgendwo im schmiedeeisernen Gitter eines kleinen Balkons im ersten Stock.
Ging man um das Haus herum, so gelangte man zu der eindrucksvollen Terrasse. Sie erstreckte sich über die gesamte Breite und war von einer Sandsteinbalustrade eingefasst, die sich nach vorn hin öffnete und einer großzügigen Treppe Raum bot. Vier lang gestreckte Stufen führten in den Garten hinunter, der eigentlich ein Park war: weitläufig, Wiesen und Wälder umschließend, eingefasst von einer sehr alten steinernen Mauer, die jedoch an so vielen Stellen zerbröckelt oder sogar ganz verschwunden war, dass sich die eigentliche Grundstücksgrenze über weite Strecken hin nicht feststellen ließ. Phillip hatte sich alles angesehen. Er hatte das ganze Areal umrundet, den ganzen Besitz, und er war fast vier Stunden unterwegs gewesen. Nun stieg er die Stufen zur Terrasse hinauf und versuchte sich vorzustellen, wie es sein musste, sie tagtäglich lässig hinauf- und hinunterzuspringen und zu wissen, dass, soweit das Auge reichte, einem das alles selber gehörte.
In einer schattigen Ecke der Veranda entdeckte er große Terrakottatöpfe, in denen verdorrte Blumen steckten, ein Hinweis darauf, dass das Anwesen als Feriensitz genutzt und zwischendurch nur in großen Abständen von einem Gärtner und einer Putzfrau gewartet wurde. Auch der Rasen unten im unmittelbar anschließenden Teil des Parks stand ziemlich hoch. Im Dorf hatte man Phillip Auskunft erteilt. Er hatte mit der Besitzerin des Gemischtwarenladens gesprochen, und diese hatte nur zu gern ihr Wissen weitergegeben.
»Meine Schwester putzt dort, und sie sieht alle drei Wochen nach dem Rechten. Und bevor die Herrschaften anreisen, lüftet sie gründlich und wischt Staub, und manchmal stellt sie auch frische Blumen in die Räume. Und dann gibt es noch Steve, den Gärtner. Also, eigentlich ist er kein Gärtner, er arbeitet in Leeds bei irgendeiner Firma … aber natürlich reicht das Geld nie, und so ist er immer dankbar, wenn er irgendwo etwas dazuverdienen kann. Na ja, und da mäht er eben den Rasen und kümmert sich ums Grundstück …« Phillip hatte rasch eingehakt, denn die Geschichte von Steve dem Gärtner interessierte ihn nicht besonders.
»Es sind doch Deutsche, denen das Anwesen gehört?«
»Ja, aber sie sind sehr nett.« Die Gemischtwarenhändlerin war, wie Phillip schätzte, etwa fünfundsechzig Jahre alt, musste den Krieg als Kind noch erlebt haben und mochte gewisse Vorbehalte gegenüber den Deutschen haben, wie aus ihrer Formulierung deutlich wurde. »Eigentlich kriegt man hier gar nicht so viel von ihnen mit. Sie kommen natürlich zum Einkaufen zu mir, aber sie suchen nicht gerade das Gespräch. Vielleicht liegt das auch an der Sprache. Es ist etwas anderes, ob man um Butter und Brot bittet oder ob man eine richtige Unterhaltung führt, nicht wahr? Nur die eine Frau hat manchmal mit mir geredet … Ich glaube, die wollte auch mal mit anderen Menschen sprechen, nicht immer nur mit den eigenen Leuten. War eine nette Person. Spanierin. Schwarzhaarig, sehr attraktiv. Aber die ist schon lange nicht mehr da … Steve hat mir irgendwann erzählt, dass ihr Mann sich von ihr hat scheiden lassen. Seit dem letzten Jahr ist er neu verheiratet. Mit einer sympathischen Frau, das muss man sagen.«
»Es sind drei Ehepaare, die hierherkommen?«
»Genau. Immer, in allen Ferien, und auch immer alle zusammen. Drei Mädchen sind noch dabei, aber zu wem die gehören … Die eine ist schon älter, ein großes, schönes Mädchen, vielleicht fünfzehn Jahre alt … schon ziemlich … na ja …« Sie hatte mit beiden Händen einen üppigen Busen beschrieben; Phillip schloss daraus, dass dieses Mädchen schon recht gut entwickelt war.
»Einmal«, hatte die Frau mit gesenkter Stimme hinzugefügt, »ist sie zum Dorffest im Sommer gekommen, im letzten Jahr war das, glaube ich. Spät in der Nacht hat Rob – mein Sohn, müssen Sie wissen – sie mit dem jungen Keith Mallory in seiner Scheune erwischt, also in der Scheune, die zu Robs Hof gehört, und er war ganz schön wütend. Ob etwas passiert ist, konnte er natürlich nicht wissen. Dem Vater von Keith Mallory hat er jedenfalls Bescheid gesagt, und dann wollte er auch zu dem Vater von dem Mädchen gehen, aber ich habe gemeint, das solle er besser nicht tun. Schließlich geht es uns nichts an, und man weiß ja nicht … es sind Ausländer, keine Ahnung, welchen Ärger sie dem armen Keith machen könnten! Keith hatte sich vorher auf dem Festplatz ganz schön an das Mädchen rangeschmissen, das haben jedenfalls einige gesagt, die die beiden gesehen haben. Und offensichtlich ist die Geschichte ja auch ohne Folgen geblieben, sonst hätten wir das bestimmt gehört.«
Phillip interessierte sich wenig für derlei Geschehnisse, aber es war klar, dass sein Gegenüber genau solche Pikanterien genoss.
»Kennen Sie eine der Frauen näher? Sie heißt Patricia Roth.« Er sprach den Namen deutsch aus, denn das tat sie vermutlich auch. »Sie ist die Eigentümerin des Anwesens.«
»Ja, so sagt man. Eine etwas verworrene Erbschaftsgeschichte war das. Der alte Kevin McGowan wollte das Anwesen ja seinem Sohn vererben, der in Deutschland lebt, aber der war nicht interessiert, und so ging alles direkt an die Enkelin … Das ist dann wohl die Frau, die Sie meinen. Patricia Roth«, sie überlegte, »ich glaube, ich weiß, welche das ist. So eine ganz Kleine, Zierliche. Meiner Ansicht nach ist sie die Mutter von den beiden anderen Mädchen. Die sind, schätze ich, zehn und zwölf Jahre alt. Niedliche Dinger. Sie begleitet sie manchmal zu Sullivans hinüber, das ist der Hof gleich am Dorfrand. Dort reiten sie auf den Ponys.«
Er dachte an dieses Gespräch, während er auf der Terrasse stand, an der Wand hochblickte und die Fenster zählte, ohne zu wissen, weshalb er das tat. Noch immer hatte er kein Bild von Patricia – dass sie sehr klein und zierlich sein sollte, brachte ihn vielleicht ein Stück weiter, verlieh ihr aber kein Gesicht, keine Stimme. Die Frau, von deren Existenz er bis vor fast zwei Jahren nichts gewusst hatte. Bis zu jenem Sommer, in dem seine Mutter plötzlich begonnen hatte zu erzählen …
In zwei Tagen, so hatte ihm seine Informantin im Gemischtwarenladen verraten, würden sie alle wieder eintreffen, für zwei volle Wochen Osterurlaub. Sie wusste das von ihrer Schwester, denn die war zum Putzen bestellt worden.
Sicher, überlegte er, während er sich umdrehte und in den Garten blickte, ist auch Steve der Gärtner angerufen worden.
Das Gras wucherte tatsächlich ziemlich hoch, es musste dringend gemäht werden. Der März und auch die ersten zwei Aprilwochen hatten viel Sonne und Regen in raschem Wechsel gebracht. Die Natur explodierte.
West Yorkshire. Brontë-Land. Er grinste. Unglaublich, dass es ihn hierher verschlagen hatte. Dass er vor einem Haus stand und es haben wollte. Er, der Londoner war mit Leib und Seele. Der sich nie hatte vorstellen können, irgendwo anders zu leben als dort, höchstens in einer anderen Metropole: New York oder Paris oder Madrid. In diesen drei Städten war er in bestimmten Lebensphasen zu Hause gewesen, hatte sich wohlgefühlt und sich dennoch nach London gesehnt, ein bisschen wenigstens, tief in seinem Herzen.
Und jetzt, mit einundvierzig Jahren, stand er in Stanbury, dem Dorf, das auf kaum einer Karte der Welt verzeichnet war, und verliebte sich in ein Haus und in die Vorstellung eines Lebensgefühls, von dem er nie gewusst hatte, dass es als Möglichkeit in ihm überhaupt existierte.
Er versuchte, durch eines der Fenster in das Innere des Hauses zu spähen, aber er konnte nichts erkennen; die schweren Vorhänge innen waren zugezogen. Tatsächlich spielte er bereits mit dem Gedanken, sich auf irgendeine Weise Zutritt zu verschaffen – vielleicht schloss eines der Kellerfenster nicht richtig, oder es gab eine Seitentür, deren Schloss leicht aufzubrechen war –, aber da hörte er, wie sich ein Auto über die Auffahrt näherte und auf der anderen Seite vor dem Hauptportal bremste. Rasch ging er um das Haus herum und sah eine ältliche Frau, die aus einem ziemlich klapprigen, kleinen Auto stieg. Sie trug eine geblümte Kittelschürze und hatte einen Korb mit undefinierbaren Utensilien in der Hand, und er vermutete, dass es sich um die Putzfrau handelte.
Er ging auf sie zu, sie erschrak sichtlich, musterte ihn dann misstrauisch.
»Ja?«, fragte sie, so als habe er etwas gesagt.
Phillip lächelte. Er wusste, dass er charmant und vertrauenerweckend wirken konnte.
»Wie gut, dass Sie kommen«, sagte er. »Sie machen hier sauber, nicht wahr? Ich habe schon mit Ihrer Schwester gesprochen …«
Ihre Züge entspannten sich. Der Umstand, dass er mit ihrer Schwester bekannt war, ließ ihn offenbar sofort unbedenklicher erscheinen.
»Ich bin Phillip Bowen«, stellte er sich vor und streckte ihr die Hand hin, »ein Verwandter von Patricia Roth.«
»Ach? Ich wusste gar nicht, dass Mrs. Roth Verwandte in England hat.« Sie ergriff seine Hand. »Ich bin Mrs. Collins. Ich wollte jetzt das Haus putzen.« Sie wies auf den Korb, in dem sich, wie Phillip jetzt erkannte, alle möglichen Reinigungsmittel befanden. »Die Herrschaften kommen ja übermorgen.«
»Ich bin wirklich froh, dass ich Sie hier gerade treffe. Patricia hat mich schon vor Wochen gebeten, nach der Heizung zu sehen … irgendetwas hat da wohl nicht gestimmt während des letzten Urlaubs, und im April kann es ja durchaus sein, dass man sie noch mal braucht …« Er lächelte wieder, jungenhaft und ein wenig schuldbewusst. Zu der langen Reihe von Versuchen, sich eine berufliche Existenz aufzubauen, gehörte auch der Besuch einer Schauspielschule, und obwohl er es natürlich auch dort nicht bis zu einem Abschluss geschafft hatte, war ihm von den Lehrern doch stets Talent bescheinigt worden – besonders was die Wandlungsfähigkeit seines Gesichtsausdrucks anging. »Aber, wie das so ist, ich habe es wieder einmal bis zum letzten Moment hinausgeschoben …«
Jetzt erwiderte sie sein Lächeln. »Ich kenne das. Man denkt immer, man hat noch so viel Zeit, und dann muss man sich plötzlich ganz furchtbar abhetzen. Sie sind Heizungsmechaniker?«
»Nein, nein. Aber ich verstehe ein bisschen was davon. Jedenfalls glaubt Patricia das!« Er wusste, dass er genau die schlichte Gesprächsebene getroffen hatte, die eine Frau wie Mrs. Collins mochte. »Das Problem ist nun … ich finde den Schlüssel nicht! Ich habe meine Taschen umgestülpt, ich habe mein Auto durchsucht – nichts!«
Mrs. Collins zog sich fast unmerklich wieder ein kleines Stück zurück. »Besitzen Sie denn einen Schlüssel?«
»Ja. Aber ich habe ihn noch nie benutzt. Ich dachte, er ist in meinem Wagen. Verflixt!« Er kratzte sich am Kopf. »Patricia wird ziemlich sauer auf mich sein! Wenn es plötzlich kalt wird, und die Heizung funktioniert nicht …«
»Sie möchten, dass ich Sie jetzt mit hineinnehme?«, folgerte Mrs. Collins, und er hätte fast Bravo! gesagt.
»Das wäre wirklich nett von Ihnen.«
»Ja … ich weiß nicht …«
»Sie sind doch die ganze Zeit im Haus. Ich glaube kaum, dass es mir gelingt, Wertgegenstände an Ihnen vorbeizutragen. Ich will nur schnell nach der Heizung sehen.«
Er sah ihrem Gesicht an, dass Bilder, die sie gesehen, und Geschichten, die sie gehört hatte, durch ihren Kopf zogen: von Männern, die sich das Vertrauen älterer Frauen erschlichen, ihnen dann einen Hammer auf den Kopf schlugen und sich mit allem aus dem Staub machten, was nicht niet- und nagelfest war. Er konnte es ihr nicht einmal verübeln. Die Zeitungen waren voll von Berichten dieser Art.
»Na ja«, sagte er, »ich will Sie nicht bedrängen. Sie kennen mich nicht, und sicher haben Sie recht, vorsichtig zu sein. Ich werde sehen …« Er ließ den Satz unvollendet und wandte sich zum Gehen.
Sie gab sich einen Ruck.
»Halt. Warten Sie! Man sollte nicht jedem Menschen misstrauen, oder?« Sie kramte ihren Schlüssel aus der Schürzentasche hervor. »Kommen Sie. Wir gehen hinein.«
Er war zuerst in den Keller gegangen und hatte sich laut klappernd im Heizungsraum zu schaffen gemacht, und nach einer Weile war er hinaufgekommen und hatte zu Mrs. Collins, die gerade im Esszimmer Staub wischte, gesagt: »Ich muss in allen Räumen die Heizkörper aufdrehen. Ist das in Ordnung?«
Sie schien inzwischen keinerlei Vorbehalte mehr gegen ihn zu haben. »Ja, machen Sie nur«, sagte sie.
Er stellte fest, dass man hier im Haus keineswegs in Luxus schwelgte. Es gab ein paar schöne, alte Möbel, die der alte Kevin McGowan vermutlich noch gekauft und mit dem ganzen Besitz seinen Erben vermacht hatte, aber hauptsächlich hatte man das Haus mit eher einfachen Dingen eingerichtet: mit gemütlichen, aber ganz sicher nicht teuren Sesseln und Sofas, vielen Kissen und Leselampen und roh gezimmerten Regalen, die voller Bücher standen. Er konnte sich vorstellen, wie sie alle an kalten Wintertagen oder nassen, stürmischen Frühlingsabenden um den Kamin im Wohnzimmer saßen, lasen, sich leise unterhielten, ein paar Weingläser um sich herum stehen hatten. Vielleicht spielten die Kinder zu ihren Füßen, und …
Halt! Er verzog das Gesicht zu einem zynischen Lächeln, als ihm aufging, wie sehr ihn der Kuschelnest-Charakter dieses alten Landhauses bereits verführt hatte, in Gedanken das Bild einer völlig idiotischen Idylle zu malen. Vielleicht sah die Wirklichkeit bei Weitem nicht so perfekt aus. Immerhin wusste er schon, dass eines der Mädchen nachts in fremden Scheunen herumknutschte, anstatt das Familienleben vor dem Kamin zu pflegen. Und möglicherweise waren auch die drei befreundeten Ehepaare gar nicht immer so glücklich miteinander. Das Haus war geräumig, aber dennoch saß man wochenlang aufeinander, und wenn es regnete, musste es noch schlimmer sein. Es gab nur eine Küche, ein Esszimmer, ein Wohnzimmer. Was bedeutete, dass die sechs Erwachsenen und die drei Kinder die Tagesabläufe im Wesentlichen gemeinsam gestalten mussten.
»Ich gehe nach oben«, sagte er zu Mrs. Collins, und diese nickte, während sie den Esstisch mit Politur bearbeitete.
Die Treppe führte von der großzügigen Eingangshalle nach oben. Es gab eine Galerie, von der mehrere Türen wegführten, und eine Art schmaler Hühnerleiter, über die man wohl in das Dachgeschoss gelangte.
Phillip öffnete aufs Geratewohl die Tür, die der Treppe am nächsten lag, und stand in einem äußerst romantisch eingerichteten Schlafzimmer mit Himmelbett, einer Menge Kerzen auf einem alten, sehr schön restaurierten Waschtisch und schweren Brokatvorhängen an den Fenstern. Im Schrank hingen einige exklusive Kostüme, die, wie er vermutete, eine schöne Stange Geld gekostet haben mussten. Kurz überlegte er, ob sie wohl Patricia gehörten, stellte aber rasch fest, dass dies nicht sein konnte. Patricia war ihm als besonders klein und zierlich beschrieben worden. Die Kostüme jedoch passten einer sehr üppigen, dicken Frau.
Ein kurzer Blick aus dem Fenster zeigte ihm, dass man von hier über den geschlängelten Weg schaute, der vom Haus weg in Richtung Dorf führte, zunächst an einer Wiese entlang, dann in einem verwilderten Wäldchen verschwindend, dessen wenige Bäume ein zartes Frühlingsgrün trugen.
Verdammt hübsches Schlafzimmer, dachte er, während er das Bad inspizierte, das durch eine diskrete Tapetentür erreichbar und äußerst modern und komfortabel war. Muss ein gutes Gefühl sein, hier am Morgen aufzuwachen, dem Vogelgezwitscher aus dem Park zu lauschen und dann nebenan eine schöne, warme Dusche zu nehmen.
Er sah sein eigenes Schlafzimmer vor sich, das diese Bezeichnung allerdings gar nicht verdiente, denn seine Wohnung in einer der schäbigsten Ecken Londons bestand nur aus einem einzigen Zimmer mit Kochnische, und wenn er schlafen wollte, musste er das Sofa aufklappen und die Bettwäsche aus einem Schrank hervorkramen. Ein richtiges Bad hatte er überhaupt nicht, nur einen abgetrennten Verschlag unter der Dachschräge mit einer Dusche darin. Es gab eine Toilette im Treppenhaus, die er sich mit fünf anderen Parteien teilte. Ein Scheißleben, und nicht die kleinste Aussicht auf eine Verbesserung.
Doch. Eine ganz kleine. Jetzt schon.
Im nächsten Schlafzimmer, das gleich nebenan lag, stolperte er geradezu über Patricia, denn sie strahlte ihn von mindestens zwei Dutzend Fotos an den Wänden und auf Tischen und Regalen an. Nie alleine, stets war sie mit der kompletten Familie abgebildet: eine auffallend kleine, zarte Frau, sehr blond und sehr attraktiv, meist in die Arme eines großen, gut aussehenden Mannes geschmiegt, und daneben zwei kleine Mädchen, so hübsch und so blond wie die Mutter, die fast immer auf Ponys saßen oder mit tapsigen Hundewelpen kuschelten. Phillip betrachtete jedes Bild eindringlich. Nach seinem Gefühl handelte es sich nicht um Schnappschüsse, sondern um sorgfältig arrangierte Szenen, die das Bild der perfekten, glücklichen Familie in einer Intensität transportierten, die unglaubwürdig wirkte.
Sie will etwas darstellen, dachte er, um jeden Preis. Seht her, wie glücklich wir sind! In welch heiler Welt wir leben! Der perfekte Mann. Die perfekte Frau. Die perfekten Kinder.
Wann stellt man etwas derart demonstrativ zur Schau?, überlegte er. Meist dann, wenn irgendetwas daran nicht stimmt.
Er studierte noch einmal die Züge der Frau. Sie musste Anfang dreißig sein und hatte sicher kein Facelifting hinter sich, aber ihr Lächeln zeigte die Starre, die operierten Gesichtern häufig zu eigen ist. Da war kein Strahlen in ihren Augen. Nur eiserner Wille. Harte Disziplin.
Sie würde keine leichte Gegnerin sein.
Er besichtigte das dritte Schlafzimmer, das ihm jedoch kaum Aufschluss gab über seine Bewohner. Keine Fotos, keine Kleider im Schrank. Ein einsamer weißer Morgenmantel hing an einem Garderobenständer. Irgendwie wirkte das Zimmer kahl und nüchtern – bis auf die roten Vorhänge an den Fenstern, die dem Raum ein wenig Farbe verliehen. Als habe jemand alles entfernt, was es vielleicht einmal wohnlich gemacht hatte, und es bislang versäumt, neue Gegenstände der Behaglichkeit herbeizuschaffen. Er musste an den Mann denken, der geschieden und noch nicht allzu lange wieder neu verheiratet war. Er hätte gewettet, dass es dieses Paar war, das in dem Zimmer wohnte.
Er schickte sich gerade an, die Hühnerleiter hinaufzuklettern, um auch noch einen Blick in die Unterkünfte der Kinder zu werfen, da klingelte unten in der Halle das Telefon.
Verdammt, dachte er.
Mrs. Collins begab sich eiligen Schrittes zu dem Apparat. Er konnte ihre Schuhe auf den Fliesen klappern hören.
»Ja, hallo?«, hörte er sie sagen, dann gleich darauf: »Oh, Mrs. Roth … wie geht es Ihnen?… Ja … ja …«
Sie lauschte eine ganze Weile in den Telefonhörer, sagte nur gelegentlich »Ja« oder »In Ordnung«. Die perfekte Patricia ratterte vermutlich eine ganze Salve von Anweisungen herunter, wie das Haus in Ordnung zu bringen war und wie sie alles vorzufinden wünschte. Dennoch würde Mrs. Collins irgendwann die Information loswerden, dass der hilfsbereite Cousin oder Onkel oder Neffe oder Was-auch-immer gerade dabei war, die Heizung zu reparieren. Und zu diesem Zeitpunkt sollte er möglichst schon das Weite gesucht haben.
Außerdem, fiel ihm ein, wartete Geraldine auf ihn. Seit über einer halben Stunde schon. Sie war zwar das Warten gewöhnt, aber er musste ihre Geduld nicht überstrapazieren.
So gleichmütig wie möglich ging er die Treppe hinunter. Mrs. Collins sah ein wenig wie ein Opferlamm aus. Phillip konnte nicht verstehen, was Patricia sagte, aber er konnte ihre Stimme aus dem Telefon hören. Sie sprach laut und klar und schnell.
Ich bin fertig, bedeutete er Mrs. Collins lautlos, ich gehe jetzt!
Natürlich konnte es die Schlampe nicht lassen. Vielleicht war sie auch einfach froh, eine Gelegenheit zu finden, Patricias Redeschwall zu unterbrechen.
»Mrs. Roth«, sagte sie hastig, »äh … Mrs. Roth, Ihr Verwandter ist übrigens gerade da. Wegen der Heizung. Ich habe ihn hereingelassen. Er hat schon alles repariert.«
Offenbar war Patricia sprachlos, denn für einen Moment blieb am anderen Ende der Leitung alles still.
Dann sagte sie irgendetwas, und Mrs. Collins starrte entsetzt zu Phillip hinüber. »Wie?«, fragte sie. »Sie haben keinen Verwandten in England?«
Phillip fand, dass das Gequake aus dem Hörer jetzt etwas hysterisch klang.
»Die Heizung ist gar nicht kaputt?«, wiederholte Mrs. Collins. In ihre Augen war ein nervöses Flackern getreten. Offenbar erwartete sie, niedergeschlagen, erstochen oder vergewaltigt zu werden. Dabei, dachte Phillip, der schon fast die Haustür erreicht hatte, müsste sie eigentlich merken, dass ich nur wegwill.
Sie ließ den Hörer sinken, aus dem noch immer Patricias Stimme drang. »Wer sind Sie?«, fragte sie.
Er hatte seine Hand auf dem Türgriff und lächelte Mrs. Collins freundlich an. »Ich bin verwandt mit Mrs. Roth«, antwortete er. »Sie weiß das bloß noch nicht.«
Er ließ sie mit ihrem Staunen allein und trat hinaus in den warmen Frühlingstag.
Er hatte sich ein erstes Bild gemacht.
2
RICARDAS TAGEBUCH
13. April. Morgen, am Montag, fahre ich zu Papa und reise dann mit ihm nach Stanbury. Niemand weiß, wie schrecklich ich ihn vermisse. Auch Mama nicht, denn sie würde es sicher ganz unglücklich machen, weil sie dann denken müsste, ich bin nicht gerne mit ihr zusammen. Als sie damals wegging von Papa, hat sie mich gefragt, bei wem ich lieber wohnen möchte, und sie hat so traurig und einsam ausgesehen, dass ich gesagt habe: Bei dir, Mama. Aber das hat nicht gestimmt. Innerlich habe ich die ganze Zeit über gerufen: Bei Papa, bei Papa, bei Papa! Aber das hat Mama natürlich nicht gehört, und ich habe ein so schlechtes Gewissen gehabt, dass ich sie umarmt und mich an sie geklammert habe. Und später hat sie mich dann nicht noch mal gefragt.
Es ist schon okay, mit Mama zu leben, aber Papa ist einfach etwas ganz Besonderes, und niemand auf der Welt kann ihn ersetzen. Ich würde alles dafür geben, wenn ich immer mit ihm zusammen sein könnte. Aber nur, wenn er nicht diese grässliche Frau geheiratet hätte.
Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie!
Sie ist echt so ätzend, das gibt es gar nicht! Jünger als Mama, aber ich finde sie nicht halb so hübsch! Beim Autofahren trägt sie eine Brille, und dann sieht sie aus wie eine Lehrerin. Sie ist Tierärztin! Papa hat damals versucht, mich damit einzuwickeln.
»Sie ist Tierärztin, Ricarda, stell dir das nur vor! Tierärztin wolltest du doch auch immer werden später! Jessica kann dir ganz viel darüber erzählen. Und sicher nimmt sie dich mal mit in ihre Praxis!«
Danke, verzichte! Papa merkt auch einfach nie, dass ich ein bisschen älter geworden bin! Mit neun oder zehn wollte ich Tierärztin werden. Alle kleinen Mädchen wollen das, auch Sophie und Diane jetzt. Typisch. Ich weiß gar nicht, was ich werden will. Am besten nichts. Einfach leben. Mich kennenlernen, die Welt kennenlernen. Und alles vergessen. Die ganze Scheiße mit meinen Eltern. Können es sich Leute nicht vorher überlegen, ob sie zusammenbleiben wollen oder nicht? Also, bevor sie unschuldige Kinder in die Welt setzen? Es müsste ein Gesetz geben, das es Menschen verbietet, sich scheiden zu lassen, wenn sie Kinder haben. Erst wenn die Kinder fertig sind mit der Schule, dann dürfen die Eltern sich trennen. Und vielleicht würden sich viele bis dahin sowieso wieder vertragen haben.
Als Mama mir sagte, dass Papa heiratet, habe ich gesagt, ich fahre nie wieder mit ihm nach Stanbury. Und ich will ihn überhaupt nie wiedersehen.
Mama hat mich nicht ernst genommen, was sie sowieso nie tut, aber ich habe es dann auch nicht geschafft. Papa nie mehr wiederzusehen, das würde so weh tun, das könnte ich nicht aushalten. Das Schlimme ist nur, dass J. immer dabei ist. Sie tut so scheißfreundlich und verständnisvoll, und wahrscheinlich hätte sie es gern, wenn ich ihr meine Probleme anvertrauen würde oder so, aber da kann sie ewig warten. Da würde ich noch eher Evelin was erzählen, oder Patricia. Na ja, Patricia vielleicht nicht. Die ist kalt wie ein toter Fisch und lächelt immer wie eine Zahnpastareklame. Aber Evelin ist echt nett. Ein bisschen doof, aber sie hat es auch sauschwer.
Am liebsten würde ich einfach mit Papa mal ganz allein Ferien machen. Ohne die anderen alle. Nur er und ich. Ich würde gerne mit ihm in einem Wohnmobil durch Kanada fahren. Das wäre mein Traum. Abends würden wir Lagerfeuer machen und Marshmallows rösten und die Sterne anschauen. Und am Tag würden wir vielleicht einen Grizzly sehen. Und Elche.
Ich werde das von jetzt an auf jeden Wunschzettel schreiben. An Weihnachten, an Ostern und an meinem Geburtstag. Ich werde nichts anderes darauf schreiben als: Ferien in Kanada mit Papa ganz alleine.
Irgendwann erfüllt er mir dann meinen Wunsch.
In diesen Osterferien werde ich jedenfalls wieder in Stanbury sein. Ich hasse es.
Ich hasse J.
Ich hasse mein Leben.
3
Am ersten Abend auf Stanbury aßen sie immer Spaghetti. Das war Tradition seit vielen Jahren, und an Traditionen wurde eisern festgehalten. Es war üblich, dass die drei Frauen gemeinsam die Nudeln kochten und dass dann nachher alle zusammen im Esszimmer aßen und zwei Flaschen Champagner dazu tranken. Am zweiten Abend kochten die Männer, dann wieder die Frauen und immer so fort. Nur gelegentlich besuchten sie zwischendurch ein Pub.
Jessica war erstaunt, dass sie niemanden in der Küche antraf, als sie hinunterkam. Nach der Ankunft hatte sich jeder in sein Zimmer verzogen, um die Koffer auszupacken, aber sie hatten vereinbart, um sieben Uhr mit dem Kochen zu beginnen. Nun war es Viertel nach sieben.
Egal, dachte Jessica, dann fange ich eben alleine an.
Sie vergewisserte sich, dass der Champagner kalt gestellt war, und ließ dann Wasser in einen großen Topf laufen. Durch das Fenster konnte sie in den Park hinaussehen, auf den eine sanfte goldfarbene Abendsonne schien. Gleich nach der Landung auf dem Leeds Bradford International Airport am Mittag hatten sie festgestellt, dass es ungewöhnlich warm war für April. Sie hatten ihre beiden Leihautos in Empfang genommen, und auf der Fahrt von Yeadon nach Stanbury hatten sich alle aus ihren Jacken und Mänteln geschält. Überall blühten wilde Narzissen, und einige Bäume trugen bereits helles, frisches Grün.
Jessica sah Leon und Tim nebeneinander über den Rasen gehen; sie schienen in ein sehr ernstes Gespräch vertieft zu sein, denn beide runzelten die Stirn und blickten alles andere als glücklich drein.
Leon war Patricias Mann, und seine Freunde taten meist so, als sei er der Besitzer von Stanbury, obwohl es Patricia war, die das Anwesen geerbt hatte. Leon hatte im Grunde nicht das Geringste zu sagen, und wenn man mit ihm etwas, das das Haus betraf, besprach, wusste man, dass er anschließend zu Patricia ging und ihre Anweisungen einholte.
Jessica schüttete Salz in das Wasser, stellte den Topf auf den Herd und zündete die Gasflamme an. Es waren ihre zweiten Osterferien in Stanbury, ihr sechster Aufenthalt insgesamt, denn sie waren dazwischen an Pfingsten, im Sommer, im Herbst und an Weihnachten hier gewesen. Die Handgriffe in der Küche waren ihr mittlerweile vertraut, und überhaupt hatte sie zweifellos Zuneigung zu dem Haus und zu der Landschaft gefasst. Dennoch dachte sie manchmal, dass es schön sein könnte, mit Alexander, ihrem Mann, anderswo hinzufahren. Mit ihm allein.
Was ironischerweise ein Wunsch war, den sie mit Alexanders fünfzehnjähriger Tochter teilte, und es war mit Sicherheit die einzige Gemeinsamkeit, die sie hatten. Jessica wusste, dass Ricarda sie abgrundtief hasste. Vorhin, im Schlafzimmer, als sie und Alexander ihre Koffer auspackten, hatte Alexander einen Zettel aus seiner Hosentasche gezogen und ihn Jessica gereicht.
»Hier. Lies mal. Ricardas Wunschzettel. Für Ostern.«
Es war ein gelochtes Blatt, lieblos aus einem Ringbuch herausgerissen. Ricarda hatte sich zudem keineswegs Mühe gegeben, einigermaßen schön und deutlich zu schreiben.
Mein Wunschzettel stand ganz oben gekritzelt, und darunter in riesigen, tief eingedrückten Buchstaben: Ferienreise mit Papa nach Kanada alleine. Das Wort alleine war dreimal dick unterstrichen.
»Und wenn du wirklich einmal mit ihr alleine verreist?«, hatte Jessica gefragt und ihm den Zettel zurückgegeben. »Vielleicht würde es euch guttun. Sie verkraftet doch ganz offensichtlich deine Scheidung von Elena nicht. Und schon überhaupt nicht den Umstand, dass du erneut geheiratet hast. Vielleicht solltest du ihr das Gefühl geben, dass ein Teil deines Herzens immer noch ihr, und nur ihr alleine, gehört.«
Alexander schüttelte den Kopf. »Ich will nicht wochenlang ohne dich sein.«
»Ich würde es verstehen. Und vielleicht würde es uns alle weiterbringen.«
»Da müsste sie sich erst anders benehmen. So wie sie sich dir gegenüber verhält, verdient sie einfach keine Belohnung. Wenn ich ihr jetzt diesen Wunsch erfülle, glaubt sie, sie kann sich alles erlauben. Ich kenne meine Tochter.«
Da Ricarda überdies bereits im Auto verkündet hatte, sie werde am gemeinsamen Abendessen keinesfalls teilnehmen, war Alexander nun auf den Dachboden hinaufgestiegen, um mit ihr zu reden. Jessica war gespannt, ob er etwas ausrichten würde.
Die Tür flog auf, und eine atemlose Evelin stürzte in die Küche. Sie hatte sich für das Abendessen umgezogen, wie immer etwas zu aufwendig. Das himmelblaue Seidenkleid, das figurumspielend lässig geschnitten war, hätte Jessica äußerstenfalls im Theater angezogen. Hier auf Stanbury trug sie fast ausschließlich Jeans und Sweatshirts.
»Ich bin ziemlich spät dran«, sagte Evelin und wirkte dabei nicht wie eine erwachsene Frau, sondern wie ein Schulmädchen, das sich für ein Versäumnis schämt, »es tut mir leid. Ich habe die Zeit vergessen …« Sie hatte hektische rote Flecken im Gesicht. »Wo ist Patricia?«
»Die hat bestimmt auch die Zeit vergessen«, meinte Jessica gleichmütig. »Keine Sorge. Es dauert sowieso eine Weile, bis das Wasser kocht.«
»Ich weiß überhaupt nicht, wo Tim steckt.«
Jessica deutete zum Fenster hinaus. »Er ist draußen mit Leon. Die beiden scheinen äußerst tiefschürfende Gespräche zu führen.«
Evelin setzte sich auf einen Stuhl. »Soll ich Tomaten schneiden?«
»In diesem Kleid solltest du das besser nicht tun. Außerdem … deine Hand!«
Evelins linke Hand war bandagiert, ein Unfall beim Tennis, wie sie den anderen morgens beim Aufbruch berichtet hatte. Evelin spielte regelmäßig Tennis und ging täglich ins Fitnessstudio, sie joggte und machte bei einem Aerobic-Kurs mit, aber sie war völlig unsportlich und ungeschickt und zog sich häufig Verletzungen zu. Kein Wunder, dachte Jessica oft, bei ihrer Figur!
Evelin war nicht einfach üppig, sie war fett, und sie schien ständig zuzunehmen. Ihre sportlichen Aktivitäten vermochten nicht den Umstand auszugleichen, dass sie sich praktisch von morgens bis abends Kalorien in Form von Torte, Schokolade und allzu vielen Gläsern Prosecco zuführte. Sie wirkte nicht glücklich, trotz des schönen Hauses, in dem sie wohnte, und der intakten Ehe, die sie führte. Sie übte keinen Beruf aus und hatte keine Kinder, und Tim, ihr Mann, war den ganzen Tag über in seiner psychotherapeutischen Praxis tätig, die sehr erfolgreich lief und ihm eine Menge Geld einbrachte. Evelin war viel allein. Sie strahlte Einsamkeit und Niedergeschlagenheit aus.
»Vor sechs Jahren«, hatte Patricia erzählt, »hat sie bei einer Fehlgeburt im sechsten Monat ihr Baby verloren, und seitdem scheint es mit einer erneuten Schwangerschaft nicht zu klappen. Ich glaube, das macht ihr schwer zu schaffen.«
»Was wirst du tun in diesen Ferien?«, fragte Evelin nun. »Wieder so viel laufen?«
Jessica hatte die Freunde von Anfang an mit ihrer Leidenschaft für endlos lange, einsame Spaziergänge verblüfft. Stets war sie mindestens zwei oder drei Stunden unterwegs, gleichgültig, ob es regnete oder die Sonne schien. Manchmal sahen die anderen sie den ganzen Tag nicht. Jessica wusste, dass Patricia deswegen schon genörgelt hatte; sie fand, Jessica grenze sich zu sehr ab und gehe zu oft ihrer eigenen Wege. Alexander hatte es ihr erzählt.
»Vielleicht solltest du sie oder Evelin einmal bitten, dich zu begleiten«, hatte er gemeint, »oder dich ihnen anschließen. Sie könnten sonst das Gefühl bekommen, du magst sie nicht besonders.«
»Ich kann Menschen mögen und muss trotzdem nicht rund um die Uhr mit ihnen zusammen sein. Patricia und Evelin stehen ständig am Rand einer Wiese und schauen Patricias Töchtern beim Reiten zu. Das ist einfach nichts für mich.«
»Ich denke ja auch nur, dass du es zwischendurch mal machen könntest. Um ein bisschen Gemeinsamkeit herzustellen.«
Jessica hatte ein paarmal versucht, seinem Wunsch zu entsprechen, aber sie hatte sich dabei fast zu Tode gelangweilt. Diane und Sophie waren auf ihren Ponys im Kreis herumgeritten, und Patricia hatte jede Bewegung ihrer Töchter kommentiert und jede Menge Anekdoten aus ihrer beider Leben erzählt. Was sie ohnehin meistens tat. Patricia kannte kein anderes Thema als ihre Familie. Ihre Kinder, ihr Mann. Ihr Mann, ihre Kinder. Gelegentlich ging es noch um Freunde ihrer Kinder oder Lehrer ihrer Kinder, und dann und wann um Prozesse ihres Mannes, der Anwalt war, und zwar – wenn man Patricia Glauben schenken wollte – einer der erfolgreichsten und bedeutendsten in ganz München. Patricias Welt war so heil, dass es ein normaler Mensch nicht aushalten konnte. Jessica misstraute diesem Ausmaß an Perfektion zutiefst, außerdem fand sie Patricias ständiges Geprahle mit ihren Kindern taktlos Evelin gegenüber, angesichts des Traumas, das diese erlitten hatte. Jessica hatte zunächst nicht verstanden, weshalb sich Evelin trotzdem so eng an Patricia anschloss, vermutete aber inzwischen, dass sie sich in Momenten des Zusammenseins mit der Freundin zu identifizieren suchte. Patricia schien für sie ein Vorbild, ein Ideal zu sein. Daher versuchte sie sich auch in all den Sportarten, die Patricia ausübte. Nur dass Patricia darin glänzte, während sich Evelin wie ein Tollpatsch benahm. Jessica betrachtete sie, wie sie da in ihrem figurumspielenden Sackkleid auf dem Küchenstuhl saß, so dick und so schwerfällig, und sie dachte: Sie ist die Unglücklichste von allen hier. Sie hat so traurige Augen, und niemand scheint jemals wirklich mit ihr zu sprechen.
Einem spontanen Gefühl folgend, wollte sie zu ihr gehen, sich neben sie setzen, ihr den Arm um die Schultern legen und sie fragen, was sie so sehr bedrückte, aber gerade in diesem Moment wurde die Küchentür aufgerissen, und Patricia kam herein. Und wie immer, wenn sie sich in einem Raum befand, schien sie ihn sofort zu besetzen und völlig auszufüllen – trotz ihrer Größe von knapp einem Meter sechzig und ihrer zerbrechlichen, kindlichen Figur. Ganz gleich, was sie tat, sie war stets ungemein intensiv, und es gab viele Menschen, die sie als ungeheuer erschöpfend empfanden.
»Ich bin zu spät«, sagte sie, »tut mir leid.« Ihre langen blonden Haare leuchteten im Licht der einfallenden Abendsonne. Sie trug einen eng anliegenden flaschengrünen Hausanzug, der sich perfekt eignete, darin zu kochen, der aber zugleich elegant genug war, um sie später beim Essen ebenfalls eine gute Figur abgeben zu lassen. Es handelte sich um eines jener Kleidungsstücke, bei denen sich Jessica oft fragte, wie es manchen Frauen gelang, sie aufzutreiben.
Patricia schwang sich auf den Küchentisch. Es war typisch für sie; nie würde sie sich, wie Evelin, einfach auf einen Stuhl plumpsen lassen. Immer lag eine besondere Energie, eine besondere Beweglichkeit in allem, was sie tat.
»Ich habe eben noch mit Mrs. Collins telefoniert. Sie ist wirklich die unfähigste Person, die ich je kennengelernt habe. Ich meine, wie kann sie einen wildfremden Mann hier im Haus umherstreifen lassen, nur weil er behauptet, er sei mit mir verwandt und müsse die Heizung reparieren? Sie hätte mich doch wenigstens anrufen und fragen müssen!«
Jessica seufzte leise. Patricia lamentierte seit Tagen über dieses Thema. Unmittelbar nach dem Ereignis, nachdem sie also mit Mrs. Collins gesprochen und von dem fremden Mann erfahren hatte, hatte sie bei den Freunden angerufen und ihnen alles erzählt. Auch auf dem Flug von München nach Leeds hatte sie ständig davon gesprochen. Sie regte sich entsetzlich auf, insbesondere auch darüber, dass ihr Mann die ganze Sache ziemlich gelassen nahm.
»Ich verstehe nicht, wie Leon so ruhig sein kann!«, hatte sie im Flugzeug ständig wiederholt. »Dieser Typ kann doch gefährlich sein. Ein Krimineller, ein Triebtäter … was weiß ich? Wir haben zwei kleine Töchter … o Gott, ich werde während dieser Ferien keine ruhige Minute haben!«
Auch jetzt konnte sie sich noch nicht beruhigen.
»Mrs. Collins sagt, er habe vertrauenerweckend ausgesehen. Ich weiß wirklich nicht, wie blöd ein Mensch sein kann. Als ob man danach gehen könnte, wie jemand aussieht! Was glaubt die Alte? Dass Verbrecher eine schwarze Augenklappe tragen und einen Dreitagebart? Wenn ich nur wüsste, was der Typ hier wollte!«
»Jedenfalls hat er ja offenbar nichts geklaut«, sagte Evelin. Diese Feststellung traf sie heute zum fünften oder sechsten Mal; allerdings, dachte Jessica, wäre es wohl ein Fehler, daraus auf mangelnde Intelligenz zu schließen. In dem Thema um den geheimnisvollen Fremden wiederholten sich alle ständig, denn sämtliche Mutmaßungen waren inzwischen ausgeschöpft, und es machte längst keinen Sinn mehr, noch länger über all das zu reden. Es war jedoch klar, dass Patricia nicht so bald aufgeben würde.
»Er hat spioniert«, sagte sie, »das steht für mich fest. Vielleicht hat er versucht, einen Weg zu finden, wie er nachts in das Haus einsteigen kann. Oder er hat sich im Keller ein Fenster geöffnet, um später hineinkommen zu können.«
»Das ließe sich ja überprüfen«, meinte Jessica.
»Was glaubst du wohl, was ich gleich nach unserer Ankunft getan habe? Ich bin in jedes verdammte Loch gekrochen und habe an jedem Fenster gerüttelt, habe die Verriegelung der Tür geprüft.« Patricia schüttelte sich. »Gott, ist das ein Staub da unten! Und ein Gerümpel. Da ist seit Generationen nicht ausgemistet worden.«
»Ich halte diese Idee für unlogisch«, sagte Jessica. »Das Haus steht seit Weihnachten leer. Es liegt vollkommen einsam. Und wenn jemand unter allen Umständen in ein Haus hineinwill, dann kommt er auch hinein. Also, warum sollte er warten, bis wir alle da sind? Das wäre doch dumm. Warum sollte er sich der Putzfrau zeigen und ihr seinen Namen nennen? Nachdem er drei Monate Zeit hatte, hier alles in Ruhe auszuräumen, falls er das gewollt hätte. Ganz abgesehen davon, dass es hier nicht viel zu holen gibt.«
»Das weiß er aber nicht. Die Vorhänge sind immer zu, wenn wir weg sind. Er kann nichts sehen von draußen.«
»Dann weiß er es spätestens jetzt. Offenbar hat er sich ja gründlich umgeschaut. Hier gibt es nichts, was das Risiko eines Einbruchs lohnt.«
»Vielleicht will er gar nichts stehlen«, beharrte Patricia, »vielleicht ist er ein Triebtäter. Irgendein perverser Typ, der hier eines Nachts ein Blutbad anrichten will!«
Evelin war blass geworden. »Sag doch nicht etwas so Schreckliches!«, rief sie. »Ich werde sonst kein Auge mehr zutun!«
Patricia musterte sie kühl. »Indem du die Möglichkeit negierst, wird deine Situation aber auch nicht sicherer.«
»Und indem du alles schwarzmalst …«
Jessica fürchtete, dass jeden Moment ein Streit ausbrechen würde, und mischte sich ein.
»Und wenn er wirklich ein Verwandter von dir ist?«, fragte sie ruhig.
Patricia starrte sie an. »Ich habe in England keine Verwandten.«
»Das weißt du doch nicht. Es kann ja auch ein Cousin dritten oder vierten Grades sein … oder ein Angeheirateter … was weiß ich! Dein Großvater war Engländer. Es muss also einen Familienzweig hier geben.«
»Mein Großvater hat seine Familie in Deutschland gegründet. Von seiner englischen Familie lebte niemand mehr, das hat mir mein Vater oft genug erzählt. Als er nach England zurückging, blieb er allein. Es kann also niemanden geben.«
»Vielleicht aber doch. Eben diesen Mann. Und er will womöglich nichts anderes als Kontakt mit dir aufnehmen.«
»Das ist aber eine merkwürdige Art, Kontakt aufzunehmen. Warum kommt er nicht her, stellt sich vor, wir trinken einen Tee zusammen, und das war es dann?«
»Vielleicht wollte er genau das. Er kam her, und wir waren noch nicht da. Zufällig kreuzte gerade Mrs. Collins auf. Er nutzte die Gelegenheit, einen Blick in dein Leben zu werfen. Womöglich platzt er fast vor Neugier auf seine deutsche … ja, vielleicht Cousine oder etwas Ähnliches!«
»Aber …«
»Es ist nicht die feine Art. Natürlich kann man so etwas nicht machen. Aber es ist eine Theorie, die weit entfernt ist von deiner Triebtätervariante.«
Patricia wirkte keineswegs überzeugt. »Na ja …«, meinte sie vage.
Jessica ging zum Kühlschrank, öffnete ihn und zog eine Flasche Prosecco heraus. »Kommt«, sagte sie, »wir trinken jetzt ein Glas zusammen. Ohne die Männer. Auf unseren Urlaub und darauf, dass Patricias Triebtäter in Wahrheit ein netter Mann ist, mit dem wir uns gut verstehen werden!«
Draußen verdämmerte der Tag. Eine friedliche Stille senkte sich über die Küche. Das Nudelwasser sprudelte. Jessica blickte hinaus. Leon und Tim kamen durch den Garten zurück.
Tims Mund war nur ein dünner Strich, so fest hatte er die Lippen zusammengepresst. Leon redete und gestikulierte.
Irgendetwas stimmt mit den beiden nicht, dachte Jessica. Sie war verwundert und beunruhigt: Zwischen den Freunden war sonst immer alles in Ordnung! Das war das Besondere an ihnen.
Eine Abweichung war undenkbar.
Ricarda erschien tatsächlich nicht zum gemeinsamen Abendessen. Allerdings hatte Alexander ohnehin nicht mit ihr sprechen können, da er sie nicht in ihrem Zimmer angetroffen und auch im ganzen übrigen Haus nicht gefunden hatte.
Er saß mit Grabesmiene am Tisch, während Patricia in ihrer erschöpfend intensiven Art auf ihn einredete.
»Das kannst du nicht durchgehen lassen! Ich meine, das Mädchen ist fünfzehn! Das ist ein äußerst gefährliches Alter. Vielleicht trifft sie sich mit irgendeinem Mann! Willst du, dass sie dich demnächst zum Großvater macht?«
»Ich bitte dich!«, sagte Alexander müde und strich sich mit der Hand über das Gesicht. »So weit ist sie nun wirklich noch nicht!«
»Woher willst du das wissen? Du weißt ja nicht einmal, wo sie sich herumtreibt. Und Einfluss hast du schon überhaupt nicht auf sie – wie auch, als geschiedener Vater. Von Elenas Erziehungsmethoden habe ich nie etwas gehalten, das weißt du. Sie hat Ricarda immer viel zu viel Freiheit gelassen, in erster Linie deshalb, damit sie selbst möglichst keine Arbeit mit dem Kind hat. Wenn ich mir überlege, wie ich mich für Diane und Sophie engagiere – das wäre für Madame natürlich nichts gewesen!«
Jessica wunderte sich oft, mit welcher Härte und Verachtung im Freundeskreis über Alexanders geschiedene Frau gesprochen wurde. Schließlich hatte sie jahrelang dazugehört, die Ferien in Stanbury geteilt, mit ihnen allen gelebt, geredet, gelacht oder vielleicht auch einmal ihr Herz ausgeschüttet. In dem Moment der Scheidung war sie offenbar zur Verfemten geworden. Jessica mischte sich ein, weil sie den Eindruck hatte, dass Alexander unter dem Maschinengewehrfeuer von Patricias Ausführungen wehrlos geworden war.
»Ich glaube, wir sollten nicht den Teufel an die Wand malen«, sagte sie. »Es ist ganz normal, dass sich ein Mädchen in Ricardas Alter von der Familie absetzt und eigene Wege geht. Bei mir war das genauso.«
»Bei meinen Töchtern wird das nicht so sein«, erklärte Patricia mit Bestimmtheit, und die Mädchen, denen, wie Jessica fand, schon heute ein außergewöhnliches Maß an Selbstgerechtigkeit anhaftete, lächelten zustimmend.
Leon brachte einen Trinkspruch auf die bevorstehenden Ferien aus, und alle prosteten einander zu. Es war zweifellos so, dass eine sehr warme Strömung von Freundschaft, Zusammengehörigkeit und Vertrauen durch den alten, holzgetäfelten Raum zu wehen schien. Jessica konnte verstehen, dass Menschen an einer fast familiären Struktur hingen, die über so viele Jahre gewachsen war. Sie betrachtete die drei Männer, die einander seit ihrer Kindheit verbunden waren. Alexander, Leon und Tim.
»Uns konntest du immer nur zusammen antreffen«, hatte Alexander ihr einmal erzählt, »eigentlich taten wir alles gemeinsam. Und wir sind froh, dass wir diese Freundschaft erhalten konnten, obwohl jeder von uns zwangsläufig in der Universität eigene Wege gehen musste.«
Jessica hatte Leon kurz vor dem Abendessen auf seine Auseinandersetzung mit Tim angesprochen.
»Hattet ihr Streit? Ich sah euch durch den Garten kommen, und …«
Leon hatte sie mit einem kurzen Lachen unterbrochen. »Um Gottes willen! Da hast du etwas missverstanden. Wir haben nicht gestritten. Tim hat mir erzählt, woran er gerade arbeitet, und ich habe sehr interessiert zugehört. Vielleicht hast du unsere Konzentration als Verstimmung gedeutet, aber das war wirklich nicht der Fall.«
Jessica hatte nicht den Eindruck, sich getäuscht zu haben, aber aus den wenigen Erfahrungen, die sie mit den Freunden gewonnen hatte, wusste sie bereits, dass es keinen Sinn gehabt hätte nachzuhaken.
So wandte sie sich nun bei Tisch an Tim. »Tim, ich habe gehört, du arbeitest an einer interessanten Sache. Kannst du darüber schon sprechen?«
»Nun«, sagte Tim, »ich arbeite nicht an einem bestimmten Fall, wenn du das meinst. Ich habe nur begonnen, meine Promotion vorzubereiten.«
»Warum willst du plötzlich promovieren?«, fragte Patricia. »Deine psychotherapeutische Praxis läuft glänzend, deine Seminare für Selbstbehauptungstraining ebenso. Glaubst du, es spielt eine Rolle, ob du einen Doktor vor dem Namen trägst?«
»Meine liebe Patricia«, erwiderte Tim, »ich finde, ein großer Reiz des Lebens besteht in den Herausforderungen, die wir an uns richten und denen wir uns dann mit all unserem Einsatz widmen. Es geht schließlich nicht nur um das, was wir unbedingt brauchen. Es geht um das Vorankommen, darum, die eigene Messlatte immer wieder ein Stück höher zu legen.«
»Welches ist das Thema deiner Doktorarbeit?«, fragte Jessica.
Es gefiel Tim, mit seinem Projekt im Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit zu stehen, das konnte man ihm ansehen.
»Abhängigkeit«, antwortete er.
»Abhängigkeit, die sich zwischen Menschen entwickelt?«
»Ja, und auch bestimmte Täter-Opfer-Konstellationen, die daraus entstehen. Was bei einem Abhängigkeitsverhältnis zwischen zwei Menschen fast immer der Fall ist. Wer ergreift warum welche Rolle? Welchen Nutzen zieht jeder von beiden daraus?«
»Das klingt interessant«, gab Jessica zu.
»Das ist interessant«, entgegnete Tim mit selbstgefälliger Miene, »aber auch sehr vielschichtig und arbeitsintensiv. Ich werde einiges daran zu tun haben in diesen Ferien.«
»Du bist noch ganz am Anfang?«, erkundigte sich Patricia.
Tim nickte. »Im Grunde noch bei den Vorarbeiten. Ich bin dabei, ein paar Persönlichkeitsprofile zu entwickeln, anhand derer ich dann meine Theorien darlegen möchte.«
Patricia lachte ein wenig hektisch. »Dann ist es ja gar nicht ungefährlich, sich in deiner Nähe aufzuhalten. Am Ende findet man sich als Fallbeispiel in deiner Arbeit wieder.«
»Kann passieren«, bestätigte Tim.
Sie starrte ihn an. »Na ja, mich kann das kaum betreffen. Ich denke, beim besten Willen könnte mir niemand irgendeine Form der Abhängigkeit andichten.«
»Bist du da so sicher?«, fragte Tim.
Patricia bekam funkelnde Augen. »Also ich möchte wirklich wissen, wo du da bei mir etwas finden könntest!«
»Oh, ich denke, das springt einem geradezu ins Auge. Du bist unendlich abhängig von dem Bild, das du in der Öffentlichkeit abgibst. Die perfekte Patricia. Die perfekte Gattin. Die perfekte Mutter. Mit ihren perfekten Kindern und ihrem perfekten Mann in einem perfekten Haus. Einfach das perfekte Leben. Und damit wiederum katapultierst du dich in eine ungeheure Abhängigkeit von Leon. Da du allein dieses Bild nicht aufrechterhalten könntest, bist du auf seine Kooperation angewiesen, und entsprechend musst du auch ihm so manches … Entgegenkommen erweisen.«
Patricia hatte hochrote Wangen und saß so aufrecht und gespannt auf ihrem Platz wie eine Stahlfeder. »Könntest du deutlicher werden?«, fragte sie schrill.
Tim widmete sich wieder seinem Essen. »Ich denke, wir verstehen uns«, antwortete er kauend und ohne das geringste Anzeichen einer Emotion.
Ein paar Minuten lang herrschte ein etwas gedrücktes Schweigen am Tisch, dann hörte man draußen die Haustür klappen.
»Das ist bestimmt Ricarda!«, sagte Patricia sofort, offenbar bestrebt, von sich als Gesprächsgegenstand abzulenken. »Alexander, du solltest jetzt gleich zu ihr gehen und ihr deine Meinung …«
Alexander machte bereits Anstalten aufzustehen, doch Jessica legte ihm rasch die Hand auf den Arm. »Nicht. Du machst alles nur schlimmer. Lass sie jetzt erst einmal in Ruhe.«
»Ich wollte gar nicht zu Ricarda gehen«, erklärte Alexander, »ich wollte eigentlich etwas verkünden.« Er lächelte. »Ich …«
Diesmal krallte sie ihm die Fingernägel in den Arm. »Nein! Nein, bitte nicht!«
Alle starrten sie überrascht an.
»Was ist denn los?«, fragte Evelin.
Alexander setzte sich wieder. »Ich verstehe dich nicht«, sagte er.
Jessica erhob sich rasch. »Ich sehe mal nach Ricarda«, murmelte sie.
Sie wusste, dass sie sich eine Abfuhr einhandeln würde. Dennoch verließ sie mit schnellen Schritten den Raum und stieg die Treppe hinauf.
4
Jessica erwachte mitten in der Nacht, und sie wusste nicht gleich, was sie geweckt hatte. Es musste etwas gewesen sein, das sie bis in ihre Träume hinein beunruhigt hatte, denn ihr Herz schlug heftig, und sie empfand ein Gefühl der Bedrohung, ohne eine Ahnung zu haben, welcher Art diese Bedrohung sein sollte. Obwohl sie schon einige Male in Stanbury Ferien gemacht hatte, war es doch für dieses Mal die erste Nacht in einem fremden Bett, und vielleicht hatte sie dieser Umstand durcheinandergebracht. Doch dann bemerkte sie den Lichtschein, der durch die Ritze unter der Tür zum anliegenden Badezimmer hindurchschimmerte, und im selben Moment registrierte sie auch, dass das Bett neben ihr leer war. Nebenan hörte sie Wasser in das Waschbecken rauschen.
Sie wusste, wovon sie aufgewacht war, und seufzte leise.
Wochenlang war nichts geschehen. Fast zwangsläufig hatte nun wieder eine solche Nacht kommen müssen.
Sie knipste ihre Nachttischlampe an, schwang die Füße aus dem Bett und warf dabei einen Blick auf den Radiowecker, der auf dem Boden stand. Kurz vor vier. Die übliche Zeit.
Sie klopfte leise an die Badezimmertür.
»Alexander?«
Er antwortete nicht, und sie trat ein.
Er stand vor dem Waschbecken, ließ kaltes Wasser in seine geöffneten Hände laufen und spritzte es sich dann ins Gesicht. Er war totenbleich, und er schien am ganzen Körper zu zittern.
»Alexander!« Sie trat an ihn heran, legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Du hast wieder geträumt?«
Er nickte. Er drehte den Wasserhahn zu, griff nach einem Handtuch, trocknete Gesicht und Hände ab. Selbst das eiskalte Wasser hatte nicht einen Hauch von Farbe auf seine Wangen gebracht.