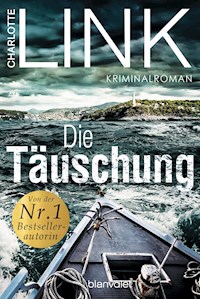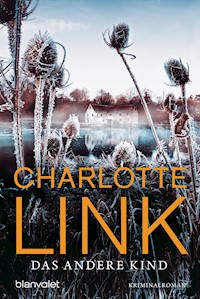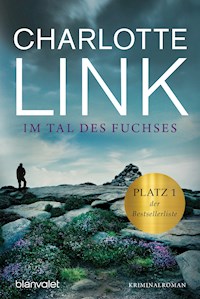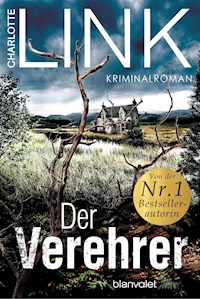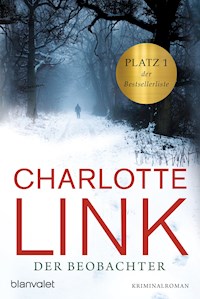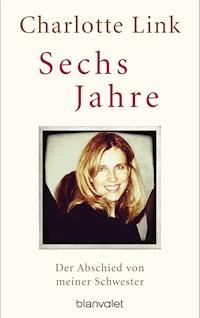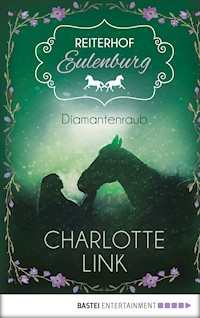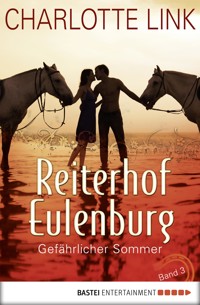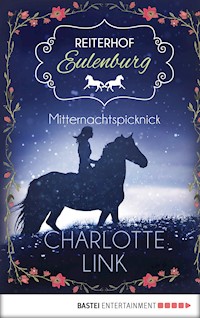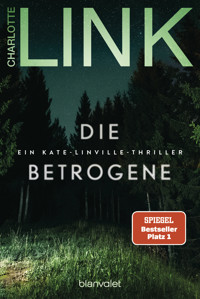10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wenn ein Vermisstenfall zur spannendsten und gefährlichsten Story deines Lebens wird …
Elaine Dawson ist vom Pech verfolgt. Als sie nach Gibraltar zur Hochzeit einer Freundin reisen will, werden sämtliche Flüge in Heathrow wegen Nebels gestrichen. Anstatt in der Abflughalle zu warten, nimmt sie das Angebot eines Fremden an, in seiner Wohnung zu übernachten – und wird von diesem Moment an nie wieder gesehen.
Fünf Jahre später rollt die Journalistin Rosanna Hamilton den Fall neu auf. Plötzlich gibt es Hinweise, dass Elaine noch lebt. Doch als Rosanna diesen Spuren folgt, ahnt sie nicht, dass sie selbst bald in Lebensgefahr schweben wird …
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 824
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Außerdem von Charlotte Link bei Blanvalet lieferbar:Die Sünde der Engel (37291)Die Täuschung (37299)Sturmzeit (37416)Wilde Lupinen (37417)Die Stunde der Erben (37418)Das Haus der Schwestern (37534)Die Rosenzüchterin (37458)Das andere Kind (37632)Am Ende des Schweigens (37640)Schattenspiel (37732)Der Verehrer (37747)Der Beobachter (36726)Der fremde Gast (37927)Im Tal des Fuchses (38259)Das Echo der Schuld (38354)
Charlotte Link
Die letzte Spur
Roman
1. AuflageNeuausgabe November 2014 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, MünchenCopyright © 2008 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: www.buerosued.deHerstellung: samISBN: 978-3-641-14175-2www.blanvalet.de
November 2002
Es würde schneien an diesem Wochenende. Das hatten die Meteorologen prophezeit, und es sah aus, als könnten sie recht behalten: Es war eisig kalt an diesem Novembernachmittag. Ein scharfer Wind blies aus Nordost. Wer aus dem Haus musste, dem tränten rasch die Augen, und die Haut brannte. Die frühe winterliche Dunkelheit brach bereits herein. Den ganzen Tag war es nicht richtig hell geworden, und nun schien die Dämmerung schon wieder in den Abend überzugehen.
Die junge Frau sah erbärmlich aus. Verfroren, bleich, mit roten Flecken auf den Wangen. Sie hielt beide Arme um ihren Körper geschlungen, als könnte sie der gnadenlosen Kälte, die draußen herrschte, auch hier drin nicht entkommen. Dabei war der Keller des gerichtsmedizinischen Instituts gut geheizt. Jedenfalls der kleine Vorraum, in den Inspector Fielder und seine Mitarbeiterin, Sergeant Christy McMarrow, die Besucherin geleitet hatten, nachdem diese die unbekannte Tote aus dem Epping Forest identifiziert hatte.
Sie hatte nur einen einzigen, kurzen Blick auf das wächserne Gesicht geworfen, sich dann rasch abgewandt und hörbar mit einem Würgen in der Kehle zu kämpfen gehabt. Dabei hatte sie nicht einmal den übel zugerichteten Körper gesehen.
Der, so hatte Fielder gedacht, hätte sie wahrscheinlich in Ohnmacht fallen lassen.
Es hatte ein paar Augenblicke gedauert, bis sie hatte sprechen können.
»Das ist sie. Das ist Jane. Jane French.«
Im Vorraum bat sie um eine Zigarette. Fielder gab ihr Feuer. Ihre Hände zitterten heftig, aber das lag nicht nur an der belastenden Situation. Die Frau war drogensüchtig, das hatte er auf den ersten Blick erkannt. Prostituierte, wie ihre Kleidung verriet. Ihr Rock war so kurz, dass es nicht viel geändert hätte, wenn sie ihn überhaupt nicht getragen hätte. Hauchdünne schwarze Strümpfe, nicht im Mindesten geeignet, sie vor der Kälte zu schützen. Hochhackige Stiefel, eine blousonähnliche Jacke aus einem metallisch glänzenden Stoff, weit geöffnet, um möglichst viel von ihren üppigen, gut geformten Brüsten zur Geltung zu bringen. Sie war jung, Anfang Zwanzig, schätzte Fielder.
»Also, Miss Kearns«, sagte er, bemüht, besonders sachlich und kühl zu erscheinen, um auch ihr Gelegenheit zu geben, sich zu fassen, »Sie sind völlig sicher, dass es sich bei der Toten um eine … Jane French handelt?«
Lil Kearns zog heftig an ihrer Zigarette und nickte. »Absolut. Das ist sie. Hab sie sofort erkannt. Sieht schon … na ja, verändert aus, aber klar, sie ist es!«
»Sie muss fast eine Woche im Wald gelegen haben, ehe sie gefunden wurde. Das heißt, sie wurde um den zehnten November herum ermordet.«
»Ermordet … ist das sicher?«
»Leider ja. Die Art ihrer Verletzungen, die Tatsache, dass sie gefesselt war, als sie gefunden wurde, lässt keinen anderen Schluss zu.«
»Schöne Scheiße«, sagte Lil.
Sie hatte sich am Morgen dieses Tages gemeldet, nachdem die Polizei es schon fast aufgegeben hatte, noch irgendeinen Hinweis auf die Identität der Toten aus dem Epping Forest zu bekommen. Man tappte seit fast vierzehn Tagen völlig im Dunkeln. Spaziergänger hatten die Frau gefunden, und die Art ihrer Verletzungen, die Grausamkeit, die sich in der Gewalttätigkeit offenbarte, mit der sie gequält und umgebracht worden war, hatte selbst hartgesottenen Beamten erst einmal die Sprache verschlagen.
»Das war ein Psychopath«, hatte irgendjemand schließlich gesagt, und alle hatten genickt. Die junge Frau musste einem völlig durchgeknallten Typen in die Hände gefallen sein.
Ihre Kleidung – oder vielmehr: was von ihrer Kleidung noch übrig war – hatte sie als Prostituierte ausgewiesen, so dass die Vermutung nahelag, dass sie zu dem falschen Freier ins Auto gestiegen war. Leider kamen solche Fälle nicht allzu selten vor, auch wenn sie dann nicht mit einer solch beispiellosen Brutalität einhergingen. Aber es liefen jede Menge Perverse herum, und nirgendwo konnten sie sich so bequem bedienen wie auf dem Straßenstrich. Nicht jedem sah man es an, dass er falsch tickte. Inspector Fielder hatte Triebtäter erlebt, die ein Aussehen und Auftreten hatten, dass jede Mutter sie sich als Schwiegersohn gewünscht hätte.
Die Tote hatte keine Papiere bei sich gehabt, und sie passte auch zu keiner der vorliegenden Vermisstenmeldungen. Man hatte ihr Bild in den Zeitungen veröffentlicht, aber auch darauf hatte es zunächst keine Reaktion gegeben. Bis Lil Kearns aufgekreuzt war und behauptet hatte, ihre ehemalige Zimmergenossin erkannt zu haben.
»Die ist seit Anfang März verschwunden! Ohne ein Wort zu sagen. Kam plötzlich nicht mehr wieder. Und jetzt sehe ich sie auf einmal in der Zeitung!«
Fielder hatte wissen wollen, weshalb Miss Kearns das Verschwinden ihrer Freundin nicht angezeigt habe, doch er hatte nur ein Schulterzucken als Antwort bekommen. Er konnte sich den Grund denken: Lil Kearns war auf einen näheren Umgang mit der Polizei alles andere als erpicht. Als Drogenabhängige war sie vermutlich in kriminelle Aktivitäten verstrickt, oder sie kannte zumindest genügend Leute, die sich in der Verbrecherszene bewegten. Sie hatte keine Lust, plötzlich selbst in irgendeinem Schlamassel zu stecken.
Obwohl sie behauptete, das Bild ihrer Freundin erst jetzt in einer alten Zeitung entdeckt zu haben, vermutete Inspector Fielder, dass sie schon über einen längeren Zeitraum hinweg Kenntnis davon gehabt hatte. Sie hatte einigen Anlauf gebraucht, den Weg zu einem Polizeirevier zu wagen. Immerhin aber, sie hatte es getan. Er hatte kein Interesse daran, ihr an den Karren zu fahren. Ihm ging es lediglich um Informationen zur Person des Opfers.
Leider wusste Lil nicht viel zu sagen. Während sie in dem kleinen Zimmer der Gerichtsmedizin stand, an ihrer Zigarette zog und nervös auf ihren halsbrecherisch hohen Absätzen wippte, zählte sie auf, was sie wusste.
»Jane French. Stammt aus Manchester. Ich glaube, nur ihre Mutter lebt noch. Ist vor drei Jahren nach London gekommen. Wollte Karriere machen!« Sie betonte das Wort Karriere in einer Art, dass es fast obszön klang. »Na ja, unter uns, in Wahrheit wollte sie einen netten Typen kennen lernen. Irgendeinen Kerl, der sie heiratet und ihr ein besseres Leben bietet als das, was sie hatte. Sie hat mal diesen Job, mal jenen gemacht … keine Ahnung, was genau. Schließlich stellte sie sich an den Straßenrand. Hatte nichts mehr zu beißen und kein Dach über dem Kopf. Ich hab sie noch angemotzt. Weil es mein Revier war.«
»Wann war das?«, hakte Christy McMarrow ein.
»Vor’m Jahr etwa. Hatte dann Mitleid. Sie durfte bei mir einziehen. Wir sind zusammen anschaffen gegangen.«
»Für wen?«
Lil blitzte Christy an. »Für niemanden! Ich liefere nicht mein Geld bei irgendeinem miesen Zuhälter ab! Jane und ich waren unabhängig.«
»Und im darauffolgenden März verschwand sie?«
»Ja. Tauchte plötzlich nicht mehr auf. Ich komme nachts zurück, sie ist nicht da. Nicht ungewöhnlich. Aber, na ja, sie kam dann eben nie mehr wieder!« Sie warf die Zigarettenkippe auf den Linoleumboden, trat sie aus. »Aber seit März ist sie nicht tot, oder?«
»Nein«, sagte Fielder, »wie gesagt, nicht länger als inzwischen drei Wochen.«
»Komisch. Wo war sie denn in der Zeit dazwischen?«
Das hätte Inspector Fielder auch gern gewusst, aber es sah nicht so aus, als könne Lil Kearns ihnen in dieser Frage weiterhelfen.
»Kennen Sie Freunde von ihr? Bekannte? Irgendjemanden, mit dem sie Kontakt hatte?«
»Nein. Da gab’s, glaube ich, auch niemanden. Obwohl … einmal hab ich gedacht …« Sie sprach nicht weiter.
»Ja?«, hakte Inspector Fielder nach.
»Das war im Januar ungefähr. Da hab ich sie mal gefragt, ob sie jemanden kennen gelernt hat. Näher. Weil sie auf einmal besser angezogen war.«
»Was genau heißt, besser angezogen?«
»Na ja, schon noch …«, sie grinste, »schon noch Berufskleidung. Sie wissen schon. So wie ich. Aber irgendwie … bessere Qualität. Teurer. Als ob sie plötzlich einfach mehr Kohle gehabt hätte.«
»Und sie gab Ihrer Ansicht nach dabei nicht das Geld aus, das sie selbst verdiente?«
»Nee. Ich kriegte ja mit, was sie verdiente. Das reichte im Grunde vorn und hinten nicht.«
»Sie meinen, sie hatte einen Freund, der ihr Geschenke machte?«
»Hab ich vermutet, ja. Aber sie stritt das ab. Ich hab auch nicht groß weitergefragt. War mir letztlich egal.«
Fielder seufzte. Sie waren insofern weitergekommen, als die Tote nun einen Namen, eine Identität hatte. Leider aber schien der Fall an dieser Stelle zu stagnieren. Lil Kearns führte selbst einen so erbarmungslosen Überlebenskampf, dass sie auf ihre Zimmergenossin nur sehr am Rande hatte achten können. Sie steckte längst in einer Situation, in der ihr andere Menschen egal waren, es sei denn, sie finanzierten ihr den nächsten Schuss.
»Sie haben uns sehr geholfen, Miss Kearns«, sagte er dennoch, »vielen Dank, dass Sie gekommen sind.«
»Ja, klar … ich meine … mir tut das total leid mit Jane. Echt blöd gelaufen!« Sie strich sich die Haare aus der Stirn, auf der noch immer Schweiß glänzte. Es ging ihr gar nicht gut, seitdem sie die Leiche hatte ansehen müssen.
Inspector Fielder kramte seinen Autoschlüssel aus der Tasche. »Kommen Sie«, sagte er, »ich fahre Sie nach Hause.«
»Ehrlich? Das ist total nett!«, sagte Lil dankbar.
Er würde dabei das Zimmer in Augenschein nehmen können, in dem Jane French bis zu ihrem Verschwinden gelebt hatte. Leider hatte er bereits die Ahnung, dass ihn auch das nicht weiterbringen würde.
Er verfügte über viele Jahre Berufserfahrung, und er hätte fast gewettet, dass er den Fall Jane French zu seinen Niederlagen würde rechnen müssen. Die junge Frau hatte in einem schwierigen sozialen Umfeld gelebt, das machte die Sache so kompliziert.
Zeugen für die Tat schien es ebenfalls nicht zu geben.
Und sollte doch irgendjemand Näheres zum grausamen Tod der jungen Jane French aussagen können, so bewegte sich diese Person aller Wahrscheinlichkeit nach in derselben Szene, in der Jane beheimatet gewesen war. Mit Informationen an die Polizei war man in diesem Umfeld äußerst vorsichtig. Um nicht selbst wegen irgendwelcher krimineller Machenschaften aufzufliegen, aber auch aus Angst vor Vergeltung.
Höchst unwahrscheinlich also, dass sich ein möglicher Zeuge melden würde.
Inspector Fielder hasste es, sich diesen Gedanken einzugestehen, aber es sah ganz danach aus, als werde der Mörder von Jane French ungestraft davonkommen.
Freitag, 10. Januar 2003
Hätte sie die Frühmaschine von Heathrow nach Malaga genommen, wäre sie jetzt längst am Ziel. In Gibraltar. Vermutlich war das Wetter in der britischen Enklave am südlichsten Zipfel der Iberischen Halbinsel wesentlich besser als in London, wo sich der Nebel seit den Morgenstunden nicht verzogen hatte, ja sogar immer dichter geworden war. Jetzt, verstärkt durch die frühe winterliche Dunkelheit, versank die Stadt in einer Art undurchdringlicher, feuchter Masse, die alle Lichter und sogar Geräusche und Bewegungen zu schlucken schien.
Während in Gibraltar die Sonne als roter Feuerball von einem pastelligen Himmel in ein dunkelblaues Meer gefallen war und nun erste Sterne aufzublitzen begannen. Wahrscheinlich. Und wenn nicht, so wäre das auch egal: Hauptsache, sie wäre jetzt dort.
Ohne Geoffs tränenreichen Zusammenbruch am Vorabend wäre sie bei ihrem Plan geblieben, die Maschine am Vormittag zu nehmen. Sie hätte sehr früh aufstehen müssen, um rechtzeitig in London zu sein, und das hätte bedeutet, dass die für die nächsten drei Tage angeheuerte Krankenschwester bereits das Frühstück für Geoff hätte zubereiten müssen. Aber alles war abgesprochen gewesen. Die resolute Pflegerin hatte zugesagt, pünktlich zu sein.
»Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Dawson! Reisen Sie in aller Ruhe ab. Wir werden das Kind schon schaukeln.«
Später wusste sie, dass sie die ganze Zeit über insgeheim schon auf einen Zusammenbruch Geoffs gewartet hatte. Er hatte ihre Ankündigung, für drei Tage nach Gibraltar zu reisen, allzu ruhig aufgenommen. Er war nicht erfreut gewesen, aber er war auf eine ziemlich erwachsene Art damit umgegangen.
»Es tut dir gut, mal rauszukommen, Elaine. Klar bin ich nicht glücklich. Aber du tust so viel für mich, da will ich nicht egoistisch sein. Du brauchst mal ein bisschen Abstand!«
»Ich verstehe ja selber nicht, weshalb Rosanna mich eingeladen hat. Eigentlich hatten wir ja nie viel miteinander zu tun. Ich meine, ich bin nicht direkt eine Freundin von ihr …«
An dieser Stelle hatte Geoff durchblicken lassen, dass er ihre Reise nach Gibraltar im Grunde auch für völlig überflüssig hielt.
»Du musst wissen, was du tust, Elaine. Ich denke, es ist ein Almosen von Rosanna. Wahrscheinlich hat ihre Mutter sie dazu überredet. Die war doch schon immer so sozial angehaucht. Wir müssen der armen, lieben Elaine mal etwas Gutes tun … Und schließlich hat sich Rosanna seufzend bereit erklärt. Na ja …« Er schwieg vielsagend. Unausgesprochen standen die Worte im Raum: Wenn dir das trotzdem Spaß macht …
Spaß vielleicht nicht, dachte sie jetzt, während sie verzweifelt die blinkende Schalttafel anstarrte, die ihr signalisierte, dass ihr Flug nach Spanien gestrichen war, so wie alle anderen Flüge auch, die Heathrow an diesem späten Januarnachmittag hätten verlassen sollen, aber es erschien mir wie eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, dass sich … irgendetwas ändert. Es hätte eine Chance sein können, die mir das Schicksal schenkt.
An allen Schaltern drängten sich aufgeregte Menschen, Reisende, die wissen wollten, wie es nun weitergehen würde. Überfordertes Flughafenpersonal versuchte, die Ruhe zu bewahren und Auskunft zu geben. Im Grunde stand aber nur eines klar und unveränderlich fest: An diesem Abend würden von Heathrow keine Flüge mehr starten.
Es gelang ihr, eine Angestellte von British Airways anzusprechen.
»Entschuldigen Sie bitte … ich muss unbedingt heute Abend noch nach Malaga fliegen!«
Die andere lächelte, professionell und unbeteiligt. »Es tut mir leid. Wir können nichts gegen den Nebel unternehmen. Es wäre einfach zu gefährlich.«
»Ja, aber …« Sie konnte es einfach nicht fassen. Einmal, ein einziges Mal in ihrem verdammten dreiundzwanzigjährigen Leben verließ sie das Dorf, in dem sie geboren und aufgewachsen war, und schickte sich an, eine Reise anzutreten, versuchte, sich aus der tödlichen Routine und Eintönigkeit ihres Alltags zu befreien, und dann scheiterte sie am Londoner Nebel. Sie merkte, dass Tränen in ihr aufstiegen, und mühte sich panisch, sie zurückzuhalten. »Ich wollte eigentlich schon heute Morgen fliegen«, erklärte sie unsinnigerweise, »aber ich hatte umgebucht …«
»Das ist schade«, meinte die Angestellte, »bis heute Mittag ging noch alles klar.«
Geoff war am Vorabend völlig unvermittelt zusammengebrochen. Beim Abendessen hatte er plötzlich seinen Löffel sinken lassen. Schon vorher hatte er in allen Speisen nur lustlos gestochert, aber das tat er auch sonst oft. Nun rannen auf einmal Tränen über seine Wangen.
»Es tut mir leid«, schluchzte er, »es tut mir leid!«
»Ach, Geoff! Geoff, nicht weinen! Ist es wegen mir? Weil ich … weil ich nach Gibraltar reise?«
Eine rein rhetorische Frage. Sie wusste, dass es wegen Gibraltar war. Seltsamerweise hatte sich im darauffolgenden Gespräch alles um den Zeitpunkt ihrer Abreise gedreht, nicht um die Reise selbst.
»Wenn du wenigstens noch zum Frühstück da wärst! Dass du so früh wegmusst … dass ich dann so bald schon dieser Fremden ausgeliefert bin …«
»Vielleicht«, hatte sie halbherzig angeboten, »geht noch ein späterer Flug. Die Hochzeit ist ja erst am Samstag …«
Er war sofort darauf angesprungen. »Das würdest du tun? Das würdest du wirklich tun? Am Nachmittag fliegen? Mein Gott, Elaine, das würde einfach alles viel leichter für mich machen!«
Wieso eigentlich? Die paar Stunden? Das Frühstück? Aber sie hatte sich in all den Jahren an derartige Verhaltensweisen bei Geoff gewöhnt. Irrational. Unverständlich. Nicht nachvollziehbar. Aber so war er eben. So würde er immer sein.
»Was soll ich denn nun machen?«, fragte sie ratlos. »Glauben Sie, dass andere Flughäfen … Gatwick? Stansted? Glauben Sie, dort gehen Flüge?«
Die Angestellte von British Airways schüttelte den Kopf. »Die haben mit demselben Problem zu kämpfen wie wir.«
»Ja, aber …«
»Wohnen Sie in London?«, fragte die andere.
»Nein. Ich wohne in Kingston St. Mary.« Glaube ich ernsthaft, irgendjemand kennt das Kaff?, fragte sie sich. »In Somerset«, setzte sie hastig hinzu. »Es ist leider nicht allzu nah.«
Und verkehrstechnisch eine Katastrophe, wollte sie weiter erklären, hätte sie nicht gemerkt, dass ihr Gegenüber schon sein Lächeln verloren hatte und zwischen Entnervtheit und Gereiztheit schwankte. »Ich glaube, da komme ich heute Abend nicht mehr hin.«
»Dann würde ich mir rasch ein Hotel suchen. Hier in Heathrow sind heute Abend so viele Menschen gestrandet, da wird im Umkreis sehr schnell nichts mehr zu haben sein. Oder Sie sichern sich einen Platz in einer der Wartehallen und verbringen die Nacht dort. Essen und Getränke kann man sich hier ja überall besorgen.«
»Denken Sie, dass ich morgen früh fliegen kann?«
Schon im Weiterlaufen, zuckte die andere mit den Schultern. »Das kann Ihnen niemand garantieren. Aber es ist möglich!«
Eine Frau, die das Gespräch mitangehört hatte, schimpfte los. »Unmöglich! Keiner hilft einem hier weiter! Keine Ahnung, wohin ich jetzt gehen soll! Die müssten doch irgendetwas unternehmen!«
Elaine sah sich in der Abfertigungshalle um. Ein solches Gewimmel von Menschen hatte sie noch nie gesehen. Wer sollte da irgendetwas unternehmen? Die Angestellte hatte ihr vermutlich den einzigen Rat gegeben, der realistisch war: Sie musste sich einen halbwegs bequemen Platz für die Nacht suchen.
Schon wieder wollten ihr die Tränen kommen. Minutenlang blieb sie mit hängenden Armen inmitten des Chaos stehen, unfähig, sich zu rühren, unfähig, einen vernünftigen Plan zu fassen. Das Stimmengewirr der Menschen schwoll an zu einem Orkan. Lautsprecheransagen übertönten den Lärm. Vorbeihastende Reisende rempelten sie an. Sie vermochte nicht zu reagieren. Sie stand nur da, in ihrem abgetragenen braunen Wintermantel, der schon nicht elegant gewesen war, als sie ihn vor vier Jahren gekauft hatte, und der jetzt wie ein Sack aussah, den sie sich um die Schultern gehängt hatte. Neben ihr stand ihr Koffer. In der einen Hand hielt sie ihre Plastikhandtasche, eine Designerimitation, die bei Woolworth zehn Pfund gekostet hatte. Mit der anderen Hand umklammerte sie ihren Pass, der in ihrer Manteltasche steckte. Bereit zum Vorzeigen. Was sich offensichtlich für heute erledigt hatte.
Ich muss überlegen, was ich jetzt mache, dachte sie schließlich.
Sie hatte etwas sehr Leichtsinniges getan und sich für Rosannas Hochzeit ein wirklich teures Kleid gekauft. Für gewöhnlich ging sie sehr vorsichtig mit ihrem Geld um, denn ihre Halbtagsstelle in einer Arztpraxis im nahe gelegenen Taunton brachte nur wenig ein. Geoffrey erhielt eine kleine Rente, und so kamen sie halbwegs über die Runden. Es reichte nie für große Sprünge, aber trotzdem hatte Elaine dann und wann etwas zur Seite legen können, ihren Notgroschen, wie sie es nannte. Er war natürlich für echte Engpässe gedacht gewesen, nicht für ein schickes Kleid und einen Flug nach Gibraltar, aber plötzlich hatte sie gedacht: So etwas muss es doch für mich auch einmal geben! Ein schönes Kleid! Ein tolles Fest! Ein bisschen … Unvernunft.
Sie erlaubte sich für gewöhnlich wenig Unvernunft in ihrem Leben. Ein pflegebedürftiger Bruder im Rollstuhl ließ kaum Spielraum für alles, was leicht und unbesonnen war. Und Geoffrey selbst, als der Mensch, der er nun einmal war, ließ überhaupt in jeder Hinsicht wenig Spielraum.
Er war wie ein Krake. Mit langen, starken Schlingarmen. Er hielt sie fest, er hielt das Einzige fest, was ihm im Leben geblieben war: seine Schwester. Er würde sie niemals loslassen.
Und offensichtlich stand jeder Emanzipationsversuch ihrerseits unter einem schlechten Stern. Denn kaum raffte sie sich auf, dem Schicksal einen Spalt breit die Tür zu öffnen, verschworen sich alle Mächte gegen sie. Sie konnte sich nur zu gut vorstellen, wie sie nach einer Nacht aussehen würde, die sie sitzend in dieser überfüllten Abflughalle verbrachte. Wenn sie Glück hatte, ging morgen ein Flieger, der aber in jedem Fall so knapp landen würde, dass an einen kurzen Rückzug in ihr Hotel nicht mehr zu denken war. Wahrscheinlich musste sie sich in einer öffentlichen Toilette auf dem Flughafen von Malaga umziehen, wo es keine Chance gab, zu duschen oder wenigstens ihre Haare zu waschen und einigermaßen in Form zu föhnen. Das Kleid würde völlig zerdrückt und verknittert sein. Abgehetzt und wie ein struppiger Besen aussehend, würde sie im letzten Moment in der Kirche eintreffen. Während der gesamten Feierlichkeiten wäre sie sich ihrer unvorteilhaften Erscheinung mit quälender Intensität bewusst, und von irgendeinem Moment an würde sie die Minuten bis zu ihrer Heimreise zählen. So viel zu Leichtigkeit und Lebenslust!
Wieder einmal würde sie das gewohnte Bild abgeben, jeder würde sehen, dass sich nichts geändert hatte. Rosanna, die Braut, war natürlich da. Ihre Eltern. Ihr Bruder. Menschen, die Elaine kannte, seit sie auf der Welt war. Die ihr Heranwachsen begleitet hatten. Die nur zu gut wussten, dass sie schon immer auf der Schattenseite des Lebens gestanden hatte. Wie hatte es Geoffrey so schön zitiert? Wir müssen der lieben, armen Elaine etwas Gutes tun …
Die liebe Elaine. Die arme Elaine. Zu deren Gesamtgeschichte es so perfekt passte, dass ihr Flug wegen Nebels gestrichen wurde, dass sie fast das Fest versäumte, dass sie in einem Kleid erschien, das wie eine einzige große Knitterfalte aussah. Ungeduscht und ungekämmt. Unscheinbar sowieso.
Die arme Elaine, wie sie leibt und lebt, würde es heißen.
Jetzt schossen ihr die Tränen mit solcher Gewalt in die Augen, dass sie sie nicht mehr zurückhalten konnte. Ein Mann sah sie erstaunt an. Zwei Frauen tuschelten und blickten zu ihr herüber. Ein Kind deutete auf sie und wandte sich dann aufgeregt an seine Mutter.
Sie konnte nicht hier stehen bleiben und sich ihrem Weinen hingeben, das in wenigen Sekunden einem Dammbruch gleichen würde. Sie nahm ihren Koffer hoch, stolperte schluchzend und fast blind vorwärts. Die Toilette. Irgendwo musste doch eine Toilette sein. Sie wollte in der Abgeschlossenheit einer kleinen, stinkenden Kabine verschwinden, allein im Dämmerlicht, verborgen vor den hastenden, rufenden, eilenden, glotzendenMenschen ringsum. Auf einem Klodeckel zusammensinken können, sich vornüber zusammenrollen wie ein Embryo und weinen, weinen, weinen …
Durch den Schleier vor ihren Augen nahm sie das ersehnte Schild wahr. Die kleinen Piktogramme, die eine Möglichkeit zum Verstecken verhießen. Den Koffer hinter sich her zerrend, stolperte sie auf die Tür zu, fast blind von Tränen, stieß sie auf und prallte mit einem Mann zusammen, der den weiß gekachelten, menschenüberfüllten Raum gerade verlassen wollte.
»Hoppla«, sagte er.
Sie wollte an ihm vorbeidrängen, aber er hielt sie am Arm fest. »Entschuldigen Sie. Das ist die Herrentoilette. Möchten Sie da wirklich hinein?«
Obwohl sie schluchzte und zitterte, drangen die Worte irgendwie an ihr Ohr.
Sie starrte den Fremden an. »Die Herrentoilette?«, fragte sie in einem Ton, als habe sie dieses Wort noch nie gehört.
»Sie müssen eigentlich eine Tür weiter«, sagte er und zeigte nach nebenan.
»Ach so«, sagte sie, ließ den Koffer neben sich auf den Boden fallen und weinte weiter.
Da andere Männer sowohl in die Toilette hinein- als auch herauswollten und sie beide den Weg blockierten, nahm der Fremde Elaines Koffer hoch und zog Elaine ein paar Schritte mit sich, bis sie in einer Ecke standen, in der sie niemanden störten.
»Hören Sie«, sagte er, »kann ich irgendetwas für Sie tun? Ich meine … sind Sie ganz allein auf dem Flughafen, oder ist irgendwo …?« Er ließ seinen Blick schweifen, so als hege er die Hoffnung, aus der unüberschaubaren Menschenmenge werde jemand auftauchen und ihm die haltlos weinende Frau abnehmen. Da sich weder jemand zeigte, der zu der Fremden zu gehören schien, noch von dieser eine Antwort kam, kramte er schließlich ein Taschentuch hervor und reichte es ihr.
»Beruhigen Sie sich doch. Bestimmt ist alles nur halb so schlimm. Na, geht’s wieder?«
Tatsächlich fühlte sie sich ein wenig ruhiger durch seine besänftigende Stimme. Sie entfaltete das Taschentuch, schnäuzte sich kräftig, betupfte ihr nasses Gesicht.
»Entschuldigen Sie bitte«, brachte sie leise hervor.
»Keine Ursache«, sagte er. Sie hatte den Eindruck, dass er gern weitergegangen wäre, jedoch aus irgendeinem Verpflichtungsgefühl heraus unschlüssig stehen blieb.
»Es ist nur … mein Flug nach Malaga ist gestrichen«, murmelte sie und kam sich gleich darauf albern vor.
Er lächelte. »Jeder Flug von London ist heute Abend gestrichen. Verdammter Nebel. Ich wollte nach Berlin und kann jetzt auch wieder nach Hause fahren.«
»Eine Freundin von mir heiratet morgen in Gibraltar.«
»Vielleicht schaffen Sie es ja morgen früh noch. Falls der Flugverkehr dann wieder aufgenommen wird.«
Ihr stiegen schon wieder die Tränen in die Augen. »Vielleicht …«
Er wirkte genervt. Kurz überlegte sie, was wohl in ihm vorging. Wahrscheinlich fragte er sich, weshalb er solches Pech haben musste an diesem Tag. Er kam nicht nach Berlin, und vielleicht platzte ihm dadurch ein wichtiges berufliches Vorhaben. Und dann stieß er noch mit einer verheulten, unattraktiven Frau zusammen, die konfus in die Herrentoilette zu stolpern versuchte, und war zu anständig, sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen.
»Also, ich fahre jetzt nach Hause«, sagte er, »kann ich Sie irgendwo absetzen? Ich habe meinen Wagen hier am Flughafen.«
»Ich wohne nicht in London.« Sie schnäuzte sich noch einmal. Ich muss toll aussehen, dachte sie resigniert, mit rot geflecktem Gesicht und dicker Nase. »Ich wohne in … ach, da komme ich unmöglich heute noch hin. Am Ende der Welt. Ausgeschlossen.«
»Na ja …« Er sah sich um. »Hier am Flughafen übernachtet man nicht gerade komfortabel. Irgendein Hotel …?«
»Ich weiß nicht, ob noch irgendwo ein Zimmer frei ist. Außerdem …«
»Ja?«
Es spielte eigentlich keine Rolle mehr, es war ohnehin schon alles peinlich genug. »Außerdem reicht dafür mein Geld wahrscheinlich nicht. Das Hotel in Gibraltar muss ich bestimmt bezahlen, selbst wenn ich heute dort nicht erscheine …«
»Unter Umständen auch nicht«, meinte er, »aber Sie haben natürlich recht: Es ist sehr fraglich, ob man hier in Heathrow etwas findet.«
»Na ja«, sie versuchte ein Lächeln, froh, dass wenigstens ihre Tränen versiegten, »dann sehe ich mal zu, dass ich ein behagliches Plätzchen in einer der Wartehallen finde. Es ist hier ja zumindest warm und trocken.«
Er zögerte. »Wissen Sie, ich könnte Ihnen anbieten … möchten Sie vielleicht bei mir übernachten? Mein Gästezimmer ist winzig, aber es ist wahrscheinlich doch etwas bequemer als die Wartehallen hier. Und morgen früh könnten Sie problemlos mit der U-Bahn wieder hierherfahren.«
Sein Angebot überraschte sie. Sie konnte inzwischen wieder klar genug sehen und denken, um zu registrieren, dass sie einem sehr gut aussehenden Mann gegenüberstand. Groß und schlank, das Gesicht schmal und intelligent. Ende Dreißig, Anfang Vierzig. Teurer Mantel. Der Typ Mann, der mit dem Finger schnippt und sofort unter einer Menge attraktiver und interessanter Frauen seine Auswahl treffen konnte. Der ganz bestimmt nicht auf eine verheulte, unscheinbare Dreiundzwanzigjährige abfuhr, die auf dem Flughafen herumirrte und wie ein Kind quengelte, weil ihre Pläne durcheinandergeraten waren. Aber er bot ihr sein Gästezimmer natürlich auch nicht an, weil sie ihn in irgendeiner Form faszinierte. Oder weil er sie gern näher kennen lernen würde. Er war einfach nett, und sie tat ihm leid. Unter normalen Umständen hätte er sie überhaupt nicht wahrgenommen.
»Ich glaube, das kann ich nicht annehmen«, sagte sie, um Zeit zu gewinnen.
Er zuckte mit den Schultern, leicht ungeduldig, wie ihr schien. »Was mich betrifft, können Sie es annehmen, andernfalls hätte ich es nicht angeboten. Mein Name ist übrigens Reeve. Marc Reeve. Hier«, er kramte in der Innentasche seines Jacketts, zog eine Karte heraus und reichte sie Elaine, »meine Karte.«
»Sie sind Anwalt?«
»Ja.«
Ihre verstorbene Mutter hatte ihr natürlich beigebracht, dass man nie mit fremden Männern ging. Keinesfalls in ihre Autos einstieg oder sie gar in ihre Wohnungen begleitete.
»Das missverstehen Männer immer«, hatte sie erklärt, »und du stehst hinterher dumm da, weil dir keiner glaubt, dass du es nicht selber auf eine kompromittierende Situation angelegt hast.«
Ach, Mummy, dachte sie, du meintest es so gut, aber wenn du mich nicht immer vor allem und jedem gewarnt hättest, würde mein Leben heute vielleicht nicht in solch einer schrecklichen Sackgasse stecken.
Außerdem war ihr völlig klar, dass sie unglücklicherweise von Marc Reeve nicht das Geringste zu befürchten hatte. Ein attraktiver, offensichtlich wohlhabender, also erfolgreicher Londoner Anwalt. Er fand sie wahrscheinlich ebenso prickelnd wie einen Schluck abgestandenes Wasser. Hatte aber eine soziale Ader.
Ich bin seine gute Tat für heute. Na, großartig!
»Ich heiße Elaine Dawson«, sagte sie, »und es wäre wirklich sehr nett, wenn ich bei Ihnen übernachten dürfte.«
»Na also«, sagte er und nahm ihren Koffer, »dann kommen Sie mit. Mein Wagen steht im Parkhaus.«
Sie schoss noch einen Testballon ab. »Hat Ihre Frau nichts dagegen, wenn Sie unangekündigt jemanden mitbringen?«
»Ich lebe getrennt«, erwiderte er kurz.
Sie folgte ihm durch das Gewühl. Trotz der vielen Menschen schritt er sehr rasch voran, sie hatte etwas Mühe, ihn nicht zu verlieren. Ihr Herz klopfte schneller und stärker als sonst.
Und auch wenn nichts ist, wenn nichts daraus wird, es ist besser als Kingston St. Mary, dachte sie, es ist besser als immer dasselbe. Tagaus, tagein. Es ist besser!
Unauffällig ließ sie ihre Hand in ihre unelegante Plastikhandtasche gleiten, suchte ein wenig herum, fand ihr Handy und schaltete es aus. Es war gemein von ihr, aber ausnahmsweise wollte sie nicht für Geoffrey erreichbar sein.
Nur für diese eine Nacht.
Teil 1
Freitag, 8. Februar 2008
Es gab an nahezu jedem Freitagabend Streit zwischen Dennis Hamilton und seinem Sohn Robert, und Rosanna fand es langsam ermüdend. Sie verstand beide: den sechzehnjährigen Robert, der mit seinen Kumpels losziehen und das Nachtleben erkunden wollte, und Dennis, der ihn für zu jung hielt und an allen Ecken Alkohol, Drogen oder andere Versuchungen witterte.
»Mein Vater hätte mir aber was erzählt, wenn ich mich mit sechzehn nachts hätte herumtreiben wollen«, sagte Dennis, und mit dem Wort herumtreiben löste er natürlich sofort eine heftige Gegenreaktion bei seinem Sohn aus.
»Wir treiben uns nicht herum! Warum musst du alles, alles, was ich tue, immer angreifen? Warum musst du, wenn ich …«
»Ich will nicht diskutieren!«
»Das ist nicht fair! Dad, du bist so was von unfair!«
Es waren an diesem Freitag genau die gleichen Sätze gefallen wie sonst auch. Die Szene hatte auch geendet wie immer: indem Robert in seinem Zimmer verschwand und lautstark die Tür hinter sich zuknallte. Jetzt dröhnte die Stereoanlage, die Bässe wummerten, dass das Haus vibrierte.
Dennis wollte aus seinem Sessel springen. »Ich sage ihm, dass …«
Rosanna, die neben ihm saß, legte die Hand auf seinen Arm und hielt ihn zurück. »Lass. Die Geschichte eskaliert sonst. Lass ihn jetzt einfach mal in Frieden.«
»Es ist rücksichtslos, die Musik derart laut zu spielen!«
»Er baut seinen Frust ab. In einer Viertelstunde gehe ich zu ihm und bitte ihn, etwas leiser zu sein. Das funktioniert dann schon.«
»Frust«, knurrte Dennis, »jetzt erlaubt sich der junge Herr auch noch, frustriert zu sein! Ich hätte in seinem Alter mal …«
»Die Zeiten haben sich geändert, Dennis. Vielleicht solltest du ihm mehr Vertrauen entgegenbringen.«
»Ach ja? Jetzt bin ich wieder schuld, dass wir ständig streiten? Wer benimmt sich denn daneben? Verdammt!« Dennis stand auf, ging aber glücklicherweise nicht zum Zimmer seines Sohnes, sondern nahm sich nur ein Glas aus dem Schrank und schenkte sich einen Whisky ein. »Söhne in der Pubertät sind einfach eine Strafe des Himmels!«
Rosanna hatte gehofft, dass an diesem Abend ausnahmsweise eine gewisse Harmonie gewahrt bliebe, da sie selbst ein heikles Anliegen mit Dennis zu besprechen hatte. Die Ausgangslage war nun denkbar ungünstig. Dennis’ Laune befand sich unter dem Nullpunkt, nicht nur wegen des Verhaltens seines Sohnes, sondern auch weil er spürte, dass Rosanna bei allem Bemühen um diplomatischen Ausgleich Roberts Argumenten und seiner Sichtweise aufgeschlossener gegenüberstand als denen seines Vaters.
»Duhast ja am Ende nicht die Verantwortung!«, fauchte er.
Sie zuckte zusammen. »Entschuldige«, sagte sie, »ich hätte mich natürlich nicht einmischen sollen. Du bist der Vater. Ich bin nicht die Mutter. Wenn es darum geht, für Robert zu kochen, seine Wäsche zu waschen, ihm bei den Schularbeiten zu helfen, bei seinen Lehrern um gut Wetter zu bitten oder ihn mitsamt seiner kompletten Computerausrüstung zu einer LAN-Party zu kutschieren, habe ich allerdings immer den Eindruck, dass weder er noch du in dieser Hinsicht so genau differenziert!«
»Ich habe doch gar nicht gesagt, dass du …«
»Doch. Wenn du in den Raum stellst, dass ich am Ende ja nicht die Verantwortung für Robert trage, was rein formal sicher stimmt, dann sagst du mir im Grunde, dass ich mich raushalten soll. Was keineswegs der Fall ist, wenn ich …«
»… wenn du seine Wäsche wäschst oder sonst etwas für ihn tust, ja. Ich weiß. Entschuldige.« Er sah plötzlich erschöpft aus. »Ich habe es so nicht gemeint«, lenkte er ein.
Rosanna war sofort bereit, ihren Teil zur Friedensstiftung beizutragen. »Ich verstehe ja seine Sorgen. Mit sechzehn halten sie sich für erwachsen, aber in Wahrheit sind sie noch halbe Kinder. Man hat einfach Angst um sie.«
Sie konnte Dennis wirklich verstehen. Als sie beide heirateten, war Robert elf Jahre alt gewesen, ein sommersprossiger, liebenswerter Junge, Ergebnis einer Beziehung zwischen einem noch sehr jungen Dennis und einer noch jüngeren Studentin, die sich von dem Kind völlig überfordert gefühlt hatte und es unter keinen Umständen hatte behalten wollen. Sie war erleichtert gewesen, als Dennis das alleinige Sorgerecht übernahm. Vater und Sohn hatten allein gelebt, bis Rosanna in beider Leben getreten war. Für Robert war sie vom ersten Moment an die Mutter, die er nie gehabt hatte. Im Prinzip empfand es auch Dennis so, aber es gab gelegentlich Momente, in denen er die Tatsache, dass juristisch gesehen nur er das Sagen hatte, für seine Zwecke ausnutzte. Anfangs war das praktisch nie passiert, aber seitdem Robert in der Pubertät war und es naturgemäß viel mehr Schwierigkeiten mit ihm gab, kam es häufiger zu derartigen Situationen. Sie belasteten die Beziehung zwischen Dennis und Rosanna weit mehr, als es Dennis bewusst war.
Aber was ist ihm schon bewusst?, fragte sich Rosanna.
Sie litt unter seinem schlechten Verhältnis zu Robert, aber wenn sie ihm das sagte, hörte er nicht hin.
Sie war unglücklich in Gibraltar und sehnte sich nach England, aber wenn sie ihm das sagte, hörte er nicht hin.
Sie vermisste ihren Beruf als Journalistin, aber wenn sie ihm das sagte, hörte er nicht hin.
Hätte ihn jemand gefragt, er hätte im Brustton der Überzeugung erklärt, dass seine Frau glücklich und ihrer beider gemeinsames Leben voller Harmonie war.
Rosanna wusste, dass es unklug war, an diesem Abend noch mit ihrem eigenen Anliegen herauszurücken, aber im Grunde blieb ihr keine andere Gelegenheit.
»Ich fliege ja morgen nach England«, sagte sie.
Dennis setzte sich wieder, schwenkte seinen Whisky im Glas sacht hin und her. »Ich weiß. Und ich weiß auch, du erwartest eigentlich, dass ich …«
Sie unterbrach ihn hastig. »Nein. Wirklich. Es ist schon in Ordnung, dass du hierbleibst.«
Ihr Vater würde am Sonntag seinen 66. Geburtstag feiern, den ersten, seit er am Ende des vergangenen Jahres völlig überraschend Witwer geworden war, und das war der Grund für Rosannas Reise. Am Anfang hatte sie gewünscht, ihr Mann könnte sie begleiten, aber Dennis hatte wichtige Termine am darauffolgenden Tag geltend gemacht – vorgeschoben oder nicht, das ließ sich nicht überprüfen. Er mochte seinen Schwiegervater, aber er reiste nicht gern nach England. Beruflich ließ es sich nicht umgehen, aber privat vermied er es, wo immer er konnte. In den fünf Jahren ihrer Ehe war es Rosanna nicht gelungen herauszufinden, woher sein Unbehagen gegenüber seiner Heimat eigentlich genau rührte.
»Ich rufe deinen Vater am Sonntag natürlich an«, versicherte Dennis.
Rosanna holte tief Luft und sprang ins kalte Wasser. »Du erinnerst dich doch bestimmt noch an Elaine Dawson?«, fragte sie.
»Elaine Dawson?«
»Meine Freundin aus Kingston St. Mary … na ja, nicht direkt eine Freundin. Ihr Bruder ging in eine Klasse mit meinem Bruder. Sie war um viele Jahre jünger als ich.«
Er runzelte die Stirn. »Ist das nicht die Frau, die zu unserer Hochzeit damals kommen sollte, aber stattdessen verschwunden ist?«
»Spurlos verschwunden. Bis heute.«
»Ich erinnere mich. Dunkel. Ich kannte sie ja gar nicht.«
»Ich habe manchmal an sie gedacht in den vergangenen Jahren«, sagte Rosanna, »und mich gefragt, was wohl damals geschehen ist.«
Es war Dennis anzusehen, dass ihn das nicht im Geringsten interessierte. »Wahrscheinlich ist sie durchgebrannt«, meinte er, »und macht sich jetzt irgendwo ein schönes Leben.«
»Der Typ war sie eigentlich nicht. Die Polizei ging irgendwann allerdings auch davon aus, aber zwischendurch gab es in der Tat Vermutungen, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.«
»Soweit ich noch weiß, saß sie doch in Heathrow wegen Nebel fest. Wer sollte sie denn auf einem derart belebten Flughafen ermorden oder verschleppen?«
»Sie ist mit einem Mann mitgegangen. Das kam irgendwie heraus. Ich meine, er hat sich sogar selber gemeldet. Er hatte ihr angeboten, bei ihm zu übernachten, weil keine Hotelzimmer mehr zu bekommen waren.«
»Und dieser Mann war in Wahrheit natürlich Jack the Ripper und hat sie …«
»Unsinn. Er hat damals geschworen, sie am nächsten Morgen wieder in die U-Bahn Richtung Flughafen gesetzt zu haben. Etwas anderes konnte ihm auch nicht nachgewiesen werden.«
»Dann stimmt wahrscheinlich meine Theorie«, meinte Dennis, »und sie lässt es sich irgendwo gutgehen.«
»Ich würde es ihr wünschen«, sagte Rosanna, und übergangslos fügte sie hinzu: »Ich soll eine Reportage über diesen Fall schreiben.«
Dennis ließ sein Glas sinken und starrte sie an. »Was sollst du?«
»Eigentlich nicht nur über diesen Fall. Nick Simon hat mich heute Morgen angerufen.«
»Nick Simon?«
»Der Chefredakteur von Cover. Du weißt, der …«
»Ich weiß, wer Nick Simon ist. Der Typ, für den du mal gearbeitet hast. Was will der von dir?«
»Er plant eine Serie für seine Zeitschrift. Über Menschen, die spurlos verschwunden sind. Von denen man nie wieder gehört, die man aber auch nie tot aufgefunden hat. Die einfach … wie vom Erdboden verschluckt sind.«
»Aha. Und wie kommt er da auf dich? Du arbeitest seit fünf Jahren nicht mehr für ihn!«
Sie blickte ihren Mann nicht an. »Ich hatte ihm einmal gesagt, dass ich mich über den einen oder anderen Auftrag durchaus freuen würde. Daran hat er sich jetzt erinnert. Hinzu kommt, dass er von meiner Bekanntschaft mit Elaine Dawson weiß. Er hält mich offenbar für geeignet, die Serie zu schreiben.«
»Wir hatten doch vereinbart, dass du für einige Jahre nicht arbeitest!«
»Wir hatten das gar nicht vereinbart. Du hast es dir gewünscht, und da es hier in Gibraltar für mich ohnehin kaum Möglichkeiten gibt, habe ich zugestimmt. Aber ich habe dir oft gesagt, dass mir mein Beruf fehlt.«
»Und ich habe dir oft genug angeboten, in meinem Büro halbtags mitzuarbeiten!«
Sie wünschte, er zeigte etwas mehr Verständnis. »Dennis, du bist Immobilienmakler. Mit diesem Beruf habe ich absolut nichts zu tun. Ich bin Journalistin. Kannst du dir vorstellen, dass ich gerne in meinem Beruf arbeiten würde?«
»Ich kann es mir vorstellen, aber ich hätte dir auch eine gewisse Flexibilität zugetraut«, sagte Dennis mürrisch. Dann knallte er plötzlich sein Glas auf den Tisch und sprang auf. »Ich werde Robert jetzt sagen, dass er diese verdammte Musik …«
Sie erhob sich ebenfalls. »Jetzt lass deinen Ärger über mich nicht an ihm aus. Ich regle das dann schon mit der Musik!«
Sie standen einander gegenüber. Es war Dennis anzumerken, dass er sich überfahren fühlte, aber aus Erfahrung wusste Rosanna, dass er immer so empfunden hätte, auch wenn der Moment günstiger oder ihr eigenes Vorgehen diplomatischer gewesen wäre. Er kam nicht damit zurecht, wenn seine Frau zu irgendeinem Thema eine andere Ansicht hatte als er selbst. Er war kein ausgesprochener Macho, aber Rosanna hatte manchmal den Eindruck, dass sein Kontrollbedürfnis gelegentlich zwanghafte Züge annahm. Es gab ihm Sicherheit, Rosanna seelisch und gedanklich zu hundert Prozent hinter sich zu wissen, und obwohl er ein nüchtern kalkulierender und sehr realistischer Mann war, schien er sich nicht klarzumachen, dass eine derartige Übereinstimmung mit einem anderen Menschen nicht durchzuhalten und schon gar nicht zu erzwingen war.
»Ich nehme an«, sagte er schließlich, »du hast Mr. Simon bereits zugesagt.«
»Ich habe ihm zugesagt, mit ihm am Montag in London zu Mittag zu essen«, sagte sie und hasste das Schuldgefühl, das sie beschlich. Sie war sechsunddreißig Jahre alt! Sie hatte das Recht, eine berufliche Verabredung zu treffen, ohne zuvor die Erlaubnis ihres Ehemanns einzuholen.
»Am Montagmittag wolltest du bereits wieder hier landen«, sagte Dennis.
»Ich weiß. Ich habe den Flug storniert. Ich möchte mit Nick über den Auftrag sprechen. Entweder mir sagt die ganze Sache ohnehin nicht zu, dann versuche ich für Montagabend oder Dienstagfrüh einen Flug nach Gibraltar zu bekommen. Andernfalls …«
»Ja?«
»Andernfalls würde ich natürlich noch ein bisschen länger in England bleiben. Weil ich ja ein paar Recherchen tätigen müsste. Schreiben kann ich das alles dann auch hier.«
Dennis schwieg einen Moment.
»Du hast ja alles bestens geplant«, meinte er dann, »gratuliere. Mir erklärst du, lediglich zum Geburtstag deines Vaters nach England zu wollen und sofort im Anschluss daran zurückzukommen. In Wahrheit hattest du längst eine Verabredung mit deinem früheren Chef, und ebendiese Verabredung dürfte ja wohl von Anfang an der wahre Anlass für deine Reiseplanung gewesen sein!«
»Da irrst du dich aber gewaltig«, sagte Rosanna heftig, »es ging ausschließlich um Dads Geburtstag. Aber als Nick anrief, dachte ich, da ich ohnehin in England bin und am Montag nach London muss, um überhaupt wieder nach Hause zu kommen, könnte ich einem Treffen zustimmen. Mein Gott, Dennis, was ist denn dabei?«
Er kippte seinen Whisky in einem Zug hinunter.
»Nichts. Im Prinzip nichts. Nur muss dir klar sein, dass dich die Recherchen für eine ganze Serie ziemlich lange in England festhalten werden. Dass das für unsere kleine Familie hier nicht gut ist, muss ich dir nicht sagen.«
»Unsere kleine Familie … Ich weiß, wo dich der Schuh drückt, Dennis. Du hast jeden halbwegs positiven Kontakt zu deinem Sohn verloren, und ich bin dein Mittelsmann. Nur über mich hast du noch einen Funken Einfluss. Nur ich sorge dafür, dass es zwischen euch nicht ständig eskaliert. Wenn ich nicht da bin, weißt du nicht einmal, wie du ihn morgens aus dem Bett und in die Schule bekommen sollst!«
»Und wenn es so wäre? Er ist nun einmal in einem äußerst problematischen Alter. Viele Jungen hören da nicht mehr auf ihre Väter!«
»Trotzdem kann ich nicht andauernd zwischen euch stehen und das Schlimmste verhindern. Du musst wieder einen eigenen Draht zu ihm bekommen, Dennis. Ich kann dir deine Rolle als Vater nicht abnehmen. Das ist für Robert nicht gut – und mir gegenüber ist es zunehmend rücksichtslos.«
»Ich dachte, du …«
»Ich mag Robert. Ich ersetze ihm auch gern die Mutter. Aber nicht den Vater. Und ich kann nicht festgekettet an dieses Haus leben, nur weil zwischen euch beiden Krieg ausbricht, wenn ich mal eine Woche weg bin. Ich werde verrückt darüber. Es muss in meinem Leben noch andere Aufgaben geben als die einer Vermittlerin zwischen euch beiden!«
»Du reißt dich doch förmlich darum. Wenn ich Robert nur sagen will, er soll seine Musik leiser drehen, hältst du mich schon davon ab. Weil du die bessere Art hast, ihm eine so ungeheuerliche Bitte vorzutragen.«
»Ich bin sicher nicht unschuldig an der Entwicklung. Ich hänge mich zu sehr rein, ja. Trotzdem ist es nicht gut. Und ein Grund mehr, für eine Weile einfach mal weg zu sein.«
»Für eine Weile, aha. Für dich steht also längst fest, dass du diese Serie machen wirst. Dieses informative Mittagessen, von dem angeblich deine Entscheidung abhängt, ist doch nur eine Farce!«
»Woher willst du das wissen? Ich weiß zum Beispiel noch gar nicht, wie die Bezahlung aussieht.«
»Oh – da wird Mr. Simon sich bestimmt nicht lumpen lassen. Du warst schließlich mal ein ganz gutes Pferd in seinem Stall. Sicher freut er sich, dich zurückzugewinnen.«
»Sonst hätte er mich wahrscheinlich auch nicht gefragt«, sagte Rosanna wütend. Sie wusste, dass es im Grunde keinen Sinn mehr machte, das Gespräch fortzusetzen. Dennis war schlecht gelaunt und verärgert, sie selbst sah sich in die Position gedrängt, sich rechtfertigen zu müssen, und wollte damit nicht fortfahren. Sie fühlte sich im Recht, wusste aber, dass es zwecklos war, Dennis auch nur zum Nachdenken über eine mögliche andere Sicht der Dinge bewegen zu wollen.
Trotzdem fügte sie hinzu: »Ich muss sowieso abwarten, was ich empfinde, wenn ich erst wieder in Kingston St. Mary bin. In Elaines Umfeld. Kann sein, die ganze Sache belastet mich so, dass ich mich gar nicht in der Lage fühle, dieser Geschichte noch einmal nachzugehen.«
»Dann habe ich ja direkt noch Hoffnung«, bemerkte Dennis zynisch. Er ging erneut zum Schrank, holte die Whiskyflasche noch einmal heraus und schenkte sich sein Glas randvoll.
Rosanna ging zur Tür, um Robert zu bitten, die Musik ein wenig leiser zu stellen.
Eigentlich, dachte sie im Hinausgehen, würde uns eine gewisse Zeit der Trennung ganz gut tun.
Samstag, 9. Februar
Noch immer, wenn sie tief in der Nacht den stillen Platz vor dem The Elephant überquerte, sich nach rechts wandte und durch die enge, vollkommen ausgestorbene Gasse ging, an deren Ende ihre Wohnung lag, fühlte sie sich unbehaglich.
Nein, dachte sie, während sie mit gesenktem Kopf vorwärtshastete, unbehaglich ist gar nicht das richtige Wort. Ich habe Angst. Ich habe immer noch Angst.
Den Freitagabend und die ersten Stunden des Samstags hasste sie besonders. Am Freitag wurden, wenn der letzte Gast gegangen war, die Wocheneinnahmen berechnet und akribisch jeder einzelne Cent in einem dicken Ordner notiert. Justin McDrummond, der Besitzer des Pubs, nahm es sehr genau mit dem Geld, aber natürlich ging es dabei auch um seine Existenz. Seine beiden Angestellten durften nicht verschwinden, ehe nicht alles kontrolliert war und auf den Cent genau stimmte. Dadurch wurde es weit nach Mitternacht, ehe man sich auf den Heimweg machen konnte. Die Aushilfskräfte waren zu diesem Zeitpunkt längst auf und davon; nur Bert, der Koch, und sie, das Serviermädchen, hatten auszuharren.
Unglücklicherweise wohnte Bert in der entgegengesetzten Richtung, so dass es keine Chance gab, wenigstens ein Stück des Weges mit ihm gemeinsam zu gehen. Zudem hatte er es immer schrecklich eilig, zu seiner Frau und seinen kleinen Kindern nach Hause zu kommen.
Aber ohnehin, dachte sie, wäre er gar nicht auf die Idee gekommen, mir seine Begleitung anzubieten. Niemand geht davon aus, dass hier etwas geschieht. Nicht in Langbury. Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen.
Sie sah auf ihre Uhr. Kurz nach halb zwei. Natürlich war kein Mensch mehr auf der Straße. Nicht, dass es hier überhaupt je von Menschen gewimmelt hätte, aber in hellen Sommernächten stieß man wenigstens gelegentlich auf ein Liebespaar oder auf irgendeinen späten Spaziergänger mit Hund. Aber natürlich nicht im Februar. Es war eine eisig kalte Nacht, der Wind jagte durch die Straßen und wirbelte ein paar Schneeflocken herum. Hinter allen Fenstern herrschte völlige Dunkelheit.
Sie hatte den Platz vor dem Pub überquert und tauchte in die kopfsteingepflasterte Gasse, die leicht bergan stieg und die so schmal war, dass man den Eindruck hatte, die Menschen könnten sich aus den Häusern rechts und links herauslehnen und einander ohne große Schwierigkeiten die Hände schütteln. Tatsächlich waren die Häuser sehr alt und neigten sich fast alle mit den oberen Stockwerken ein Stück nach vorn. Touristen, die nach Langbury kamen, begeisterten sich an den Häusern, gerade weil sie so schmalbrüstig und schief waren. So alt, so englisch!
Sie dachte, dass man die zugigen, engen Kästen mit den schlecht schließenden, viel zu kleinen Fenstern, den winzigen Räumen und halsbrecherisch steilen Treppen im Innern nur bejubeln konnte, wenn man selbst nicht darin leben musste. Hatten sich die Leute mal überlegt, wie wenig Licht in die Zimmer dringen konnte? Wie dunkel es darin sein musste, selbst im Sommer? Wie beengt man hauste? Aber natürlich machte sich niemand darüber Gedanken. Man nannte das Bild, das das kleine Dorf in Northumberland bot, romantisch und kehrte dann nach Hause zurück, wo man es heller, komfortabler und großzügiger hatte.
Obwohl sie froh sein musste, die Wohnung gefunden zu haben, keine Frage. Und die Arbeit bei Mr. McDrummond. Als sie ihren letzten Job verloren hatte – sie hatte im Lager eines Schuhgeschäfts die Ware sortiert und etikettiert –, war sie völlig verzweifelt gewesen. Nicht, dass diese Tätigkeit ihr besonders viel Spaß gemacht hätte, aber sie hatte sich in dem abgeschiedenen Raum so fern der Welt und damit sicher gefühlt. Außer ihren Kollegen traf sie kaum je einen Menschen. Es war nicht das Leben, von dem sie geträumt hatte, aber es hatte ihr allmählich eine innere Ruhe vermittelt, die schwerer wog als Anflüge von Einsamkeit und das Bewusstsein, dass das eigentliche Leben an ihr vorüberging. Die Angst war das Schlimmste. Jedes Bollwerk gegen die Angst, und wenn es sie gleichzeitig gegen Menschen, Freundschaften und Liebe blockierte, war willkommen.
In einem Pub hatte sie eigentlich zuallerletzt arbeiten wollen. Die meisten Gäste dort waren Menschen aus dem Dorf, aber gerade im Sommer kamen auch viele Touristen. Fremde. Jeder konnte kommen, jeden Augenblick. Auch …
Sie arbeitete seit dem vergangenen Juni im Elephant. Aber noch immer schrak sie zusammen, wenn sich die Tür von draußen öffnete. Noch immer brach ihr der Schweiß in den Handflächen aus. Noch immer dauerte es Minuten, ehe sich Herzschlag und Puls halbwegs normalisiert hatten.
Sie hatte einfach keinen anderen Job gefunden. Zwei Mieten war sie schon im Rückstand gewesen. Mr. Cadwick, der Hausbesitzer, der in der Wohnung unter ihr wohnte, hatte ihr ständig im Treppenhaus aufgelauert. »So geht das nicht weiter. Sie können hier nicht umsonst wohnen. Ich bin kein Wohltätigkeitsverein. Wenn ich nicht nächste Woche das Geld habe, rufe ich die Polizei!«
In ihrer Not hatte sie die Stelle im Elephant angenommen. Justin zahlte nicht schlecht, und zusammen mit dem Trinkgeld verdiente sie nun besser als vorher. Dafür schlief sie schlechter und hatte wieder an Gewicht verloren. Sie hielt Ausschau nach einer anderen Tätigkeit, hatte aber bislang nichts gefunden.
Sie hatte die Hälfte des Weges zurückgelegt und hielt für einen Moment inne. Eigentlich besaß sie eine gute Kondition, aber sie hatte in ihrer Verspannung und Furcht wieder einmal falsch geatmet und wurde nun von heftigem Seitenstechen geplagt. Die Hand an die Taille gepresst, versuchte sie tief Luft zu holen. Rechts und links von ihr lagen schwarz und stumm die tiefen Hauseingänge. Als sie daran dachte, was und wer sich alles ganz leicht dort verbergen konnte, atmete sie sofort wieder verkrampft und spürte, wie die Schmerzen schlimmer wurden. Es hatte keinen Sinn, hier stehen zu bleiben, es machte sie nur verrückt.
Du bist neurotisch, schimpfte sie mit sich, während sie weiterlief, total neurotisch. Irgendwann drehst du noch komplett durch!
Aber wer gesehen hatte, was sie gesehen hatte. Wer erlebt hatte …
Nicht weiterdenken. Sie hatte noch etwa zweihundert Meter zu laufen. Wenn sie erst in der Wohnung war, wenn sie festgestellt hatte, dass sich niemand dort verborgen hielt, wenn sie die Fensterläden verriegelt und verrammelt hatte und unter ihrer warmen Bettdecke lag, eine Wärmflasche auf dem Bauch und ein Glas heiße Milch mit Honig neben sich, dann würde es ihr besser gehen. Dann würde sie sich sicherer fühlen. Und wissen, dass sie wieder einen Tag geschafft hatte.
Kurz vor der Haustür hielt sie inne, um ihren Schlüssel aus der Tasche zu kramen. Es war völlig dunkel, sie konnte nichts sehen, aber urplötzlich blitzte eine Taschenlampe auf und leuchtete ihr ins Gesicht.
Sie hob den Kopf, wollte schreien. Und brachte keinen Laut hervor.
Sonntag, 10. Februar
1
Es überraschte Rosanna zu sehen, dass Cedric wieder rauchte.
»Als wir … bei Mummys Beerdigung hattest du es dir abgewöhnt«, sagte sie.
Er nickte und nahm einen tiefen, genießerischen Zug. »Irgendwann um Weihnachten herum ging es wieder schief. Du weißt schon, ständig Weihnachtsfeiern und der ganze Mist. Die anderen rauchen, und irgendwie fängst du dann auch wieder an.«
»Ich dachte, in Amerika kann man gar nicht anders, als enthaltsam zu leben. Dort ist das Rauchen doch inzwischen fast überall verboten.«
Cedric grinste. »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Je mehr Verbote, desto mehr Schlupflöcher. Oder glaubst du, während der Prohibition wurde weniger gesoffen als davor und danach?«
Sie betrachtete ihren großen Bruder mit einem liebevollen Lächeln. Sie rechnete es ihm hoch an, dass er zum Geburtstag seines Vaters extra aus New York angereist war, obwohl sie insgeheim mutmaßte, dass dies nicht in erster Linie mit einer Fürsorglichkeit dem frischgebackenen Witwer gegenüber zu tun hatte, sondern mit seiner eigenen Einsamkeit. Cedric lebte ein wildes, oberflächliches Leben, das er einerseits zu brauchen schien, das ihm andererseits nicht allzu gut tat. Bei der Beerdigung seiner Mutter im vergangenen Herbst hatte ihn eine Freundin begleitet, ein Mädchen mit dramatisch geschminkten Augen, das kaum dem Teenageralter entwachsen war. Er hatte sie als meine Lebensgefährtin vorgestellt. Die Geschichte schien sich bereits wieder erledigt zu haben, aber Rosanna hatte auch nichts anderes erwartet. Cedrics bisher längste Beziehung hatte ein halbes Jahr gedauert, alle anderen waren noch eher zerbrochen. Er war achtunddreißig. Rosanna fand, dass es höchste Zeit für ihn war, seinen Platz im Leben zu finden. Eine Familie zu gründen und eine innere Heimat zu haben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!