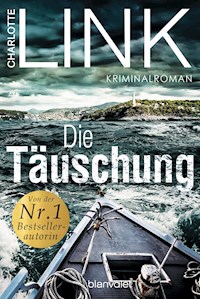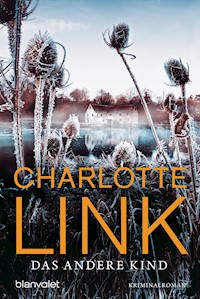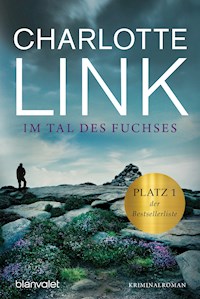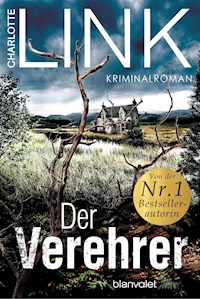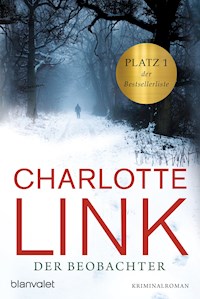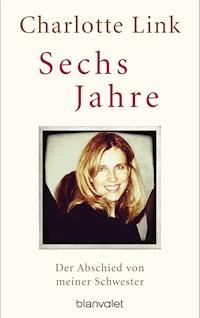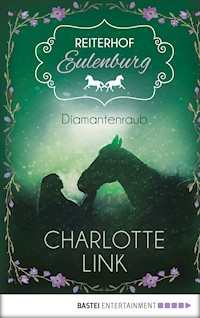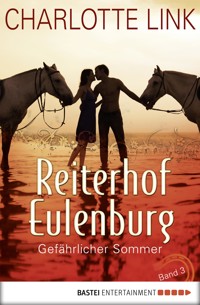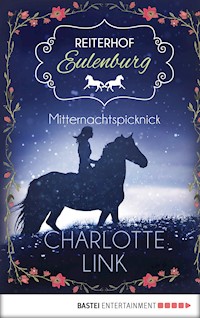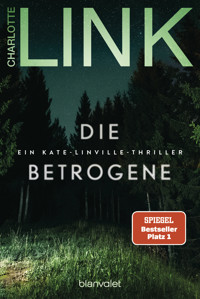9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Was, wenn du im falschen Moment die falsche Entscheidung triffst?
Eigentlich will Simon mit seinen Liebsten in Südfrankreich ein ruhiges Weihnachtsfest feiern. Doch dann kommt alles ganz anders: Auf einem Strandspaziergang begegnet er einer jungen, völlig verwahrlosten Frau: Nathalie, die weder Geld, Papiere noch eine Unterkunft hat und hochgradig verängstigt ist. Simon bietet ihr seine Hilfe an, nicht ahnend, dass er durch diese Entscheidung in eine mörderische Geschichte hineingezogen wird, deren Spuren bis nach Bulgarien führen. Und zu Selina, einem jungen Mädchen, das ein besseres Leben suchte und in die Hände skrupelloser Verbrecher geriet ...
Millionen Fans sind von den fesselnden Krimis von Charlotte Link begeistert. Dunkle Geheimnisse und spannende Mordfälle erwarten Sie. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 693
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Charlotte Link
Die Entscheidung
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage© 2016 by Blanvalet Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagabbildungen: Arcangel Images/Marta Orlowska; Getty Images/Auscape/UIG; www.buerosued.deLektorat: Nicola BartelsHerstellung: kwSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-19980-7www.blanvalet.de
GOUSSAINVILLE, FRANKREICH, MONTAG, 7. DEZEMBER
Sie brauchte tatsächlich nur ein paar Sekunden, um das Türschloss zu öffnen. Mithilfe eines Drahtes, den sie geformt und gebogen hatte, genau so, wie es ihr Boris, ihr großer Bruder, vor vielen Jahren gezeigt hatte. Sie war noch ein kleines Mädchen gewesen, Boris hingegen schon erwachsen, und jeder, der seine speziellen Hobbys kannte, hätte vermutlich darauf gewettet, dass er eines Tages eine kriminelle Karriere hinlegen würde: Er übte beständig, Türschlösser zu knacken oder Fenster aufzuhebeln, und er hatte beachtliche Fähigkeiten darin entwickelt. Aber schließlich war er ein grundsolider Tischler geworden. Es hatte nie auch nur die geringste Gesetzesübertretung in seinem Leben gegeben.
Selina schob die Tür auf, huschte in das Zimmer, schloss die Tür hinter sich und lehnte sich kurz von innen dagegen. Bislang lief alles nach Plan, vor allem vollkommen lautlos. Trotzdem wusste sie, dass sie jeden Moment entdeckt werden konnte, und dass sie dann vermutlich am besten mit dem Leben abschloss. Wenn Sergej und Igor sie bei einem Fluchtversuch erwischten, war sie so gut wie tot.
Ihre Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, die in dem Zimmer herrschte. Eine Straßenlaterne, die unmittelbar hinter der Grundstücksgrenze stand, spendete ein wenig Licht, gedämpft von einem Baum, der sie zur Hälfte verdeckte. Nur schattenhaft konnte sie die Umrisse der Gegenstände im Raum wahrnehmen: Schreibtisch, Regale, ein Aktenschrank. Taisias Zimmer. Taisia war die Schlimmste. Sergej und Igor waren brutale Schläger, aber Taisia war der kluge Kopf dahinter, vollkommen kalt, skrupellos und ohne den Anflug eines Gewissens. Hier im Haus war sie die Chefin. Und jeder tat, was sie sagte.
Selina hatte ein einziges Mal im Vorbeigehen einen kurzen Blick in Taisias Büro werfen können, weil tatsächlich minutenlang die Tür nur angelehnt gewesen war, und dabei hatte sie gesehen, dass die Fenster nicht vergittert waren – wie sonst überall im Haus. Die Haustür war mit mehreren Zusatzriegeln versehen, sämtliche Fenster zudem durch abgeschraubte Griffe gesichert. Es gab kein Entkommen, jedenfalls keines, das nicht mühselig und umständlich und mit jeder Menge Lärm verbunden gewesen wäre. Was bedeutete, man konnte jeden Fluchtversuch vergessen.
Nur dieses eine Zimmer war eine Chance, das Zimmer, in dem Taisia arbeitete … Offenbar hatte sie ein Problem mit Gittern. Und mit abgeschraubten Griffen. Wahrscheinlich wollte sie gelegentlich frische Luft in ihr Büro lassen. Dafür hielt sie die Tür sorgfältig verschlossen, zog den Schlüssel immer ab. Und trug ihn wahrscheinlich stets bei sich.
Aber jetzt hatte sie sich bereits zum Schlafen zurückgezogen. Die anderen Mädchen waren unterwegs. Sergej und Igor saßen in dem kleinen Raum neben der Küche und spielten Karten. Selina wusste, dass es ihnen strikt verboten war, Alkohol zu trinken, daher brauchte sie nicht zu hoffen, dass sie sich langsam zulaufen ließen und an Wachsamkeit und Reaktionsvermögen verloren. Sie waren vollkommen nüchtern und so gefährlich wie scharfe Hunde. Wenn einer von ihnen auf die Idee kam, nach ihr zu sehen …
Ihr brach bei dieser Vorstellung der Schweiß aus. Sie durfte über diese Möglichkeit jetzt nicht nachdenken, sie bekam dann weiche Knie, geriet in Panik und machte ganz sicher irgendeinen furchtbaren Fehler.
Den Draht hielt sie noch immer in der Hand, bückte sich jetzt aber und schob ihn unter den Schrank. Man würde ihn dort finden, aber das war egal. Wenn sie weg war, war sie weg, und die konnten ruhig wissen, wie es ihr gelungen war. Den Draht hatte sie aus einer Korsage herausgezogen, nachdem sie geduldig mit den Fingernägeln die Nähte aufgetrennt hatte. Die Mädchen hatten nicht einmal eine Nagelfeile zu ihrer freien Verfügung, geschweige denn eine Schere, und sie mussten sogar Haarklammern abliefern, wenn sie zu Hause waren. Es war fast unmöglich, an irgendeine Art von Werkzeug zu kommen.
Aber Selina hatte es geschafft.
Weil sie schlau war. Aber natürlich auch, weil sie Hilfe hatte.
In ihrer Jeanstasche steckte das Handy. Dass es ihr gelungen war, es bislang an sämtlichen Kontrollen vorbeizuschmuggeln, grenzte an ein Wunder. Es hing sicher damit zusammen, dass sie erst seit so kurzer Zeit hier war und es bislang noch keine Zimmerdurchsuchungen gegeben hatte. Die fanden, wie sie erfahren hatte, ohne jede Vorankündigung statt, und danach war kein einziger Gegenstand mehr an seinem alten Platz. Jede Mauerritze, jede Nische, jedes Schrankfach wurde auf den Kopf gestellt. Am schlimmsten aber waren die Leibesvisitationen, die Taisia höchstpersönlich vornahm. Selina wurde fast schlecht bei der Vorstellung, dass diese widerliche Frau ihr in jede einzelne Körperöffnung griff. Ganz abgesehen davon, dass spätestens dann das Mobiltelefon gefunden worden wäre, und sie mochte sich gar nicht ausmalen, was das nach sich gezogen hätte. Am Ende wäre darüber auch ihr Helfer ins Verderben gestürzt worden. Auch seinetwegen war es so wichtig, dass heute Abend alles glatt lief. Selina wusste genau, dass sie nur diese einzige Chance hatte. Entweder, es gelang heute. Oder es würde kein zweites Mal geben.
Sie wagte endlich wieder, sich vorwärts zu bewegen, und schlich durch den Raum. Sehr langsam, um bloß nirgends anzustoßen. Sie durfte nichts umwerfen, keinen Stuhl über den Boden rutschen, nichts berühren, nichts bewegen. Ihr kam plötzlich der Gedanke, dass sie keine Ahnung hatte, ob die Fenster womöglich mit einer Alarmanlage gesichert waren, und vor Schreck blieb sie stehen und überlegte. Sie konnte es nicht herausfinden, sie musste das Risiko eingehen. Oder das ganze Unternehmen abbrechen und in ihr Zimmer zurückkehren. Aber vor dem Umkehren hatte sie inzwischen genauso viel Angst wie vor dem Weitergehen. Sie war ungesehen und ungehört die zwei Treppen hinunter und über den Gang bis hierher gelangt, und damit hatte sie riesiges Glück gehabt. Es war keineswegs sicher, dass sie das ein zweites Mal schaffen würde, denn Sergej und Igor unternahmen in unregelmäßigen Abständen Kontrollgänge durch das Haus. Sie konnte ihnen jederzeit direkt in die Arme laufen, und dann gnade ihr Gott.
Okay, sie musste es auf die Alarmanlage ankommen lassen. Vielleicht konnte sie im Zweifelsfall trotzdem noch nach draußen gelangen und blitzschnell in der Dunkelheit untertauchen. Sie hörte plötzlich ein seltsames Geräusch und stellte gleich darauf fest, dass es ihre Zähne waren, die unkontrolliert aufeinanderschlugen. Sie hatte nicht gewusst, dass das sprichwörtliche Zähneklappern ein tatsächlicher körperlicher Reflex sein konnte. Im Grunde, wenn sie den Gedanken nur eine Sekunde lang zuließ, wusste sie, dass es Wahnsinn war, was sie tat, und dass die Chancen hoch standen, dass sie diese Nacht nicht überleben würde.
Sie kam am Schreibtisch vorbei. Taisias Laptop stand zusammengeklappt auf der Schreibtischunterlage. Ein ziemlich kleines Teil. Ehe Selina wirklich überlegte, weshalbsie das tat, griff sie danach. Es war kein Problem, es mitzunehmen. Wer wusste, was darauf gespeichert war. Es ging ihr vordergründig um nichts anderes als um Flucht, Überleben, um das Entkommen vor dem Wahnsinn. Aber dahinter, hinter ihrem reinen, unverfälschten Überlebensinstinkt, saß ein weiterer Gedanke: diese Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Irgendwann vielleicht. Irgendwie.
Ihr Atem ging keuchend und viel zu laut, als sie das Fenster erreichte. Von dem Moment an, da sie die Tür geöffnet hatte, bis hin zu diesem Augenblick waren höchstens drei Minuten vergangen, aber Selina kam es vor, als hätte sie eine erschöpfende, kräftezehrende, endlos anmutende Wanderung hinter sich. Sie war schweißgebadet, der warme Pullover, den sie trug, klebte an ihrem Körper. Sie fühlte sich gleichzeitig hellwach, elektrisiert und daneben zu Tode erschöpft. Dem Zusammenbruch nahe. Dabei war Zusammenbrechen das Letzte, was sie sich gerade jetzt erlauben durfte.
Ihre Hand glitt zum Fenstergriff, berührte ihn, bewegte ihn vorsichtig. Sie erwartete, jeden Augenblick das schrille Kreischen einer Alarmanlage zu hören, aber alles blieb ruhig. Sie drehte den Griff.
Es blieb immer noch alles ruhig.
Das Fenster ging auf.
Kalte, feuchte Luft strömte ins Zimmer. Selina atmete tief. Wie lange war es her, dass sie zuletzt draußen gewesen war, etwas anderes gerochen hatte als den abgestandenen, stickigen Geruch dieses alten Hauses? Obwohl es hier, in diesem stillgelegten Industriegebiet eines Pariser Vororts nur ein paar wenige Bäume und Büsche und kaum Grasflächen gab, konnte Selina den Duft nach Erde riechen, nach Tannennadeln, nach Wald, nach Holz. Ihr schossen die Tränen in die Augen, weil in dieser Sekunde die Erinnerung mit einer schmerzhaften Heftigkeit über sie kam: die Erinnerung an Spaziergänge mit ihren Eltern, früher, als sie noch klein gewesen war. Und dann später mit Sarko, ihrem Freund. Sie hatten an den Sonntagen lange Wanderungen mit seinem Hund unternommen. In den Wäldern hatte es gerochen wie hier, und vor dem Himmel über ihnen kreuzten sich die Äste der Bäume.
Wie hatte sie Sarko und seine schüchterne Liebe so gering schätzen können? So gering, dass sie sie, ohne mit der Wimper zu zucken, aufgegeben und weggeworfen hatte.
Nicht heulen, ermahnte sie sich. Nicht jetzt!
Sie kletterte auf die Fensterbank, spähte hinunter. Das Zimmer lag im Hochparterre, trotzdem würde der Sprung nicht allzu hoch sein. Sie musste geschickt aufkommen, durfte sich nichts verknacksen oder vertreten, weil jetzt alles darauf ankam, dass sie so schnell wie möglich davonlief. Einen Moment überlegte sie, den Laptop doch zurückzulassen, weil er womöglich ihren Sprung behinderte, doch dann entschied sie sich dagegen.
Sie sprang. Sie landete auf weicher Erde, hatte trotzdem den Eindruck, dass sie übermäßig laut aufkam. Jeder im Umkreis von zehn Kilometern musste gehört haben, dass hier eine Frau aus einem Fenster gesprungen war. Nur dass es im Umkreis von zehn Kilometern niemanden gab, der sie hätte hören können, außer Igor, Sergej und Taisia in dem Haus hinter ihr. Hier wohnte niemand mehr. Es gab leerstehende Geschäfte, eine verlassene Autowerkstatt, eine nicht fertiggestellte Shoppingmall. Sonst nichts. Wegen der furchtbaren Terroranschläge vom November herrschte noch immer eine hohe Polizei- und Militärpräsenz in Paris, jedenfalls hatte man das Selina berichtet, aber hier draußen war nichts davon zu bemerken.
Wenn Sergej und Igor sie hier in diesem Garten umbrachten, würde das niemand mitbekommen.
Aus dem Haus war kein Laut zu hören. Sie hatten immer noch nichts bemerkt.
Selina sprintete durch den kleinen Garten, kletterte über den Zaun, der zum Glück kein wirkliches Hindernis darstellte. Sie wagte einen Blick zurück: alles dunkel.
Es musste vor Kurzem geregnet haben, denn die Straße war nass. Tiefschwarz und glänzend. Beschienen von Straßenlaternen – von den wenigen, die noch nicht defekt waren.
Sie hatte sich den Weg eingeprägt: einfach die Straße entlang, an der ersten Abzweigung nach links. Nach ein paar hundert Metern würde sie an die Bauruine der einst geplanten Shoppingmall gelangen. Auf dem Parkplatz würde er warten. So war es vereinbart. Dass dort jemand mit einem Auto auf sie wartete. Sie konnte nur beten, dass er rechtzeitig da sein würde, er und vor allem sein Wagen waren ihre einzige Hoffnung.
Selina rannte los.
Heute weiß ich, dass meine Mutter schon früh begonnen hatte, dann und wann zu viel zu trinken, aber so richtig fing sie mit dem Alkohol an, als mein Vater uns verließ. Ich war damals sieben, und deshalb verstand ich noch nicht alles, aber rückblickend würde ich sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt in der verschärften Form losging. Wenn wir abends zusammen aßen, stand immer eine Weinflasche auf dem Tisch, und noch ehe ich ins Bett ging, war sie leer. Ich hatte keine Ahnung, was Alkohol eigentlich ist. Ich fand nur, dass der Inhalt der Flasche nicht gut roch, deshalb kam es mir seltsam vor, dass meine Mutter offenbar so wild hinter dem Zeug her war. Mit der Flasche und dem Glas setzte sie sich nach dem Essen vor den Fernseher und schlief ziemlich bald ein. Zwischendurch schreckte sie auf, dann schenkte sie sich nach und trank wieder. Früher war sie nicht so schnell eingeschlafen. Ich schloss daraus, dass der Wein, was immer er enthielt, ziemlich müde machte.
Da sie nie den Tisch abräumte, übernahm ich das. Mit der Zeit ging das immer schneller, weil es gar nicht mehr viel abzuräumen gab. Sie kochte nicht mehr, und sie kaufte auch kaum noch etwas Besonderes ein. Oft gab es das halbe, schon ziemlich trockene Baguette, das vom Frühstück übrig war, und dazu etwas Käse. Wenn ich Glück hatte. Manchmal auch nur Butter.
Da ich in der Schule zu Mittag aß, fiel es mir nicht so schwer, abends mit einer eher bescheidenen Mahlzeit auszukommen. Trotzdem fehlten mir die früheren Zeiten. Meine Mutter hatte wunderbare Gerichte gekocht, einen schönen Tisch im Wohnzimmer gedeckt und Kerzen angezündet, und mein Vater war von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte sich gefreut, uns zu sehen. Besonders mich. Damals ging ich noch in die École maternelle, die Vorschule, und er wollte immer ganz genau wissen, was ich dort erlebt und gemacht hatte. Er kannte die Namen der anderen Kinder, und wenn ich ihm von einem Streit mit meiner Freundin Bernadette erzählt hatte, dann wusste er das noch am nächsten Tag und erkundigte sich, ob wir uns wieder vertragen hätten.
Inzwischen ging ich in die Grundschule, in die École élémentaire, ich war immer noch mit Bernadette befreundet, und wir zerstritten uns jeden Tag von Neuem, aber meine Mutter interessierte das nicht. Wenn ich beim Abendessen davon anfing, sagte sie: »Oh Gott, Nathalie, immer dasselbe. Immer dasselbe. Warum werdet ihr nicht erwachsen?«
Dann nahm sie ein paar Schlucke Grand Marnier. Dieser klebrige, süße und ziemlich starke Likör wurde immer mehr zu ihrem Lieblingsgetränk. Nach einer Weile bekam sie glasige Augen davon und einen schwimmenden Blick. Dann war sie praktisch überhaupt nicht mehr ansprechbar und wimmelte jedes Thema ab, mit dem ich sie konfrontierte. Ich lernte daraus, dass ich wichtige Dinge unbedingt ganz früh am Abend zur Sprache bringen musste, dann, wenn sie noch erreichbar war. Wenn ich Geld für einen Schulausflug oder neue Hefte brauchte zum Beispiel, oder wenn sie ein Diktat unterschreiben musste.
Wir lebten in Metz, der Hauptstadt von Lothringen. Ziemlich nahe der deutschen Grenze, es gibt hier viele Menschen, die in Deutschland arbeiten und Deutsch sprechen. Als wir in der zweiten Klasse erstmals eine Fremdsprache auswählen durften, nahm ich Deutsch. Dazu riet mir noch mein Vater. Das war kurz bevor er uns verließ.
Meine Eltern haben nie gestritten, zumindest nicht so, dass ich es hätte mitbekommen können, und daher hatte ich die Trennung nicht kommen sehen. Später erfuhr ich, dass vieles im Vorfeld schon nicht stimmte, aber dass ich in meiner Naivität nie die richtigen Schlüsse zog. Ich fand es einfach nur schön, dass meine Mutter jedes Abendessen so festlich gestaltete, und es war ganz normal für mich, dass sie sich vorher umzog, auffällige Kleider, zarte Strümpfe, hochhackige Schuhe trug. Sie schminkte sich sorgfältig und sprühte Parfüm an ihren Hals. Ich beneidete sie um ihre schönen Kleider, und ich sah nicht die Verzweiflung, mit der sie sich in Schale warf, um einen Mann für sich zu begeistern, der wohl schon längst nicht mehr allzu viel Interesse für sie hatte. Irgendwann, als ich älter war, vielleicht dreizehn oder vierzehn, erzählte sie mir, dass er sie schon betrogen hatte, als sie mit mir schwanger war, und dass es danach immer weitergegangen war. Wenn man sie hörte, gewann man den Eindruck, dass er mit nahezu jeder Frau, die seinen Weg kreuzte, sofort ein Verhältnis anfing. Wahrscheinlich dichtete sie ihm manches an, was nicht stimmte, aber oft dürfte sie mit einem Verdacht auch richtiggelegen haben. Er war sehr gutaussehend und charmant, und alles, was mich an ihm so begeisterte, sein Interesse, seine Zugewandtheit, seine gute Laune und Liebenswürdigkeit, brachte er auch anderen Menschen entgegen. Besonders natürlich Frauen.
Mein Vater arbeitete als Abteilungsleiter in einer Firma, die Unterwäsche produzierte. Wie passend! Meine Mutter bekam die herrlichsten Dessous geschenkt, und sie kosteten keinen Cent, aber sie nützten ihr trotzdem nichts.
Als es mit dem Alkohol bei ihr immer schlimmer wurde, ahnte ich noch nicht, dass die Sucht sie und unser beider Verhältnis zueinander völlig zerstören würde. Ich war ein trauriges kleines Mädchen, das seinen Vater verloren hatte.
»Wo ist er denn hingegangen?«, fragte ich meine Mutter tränenüberströmt, nachdem sie mir eröffnet hatte, er sei weg und werde nicht wiederkommen.
Meine Mutter war kreideweiß im Gesicht und hielt ein Glas in der Hand, in das sie gerade zum dritten Mal einen großzügigen Schwung Grand Marnier nachfüllte und hinunterkippte.
»Er hat sich für die andere entschieden«, sagte sie. »Endgültig.«
Offensichtlich hatte es seit einiger Zeit nicht mehr so viele wechselhafte Affären gegeben, sondern es hatte sich die viel größere Katastrophe angebahnt: Mein Vater hatte begonnen, sich ernsthaft in eine andere Frau zu verlieben.
»Wer ist sie?«, fragte ich.
»Ein Unterwäschemodel«, sagte meine Mutter und schenkte sich erneut nach. »Zwanzig Jahre alt.«
Für mich mit meinen sieben Jahren war zwanzig genauso alt und genauso weit weg wie vierzig oder fünfzig. Ich konnte absolut nicht begreifen, warum er uns, seine Familie, wegen dieser Frau verließ.
»Besucht er uns noch?«
»Mein Gott, Nathalie, was für eine Frage«, sagte meine Mutter, leerte das Glas und griff wieder nach der Flasche.
Das Ende dieses Vormittages im Spätsommer 2002 war, dass sie schließlich ins Bett schwankte und sofort einschlief.
Meinen Vater sah ich nicht mehr. Er war mit dem zwanzigjährigen Unterwäschemodel nach Paris gezogen. Er überwies uns regelmäßig Geld.
Aber darüber hinaus existierten wir nicht mehr für ihn.
SOFIA, BULGARIEN, NOVEMBER 2015
1
Sofia war noch schlimmer als Plovdiv, dabei hatte hier alles gut werden sollen. Kiril hatte geglaubt, er werde hier Arbeit finden können, so wie Dano, sein Freund, der Plovdiv schon ein knappes Jahr zuvor verlassen hatte. Dano war immer der Mutige, der Entschlussfreudige gewesen, während Kiril zögerte und zauderte. Dano hatte sofort eine Anstellung am Flughafen gefunden und von dem Leben in Sofia geschwärmt.
»Hier ist wirklich alles besser. Hier gibt es echte Chancen. Du musst dich nur endlich trauen, diesen Schritt zu tun!«
Kiril hatte sich aufgerafft, als die Situation in Plovdiv nicht länger tragbar gewesen war. Als die kleine Gärtnerei am Stadtrand, für die er seit Jahren arbeitete, schloss und er auf der Straße stand. Als alle Versuche, eine neue Arbeit zu finden, scheiterten. Als ihm nach neun Monaten kein Arbeitslosengeld mehr ausgezahlt wurde und das Kindergeld kaum ausreichte, ihn, seine Frau Ivana und die fünf Kinder satt zu bekommen. Als er drei Monatsmieten im Rückstand war und der Vermieter mit Rauswurf drohte.
Ivana hatte von morgens bis abends geweint.
»Ich will nicht nach Stolipinovo, Kiril. Ich habe solche Angst. Ich will dort nicht hin!«
Stolipinovo war das Armenviertel der Stadt. Es war das, womit man den Kindern drohte, wenn sie in der Schule nicht ordentlich lernten. Wer hier landete, war ganz unten angekommen. Graue, angeschlagene, kaputte Plattenbauten. Feuchte, verdreckte, eiskalte Wohnungen. Müllberge auf den Straßen. Scharen von verwahrlosten Kindern, von denen niemand wusste, ob sie irgendwo noch ein Zuhause hatten oder schon lange nur noch draußen lebten. Magere, struppige, kranke Hunde, die auf der verzweifelten Suche nach Nahrung herumstreiften. Gestank. Schmutz. Trostlosigkeit.
Es kamen immer wieder einmal Journalisten aus dem Westen nach Stolipinovo. Sie machten Bilder, dokumentierten das Elend. Kiril konnte sich vorstellen, mit welchem Schauer die reichen Menschen in Deutschland, Frankreich oder England diese Bilder betrachteten. Bulgarien, das Armenhaus Europas. Wer es nicht glaubte, der musste bloß hierherkommen.
Nach der Kündigung ihrer Wohnung wäre Stolipinovo die nächste Station gewesen, und daher hatte Kiril alles auf eine Karte gesetzt, seine üblichen Vorbehalte und Ängste über Bord geworfen und war mit der ganzen Familie nach Sofia gezogen. Was Dano geschafft hatte, musste ihm doch auch gelingen. Dano hatte ihm ein bisschen Geld geliehen und für ihn gebürgt, daher bekamen sie eine Wohnung, obwohl Kiril noch keine Arbeit nachweisen konnte. Die Wohnung befand sich ganz oben in einem mehrstöckigen Wohnhaus, das in Kirils Augen so aussah, als hätte man lauter eingedellte, hässliche Schuhkartons übereinandergestapelt. Irgendwie wirkte das ganze Bauwerk schief. Das war es wahrscheinlich nicht, aber es sah so aus.
Die Wohnung war winzig, zwei Zimmer für sieben Personen. Die Kinder schliefen alle in dem einen Raum, Kiril und Ivana klappten nachts die Wohnzimmercouch für sich auf. Es gab noch eine kleine Küche, in die sie aber nicht alle auf einmal hineinpassten. Sie nahmen ihre Mahlzeiten daher in zwei Schichten zu sich. Viel war es ohnehin nicht, was Ivana auf den Tisch brachte.
Im Sommer, so wusste Kiril, würden sich die Kinder die meiste Zeit draußen auf der Straße herumtreiben, und das Leben hier oben würde ein wenig erträglicher werden. Aber jetzt war Ende November, es hatte noch nicht geschneit, aber es wurde täglich kälter. Ein harter, frostklirrender Winter lag vor ihnen, und er würde sich bis tief in den März hineinziehen.
Und noch immer hatte Kiril keine Arbeit.
Er hatte in den letzten Wochen gemerkt, dass sich Danos bislang freundschaftlicher Ton ihm gegenüber veränderte. Dano hatte ihnen wirklich geholfen, aber nun, da sich die Lage seit Monaten nicht besserte, wurde er ungeduldig. Kiril musste ihn weiterhin ständig um Geld anpumpen, wegen der Miete, wegen des Essens, und eigentlich brauchten die Kinder dringend neue Stiefel für den Winter, aber danach wagte er schon gar nicht mehr zu fragen. Dano hatte bereits angedeutet, dass die Schulden langsam ein Ausmaß angenommen hatten, das ihn daran zweifeln ließ, ob Kiril jemals in der Lage sein würde, den Betrag zurückzuzahlen.
»Und schenken«, sagte Dano, »schenken kann ich dir das alles wirklich nicht!«
»Ich weiß«, sagte Kiril verzweifelt, »aber es ist wie verhext. Ich laufe mir die Füße blutig auf der Suche nach Arbeit, aber ich finde nichts.«
Sie saßen in einer Kneipe. Draußen war es kalt, windig und dunkel, drinnen viel zu warm und völlig überfüllt. Es stank nach Zigarettenrauch, nach Schweiß, nach Alkohol. Hin und wieder kamen oder gingen Leute, dann drang ein Schwall frischer Luft durch die Tür, und Kiril atmete dankbar auf. Er hatte Kopfschmerzen, und er hatte seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Die letzte Nacht hatte er nicht geschlafen, weil Ivana Stunde um Stunde geweint hatte. Ihm war nichts eingefallen, um sie zu trösten, außer: »Ich gehe noch mal zu Dano. Vielleicht hilft er uns.«
Deshalb saß er jetzt hier. Er hatte Dano zu Hause besuchen wollen, aber Dano hatte Lust auf einen Kneipenbesuch. Natürlich hatte Kiril gezögert, aber Dano hatte schließlich gesagt: »Ich zahle das Bier. Also komm mit!«
Kiril war schon nach den ersten beiden Schlucken schwindelig. Er hätte dringend als Grundlage etwas zu essen gebraucht, aber er wagte nicht, darum zu bitten. Am Nachbartisch saß ein Mann und löffelte irgendein Eintopfgericht, dessen Geruch Kiril fast die Tränen in die Augen trieb.
Er war so schrecklich hungrig.
»Hör zu, Dano, ich weiß, du hast uns schon viel zu oft geholfen, aber im Augenblick … Es geht einfach nicht weiter. Ich kann die Miete für November nicht zahlen. Ich kann kaum noch etwas zu essen kaufen. Ivana weint sich die Augen aus. Die Kinder kratzen auf ihren leeren Tellern herum und schauen mich aus großen Augen an, und ich kann ihnen nur winzige Portionen zuteilen. Sie sind alle andauernd krank, weil sie in viel zu dünnen Sachen draußen herumlaufen. Ich weiß nicht, was werden soll, wenn sie uns die Heizung abstellen. Ich weiß im Grunde überhaupt nichts mehr. Wir sind am Ende. Ich bin am Ende.« Jetzt kamen die Tränen tatsächlich. Mit einer hilflosen, fast kindlichen Geste wischte Kiril sie weg. Nicht heulen. Bloß nicht heulen. Er ahnte, dass er Dano dadurch nicht mitleidiger stimmen, sondern verärgern würde.
»Du hast einfach zu viele Kinder«, sagte Dano.
Kiril nickte demütig, obwohl er diesen Kommentar unfair und völlig nutzlos fand. »Ich hatte jahrelang die Arbeit in der Gärtnerei. Ich war weiß Gott nicht gut bezahlt, aber irgendwie reichte es immer. Auch für fünf Kinder.«
»Ja, aber man kann nicht ein Kind nach dem anderen in die Welt setzen und darauf vertrauen, dass man immer genug verdienen wird, sie alle durchzubringen«, sagte Dano. »Und das Kindergeld – das reicht doch vorne und hinten nicht!« Er selbst hatte weder Frau noch Kinder, was sein Leben natürlich leichter machte.
Aber auch unsteter und einsamer, dachte Kiril, sagte es jedoch nicht.
»Ich kann meine Kinder aber nicht mehr abschaffen«, meinte er stattdessen und lachte nervös, weil das ja ein wirklich absurder Gedanke war.
Dano seufzte lange und tief, nahm einen großen Schluck Bier, stellte das Glas ab und sah seinen Freund eindringlich an. »Es kann so nicht weitergehen, Kiril. Ich kann dir nicht mehr helfen. Inzwischen finanziere ich praktisch seit Monaten nebenher eine siebenköpfige Familie, und es ist überhaupt kein Ende in Sicht. Ich meine, ernsthaft, du weißt auch, dass das die beste Freundschaft überstrapaziert.«
»Wir müssen nur noch den Winter durchstehen, Dano. Im Winter ist es viel schwieriger, Arbeit zu finden. Wenn der Frühling kommt …«
»Ach, hör auf, mach dir nichts vor! Wann seid ihr nach Sofia gekommen? Im April! Mitten im Frühling. Und du hast nichts gefunden. Den ganzen Sommer hindurch nicht. Jetzt ist es Herbst. Und jetzt denkst du, im nächsten Frühjahr sieht alles anders aus? Verdammt, Kiril, sei doch nicht so naiv!«
»Du hast mich doch überredet, nach Sofia zu kommen! Du hast gesagt, dass …«
»Ach, jetzt willst du mir die Schuld geben? Nach allem, was ich für euch getan habe? Wo wart ihr denn in Plovdiv? Da ging doch überhaupt nichts mehr. Sofia ist eine Chance gewesen, mehr nicht. Und du verstehst es eben nicht, Chancen zu nutzen!«
»Ich versuche doch alles. Ich ….«
»Mir hat neulich ein Kollege auf der Arbeit was Interessantes erzählt«, sagte Dano. »Etwas wirklich Interessantes. Er hatte im Handumdrehen ein paar tausend Euro verdient. Ich betone: Euro. Nicht Leva.«
Kiril starrte ihn hoffnungslos an. Das durchschnittliche Monatseinkommen eines Menschen in Bulgarien liegt umgerechnet bei etwa 300 Euro. Ein paar tausend Euro klangen für ihn wie ein Märchen. Ein böses Märchen. Denn mit rechten Dingen konnte so etwas nicht zugehen.
Dano senkte seine Stimme, was eigentlich unnötig war. Der Geräuschpegel im Raum war so hoch, dass ohnehin kaum jemand sein eigenes Wort verstand, geschweige denn hätte hören können, was an einem Nebentisch gesprochen wurde.
»Gib deinen Kindern eine Chance«, sagte Dano. »Gib wenigstens einem von ihnen eine Chance.«
Kiril hatte keine Ahnung, was er meinte.
2
Die Frau hieß Vjara und sah vertrauenerweckend und respekteinflößend aus. Keinesfalls unsympathisch. Sie hatte eine angenehme Stimme, ein schönes, intelligentes Gesicht, und sie trug ein elegantes graublaues Kostüm, das von einem Designer stammen musste, keinesfalls aus einem der Kaufhäuser, in denen Ivana ihre Kleidung kaufte. Sie verfügte über gute Umgangsformen: An der Wohnungstür hatte sie unaufgefordert ihre nassen Stiefel abgestreift, ein paar farblich zum Kostüm passende Wildlederschuhe aus der Handtasche gezaubert und an die schlanken Füße gezogen. Sie saß nun im Wohnzimmer auf dem durchhängenden Sofa, auf dem Kiril und Ivana nachts schliefen, und hielt mit beiden Händen den Kaffeebecher umklammert, den sie vor sie hingestellt hatten. Sie wärmte sich daran. Es war kalt im Zimmer.
Danos Arbeitskollege hatte Vjara zu ihnen geschickt. Kiril hatte tagelang mit sich und mit Ivana gerungen, ehe er einem Treffen zugestimmt hatte. Inzwischen stand der Dezember vor der Tür, noch immer lag kein Schnee, aber die Luft war feucht und kalt. Der Vermieter hatte eine drohend formulierte Mahnung geschickt. Die Heizung war wegen des Mietrückstands abgeschaltet.
Die Situation hätte verzweifelter und aussichtsloser kaum noch werden können.
»Es geht also um Ihre Tochter Ninka«, sagte Vjara. »Sie ist siebzehn Jahre alt, wenn ich richtig informiert wurde?«
»Ja«, sagte Kiril.
Ivana sagte nichts. Sie fixierte die schöne fremde Frau nur mit einer Intensität, als wollte sie am liebsten tief in ihren Kopf eindringen, um jeden Gedanken, jedes Gefühl darin mit allen Sinnen zu erfassen.
»Dürfte ich sie kennenlernen?«, fragte Vjara.
Kiril stand auf, ging ins Nebenzimmer und kehrte mit Ninka, die dort schon gewartet hatte, zurück. Sie hatte sich fein gemacht, so gut es ging: Sie trug ein etwas zerschlissenes, aber sehr figurbetontes schwarzes Baumwollkleid mit weißem Spitzenkragen und weißen Spitzenmanschetten an den Ärmeln, eine hautfarbene Strumpfhose und etwas unpassende braune Ballerinas mit abgestoßenen Spitzen. Ihre frisch gewaschenen blonden Haare fielen fast bis zu ihrer schmalen Taille hinab. Sie sah Vjara aus tiefdunklen Augen an, mit einem Blick, der gleichermaßen ängstlich wie erwartungsvoll war. Vjara stand auf und streckte ihr die Hand hin: »Guten Tag, Ninka. Ich bin Vjara.«
Ninka lächelte scheu. »Guten Tag.«
Vjara wandte sich an Kiril. »Ihre Tochter ist wunderschön. Es wäre wirklich schade, wenn sie …«
»Ja?«, fragte Ivana.
»Wenn sie nichts daraus machen würde. Für ein Gesicht wie ihres werden Kosmetikkonzerne und Modehersteller ein Vermögen zahlen. Sie hat etwas sehr Besonderes. Es ist gut, dass Sie sich an mich gewandt haben.«
»Dieser Freund von mir … Dano… er sagt, dass Sie eine der größten Agenturen für Models in Westeuropa leiten?«
»So ist es. Sitz in Rom. Ich bin jedoch oft hier in Bulgarien, meiner Heimat. Weil es hier besonders schöne Mädchen gibt. Wobei ich sagen muss«, sie schaute Ninka erneut prüfend an, »eine so schöne wie sie habe ich lange nicht gesehen.«
Ninka wusste gar nicht mehr, wo sie hinblicken sollte. Ivana machte ihr ein Zeichen mit den Augen, und Ninka verließ erleichtert das Zimmer. Ihre Wangen glühten. Fotomodell! Seitdem ihre Eltern ihr zwei Tage zuvor von dieser Möglichkeit für sie berichtet hatten, kam sie sich vor wie in einem Traum.
»Sie ist auch klug«, bemerkte Kiril, als er und Ivana wieder mit Vjara alleine waren. »Und ehrgeizig.«
»Ich verstehe«, sagte Vjara. »Weil sie so klug und ehrgeizig ist, wollen Sie ihr die Chance auf ein gutes Leben ermöglichen.«
»Ja. Ich bin sicher, sie kann wirklich etwas aus ihrem Leben machen. Nur … hier hat sie die ungünstigsten Startbedingungen.«
»Entschuldigen Sie, wenn ich das so deutlich sage«, sagte Vjara, »aber hier hat sie praktisch überhaupt keine Startbedingungen. Nach allem, was mir von dem Kollegen Ihres Freundes Dano übermittelt wurde …« Sie hüstelte taktvoll, setzte sich auf das Sofa und griff hastig nach ihrem Kaffeebecher, dem einzigen Gegenstand im Raum, der noch ein wenig Wärme ausstrahlte.
»Ja«, sagte Kiril. Was sollte er noch versuchen, irgendeinen Schein zu wahren? »Im Moment sind wir total am Ende. Wir wissen nicht mehr weiter. Ich kann für keines meiner Kinder mehr wirklich sorgen, für meine Frau nicht, für mich nicht. Ich sehe keinen Ausweg mehr.« Er musste schlucken, weil ihm schon wieder die Tränen in die Augen traten. Er war nervlich inzwischen so angeschlagen, dass er sich allmählich in eine richtige Heulsuse verwandelte.
»Keinen Ausweg«, wiederholte er. »Außer …«
»Sie haben die richtige Entscheidung getroffen«, sagte Vjara mit sanfter Stimme. »Ich kann sehr gut verstehen, dass dies kein leichter Schritt für Sie ist. Aber Sie ermöglichen Ihrer Tochter Ninka eine sichere und erfolgreiche Zukunft. Und damit wird ja auch die Situation für Ihre anderen Kinder besser.«
Erstmals schaltete sich Ivana in das Gespräch ein. »Und es wird ihr dort wirklich gut gehen? Sie ist erst siebzehn, wissen Sie, und sie war noch nie von daheim fort. Sie hatte noch keinen Freund. In mancher Hinsicht ist sie … fast noch ein Kind.«
»Wir passen wirklich gut auf die Mädchen auf«, sagte Vjara mit ihrer weichen, sanften Stimme. »Wir wollen, dass sie eine große Karriere machen. Als Models, vielleicht sogar als Schauspielerinnen. Wir hüten sie wie unsere Augäpfel.«
»Dano sagte … dass die Tochter eines Kollegen vor Kurzem in den Westen gereist ist. Dadurch kam er auf Ihre Agentur. Wissen Sie, wie es dem Mädchen geht?«
»Hervorragend natürlich. Allen unseren Mädchen geht es hervorragend.«
»Könnten wir Ninka auch besuchen?«
Erstmals zögerte Vjara eine Sekunde. »Darüber kann man später sprechen«, sagte sie dann. »Erst einmal ist es wichtig, dass sich Ninka in ihrem neuen Leben zurechtfindet. Sie wird oft gebucht sein, heute Mailand, morgen London, übermorgen Rom oder Paris. Viel Freizeit bleibt nicht. Aber sie wird dieses Leben lieben, das kann ich Ihnen schon jetzt versprechen. Sie lieben es alle.«
»Gott, wie sehr wünsche ich es ihr«, sagte Kiril inbrünstig.
Nach dieser Bemerkung senkte sich ein unbehagliches Schweigen über den Raum, ein Schweigen, das angefüllt war mit verschämter, ungeäußerter Erwartung.
Vjara wusste, welchen Punkt die Eltern nicht anzusprechen wagten – den Punkt, der die ganze Sache für sie so ungeheuerlich machte, den sie aber in ihrer augenblicklichen Lage nicht unbeachtet lassen konnten.
»Dreitausend Euro«, sagte sie. »Eineinhalbtausend bekommen Sie. Die andere Hälfte Ihre Tochter.«
Endlich war es ausgesprochen. Kiril merkte, dass er den Atem angehalten hatte. Er blickte zu Ivana hinüber. Eineinhalbtausend Euro waren unvorstellbar viel Geld. Eineinhalbtausend Euro bedeuteten, dass sie bis in den Sommer hinein die Miete bezahlen konnten. Sie konnten die Wohnung heizen. Sie konnten warme Sachen für die verbleibenden vier Kinder kaufen. Es würde kein Problem mehr sein, anständiges und gesundes Essen auf den Tisch zu bringen. Kiril konnte in Ruhe auf Arbeitssuche gehen. Ihre gesamte Situation würde sich auf eine Art und Weise entspannen, wie sie es sich kaum hätten träumen lassen.
Dafür verkaufen wir unsere Tochter.
Auch dieser Satz stand im Raum, dröhnend laut, obwohl niemand die Worte in den Mund genommen hatte.
Auch Vjara konnte ihn hören. »Ihre Tochter bekommt das Geld als Vorschuss auf ihre Arbeit. Es ist Geld, das sie im Handumdrehen verdienen wird. Wir treten nur in eine Vorleistung, damit sie nicht ganz und gar mittellos in den Westen reist. Der Anteil für Sie ist unsere Anerkennung für das, was Sie geleistet haben, als Sie Ihre Tochter großgezogen haben. Später wird das alles mit unserer Provision verrechnet. Sie können ganz beruhigt sein. Hier läuft kein anstößiges Geschäft ab. Das würden wir nicht wollen.«
Kiril, der den Atem angehalten hatte, atmete tief und hörbar aus. Es war ein guter Satz, den ihre Besucherin da gesagt hatte. Hier läuft kein anstößiges Geschäft ab. Ein Satz, an dem man sich würde festhalten können.
Zum ersten Mal an diesem Tag – und genau genommen zum ersten Mal seit vielen Wochen – verzog Kiril seinen Mund zu etwas, das ansatzweise an ein Lächeln erinnerte. Siehst du, sagte der Blick, den er seiner Frau zuwarf, Dano hat es uns doch versichert. Dass das alles seriös ist. Dass wir diesen Menschen vertrauen können.
Ivana erwiderte seinen Blick zwar nicht ihrerseits mit einem Lächeln, aber doch mit einem neu erwachten Schimmer der Hoffnung in den Augen. Der Hoffnung, dass sie das Richtige taten.
»Die Mädchen reisen mit dem Auto in den Westen«, sagte Vjara. »Ich hätte für übermorgen einen Fahrer. Es könnte jetzt also alles recht schnell gehen.«
»So schnell?«, fragte Ivana geschockt. »Noch vor Weihnachten?«
»Zu Weihnachten schickt Ihre Tochter Ihnen dann schon ein Paket mit wunderbaren Überraschungen darin«, sagte Vjara lächelnd.
Kiril legte Ivana die Hand auf den Arm. »Sie hat recht. Es wird nur schwerer, wenn wir es vor uns herschieben.«
»Aber … so schnell …«
Kiril verkniff sich den Hinweis, dass sie ab der nächsten Woche auf der Straße saßen, wenn sie nicht unverzüglich die Miete zahlten. Ivana wusste das ohnehin. Das Schreiben des Vermieters war eindeutig gewesen und hatte letztlich den Ausschlag dafür gegeben, dass sich Ivana auf das Treffen mit Vjara schließlich eingelassen hatte.
»Aber umso schneller kommt Ninka aus der Kälte hier heraus«, sagte er, »und beginnt ein neues, besseres Leben.«
Ivana nickte. Sie stand auf und verließ das Zimmer. An ihren bebenden Schultern erkannte Kiril, dass sie weinte.
»Für die Mütter ist es immer schwer«, sagte Vjara mitfühlend.
Für die Väter auch, dachte Kiril.
»Wir tun doch das Richtige?«, fragte er ängstlich.
»Das tun Sie mit absoluter Sicherheit«, bestätigte Vjara.
LYON, FRANKREICH, MITTWOCH, 9. DEZEMBER
Nathalie fand den Mann widerlich und unappetitlich, aber nachdem sie jetzt seit vier Stunden in dem Hauseingang in einer der zahlreichen Seitenstraßen des Quai Perrache in Lyon kauerte, Schutz vor dem kalten Regen suchend und mit weichen Knien vor Hunger, war sie bereit, sich von nahezu jedem ansprechen zu lassen, selbst wenn derjenige wie ein Triebtäter aussah und penetrant nach Alkohol roch.
Verpiss dich, hätte sie zu einem wie ihm normalerweise gesagt. Jetzt aber versuchte sie, ein freundliches Gesicht zu machen und ihn anzulächeln. Sie spürte, dass das Lächeln ziemlich schief ausfiel: Sie war einfach zu müde, zu hungrig und zu verfroren.
Und kaputt und voller Angst.
»Hätten Sie vielleicht ein paar Cent für mich?«, fragte sie. Der Mann kam vom Einkaufen, denn er trug eine Plastiktüte in der Hand, in der es verräterisch klirrte. Also musste er Geld dabeihaben. Wenn er es nicht alles in Alkohol investiert hatte.
Er grinste. »Nichts dabei. Alles weg.«
Sie glaubte ihm das nicht, aber sie konnte ihm nichts Gegenteiliges beweisen. Sie krümmte sich leicht nach vorne: Sie hatte nicht gewusst, dass Hunger so wehtat. Es war, als bohrten sich Messer in ihre Eingeweide.
Obwohl der Kerl vor ihr so versoffen war, hatte er gemerkt, dass sie sich zusammenkrampfte. »Lange nichts mehr gegessen, oder?«, fragte er, ohne dabei mit dem Grinsen aufzuhören.
Warum sollte sie ihm etwas vorspielen? »Nein«, gab sie zu.
»Wenn du mitkommst zu mir, kann ich dir ein Brot machen. Und eine Suppe zum Aufwärmen müsste auch noch da sein.«
Die Erwähnung sämtlicher Reizbegriffe – Brot, Suppe und Aufwärmen – ließ Nathalie fast stöhnen. Sie ahnte, dass die Wohnung des Fremden verdreckt sein würde und dass es nicht viel Spaß machte, von seinen wahrscheinlich schmierigen Tellern relativ vergammelte Lebensmittel zu essen, aber sie war zu einer Menge Zugeständnisse bereit, wenn dafür die Krämpfe in ihrem Magen aufhörten und wenn ihr wenigstens für eine halbe Stunde etwas wärmer würde.
»Wie heißt du?«, fragte der Mann.
Nathalie wusste, dass sie auf keinen Fall ihren richtigen Namen nennen durfte. Sie wollte nicht das geringste Risiko eingehen.
»Aurelie«, log sie.
So hieß die Frau, die sie von einem Autobahnrastplatz kurz hinter Dijon bis nach Lyon mitgenommen hatte. Es war die beste Zeit des Tages gewesen: das geheizte Auto, gegen dessen Scheiben der Regen sprühte, die weichen Polster, ganz leise Musik aus dem Radio. Vor der Frau hatte sie keine Angst haben müssen, sie war nett gewesen, hatte sich vorgestellt und ihr gesagt, sie solle möglichst nicht weiterhin per Anhalter reisen. »Das ist zu gefährlich. Wo willst du denn hin?«
»In die Provence«, hatte Nathalie geantwortet.
Dort befand sich das Apartment. Der Treffpunkt.
Leider fuhr Aurelie nur bis Lyon, wo ihre Eltern lebten, die sie für eine Woche besuchen wollte. Nathalie hatte gehofft, Aurelie würde ihr vielleicht anbieten mitzukommen, oder sie würde mit ihr mittagessen gehen, aber die junge Frau hatte es dann schließlich eilig gehabt und sie gleich hinter dem großen Tunnel, durch den die Autobahn führte, aussteigen lassen, ehe sie selbst Richtung Stadtmitte abbog.
»Ich würde dir wirklich raten, den Zug zu nehmen«, sagte sie zum Abschied. »Mit dem TGW bist du ganz schnell in Aix.«
»Gute Idee«, sagte Nathalie und verschwieg, dass sie kein Geld hatte, sich die teure Fahrkarte für den Hochgeschwindigkeitszug zu kaufen. Sie hatte überhaupt kein Geld mehr, null, nichts, nicht einen Cent. Gestern Abend hatte sie sich einen Burger und ein Wasser gekauft, und seitdem war sie vollständig pleite.
So pleite und hungrig, dass sie nun mit diesem widerlichen Typ nach Hause gehen und darauf hoffen würde, dass sie dort tatsächlich ein Stück Brot und eine Suppe bekam.
»Aurelie«, sagte er. »Schöner Name. Ich heiße Yves.«
»Hallo, Yves.«
»Dann komm mal mit«, sagte er.
Nathalie erhob sich zögernd, weil sie nicht wusste, ob ihre Beine sie tragen würden. Einen Moment lang glaubte sie, ihre Knie würden wegknicken, aber überraschenderweise stand sie dann doch ohne sichtbares Zittern aufrecht auf der Straße. Rue Marc-Antoine Petit, wie sie gelesen hatte. Vorne am Quai Perrache gingen zwei Frauen auf und ab, die eindeutig auf Kundschaft warteten. Schon vorher, ehe sie bis zu diesem Hauseingang geschlichen war und sich dort niedergekauert hatte, war ihr aufgefallen, dass es sie in ein offenkundig etwas zwielichtiges Viertel verschlagen hatte: Einige Häuser wirkten äußerst heruntergekommen, andere schienen gerade saniert worden zu sein. Ungeachtet des Regens hing Wäsche auf etlichen Balkonen, und irgendwo in einer der Wohnungen stritten ein Mann und eine Frau so lautstark, dass ihre Stimmen sogar den Lärm der dichtbefahrenen Autoroute du Soleil übertönte, die zwischen Quai und Rhone in Richtung Mittelmeer führte. Es gab eine Bäckerei und ein kleines Restaurant, daneben aber auch zahlreiche Geschäfte, die längst aufgegeben und deren Schaufenster mit Brettern vernagelt waren. Zwischen ein paar schmuddeligen Kneipen streiften Männer herum, denen man auf Kilometer hin ansah, dass es sich um Drogendealer handelte. Sie schienen sich nicht um die Tatsache zu scheren, dass es auf dem gleich hinter dem Viertel liegenden Bahnhof von Polizei wimmelte: Frankreich stand noch ganz und gar im Zeichen der Anschläge vom 13. November, noch immer war der Ausnahmezustand über das Land verhängt. Die hohe Präsenz von Polizei und Militär überall war nicht zu übersehen. Eine Gefahr auch für Nathalie: Wenn sie noch lange hier saß, würde sie einem Polizisten auffallen und dann womöglich aufgegriffen werden.
Sie musste weg von der Straße.
Sie hoffte, dass Yves nicht davon ausging, sie werde sich für ihr Essen erkenntlich zeigen, denn auch wenn sie vor Hunger fast wahnsinnig war und keine Ahnung hatte, wie es weitergehen sollte, würde sie doch auf gar keinen Fall mit ihm ins Bett gehen. Vielleicht kam sie noch an den Punkt, an dem sie selbst dazu bereit sein würde, aber noch hatte sie ihn nicht erreicht. Sie ekelte sich vor dem Mann, und außerdem war sie sicher, dass er irgendwelche grässlichen Krankheiten übertrug. Das roch sie förmlich.
»Nur essen«, vergewisserte sie sich.
Er grinste anzüglich.
»Ich kann nicht bezahlen«, fügte sie hinzu. »Weder mit Geld noch sonst irgendwie.«
»Kommst du jetzt mit oder nicht?«, fragte Yves.
Rasch checkte sie ihre Chancen, falls er zudringlich werden würde. Er war ein gutes Stück größer als sie, aber er war sehr dünn und wirkte nicht besonders kräftig. Zudem hatte er getrunken. Sie hoffte, dass sie im Zweifelsfall mit ihm fertigwerden könnte.
Sicherheitshalber schaltete sie unauffällig ihr Handy wieder ein. Um den Akku zu schonen, hatte sie es zwischendurch ausgeschaltet, aber wer wusste, ob sie nun nicht doch plötzlich Hilfe würde rufen müssen. Obwohl sie sich gerade an die Polizei eigentlich keinesfalls wenden durfte.
Sie hielt ihre kleine Handtasche, in der sich ihr Pass, ihr Handy und ihr leeres Portemonnaie befanden, fest umklammert. Ihre allerletzten Besitztümer.
Dann folgte sie dem Fremden in dessen Wohnung.
LA CADIÈRE, FRANKREICH, MONTAG, 14. DEZEMBER
Es regnete in Strömen. Es regnete seit dem frühen Morgen, und es sah nicht so aus, als würde es an diesem Tag noch irgendwann aufhören. Meer und Himmel verschwammen zu einer wabernden, undurchdringlichen grauen Fläche. Der Bec de l’Aigle, der wie ein gewaltiger Adlerschnabel geformte, weit ins Mittelmeer ragende Felsen, war nicht mehr zu sehen hinter den Regenschleiern, ein Anzeichen dafür, dass sich das schlechte Wetter nicht allzu schnell verziehen würde.
Das Tal lag nass und grau und seltsam leblos im matten Licht dieses Dezembertages.
Es überraschte Simon immer wieder von Neuem, wie schnell sich die Provence, dieses idyllische Kleinod unter blauem Himmel und strahlender Sonne, in einen Ort der Trostlosigkeit verwandeln konnte, sowie das Wetter umschlug. Es war dann, als verlöre sie in Sekundenschnelle alle Farben, alle Schönheit, alles, was sie anziehend und begehrenswert machte.
Als wäre sie vollkommen angewiesen auf die Sonne, dachte er, und ohne sie ein Nichts.
Er stand an dem großen Glasfenster des Hauses, das seinem Vater gehörte, und blickte hinaus in Richtung Meer, ohne das Meer wirklich sehen zu können. Auf der Autobahn im Tal bewegten sich die Fahrzeuge wie kleine Spielzeugautos. Sie waren das Einzige, das noch zu leben schien da unten.
Sonst war alles tot, ertrunken im Regen und in einer kaum fassbaren Traurigkeit.
Simon hielt das Telefon in der Hand, und er fragte sich seit fast einer Stunde, ob er es wagen sollte, Kristina anzurufen. Wahrscheinlich handelte er sich eine Abfuhr ein, die ihre noch so zaghafte Beziehung endgültig beenden würde – falls sie nicht schon beendet war, was er nicht genau einschätzen konnte. Mit seiner Bitte, ihn allein nach Südfrankreich fahren und das Weihnachtsfest ohne sie nur mit den Kindern verbringen zu lassen, hatte er sie schlimmer gekränkt, als er es sich vorgestellt hatte. Er hatte geglaubt, sie werde ihn irgendwie verstehen. Aber sie war nur zornig gewesen. Und schließlich tief deprimiert.
Ich rufe sie jetzt an, sagte er sich, schließlich kann ich an der Geschichte kaum noch etwas schlimmer machen, als es bereits ist.
Er tippte die Nummer ein und wartete. Kristina meldete sich nach dem dritten Klingeln. Gott sei Dank. Er hatte gefürchtet, sie werde gar nicht an den Apparat gehen, sowie sie die französische Vorwahl im Display erkannte.
»Hallo, Kristina«, sagte er mit belegter Stimme. »Ich bin es. Simon.«
»Hallo«, sagte sie.
»Ich rufe aus Frankreich an.«
»Ja. Das habe ich schon gesehen.«
Sie wartete. Er fand, dass sie sich nicht besonders entgegenkommend verhielt, aber vielleicht hätte er damit auch zu viel erhofft. Normalerweise redete sie viel, schnell und lebhaft. Jetzt schien sie nur bereit, das Nötigste zu sagen. Sie klang höflich, aber absolut nicht herzlich.
»Ich bin früher gefahren als geplant«, sagte er schließlich. »Alleine. Ohne die Kinder.«
»Ach?«
»Ja. Sie wollten doch nicht mit. Also musste ich nicht den Beginn der Schulferien abwarten.« Während er das sagte, merkte er, wie weh ihm diese Tatsache noch immer tat. Dass sie ihn versetzt hatten. Keine zwei Wochen vor Weihnachten.
»Das tut mir leid«, sagte Kristina förmlich.
Er hatte ihr gar nicht beichten wollen, wie gedemütigt und verletzt er sich fühlte, aber nun brach es doch aus ihm heraus. »Der Kerl wickelt sie vollständig ein. Leon. Er hat ihnen zum Nikolaus unglaublich tolle Schlitten geschenkt, mit Doppelsitzen und Lenkrad und was weiß ich noch alles …«
»Hier liegt überhaupt kein Schnee«, sagte Kristina.
»Ja, aber es gibt ja Kunstschneebahnen, zu denen man gehen kann. Damit hat er ihnen den Mund wässrig gemacht. Kindern in dem Alter kann man alles einreden, wenn man es einigermaßen geschickt anfängt. Und ich glaube, im Hintergrund werden die Fäden da sowieso von Maya gezogen.«
Er konnte Kristina ganz leise seufzen hören. Er wusste ja, dass er ihr mit seinem Gejammer manchmal auf die Nerven ging. Über Maya, seine Exfrau. Über Leon, diesen gewissenlosen Schönling, dessentwegen sie ihn verlassen hatte. Über die Tatsache, dass die beiden Kinder in Leon zunehmend einen Ersatzvater sahen und von Maya subtil, aber unverkennbar gegen ihn, den eigentlichen Vater, aufgebracht wurden. Er konnte verstehen, dass eine Frau, die vielleicht die neue Partnerin an seiner Seite werden würde, nicht viel Spaß daran fand, ständig über die Ex zu reden, aber er wusste auch nicht, wie er das Thema vermeiden sollte. Es war nun einmal das ihn im Augenblick am stärksten beherrschende Problem. Neben der Tatsache, dass es ihm finanziell nicht gut ging und er in einer Krise steckte und, und, und …
Manchmal wunderte er sich, dass sich eine Frau wie Kristina überhaupt auf einen Mann wie ihn eingelassen hatte.
»Ich fürchte, diesmal musste Maya gar nicht allzu viele Fäden ziehen«, meinte Kristina nun. »Die Idee, schon wieder mit den Kindern ans Mittelmeer zu fahren, war vielleicht nicht optimal. Du hast mir erzählt, dass sie sich dort schon im letzten Jahr gelangweilt haben.«
Das stimmte in der Tat. Im letzten Jahr war er mit ihnen über Silvester in Frankreich gewesen, und das Ganze hatte sich zu einem einzigen Reinfall entwickelt. Trotz schönen, sonnigen, windigen Wetters. Aber was hatten zwei Kinder, damals elf und acht Jahre alt, davon? Im Meer zu baden erforderte ein kräftiges Maß an Selbstdisziplin, und allzu lange hielt man es keinesfalls aus. Um im Sand zu sitzen, zu buddeln und graben, wehte der Wind zu kühl. Das Aqualand mit der riesigen Wasserrutsche, im Sommer die Attraktion schlechthin, hatte geschlossen. Die Kinder nörgelten und quengelten, während Simon verzweifelt versuchte, sich für jeden Tag irgendeine Unternehmung auszudenken, die Gnade vor den Augen der beiden fand. Am Tag vor ihrer Abreise im Januar hatte das Attentat auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo in Paris stattgefunden, und auf der Rückfahrt sahen sie schwerbewaffnete Polizisten an allen Mautstellen patrouillieren, und auf den großen Tafeln über den Autobahnen, auf denen sonst Staus oder Baustellen angezeigt wurden, prangten nun die Worte: Je suis Charlie. In orangefarbener Leuchtschrift schimmerten sie durch den regnerischen Tag und die früh einsetzende Dämmerung. Simon hatte später den Eindruck, dass das Attentat, soweit die Kinder verstanden, worum es dabei ging, und seine sichtbaren Folgen das Einzige gewesen waren, was sie an den Ferien mit ihrem Vater spannend gefunden hatten, und diese Erkenntnis deprimierte ihn zutiefst.
»Ich habe nicht das Geld, um sie nach Florida oder sonst wohin einzuladen«, sagte er, »ich habe nur dieses Haus …«
»Dein Vater hat dieses Haus«, korrigierte Kristina, »und du darfst es nutzen. Und wie du mir erzählt hast, musst du dir jedes Mal, wenn du ihn um den Schlüssel bittest, anhören, dass er dich für einen Versager hält. Warum also fragst du ihn immer wieder?«
»Wohin sollte ich sonst …?«
»Zu Hause bleiben. Ehe du dich demütigen lässt.«
»In der kleinen Wohnung mit den Kindern während der ganzen Ferien … Wie soll das gehen?«
»Sie müssen sich eben arrangieren. Das kannst du von ihnen verlangen. So wie sie sich mit der Tatsache hätten arrangieren müssen, dass es eine Frau in deinem Leben gibt. Aber das konntest du ihnen ja auch nicht zumuten!«
Damit waren sie am entscheidenden Punkt.
»Ich wollte ihnen Zeit lassen«, sagte Simon.
Kristina lachte, klang dabei jedoch nicht fröhlich. »Wir kennen uns seit vergangenem Juni. Ein halbes Jahr. Wie viel Zeit brauchst du noch, um ihnen wenigstens eine Andeutung zu machen, dass es da möglicherweise jemanden gibt in deinem Leben?«
»Ich bin ihr Vater. Es wird schwierig für sie, wenn sie hören, dass sie mich von nun an teilen müssen.«
»Und weil sie so maßlos an dir hängen, ist es ihnen vollkommen egal, dass du Weihnachten mutterseelenallein verbringen musst, wenn sie dir keine zwei Wochen vor dem Fest einfach absagen«, stellte Kristina zynisch fest. »Wach auf, Simon! Du bist die Marionette deiner Exfamilie, sie machen mit dir, was sie wollen. Alle miteinander. Weil sie längst wissen, dass sie es können. Weil du dich nie wehren wirst. Weil du …« Sie verschluckte den Rest des Satzes.
Weil du kein Mann bist, vollendete Simon in Gedanken. Das sagte sein Vater immer zu ihm. Unwahrscheinlich, dass auch Kristina es so hart ausgedrückt hätte. Aber etwas in dieser Richtung hatte ihr zweifellos auf der Zunge gelegen.
Es war jetzt schon egal, wenn er sich noch kleiner machte. Sie hielt ja ohnehin nicht viel von ihm.
»Möchtest du doch noch kommen?«, fragte er und fügte leise hinzu: »Ich würde mich freuen.«
Kristina zögerte keine Sekunde. »Nein. Ich möchte nicht kommen, Simon. Und, ganz ehrlich gesagt, ich sehe sowieso keine Zukunft mehr für uns.«
»Wie meinst du das?«
»Wie ich es sage. Ruf mich nicht mehr an. Schick mir keine Mails mehr. Bring dein Leben in Ordnung, finde heraus, ob überhaupt eine Frau darin Platz hat. Dann kannst du ja wieder auf die Suche gehen. Aber mit uns beiden ist es vorbei. Tut mir leid.« Sie legte den Hörer auf.
Er starrte sein Telefon an. Der Regen trommelte auf das Dach. Irgendwo schrie ein Vogel, vielleicht eine Möwe oder eine Taube.
Und er fragte sich, ob es wohl irgendwo auf der Welt noch jemanden gab, dem es mit so großer Zuverlässigkeit wie ihm gelang, sich immer wieder selbst zu torpedieren und zu versenken.
Wahrscheinlich hielt er in dieser Disziplin einen traurigen, einsamen Rekord.
Später überlegte er oft, wie alles weitergegangen wäre, hätte Kristina in jenem Telefonat ihr Kommen zugesagt. Zumindest wäre er ganz sicher nicht ans Meer hinunter gefahren, um sich im strömenden Regen den menschenleeren Strand entlangzuschleppen. Wahrscheinlich hätte er stattdessen das Haus weihnachtlich geschmückt, Strohsterne aufgehängt und eine Lichterkette am Vordach über dem Balkon angebracht. Er wäre von Vorfreude erfüllt und guter Laune gewesen. Später wäre er zum Casino, dem Supermarkt, gefahren und hätte eingekauft: Champagner, Lachs, Oliven, Baguette. Dinge, die Kristina mochte. Er hätte Holz neben dem Kamin aufgeschichtet, um an den Abenden ein knisterndes Feuer entfachen zu können. Er hätte neue Kerzen in alle Halter gesteckt.
Er hätte sich mit alldem wahrscheinlich selbst betrogen, denn Kristinas Zusage hätte nichts daran geändert, dass alles, was er anpackte in seinem Leben, gründlich schiefging, aber er hätte immerhin genug zu tun gehabt, um darüber nicht nachdenken zu müssen.
So, wie die Dinge nun lagen, würde er die ganze nächste Woche jedoch über nichts anderes nachdenken als über sein Scheitern.
Es regnete so stark, dass seine Hose schnell durchweicht war und das Wasser in seinen Turnschuhen stand. Seinen Oberkörper schützte eine Regenjacke. Die Hände hielt er tief in den Taschen vergraben, aber sie fühlten sich trotzdem klamm und kalt an. Er hatte sein Auto auf dem großen Parkplatz am Strand von La Madrague geparkt, war über den breiten hölzernen Steg unterhalb der Felsen am Meer entlanggelaufen, ein kurzes Stück auf der Straße gegangen und dann auf den Strand von Les Lecques abgebogen. Er war der einzige Mensch weit und breit. Schließlich entdeckte er in der Ferne einen Jogger, aber als dieser aus seiner Blickweite verschwunden war, sah er überhaupt niemanden mehr. Die Leute saßen gemütlich daheim in ihren Häusern. Oder kauften Geschenke. Oder stürmten die Supermärkte.
Niemand lief alleine den Strand entlang.
Er hätte daheim bleiben sollen. In Hamburg. Zumindest für den Moment konnte das Wetter dort nicht schlechter sein. Er wäre auch allein gewesen, aber er hatte wenigstens Freunde ringsum. Er hätte Kristina aufsuchen können, versuchen, die Situation in Ordnung zu bringen. Am Telefon, zwischen ihnen eineinhalbtausend Kilometer, konnte es nicht funktionieren, aber vielleicht, wenn er vor ihrer Haustür aufgetaucht wäre, eine Flasche Sekt unter dem Arm, ein entwaffnendes Lächeln auf dem Gesicht … Auch Kristina war an Weihnachten allein. Vielleicht hätte sie sich letzten Endes doch gefreut, ihn zu sehen. Frauen reagierten schnell und positiv auf ihn, das war die einzige aufbauende Erfahrung, die er zeitlebens gemacht hatte. Er sah gut aus, war intelligent und gebildet. Bis die Frauen merkten, dass darüber hinaus an ihm nichts Besonderes war, hatten sie sich meist schon ein gutes Stück weit auf ihn eingelassen.
Er hätte, nachdem die Kinder abgesagt hatten, gar nicht hierher fahren sollen. Aber dann hätte er seinem Vater Bescheid geben müssen. Dieser hatte der Frau, die das Haus wartete, die Pflanzen versorgte und regelmäßig nach dem Rechten sah, freigegeben, in der Annahme, dass Simon zwei Wochen lang hier sein würde. Er hätte also nicht einfach wegbleiben können. Aber es hatte ihm davor gegraut, seinem Vater die Wahrheit zu sagen: die Wahrheit, dass seine Kinder nun auch schon keine Lust mehr auf ihn hatten.
Er konnte sich die Bemerkungen seines Vaters nur allzu gut vorstellen, und er hatte nicht die Kraft gefunden, sich diese Last auch noch aufzubürden. Also war er sogar früher als geplant gefahren – ohne noch im Geringsten Lust darauf zu haben.
Kristina hatte recht: Er war eine Marionette. Es gab kaum eine Bezeichnung, die besser auf ihn zutraf als diese.
Das Meer war tiefgrau und bewegt. Schmutzig gelber Schaum strömte hoch hinauf über den nassen, schweren Sand. Simon wich aus, obwohl seine Füße nicht hätten nasser werden können, als sie es schon waren. Das Laufen war anstrengend, aber auf irgendeine Weise tat es dennoch gut. Insgesamt hatte er sicher die bessere Lösung gewählt, als nur daheim zu sitzen und darüber nachzugrübeln, wie es ihm hatte gelingen können, nach der Scheidung von Maya nun auch noch die Beziehung mit Kristina vollständig zu vermasseln.
Rechter Hand von ihm führte die Uferpromenade entlang, mit ihren Bänken und Papierkörben und kleinen Rasenstücken. Ein Minigolfplatz, ein hoch eingezäuntes Areal, auf dem man Volleyball spielen konnte, dann ein Karussell, das zu dieser Jahreszeit nicht in Betrieb war. Dahinter lagen die Parkplätze, auf denen es im Sommer vollkommen unmöglich war, das Auto abzustellen. Jetzt waren sie gähnend leer.
Jenseits der Parkplätze verlief eine Straße, der Boulevard de la Plage, an dem entlang sich große Häuserkomplexe aufreihten. Schilder wiesen darauf hin, dass man Apartments mieten konnte. Im Sommer waren die kleinen Wohnungen mit den überdachten Balkonen gut gebucht, aber jetzt gab es keinen Anhaltspunkt dafür, dass dort Touristen untergekommen waren. Besonders an diesem Tag sahen sie auch alles andere als einladend aus. Feuchte Wände, beschlagene Fensterscheiben. Die Nässe des Meeres saß tief im Mauerwerk. Simon konnte sich vorstellen, wie klamm alles im Inneren war, die Möbel, die Teppiche, die Bettwäsche. Im Sommer unter wochenlanger heißer Sonne mochte es anders sein, aber im Augenblick hätten ihn keine zehn Pferde dazu gebracht, hier eine Unterkunft zu suchen.
Er war so in Gedanken versunken, dass er den kleinen Menschenauflauf erst bemerkte, als er sich schon auf gleicher Höhe befand. Menschenauflauf war zu viel gesagt. Es handelte sich um drei Personen, die oben auf der Promenade beieinanderstanden, direkt bei dem weiß-grau gestreiften Gebäude, in dem sich unten die Strandtoiletten und oben der Raum für den Poste de Secours, die Badeaufsicht, befanden. Nur aufgrund der Tatsache, dass sonst alles menschenleer war, fielen ihm die Leute auf.
Simon sah zwei Männer und eine junge Frau. Einer der Männer schrie herum. Simon sprach nahezu perfekt Französisch, aber immer wenn er gerade erst wieder aus Deutschland gekommen war, brauchte er einen Moment, um sich an die französischen Laute zu gewöhnen und den Gesprächen folgen zu können.
»Mir ist das völlig gleichgültig!«, schrie der Mann. »Ich werde jetzt sofort mit Ihnen zur Polizei gehen.«
Die junge Frau erwiderte etwas, aber sie sprach zu leise, als dass Simon sie verstehen konnte.
Der Mann schrie schon wieder. »Die werden schon wissen, was man mit Leuten wie Ihnen am besten macht. Und das Geld will ich auch haben! Glauben Sie bloß nicht, dass Sie so einfach davonkommen.«
Simon machte unwillkürlich einen Schritt auf die Gruppe zu. Eigentlich ging ihn das alles nichts an, aber irgendwie erfüllte ihn mit Mitgefühl, was er sah. Die junge Frau, die kaum älter als neunzehn oder zwanzig sein mochte, sah verwahrlost und krank aus, und sie schien sich nur mit letzter Kraft auf den Beinen halten zu können. Er fragte sich, was sie getan hatte, um den Mann, der ihr direkt gegenüberstand, mit solcher Wut zu erfüllen. Der andere Mann hielt sich zwei Schritte entfernt, sagte nichts und wirkte etwas unschlüssig.
»Also mitkommen! Bei der Polizei wird sich alles klären.«
Wahrscheinlich hat sie etwas geklaut, dachte Simon, dazu würde passen, dass sie aussieht, als ob sie seit Tagen nichts mehr gegessen hat.
Er konnte nichts für sie tun. Sie tat ihm leid, aber sie musste mit dem Schlamassel, den sie angerichtet hatte, selbst klarkommen. Er wollte schon weitergehen, da hatte die Frau ihn entdeckt, stürzte nach vorne und beugte sich weit über das Geländer der hier zum Strand hinunterführenden Treppenstufen. Simon sah weit aufgerissene Augen in einem abgemagerten, gespenstisch bleichen Gesicht.
»Monsieur, bitte helfen Sie mir. Bitte. Es ist alles aus, wenn die jetzt mit mir zur Polizei gehen!«
Widerwillig trat er noch näher an sie heran. »Was ist denn passiert?«
Der zornige Mann trat nun auch auf die Treppe. Vorsichtshalber hatte er die junge Frau am Arm gepackt, entschlossen, sie nicht entkommen zu lassen. »Eingenistet hat sie sich. In einem der Apartments. Ohne zu zahlen, versteht sich. Zwei Türschlösser hat sie aufgebrochen, unten an der Haustür und oben an der Wohnung.«
Eine Obdachlose. Simon war nun nahe genug, um trotz der frischen, nasskalten Luft ringsum festzustellen, dass die junge Frau schlecht roch. Nach ungewaschenen Klamotten, nach Schweiß.
»Bitte helfen Sie mir«, wiederholte sie.
»Ich bin der Hausmeister in dem Gebäude hier«, sagte der Mann. Er wies auf einen Apartmentblock jenseits der Straße und dann auf den zweiten Mann, der sich noch immer im Hintergrund hielt. »Das hier ist Yanis. Er ist mein Mitarbeiter. Er hat heute den Kontrollgang gemacht. Machen wir auch im Winter einmal die Woche. Dabei hat er dieses Früchtchen hier entdeckt. Und mich gleich verständigt.«
Simon gewahrte einen Ausdruck von Schuldbewusstsein und Mitleid auf Yanis’ Gesicht. Der Mann bereute es inzwischen, seinen Chef angerufen zu haben. Er hätte das junge Ding auch verscheuchen und die Sache auf sich beruhen lassen können.
»Ich wollte nichts falsch machen«, rechtfertigte er sich, ohne dass ihn jemand angegriffen hätte. »Man weiß ja nie … in diesen Zeiten …«