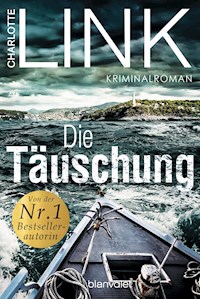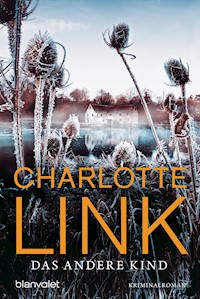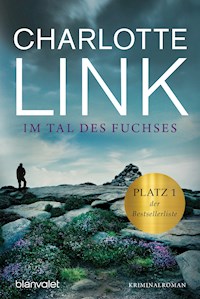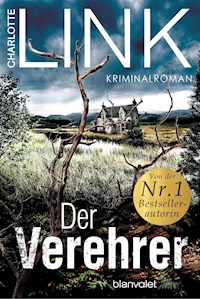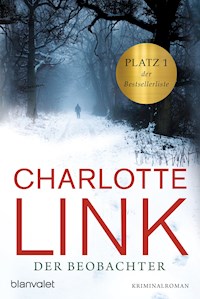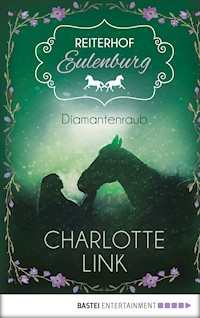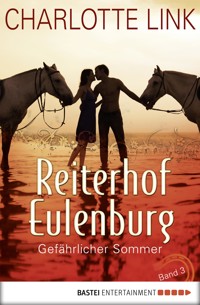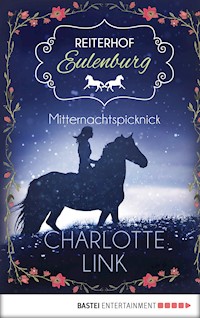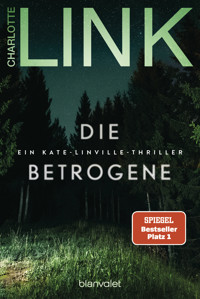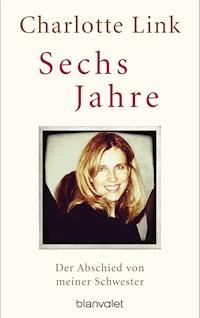
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das persönlichste Buch von Charlotte Link
Auf eindringliche Weise berichtet Bestsellerautorin Charlotte Link von der Krankheit und dem Sterben ihrer Schwester Franziska. Es ist nicht nur das persönlichste Werk der Schriftstellerin, voller Einblicke in ihr eigenes Leben, sondern auch die berührende Schilderung der jahrelang ständig präsenten Angst, einen über alles geliebten Menschen verlieren zu müssen. Charlotte Link beschreibt den Klinikalltag in Deutschland, dem sich Krebspatienten und mit ihnen ihre Angehörigen ausgesetzt sehen, das Zusammentreffen mit großartigen, engagierten Ärzten, aber auch mit solchen, deren Verhalten schaudern lässt und Angst macht. Und sie plädiert dafür, die Hoffnung nie aufzugeben – denn nur sie verleiht die Kraft zu kämpfen.
Ein subtiles, anrührendes Plädoyer für mehr Menschlichkeit. Ein Buch, das Kraft gibt, nicht aufzugeben und um das Leben zu kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Charlotte Link
Sechs Jahre
Der Abschied von meiner Schwester
1. Auflage© 2014 by Blanvalet Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlaggestaltung: www.buerosued.deUmschlagbild: privatLektorat: Nicola BartelsSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN: 978-3-641-14100-4www.blanvalet.de
Vorwort
Warum dieses Buch? Diese Frage habe ich mir gestellt, bevor ich begann, es zu schreiben, und auch während ich daran arbeitete, habe ich immer wieder versucht, sie zu beantworten. Schon deshalb, weil ich, bekannt als Autorin von Kriminalromanen, davon ausging, dass meine Leser vielleicht verwundert sein würden und eben genau dies von mir würden wissen wollen: Warum dieses Buch?
Meine Schwester Franziska starb im Alter von sechsundvierzig Jahren am 7. Februar 2012, nachdem sie sechs Jahre lang voller Entschlossenheit gegen den Krebs und vor allem gegen die dramatischen gesundheitlichen Folgen von Strahlen- und Chemotherapien gekämpft hatte. Unsere ganze Familie kämpfte an ihrer Seite. Wir erlebten Schreckliches in dieser Zeit, Tragisches, Verrücktes, Unglaubliches, manchmal sogar Komisches. Es gab immer wieder Momente, in denen Franziska zu mir sagte: »Wenn das alles hier hinter uns liegt, musst du darüber schreiben!«
Ich versprach ihr, dass ich das tun würde. Und dann wechselten wir rasch das Thema, weil wir nicht weiter vertiefen wollten, wie es aussehen würde, dieses Wenn das alles hinter uns liegt. Es ging um Leben oder Sterben. Diese Dimension sieht keine Zwischenlösungen vor.
Mit dem Tod meiner Schwester verlor ich den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich durchlebte eine seelische Erschütterung, die mir vorkam wie ein schweres Erdbeben: Nichts war mehr wie zuvor, kein Stein lag mehr auf dem anderen, jedes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen schien verloren zu sein.
»Das Leben geht weiter!« Es gibt wohl keinen Ausspruch, den ich in der Folgezeit so oft hörte wie diesen.
Ja, dachte ich dann immer, das tut es wohl. Bloß wie?
Ich wusste nicht mehr, wo mein Platz in meinem eigenen Leben war. Ich versuchte, diesem Schicksalsschlag mit Tapferkeit zu begegnen, weiterzumachen, nicht in Trauer zu versinken, den Kopf über Wasser zu halten. Manchmal gelang mir die Strategie des Vorwärtsgehens; meistens glückte sie aber auch gar nicht. Irgendwann begriff ich, dass ich der Verwüstung, die in meinem Inneren herrschte, nicht dadurch Herr werden konnte, dass ich sie immer wieder zu ignorieren versuchte. Ich musste sie ansehen, akzeptieren und dann mit den Aufräumarbeiten beginnen. Nur so würde ich möglicherweise irgendwann eine Ahnung davon haben, wie mein Leben von nun an tatsächlich weitergehen könnte.
So besehen, gehörte das Schreiben dieses Buches für mich zu den Aufräumarbeiten. Stellte ein Stück persönliche Bewältigungsstrategie dar. Vielleicht sogar den Versuch, das, was geschehen ist, irgendwann dadurch zu begreifen, dass ich es in Worte gefasst habe. Denn noch immer ist dies das vorherrschende Gefühl in mir: Ich begreife nicht, dass sie nicht mehr da ist.
Darüber hinaus denke ich, dass wir in den hier beschriebenen sechs Jahren manches erlebt haben, was anderen Menschen zugänglich gemacht werden sollte. Ich schildere in diesem Buch, mit welch erschreckend geringer Empathie schwer kranke Menschen in manchen – keineswegs in allen – Krankenhäusern behandelt werden. Wie alleine man sie und ihre Angehörigen mit hoffnungslosen Diagnosen lässt. Wie gnadenlos drastisch oft gerade tödliche Diagnosen ausgesprochen werden, ohne dass zuvor mit der gebotenen Gründlichkeit überprüft worden wäre, ob sie überhaupt stimmen.
Ich bin sicher nicht die Erste und nicht die Letzte, die ihren Finger auf solche Missstände legt. Ich bin aber der Überzeugung, dass man auf diese Probleme nicht oft genug hinweisen kann. Dass man als Betroffener sogar verpflichtet ist, immer wieder darauf hinzuweisen, so lange, bis sich etwas Entscheidendes ändert.
Dieses Buch möchte außerdem Mut machen, trotz seines tragischen Ausgangs. Franziska war eine Kämpfernatur, und sie hat scheinbare Aussichtslosigkeit nie einfach hingenommen. Wenn ihr fünf Ärzte gesagt hatten, dass es aus einer bestimmten Situation keinen Ausweg mehr gebe, dann hat sie den sechsten oder siebten Arzt gesucht, der vielleicht doch noch eine Möglichkeit sah. Wir, ihre Familie, haben mit gesucht, und wir konnten Erfolge verbuchen. In vermeintlich hoffnungslosen Situationen, über die man uns zuvor gesagt hatte, ein Erfolg sei vollkommen ausgeschlossen.
Ich habe dieses Buch aus meiner Sicht, also aus der Sicht eines medizinischen Laien geschrieben, und ich habe bewusst darauf verzichtet, es später von einem Arzt noch einmal gegenlesen zu lassen. Über medizinische Abläufe und Zusammenhänge berichte ich daher genau so, wie sie sich mir in jener Zeit darstellten und wie ich sie verstehen konnte. Ganz sicher würden Fachleute etliche Problembereiche als weitaus komplexer und vielschichtiger bezeichnen, als ich hier mit ihnen umgegangen bin.
Einem wissenschaftlich fundierten Anspruch in größerem Ausmaß gerecht werden zu wollen hätte jedoch bedeutet, die Absichten dieses Buches in einem wesentlichen Punkt zu unterlaufen: Wir waren eine Familie ohne besonderes medizinisches Wissen, und wir standen plötzlich inmitten der Konfrontation mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. Gerade auch die Hilflosigkeit zum Ausdruck zu bringen, die sich aus Unkenntnis ergibt, war mir ein Anliegen.
Dass es richtig war, dieses Buch zu schreiben, bestätigt mir die Tatsache, dass ich noch während der Entstehungsphase bereits von zwei Kliniken angesprochen und um spätere Lesungen aus dem fertigen Buch gebeten wurde. Einmal zu der Thematik des ärztlichen Umgangs mit Schwerstkranken. Und dann zu dem Problem der Spätfolgen von Radiotherapien. Ich hielt unseren Fall natürlich nicht für den einzigen seiner Art, aber doch für ziemlich speziell. Was nicht stimmt, wie ich erfuhr.
»Das Problem der Spätfolgen von Krebstherapien betrifft immer mehr Patienten«, schrieb mir der Professor, der mich zu der Lesung einlud. Zunehmend beschäftigt sich die Wissenschaft nicht mehr nur mit der Bekämpfung der furchtbaren Krankheit Krebs, sondern mit den Krankheiten, die durch eben diese Bekämpfung überhaupt erst ausgelöst werden. Franziskas gesamter Leidensweg ist ein tragisches Beispiel für dieses Dilemma, in dem die moderne Medizin steckt – und wir alle mit ihr.
All dies sind sicher sinnvolle Gründe, die vorliegende Geschichte zu erzählen. Aber neben meinem Versuch der persönlichen Aufarbeitung und dem Bemühen, anderen Betroffenen mit unserer Geschichte zu helfen, geht es mir vor allem auch darum, einem sehr besonderen Menschen in der Beschreibung wenigstens ansatzweise gerecht zu werden: meiner Schwester Franziska.
Charlotte Link
Sonntag, 8. Januar 2012
Die Sonntage sind mein Part, so haben wir es abgesprochen. Vereinzelt auch Wochentage zwischendurch, aber die Sonntage stehen fest. Es fällt mir sonst schwer, von morgens bis abends nicht daheim zu sein, ich habe ein zehnjähriges Kind und drei Hunde. Aber sonntags ist mein Mann da, ich kann problemlos weg.
An den anderen Tagen sind meine Eltern im Krankenhaus. Wir wollen meine Schwester Franziska nicht mehr alleine lassen, oder zumindest so wenig wie möglich. Seit dem 29. Dezember 2011 liegt sie im Krankenhaus von Bad Homburg, einem Vorort von Frankfurt. Seit sechs Jahren kämpft sie, kämpfen wir alle um ihr Leben. In den vergangenen Wochen hat sich die Situation dramatisch verschärft. Im tiefsten Inneren wissen wir bereits, dass jetzt nur noch ein Wunder helfen kann, und sie weiß es auch. Sie ist 46 Jahre alt und wird Tag und Nacht von dem Gedanken an ihre Kinder gequält, die sie zurücklassen muss, einen zwanzigjährigen Sohn und eine achtjährige Tochter. Darüber hinaus hat sie einfach Todesangst. Die Angst wird schlimmer, wenn sie alleine ist, daher versuchen wir sie abzulenken, so gut wir können.
Ich gehe den Gang entlang. Krankenhausgeruch, leise quietschendes Linoleum unter meinen Füßen. Eine Schwester schiebt einen Wagen mit leeren Tassen und Tellern zur Küche zurück. Sie grüßt freundlich. Alle hier auf der Lungenstation sind sehr nett, sehr bemüht. Eine Wohltat nach manch anderem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.
An den Türen hängen noch die Weihnachtssterne aus rotem und goldfarbenem Stanniolpapier. Irgendwie wirken sie inzwischen etwas deplatziert. Mir begegnet der sehr sympathische Pfleger, der sich immer so um meine Schwester bemüht. Er gehört zu den Menschen, die unaufgefordert stets mehr tun, als sie tun müssten. Er scheint auch gerade über die Sterne nachzudenken, denn er sagt zu mir: »Die kommen morgen weg. Dann hängen wir Frühlingsblumen aus Papier an die Türen.«
»Ich freue mich darauf«, sage ich. Zwar scheint der Frühling in endlos weiter Ferne zu liegen, und draußen ist der Januar genauso kalt, grau und trostlos, wie es nach meinem Empfinden nur dieser Monat sein kann. Aber umso schöner, wenn man versucht, etwas Farbe in den Alltag zu bringen.
Ich betrete das Zimmer meiner Schwester. Die Tür ist nur angelehnt. Franziska, die genau wie ich immer eher der ausgesprochen individualistische Typ war – nie zu viel Gemeinschaft ertrug und stetseine gute Rückzugsmöglichkeit in Reichweite brauchte –, hält geschlossene Türen nicht mehr aus, zumindest nicht, wenn sie alleine ist. Man respektiert das auf dieser Station, indem ständig ein blaues Handtuch so von innerer zu äußerer Türklinke drapiert wird, dass die Tür nicht zugehen kann. Ich nehme das Handtuch jetzt weg. Ich bin da, wir können die Tür schließen.
Franziska schläft, sie bemerkt mein Kommen nicht. Ich stelle die große Tasche, in der ich frische Wäsche und Zeitschriften für sie habe, auf einen Stuhl. Ziehe meinen Mantel aus und husche so leise wie möglich zur Garderobe, um ihn aufzuhängen. Trotzdem hört sie mich jetzt. Sie schlägt die Augen auf, braucht eine Sekunde, um den Schlaf abzuschütteln. Dann erhellt ein warmes, freudiges Lächeln ihr Gesicht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!