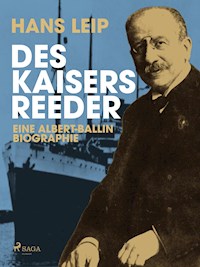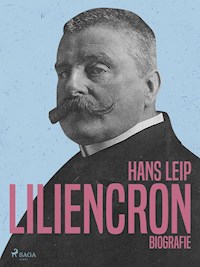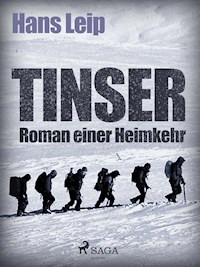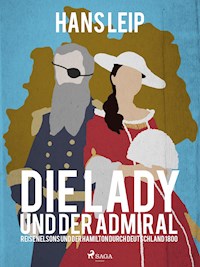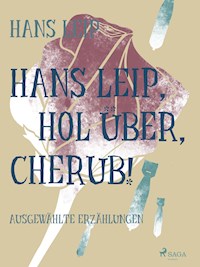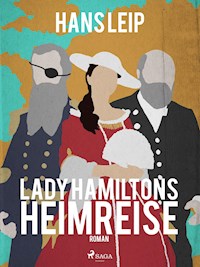Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der bekannte Hamburger Schriftsteller Hans Leip dieses Buch über Anny Ondra und Max Schmeling schrieb, waren beide auf dem Höhepunkt ihrer schauspielerischen und sportlichen Karriere angelangt. Und sie waren spätestens seit zwei Jahren, seit ihrer Hochzeit 1933, das deutsche Traumpaar schlechthin. Während beide noch über 50 Jahre, Max Schmeling sogar noch 70 Jahre, leben sollten, sind es doch ihr Kinderjahre und ihr Weg zum Ruhm und zueinander, die es zu entdecken gilt. In bekannt liebevoller Art bebildert Hans Leip ihre Lebenswege. So bewundert der kleine Max von der Hamburger Lombardsbrücke einen Eiskunstläufer und möchte "mehr, mehr" davon. Selbst muss er noch eine weite Wegstrecke zurücklegen, bis er andere Jungen zu solchen Begeisterungsstürmen veranlassen kann.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Leip
Max und Anny
Romantischer Berichtvom Aufstieg zweier Sterne
Saga
Max und Anny
© 1935 Hans Leip
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711467503
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Lütt Mackie
An einem hübschen klaren Frosttage stand ein Knirps von drei Jahren zu Hamburg auf der Lombardsbrücke. Seine schwarzen Strupphaare wehten im Wind, er war ohne Mütze, er war ohne Mantel, es machte ihm nichts. Bald hielt er sich mit seinen kleinen rotgefrorenen Fäusten bäuchlings oben auf der dicken Steinbrüstung, bald versuchte er, seinen Kopf zwischen die vasenförmigen Balustradenpfeiler zu zwängen. Seine schwarzen Augen starrten gebannt auf einen Schlittschuhläufer, der auf freigefegter Fläche von einem dunklen Ring Zuschauer umgeben, seine Kunststücke zeigte.
Beifall klatschte und verwehte dünn in der grauen Dämmerung. Unermüdlich zog der Kunstläufer seine Schleifen, vorwärts, rückwärts, tanzte einen Walzer, sprang, legte sich tief ins Knie, wirbelte wie ein Kreisel. Es dunkelte schon. Noch immer hing der schwarzhaarige Knirps über dem Brückengeländer. Es fror ihn nicht, er war entzückt.
„Mehr, mehr!“ schrie er mit heller Stimme.
Aber der Mann schien ihn nicht zu hören und ging daran, die Schlittschuhe abzuschnallen. Schon verzogen sich die Zuschauer.
Dem Knirps auf der Brücke passte es nicht. Er versuchte über die Brüstung zu klettern. Ein bärtiger gütiger Herr kam vorbei und hielt ihn zurück vom Sturz in die Tiefe.
„Wie heisst du, mein Kind?“ fragte er besorgt.
„Mackie Schmeling!“ antwortete ungnädig der Knirps.
„Und wo wohnst du?“
„Weiss ich nicht!“
Da war guter Rat teuer. Menschen versammelten sich um das Kleinformat des verlorenen Sohnes. Er zeigte sich gefasst. Es machte ihm augenscheinlich Spass, Mittelpunkt zu sein, wie etwa ein Eiskünstler. Er hielt den Fragern stand wie später den Reportern, und seine später oft bewundernswerte Geschicklichkeit, zwischen Sportneigung und Zuhause den rechten Weg zu finden, erwies sich früh, als er mit einem lässigen Aufleuchten in seinem kleinen prallen Jungensgesicht schliesslich erwähnte:
„Meine Bomboms krieg ich immer inne Brennerstrasse.“
Durch den Krämer und Bonbonlieferanten dort, wohin man mit ihm gelangte, ergab sich die nähere Anschrift.
Es war übrigens derselbe Krämer, bei dem ein paar Jahre früher auch Hans Albers, der nicht weit entfernt in der Langenreihe gross wurde, ab und an genascht hatte, und auch der Verfasser dieser Zeilen, der den grössten Teil seiner Jugend im Stadtteil St. Georg wohnte (z. B. auch in der Langenreihe), kannte ihn gut.
Mackies Vater, weiland Bootsmann bei der Hamburg-Amerika Linie, hatte den Nachmittag schon verzweifelt mehrere Polizeiwachen abgesucht. Er schloss das wiedergewonnene Kind dankbar in die Arme.
„Wo bist du gewesen?“ fragte er streng.
„Ich hab zugekuckt!“ antwortete Mackie. „Da war irgend so’n Mann ...“
Der Vater sollte noch erleben, dass auch sein kleiner Max einmal „irgend so’n Mann ...“ sein würde, bei dem es sich lohnte, zuzugucken.
Am gleichen Abend, auf der anderen Seite der Erde, in Australien, gewann der Neger Jack Johnson die Boxweltmeisterschaft, in dem er den weissen Titelhalter, Tommy Burns, in der 14. Runde k. o. schlug.
Um diese Zeit gab es in Hamburg auf dem Steindamm ein „Kinematographen-Theater“, das, wie damals üblich, durch das Hineinstellen von Stuhlreihen und eines mit Pappornamenten verzierten leinwandbespannten Teppichklopfrahmens aus einem Gastwirtschaftslokal hervorgegangen war. Die Musik zu den „Lebenden Bildern“ wurde von einem Orchestrion bestritten, und es lief derzeit unter rasselnder und klingelnder Begleitung Verdischer Melodien einer der ersten Starfilme, dessen Held auch Max hiess, jener kleine schmachtäugige behende Franzose Linder, der sich in den kurzen Szenen, die angestrengte Attacken auf das Zwerchfell des Publikums machten, „Max mit’m Schwung“ nannte.
Bootsmann Schmeling sah es sich an und lachte in seinen breiten Schnauzbart über die Witze, die uns heute keine mehr dünken, und er hielt die Leinwand, mit der gesegelt wird, für wichtiger.
Aber die Leinwand, mit der gesegelt wird, war damals schon zum Aussterben verurteilt. Was an Jachtsegeln übrig blieb, hielt sich besser an Baumwolle. Die Leinwände jedoch, die vor die dunklen Säle gespannt waren und nach Gutdünken mit den Zuschauerhirnen davonsegelten, die wuchsen heran und vermehrten sich ins Ungeahnte.
Klein Ānny
Es war ein munterer Sommertag zu Pola an der Adria. Der österreichische Kriegshafen prangte in Flaggengala. Englische Kreuzer lagen zu Besuch auf der Reede. Es war ein paar Jahre vor dem Kriege. Klein Annys Vater, Verpflegungsoffizier der k. u. k. Armee, trug Paradeuniform und hatte zu tun, die Bankette der Verbrüderung mit dem Nötigen zu versorgen. Das glutäugige kroatische Kindermädchen Minka fuhr Klein Anny mit dem zarten federnden Kinderwägelchen spazieren. Es war nicht lange vor jener Zeit, da Mackie zu Hamburg seine eifersüchtig geliebte kleine Schwester im Kinderwagen spazierenfuhr. Doch zu Pola auf der Hafenpromenade gab es mehr Augenweide als im Eilbecker Park.
Eine Menge netter Jungen der britischen Marine flanierte dort, und Tag für Tag gab es Platzkonzerte. Klein Anny staunte unter dem Spitzenmützchen hervor, und Vatis Bursche, ein vorbildlicher Steiermärker, begleitete den Spaziergang, teils weil er Zeit hatte und teils weil er zwischen den vielen fremden Blicken und dem feurigen Temperament seiner Minka abwegige Anknüpfungsmöglichkeiten ahnte. Sein kühles Gebirgsblut begann unter der heissen Sonne Istriens zu sieden in der Vorstellung, dass die österreichische Gastfreundschaft sich nicht allein in offiziellen Liebesbeteuerungen und Empfängen erschöpfen würde. Ein lustiger irischer Bootsmannsmaat kam des Weges, und strich mit seegrauen Augen bewundernd über Minkas niedliches Galionsantlitz.
Da ergrimmte das steirische Herz, das den zarten Spaziergang zu schützen gedachte, und der irische Maat fühlte plötzlich eine heftige Pranke in seinem Gesichtsfeld landen, was er natürlich nicht unverzollt hingehen liess. Und da er ein regelrechter Boxer war, welche Kunst in Britannien seit mehr als hundert Jahren volkstümlich ist (auf dem Festlande damals aber noch gänzlich in den Windeln lag), so wäre der Kampf wohl zuungunsten Österreichs entschieden worden, wenn nicht Klein Annys hellzwitscherndes, mörderisches Geschrei den Eingeborenen der grünen Insel ein wenig aus der Fassung und im nächsten Augenblick, dank der Aufmerksamkeit des Steirabuas, aufs Pflaster gebracht hätte.
Vielleicht ist es dieser, aus Annys Bewusstsein längst fortgewischte Vorfall gewesen, der sie später davon abhielt, je an Boxkämpfen Vergnügen zu finden. Obschon sie, als sie eben sprechen konnte und zufällig an Pola erinnert wurde, ihrer Minka geraten haben soll, den starken Mann zu heiraten.
Die Kriegsläufte kamen dazwischen, und es ist nicht mehr festzustellen, ob der Rat befolgt wurde oder ob das Schicksal derzeit nur, wie es oft tut, sich eine kleine Andeutung hatte leisten wollen für Späteres.
Mackie verdient Geld
Die Familie Schmeling zog nach Rothenburgsort, dorthin, wo Max seinen vielleicht ruhmvollsten Kampf gegen den tüchtigen österreichisch-amerikanischen Studenten, Allround-Athleten und Wirbelwind Steve Hamas austragen wird.
Während des Krieges war Mackies Vater bei der Marine eingezogen, und im Hause sah es nicht rosig aus. Da versuchte Mackie auf manche Weise Geld zu verdienen. Er wohnte derzeit mit Mutter, Bruder und Schwesterchen in der Hasselbrookstrasse (Hamburg-Eilbeck), und eben elfjährig, bewarb er sich auf eigene Faust in der Apotheke an der Wandsbecker Chaussee um einen Laufjungenposten. Seine Offenheit und Zutraulichkeit gefielen dem Apotheker und dessen Tochter, und Mackie blieb dort über ein Jahr.
Regelmässig lieferte er seinen kleinen Wochenverdienst in die Hände seiner Mutter, von den Trinkgeldern aber kaufte er jeden Sonnabend Blumen für sie.
Und man kann wohl sagen, diese kleinen bescheidenen Jungssträusse wiegen alle Blumen auf, die Mackie in späteren Jahren so reichlich empfangen durfte.
Die Lebensmittel wurden damals knapp, aber Mackie war immer rechtzeitig darauf bedacht, seinem Körper zu geben, was ihm gebühre. Somit erlag er eines Tages der Versuchung, eine Flasche Rahm und eine Flasche Lebertran-Emulsion mitgehen zu heissen. Da er sie zu Hause nicht zu vertilgen wagte, nahm er die Schätze mit in die Schule. Dort trank er den Rahm selber. Den Lebertran aber, der so ähnlich aussah, schenkte er grossmütig den Kameraden, die sich in der Pause reihum gütlich daran taten.
Dem kleinen Max bekam der Rahm glänzend. Die Emulsion aber war weniger leicht verdaulich. In der Stunde meldeten sich seine Mitschüler einer nach dem andern, um wegen Übelkeit einen stillen Ort aufzusuchen.
Das wollte dem Lehrer eine auffällige Sache scheinen, und er forschte nach, drang bis zu der geleerten Lebertranflasche vor, von da bis zu dem Spender und sodann, ungeachtet der flehentlichen Bitten: „Herr Fehse, ich will es auch wirklich nicht wiedertun, Herr Fehse!“ — bis zu dem gutherzigen Apotheker, der dann aber dem reumütigen Sünder verzieh und ihn behielt.
Damals jedoch dachte Mackie, er würde eines Tages Seemann werden wie sein Vater. Allzusehr lockten ihn die fernen Länder, von denen der weitgereiste Bootsmann so oft erzählt hatte.
Die Kartothek des Hamburger Seemannsamtes enthält übrigens nicht weniger als siebzehn Typen des Namens Schmeling, die alle zur See gefahren sind. Der Vater von Mackies Vater aber war Malermeister gewesen, und dessen Vater hatte die Militärkantine zu Stettin geleitet, war also in der preussischen Heeresverpflegung tätig gewesen und somit sozusagen ein vormärzlicher Kollege des Schwiegervaters seines Urenkels. Mütterlicherseits waren Mackies Grosseltern Bauern aus der Uckermark, in denen aber die Sehnsucht zu Höherem aufstand und sich der Kunstmalerei zuwandte, was teils in Berlin, teils in den Vereinigten Staaten sesshaft wurde. Aber auch der Bruder des Vaters steigerte die vererbte Grundlage der Farbenbehandlung ins Künstlerische, und dieser Onkel lebte in Hamburg.
Max in seiner weissen Marinebluse, die Schülermütze keck ein wenig auf das rechte Ohr gerückt, den breiten Sportgürtel mit dem doppelten Schlangenschloss eng um die Taille gezogen, verkehrte dort gern, zumal drei nette Kusinen das verwandte künstlerische Haus belebten.
Mackies aufkeimende Meinung, dass vielleicht Kunstmaler ein noch netterer Beruf sei als der des Seemanns, wurde von seiner Mutter kräftig unterstützt. Denn keine Seemannsfrau wünscht die Sorgen, die sie um ihren Mann gehabt, in dem Sohne noch einmal zu durchleben.
Der kleine Max wurde also für manchen Nachmittag einem Kunstmaler übergeben, sein Ehrgeiz aber gedachte die Kosten für den Unterricht selbst aufzubringen. Und das gelang ihm volle vier Wochen, indem er als Fremdenführer bei Hagenbeck wirkte. Er tat es heimlich und auf eigene Faust, seine Eltern hätten es ihm nämlich nicht gestattet, und da sein Fehlen nachmittags zu Hause aufgefallen wäre, verlegte er seinen neuen Posten auf die Vormittage. Er schwänzte einfach die Schule. Seine grosse Liebe zu Tieren, die ihn auch heute noch erfüllt, war sicher seiner Idee zu Hilfe gekommen.
Aber in der Schule roch man schliesslich Lunte. Der Schuldiener wurde zur Erkundigung ins Haus geschickt, und das zweckmässige Abenteuer war aus.
Max Schmeling sagt selbst darüber: „Ich fand dieses Vorgehen sehr hässlich, denn ich hatte jeden Tag einen Entschuldigungszettel durch meinen Bruder Rudolf abgeben lassen — dass ich für meine Mutter unterschrieb, geschah doch nur, um ihr eine Arbeit zu ersparen ... und noch lange Zeit spürte ich beim Sitzen die Folgen meiner Tätigkeit als Fremdenführer.“
Zu Ende des Krieges war Mackie schon ein stämmiger Junge und Mitglied eines Fussballvereins.
Seine Erkenntnis, dass es für einen Mann im Leben wichtig sei, Geld zu verdienen, hatte ihn nicht wieder verlassen. Er versuchte in der Zeit der ausserordentlichen Tabakknappheit einen flottgehenden Handel mit selbstgedrehten Zigaretten. Vielleicht kommt es daher, dass es ihm später nie schwer gefallen ist, sich des Nikotins zu enthalten.
Die Sache ging gut, bis er einmal im Dunkel des Wandsbecker Gehölzes seine Erzeugnisse versehentlich dem eigenen Vater zum Kaufe anbot.
Der hatte Humor genug, zu sagen: „Bitte, geben Sie mir zehn, aber dann scher dich nach Haus, Bengel!“
Ānnys erstes Theater
Annys Vater wurde, wie es bei aktiven Offizieren üblich ist, von einer Garnison in die andere versetzt, von Tarnow in Westgalizien, wo Anny geboren wurde, nach Pola, von Pola nach Theresienstadt, von Theresienstadt nach Prag.
Zwischen der Adria und der Nordsee erstreckte sich einst das alte deutsche Kaiserreich. Es gab einen alten deutschen Kaisertraum, Adria und Nordsee durch ein phantastisches Kanalsystem über Donau, Moldau und Elbe miteinander zu verbinden. Derselbe Kaiser gründete die erste deutsche Universität, nämlich die zu Prag. Prag liegt auf halbem Wege zwischen Süden und Norden. Manche sagen, es sei auf halbem Wege liegen geblieben und halten es, wie weiland der Triester Theodor Däubler, deshalb für eine zwiespältige, aber reizvolle Stadt. Und heute ist nicht Triest, heute ist Hamburg der Seehafen Prags.
Bei allen Übersiedlungen war Annys grösste Sorge, ihre umfangreiche Puppenfamilie auch ja vollzählig mitzubekommen. Ihre Lieblingspuppe hiess Leni, und die konnte die Augen auf- und zumachen und sagte, wenn man sie entsprechend bewegte, deutlich „Mama“. Im Wettbewerb mit dieser Süssen siegte aber eines Tages der Dackel „Satan“, ein schwarzes, wildes, unfolgsames und schlaues Rabenvieh, das sich von niemandem etwas sagen liess, ausser der kleinen Anny. Von Anny liess er sich sogar geduldig ankleiden, von Kopf bis Fuss, mit Lenis Kleid, Höschen, Strümpfen, Hut und Schuhen, und Leni sass nackt und starren Auges dabei. Diesen „Satan“ liebte Anny sehr, und wenn er Haue kriegte, weinte sie mit.
Er war die lebendige Auferstehung eines Stoffhündchens, das sie besessen hatte, als sie noch kleiner war. Das war ein Wunder von Hündchen gewesen: wenn man seinen Schweif drehte, ertönte eine kurze lustige Melodie.
Eines Tages war man zu Besuch bei Bekannten. Da lagen gerade ein paar ganz junge Hündchen im Korb. Sofort nahm Anny das nächste beste heraus und drehte es am Schweif, gerad als sei es ein Leierkasten. Leider musste sie mit Bedauern feststellen: es spielte nicht.
Einer von Annys Onkeln hatte die freundliche Gewohnheit, Klein Anny zur Begrüssung auf die Wange zu küssen. Wenn sie diesen netten Herrn beim Spaziergang von weitem kommen sah, sagte sie zu dem Kindermädchen: Minka, wisch mir rasch die Nase ab, Onkel kommt! — Denn sie wusste schon damals, was sie ihrem Äusseren schuldig sei.
In Prag war Anny schon so gross, dass sie zur Schule musste, und es wurde für sie die Klosterschule gewählt. Denn sie war ein kleiner Unband, der Tag für Tag Theater spielte und Tänzerin zu werden gedachte. Ergatterte sie ein weisses Stück Papier, so bemalte sie es mit zierlichen Tänzerinnen oder schnitt Tänzerinnen daraus, und schliesslich bewegte sie ihren älteren Bruder, ein Puppentheater für sie zu bauen.
Angeregt war solche frühe Neigung durch den verschiedentlichen Besuch des Nationaltheaters in Prag, wo es Sonntags nachmittags schöne Ballette und Märchen für Kinder gab. Kinos mit Kindervorstellungen kannte man damals noch nicht in Prag.
Annys älterer Bruder war technisch hochbegabt und ist jetzt Ingenieur der Eisenwerke zu Kladno. Es braucht kaum gesagt zu werden, dass es damals eine ausserordentlich prächtige Puppenbühne für seine kleine Schwester wurde. Die Puppen dazu machte Klein Anny selber, und zwar aus Kartoffeln. Sie bemalte sie süss und zog sie phantastisch an. Auch Tiere durften nicht fehlen; denn der Grossvater mütterlicherseits war Oberförster in den grossen Wäldern der Hanakei in Mähren. Obwohl die Beine des Bühnengetiers nur Streichhölzer waren, erschien Anny doch alles zauberhaft lebendig.
Hauptsächlich wurden Märchen gespielt. Es befand sich ein grosses altes Märchenbuch im Haus, in dem, wenigstens in der Erinnerung, alle Märchen gestanden haben müssen, die es in der Welt gibt. Aber das schönste darin war das Märchen vom Fliedermütterchen. Es hat kaum eine Handlung und ist ungemein schwer zu spielen, aber vielleicht gerade darum, weil es von allen Tollheiten frei ist, die so oft im Film verlangt werden, ist Andersens Fliedermütterchen bis heute Anny Ondras liebstes Märchen geblieben. Es kam soviel von Abschied und Wiedersehen darin vor, von der Fahrt des Liebsten übers Meer und von treuer Liebe.
Bald schrieb sie auch selber Stücke und erkor die Stube zur Bühne und stellte befreundete Kinder in den Nebenrollen an. Die Kostüme waren aus Seidenpapier, aber heimlich wurde manchmal der Kleiderschrank der Eltern ausgeräumt, und die würdigen Uniformen der einstigen k. u. k. Armee und die Ballkleider der Mama dienten dann dem Hofstaat der Könige und Königinnen in Annys Kindertheater.
An der Moldau, in den ausgedehnten Grünanlagen, befindet sich auch ein Planschbecken für Kinder, so schön, wie es Mackie zu Hamburg im Stadtpark nicht mehr geniessen konnte, da er schon zu gross war, als man hier solcherlei eröffnete. Längst badete er schon lieber in der Elbe. Er war ein kräftiger Schwimmer. Aber wenn man dem romantischen Gedanken folgen will, der sich aus der unaufhaltsamen Verbindung von Moldau und Elbe ergibt, so mag es sein, dass Mackies Schicksal schon sehr früh auf dem Wasserwege einen unbewussten zarten Strömungshauch verspürte von einem blonden hübschen kleinen Prager Mädchen, das auch das Wasser liebte.
Dort in den Moldauanlagen durfte Anny eigentlich nicht spielen. Alle Mütter pflegen dem Sprichwort „Stille Wasser sind tief“ unbedingt zu trauen, aber dass ein von vielen Patschbeinen unruhiges Planschbeckenwasser nicht tief sei, wagen manche Mütter nicht zu glauben. Anny aber zog es dorthin. Erstens stand dort ein grosser, alter Holunderbusch, der just aus Andersens Fliederteemärchen zu stammen schien. Und zweitens hatte sie ein nettes kleines Mädchen kennengelernt, das zu diesem Märchen passte und zudem entfernt etwas vom Theater geäussert hatte, sich auch überdies ungewöhnlich zierlich zu bewegen wusste. Es tanzte sozusagen Ballett mitten in dem kleinen himmlisch flachen Anlagensee, vermochte auch wie eine zarte Marmorstatue unbeweglich eine Nixe oder einen Schwan darzustellen. Anny blieb der Atem weg vor Entzücken. Sie wartete Tag für Tag auf nähere Offenbarungen. Nein, sie mochte nicht fragen, um nicht die leise Ahnung, die sie hegte, vielleicht zu bald zerstört zu sehen.
Eines Sonntags nun in der Aufführung der „Puppenfee“ sah Anny zu ihrem Erstaunen und unbeschreiblichen Jubel, dass die Planschbeckenfreundin einer der kleinen Stars auf der Bühne sei. Da hatte ihr Herz keine Ruhe mehr, heimlich musste Lusette ihr alle Übungen und Schritte zeigen, und es dauerte nicht lange, da konnte auch Anny Spitze tanzen und allerhand akrobatische Tanzkunststücke. Ihre Eltern konnten sich gar nicht erklären, woher sie solches habe.
„Klopfet an, so wird euch aufgetan“
Es behagte Mackie nicht in der Eilbecker Schule, und er setzte es durch, wieder nach Rothenburgsort zu kommen. Wie er auch später keinen langen Weg gescheut hat, um zu erlangen, was er wollte. Er wurde in der Eilbecker Kirche konfirmiert, und der Tag war festlich geschmückt durch die Anwesenheit seiner drei munteren Kusinen. Der Spruch, den ihm der Pastor mit auf dem Weg gab, hiess: „Klopfet an, so wird euch aufgetan.“ Kein schlechtes Omen fürwahr für seinen späteren Beruf.
Auch für das, was er nun erstmal wurde, war es ein gängiger Spruch. Das Kunstmalen hatte er nach zwölf Monaten aufgegeben. Danach hatte ihm eine Weile vorgeschwebt. Förster zu werden, denn sein verehrter Onkel war nebenbei auch ein leidenschaftlicher Jäger. Die Mutier jedoch riet ihm notgezwungen von der langwierigen Laufbahn ab, und das ganz energisch. Somit wurde er Stift in einer Anzeigenvertretung, die mit dem Hamburger Fremdenblatt zusammenarbeitete.
Es war das Jahr 1920. Mit Mühe war der Bürgerkrieg in Deutschland in seinen Anfängen erstickt worden. Und langsam überpinselten Wind und Wetter und Sott die weissen Wunden, die dem Hamburger Rathaus von den zahlreichen Einschlägen durch Maschinengewehr- und Flintenkugeln der Aufständischen zugefügt worden waren. Jedermann, der nach langen trüben Jahren noch lebte, freute sich des Daseins, so gut es ging. Singend und klampfend zog Mackie in die Lüneburger Heide, falls er die Sonntage nicht nötiger für seinen Sportklub St. Georg brauchte, wo er Torwart der zweiten Schülermannschaft war. Die Hamburger Kaufmannschaft begann den Nacken neu zu steifen. Die Hamburg-Amerika Linie erhob sich aus kläglichen Resten. Sie willigte in eine Gemeinschaft mit dem amerikanischen Harrimankonzern und legte damit den Grund zu einem neuen Aufstieg, der die Welt bald in Erstaunen setzen sollte.
Mackie war sechzehn Jahre und für sein Alter ungewöhnlich gross und kräftig. Der Kontorbock schien ihm kein rechtes Streitross zu sein für seinen Wagemut. Der Sportverein, der sich allmählich zum Ringerklub gewandelt hatte, war allerdings geeigneter, um sich richtig auszutoben, und bald war Max dort der Hauptmacker.
Eines Tages wurde er ausersehen, in einem öffentlichen Ringkampf die Ehre seines Vereins gegen einen um neun Jahre älteren Gegner zu verteidigen. Der Kampf sollte an einem Sonntagvormittag stattfinden. Schon um sechs Uhr morgens erhob sich Mackie aus den zerwühlten Federn, er, der gern an Feiertagen bis Mittag schlief. Seine Mutter merkte, dass etwas im Busche sei. Nach längerer Auseinandersetzung, bei der Mackie sein Vorhaben nicht leugnete, aber auch nicht davon abzubringen war, schloss sie ihn kurzerhand und gnadenlos in sein Zimmer ein.
Und während zu Prag Klein Anny, schon ein halber Backfisch, vor dem Nationaltheater wartete, um einen Platz zu ergattern und Lusette zu sehen, sass Mackie dumpf und hilflos in seiner nördlichen Kammer und sah seine Ringerlaufbahn auf ewig abgebrochen. Er schämte sich tatsächlich so vor seinem Verein, dass er sich dort von da ab nie mehr blicken liess.
Dennoch ist er einmal öffentlich als Ringer aufgetreten, und zwar bald danach. Es war auf dem Wandsbeker Pflaumenmarkt, einem munteren Herbstrummel, nahe Hamburgs Grenzen, der nicht weit von der Wirkungsstätte des aller Gewalt so abholden Mondbesingers Matthias Claudius vor sich zu gehen pflegte. Mackie nahm dort die übliche Herausforderung des Direktors einer Artistenbude ernst und legte „Bully, die Eiche Deutschlands“, nachdem er sich überzeugt hatte, dass sie zu fällen sei, zu Beginn der zweiten Runde auf die Schultern. Leider liess der „Direktor“ im gleichen Augenblick den Gong erschallen und verkündete, die Zeit sei überschritten, welche Auffassung eines dehnbaren Begriffes mangels vorangegangener Verträge schwer zu widerlegen war. Somit gingen Max die bei seinem ersten öffentlichen Sportsiege ausgelobten hundert Mark aus der Nase. Er zog daraus die Lehre, dass es besser sei, von da ab sich an keinem öffentlichen sportlichen Kampf ohne gehörigen Vertrag zu beteiligen, und obwohl ihn nun zum ersten Male der Beifall des Publikums umschmeichelt hatte, so fand er doch, dass ausgerechnet mit dem Ringen nicht das wahre Glück für ihn verbunden sei, und deshalb lernte er Boxen.
Mit dem Boxen war es nun zuerst noch nicht weit her. Es handelte sich da erstmal um das, was man an der Wasserkante unter den Befahrenen so Boxen nennt. Es war englische Überlieferung mit einem gehörigen Schuss Rum und Kautabak; von adligem Stil konnte keine Rede sein, man gab und nahm so richtig aus der Plünnenkiste, haste was kannste. Gewiss, da gab es so eine kleine Schrift: „Der perfekte Faustkämpfer“ oder „Die Kunst der Selbstverteidigung ohne Waffen“. Da las man auch richtig von Haken, Schwingern, Uppercuts, Geraden, von Clinch und Beinarbeit, von Unzen, Bandagen hart und weich, von „Nierenschützern“ aus Aluminium, von Schuhen aus „Kautschuk, die einen leichten, federnden Tritt geben“, von Sandsack und Lederbirne und der geradezu akrobatischen Arbeit daran, und es war auch von den internationalen Regeln der Runden und Pausen die Rede und von der dazu gehörigen Massage vor, während und nach dem Kampfe und auch, dass man frisches Kalbfleisch auf die geschwollenen Stellen legen solle, um sie zum raschen Abziehen zu bringen. Das war alles ganz schön, und man konnte stundenlang darüber sprechen. Man sah auch manchmal im Edentheater ein Kraftweib auftreten, das in grosser Abendrobe anfangs weisse Tauben aus einem Goldfischhafen hervorzauberte und danach, noch diese zarten Geschöpfe auf der Schulter, einen tadellos aufgehängten Lederball zu bearbeiten begann, bald mit den Fäusten, bald mit den Ellenbogen, den Schultern, dem Busen, dass es nur so schnurrte und flimmerte. Die Dame lud auch Herren aus dem staunenden Publikum ein, es ihr nachzumachen. Nur einer soll es einmal fast so gut wie sie gekonnt haben: Mackie. Er war froh, endlich einmal ein so teures Stück unter die Knöchel zu kriegen; denn in seinem Sportverein gab es dergleichen noch nicht, sondern im Anfang wurde das einzige Paar Handschuhe, das vorhanden war, jedesmal unter die beiden Kämpfer dem Los nach verteilt, und da, wie die Sage geht, Mackie meistens den Rechten zog, wurde seine Rechte frühzeitiger geschult und früher hart als die Linke. Und weil für Nachkuren das teure Kalbfleisch nicht in Frage kam, lernte er früh, sich trefflich vor allzu unzarter Berührung der gegnerischen Pfoten zu wahren und im übrigen, sozusagen durch „Selbstbesprechung“, seinem Schädel anzugewöhnen, harten Schlägen die Wirkung einfach nicht zu gönnen, sondern sich zu einer stählernen Maske auszubilden. Es ergab sich, dass Max körperlich und geistig ungewöhnliche „Konzentrationskraft“ besass. Er war geradezu vorbildlich für den Boxsport begabt. Wohin das führen würde, ahnte noch niemand, und auch er selber noch nicht.
Es wird ernst mit dem Theater
Es war mitten in jenem reissenden Währungsabsturz, der alles, was auf dem europäischen Festlande am Kriege beteiligt gewesen war, unbarmherzig erfasste. Anny war zwischen dreizehn und vierzehn, und das Leben in der jungen Tschechoslowakei liess sich bunt und laut und zukunftsreich an. Der Begriff Geld, der die Ohren des hübschen Backfisches zum ersten Male märchenlos berührte, erging sich in ungeheuerlichen, Tag für Tag wachsenden Zahlen. Aber die Gegenwerte, die den Bedarf des Lebens an Nahrung, Kleidung und Krimskrams ausmachen, wurden immer dürftiger.
Annys Eltern hatten ein kleines Vermögen in der österreichischen Kriegsanleihe verloren; die Inflation bot ihnen keine Möglichkeit, es neu zu erwerben. Darum waren sie schliesslich froh, als Anny schon vor dem Verlassen der Schule — gleich ihrem späteren Gatten — etwas zum Unterhalt des Hauses beitragen konnte. Klein Anny hatte nämlich auf der erwähnten Planschwiese noch eine andere Bekanntschaft gemacht. Das lustige Geschöpf war nämlich ganz zufällig dem Spielleiter des Svanda-Theaters aufgefallen, gerade als sie einige Schritte, die ihre Ballettfreundin wunderschön vorgemacht hatte, in einer ungewöhnlich drolligen Anmut nachtanzte. Der Herr fragte nach dem Namen des netten Mädchens, indem er nicht die Gefahr scheute, dabei eine kleine Dusche an Planschspritzern abzubekommen. Er setzte sich mit den Eltern in Verbindung und erhielt die Erlaubnis, dem hübschen Kinde den ersten dramatischen Unterricht zu geben. Bald trat die kleine Anny Ondra schon in Kinderrollen auf und verdiente somit ihre ersten, wenn auch bescheidenen Honorare. Anny, von früh auf ausserordentlich gewandt, konnte damals schon schwimmen, radfahren, eislaufen und reiten. So lernte Lamač sie kennen. Karel Lamač (sprich Lamatsch), von Haus aus Pharmazeut, hatte schon während des Feldzuges sich mit der Kamera beschäftigt und Wochenschau-Aufnahmen im Kampfgelände gedreht. Die Prager „Exzelsior“-Filmgesellschaft, eine Gründung gleich nach dem Kriege, verpflichtete ihn als technischen Leiter. Bald spielte er selber, und im Laufe weniger Jahre stellte er zu Prag und Wien in rund siebzig Filmen die Hauptrollen dar, hatte auch schon manchmal Regie geführt, als er Anny entdeckte. Ein rechter Schauspieler, ein begabter Spielleiter, Verehrer amerikanischer Groteskfilme, ein lebhafter Bohemien von Natur (auch der Geburt nach in der tatsächlichen Bedeutung des Wortes), ein unerschöpflicher Witzbold, ein leidenschaftlicher Liebhaber und Gestalter komischer Einfälle und auch von technischer Erfindungsgabe, erkannte er Anny Ondras ungewöhnliches Filmtalent und war von bestimmendem Einfluss auf ihr Können und ihre Laufbahn.
Er war einer der ersten, die sich in der Tschechoslowakei an den Film getrauten, der eben erst aus der Ebene der Artisten und Schaubuden zu einer ernsthafteren Beachtung durch die Öffentlichkeit gedieh und sich zu künstlerisch ehrgeizigeren Zielen aufzuschwingen begann. Es gehörte damals Mut dazu, und man setzte seinen Ruf aufs Spiel. Anny aber betrat furchtlos und vertrauensvoll mit ihrem Entdecker den noch unsicheren Weg. Beide haben es nicht zu bereuen gehabt. Sie sind einander künstlerisch treu geblieben, und man kann wohl sagen, dass innerhalb der Grenzen, die der grotesken Wirkung in aller Welt nun einmal gesetzt sind, Lamač für die Ondra eine durchweg glückliche Hand bewiesen hat.
Anny wurde durch ihn die Clara Bow Europas, doch mit dem einen Unterschied, dass sie den Vorteil der Jugend hatte und in allem ein wenig liebreizender blieb als die tolle Amerikanerin und auch, dass im Laufe der Entwicklung jene Innigkeit ihres Spiels möglich wurde, die eben deutsch ist und nicht amerikanisch.
Mit vierzehn Jahren spielte Anny Ondra ihren ersten Film. Es war ein dreiaktiges Lustspiel und hiess „Gillis Abenteuer“. Eine kostbare Sache war es noch nicht. Die Herstellung durfte nicht viel mehr als das Material kosten. Jeder Meter Film war genau berechnet, und verpatzte Stellen wurden keineswegs zweimal gedreht. Es gab auch noch kein Filmatelier damals in Prag, alle Szenen spielten auf der Strasse oder in einem Park. Lamač benutzte für seine Aufnahmen vorzugsweise den Hof seines eigenen Hauses, ab und an auch einen grossen verlassenen Garten an der Moldau.
Der Kameramann hiess Heller, und das Kleeblatt Lamač-Ondra-Heller ist bis auf den heutigen Tag kameradschaftlich beieinander geblieben.
Damals die ersten Filme wurden in einer alten Badewanne entwickelt. Trotzdem waren die Bilder nicht schlecht, und zumindest die drei Hersteller waren ausserordentlich begeistert. Doch auch den Zuschauern in den paar düsteren Prager Kintöppen schien das Erzeugnis, und zumal die lustige und liebreizende Anny ebensogut zu gefallen oder gar noch besser als alle auswärtige „Produktion“, deren Spitzenleistungen damals aus dem Norden kamen und herrlich waren von dem tragisch so unvergleichlichen Spiel der Asta Nielsen.
Ein Typ wie Anny Ondra war das gerade Gegenteil von der dunkeln Leidenschaft und Schwermut einer Asta Nielsen. Die Welt lebt von Gegensätzen, und somit durfte Anny, eben 15 Jahre, in dem nächsten Lamač-Film die Hauptrolle spielen.
Es war ein vielsagender Titel: „Mädchen, die sich nicht verkaufen“. Ihr war es gleich, wenn sie nur spielen durfte. Sie war der rechte Kobold, den Lamač brauchte, zierlich, schlank, von übermütiger Behendigkeit, blondwuschelig, mit einem süssen Kindergesicht, mit einem runden Mund und noch runderen hellen Augen, die unglaublich erstaunt und unschuldsvoll in die Welt zu blicken vermochten, indes die zarte Gestalt sich in den damals eben eingeführten amerikanischen Tänzen in unglaublichen akrobatischen Kapriolen erging.
Die Kostüme zu diesem Film wurden zu Hause genäht. Es muss gesagt werden, dass die kleine Diva eine geschickte Hand hatte, man sah es schon an ihren frühen Zeichenkünsten. Ja, sie hatte sogar hausfrauliche Neigungen und scheute sich nicht, ihre Strümpfe selber zu stopfen und ihre Knöpfe selber anzunähen, oft auch ihre Kleider selber herzustellen. In diesem Falle zog sie bei dem Umfange der Arbeit alle ihre Schulfreundinnen zur Hilfe heran, und alle durften dafür mitspielen.
Es wurde ein grosser Erfolg. Die Prager zeigten sich rührend dankbar, dass die junge tschechische Nation ihre eigene Filmindustrie begonnen hatte und Land und Leute und Blut und Boden nationaler Gattung zu Themen wählte.
Sehr viele Filme entstanden damals, die meisten wurden in vier bis sieben Tagen gedreht.
Gleich im ersten Jahr ihrer „Filmtätigkeit“ bekam Anny eine Einladung der Filmgesellschaft Sascha nach Wien. Sie sollte dort vorspielen; ihre Mama begleitete sie, aber es wurde nichts als eine Enttäuschung. Wie gross und frech war die Welt zu Wien! Nein, da konnte sich ein kleines Mädchen nicht wohlfühlen.
Anny war froh, wieder in Prag zu landen, wo inzwischen nun doch ein Filmatelier entstanden war. Zwar war es nichts weiter als die alte hölzerne Scheune einer Brauerei, wo früher Hopfen getrocknet wurde, zwar wurden vorerst nur alte Theaterkulissen dafür zurecht gemacht, und mit der Beleuchtung haperte es anfangs auch. Es war ein Unternehmen, das das Missfallen einer jeden Feuerpolizei erregt hätte. Dennoch wurden hier Hunderte von Filmen gedreht, und noch 1931 wurde dort gefilmt (wenn auch nicht mehr mit Anny), ohne dass je etwas passiert wäre.
Max geht auf Wanderschaft
Wie gesagt, Büroarbeiten waren nichts für Max. Er musste mehr frische Luft um sich haben, und seine Arme sehnen sich nach anderen Lasten, als es Federhalter, Briefmarken, Bestellzettel und Kontobücher ihm sein konnten. Er wurde Arbeiter in einem Hamburger Rohrbogenwerk. Dort wurden riesige Eisenplatten mit Gasbrennern zu Rohrstücken gewölbt. Das behagte Max eine Weile ganz gut, bis er sich eines Tages die Hand so übel verbrannte, dass er die weitere Neigung zu dieser Art Beschäftigung verlor. Es fiel ihm ein, wie anders doch sein Vater gelebt habe, und er spürte, das Erbteil, das er in sich trug, hiess: Sehnsucht in die Weite. Seine Mutter verstand ihn, und da er versprach, niemals Seemann zu werden, schnürte sie ihm den Pappkarton, versorgte ihn mit einem dicken Paket deftiger Butterbrote und wünschte ihm viel Glück. Er fuhr nach Düsseldorf, um bei den Eltern eines Hamburger Sportfreundes zu wohnen.
Nun begann eine harte Schule für ihn. Schliesslich wurde er Arbeiter bei einer Hoch- und Tiefbaufirma. Er schaufelte, schuftete und grub, drehte Winschen, mischte Zement, bohrte Brunnen und legte Rohre. Das bekam seinen Muskeln und seinem Appetit vortrefflich, obwohl es nicht immer gross was zu beissen gab. Auch Freizeit gab es wenig, aber selbst in dieser kargen Freizeit verlangte sein Körper nach Betätigung. Somit wurde er Mitglied eines „Ring- und Stemmklubs“ zu Benrath, in welchem Ort seine Firma einen grösseren Auftrag auszuführen hatte.
Mit kaum glaublicher Zähigkeit widmete er sich seiner sportlichen Fortbildung, rang, boxte und trieb Leichtathletik.
Manchen Sonntag aber zog er mit einem ehemaligen Artisten auf die Dörfer, und die beiden auf den kleinen Bühnen der ländlichen Tanzsäle erstaunten die Menge mit „sensationellen Attraktionen“, indem sie Nägel mit der ungeschützten Hand in ein Brett schlugen, Ketten zerrissen und Hufeisen verbogen, hin und wieder auch einmal ein bisschen boxten.
Max war es eben gewohnt von Jugend auf, seine Fertigkeiten nicht nur zum Vergnügen auszuüben, sondern vielmehr das Vergnügen durch Zweckmässigkeit zu steigern.
Boxen, das war ein Sport, der vor dem Kriege in Deutschland als roh und blutig öffentlich verboten gewesen war und der übrigens heute noch in den Vereinigten Staaten fast überall der behördlichen Genehmigung bedarf, sobald es sich um öffentliche Kämpfe handelt. Nach dem Kriege änderte sich die deutsche Einstellung. Deutsche Kriegsgefangene hatten in England, zumal auf der Insel Man, den Faustkampf sozusagen aus Verzweiflung und Langerweile gelernt. Prenzel, Breitensträter, Grimm, Naujoks, Wiegert, Dubois, Huber, Koch, Möller, Spörl, das hauptsächlich waren die ersten, die in Lederhandschuhen zu Hamburg, Berlin oder Köln auf das „Ring“ genannte, hanfseilumspannte rechteckige Podium vor das Publikum traten, und Otto Flint, ein Verwandter der berühmten Taucherfamilie, der schon vor dem Kriege bedeutendes boxerisches Können erlangt hatte, wurde der erste deutsche Schwergewichtsmeister.
Durch seine Baufirma kam Max nach Köln. Dort lernte er seinen ersten richtigen Boxlehrer Adolf Dübbers kennen. Er hatte eine Menge allzu privater „Boxauffassung“ abzulegen. Er musste sozusagen ganz von vorn anfangen. Aber er lernte rasch. Dübbers fiel von einem Erstaunen ins andere. Und bald lagen auch die ersten „Gegner“ auf den Brettern.
Wo etwas geleistet wird, stellen sich die Manager ein. Zwischenhandel gibt es nicht nur in der Wirtschaft, sondern ebensogut in der Kunst und im Sport. Der Manager und Agent eines Artisten zum Beispiel ist sozusagen sein Makler und Spediteur und oft auch sein Bankier. Nicht viel anders ist es beim Film. Und nicht viel anders im Berufssport, zumal bei den Boxern.
Damals verdienten einige Boxer selbst in Deutschland schon ansehnliche Summen, so zum Beispiel der Gentlemanfighter Prenzel und auch Breitensträter, der blonde Hans. Summen von zwanzigtausend bis fünfundzwanzigtausend Mark als Kampfbörse. Max schwindelte es, wenn er sich das vorstellte. Aber es war nicht nur die Sehnsucht, Geld zu verdienen, die ihn anspornte. Der erste Beifall lag ihm in den Ohren, Ehrgeiz brannte in ihm. Er wollte zeigen, was er konnte. Sein Vater hatte die weite Welt gesehen, und auch sein Herz schlug für grössere Horizonte, als Adolf Dübbers und als sein erster Manager Abels ahnten.
Es war um die Zeit, als der Fiskus ebenfalls seinen Anteil an den steigenden Boxunternehmungen suchte. Mit einem Schlage aber vermochte das die Entwicklung abzudrosseln. Die Kämpfe wurden seltener; das durch die Lustbarkeitssteuer vergrösserte Risiko schreckte viele Veranstalter ab.
Auch kamen immer weniger Ausländer in den deutschen Ring. Die fortschreitende Geldentwertung machte ihre Bezahlung fast unmöglich.
Es war das Jahr 1924.
Damals schon gab es eine Fachzeitschrift des Faustkampfes: „Der Boxsport“. Der Hauptschriftleiter hiess Arthur Bülow. Unter den Mitarbeitern sah man auch den einstigen Hamburger Seemann Walter Rothenburg.
Rothenburg war einer der frühesten Boxveranstalter nach dem Kriege. Jetzt sah er sein Geschäft dahinsinken, und da er auch ein fruchtbarer Lyriker war, erleichterte er sein Herz mit einem Gedicht, dessen melancholische Überschrift lautete: „Unheimliche Ruhe“.
Der grosse Bauernfilm
Im Filmgeschäft aber begann es lebhafter zu werden. Und die Suche nach den grossen Themen begann. Da ist zum Beispiel das Gebirge. Und, nicht wahr, das deutschsprachige Gebirgsbauerntum ist seit jeher beliebt gewesen, teils wegen der Tracht, teils wegen des freiheitlichen Charakters und teils als Musikkapelle für bürgerliche Bierlokale.
In Norddeutschland singen schon die ganz kleinen Mädchen, wenn sie im Kreis auf der Strasse spielen:
„Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh.“
Peter Rosegger hat uns, da wir noch jung waren, mit den Geschichten vom Waldbauernbuben ans Herz gegriffen, Ludwig Thoma vermochte es auf bayrischer Grundlage später, als wir erwachsen waren (für andere war es Ludwig Ganghofer). Der grossen Literatur und Bühne aber hatte Karl Schönherr die Söhne der Berge entdeckt und hatte ihnen dort Raum und Gehör geschaffen schon vor dem Kriege.