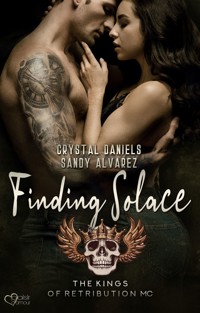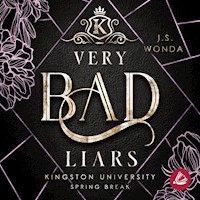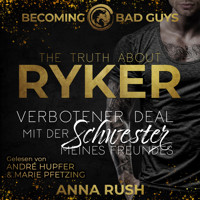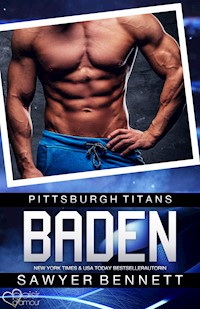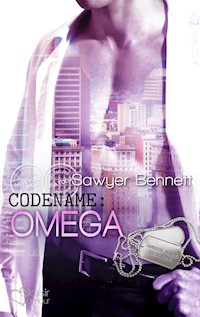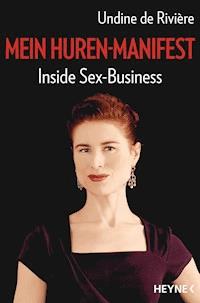
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Über Prostituierte glaubt jeder Bescheid zu wissen: Huren verkaufen ihre Seele. Die meisten werden zum »Anschaffen« gezwungen. Mafiose Strukturen bestimmen das Geschäft.
Mit solchen und anderen Klischees räumt die Sexarbeiterin Undine de Rivière auf. Sie gibt einen unerwartet differenzierten Einblick in die Welt zwischen BDSM-Studio, Laufhaus und Gangbang-Party und lässt Kolleginnen, Freier, Betreiber und Experten zu Wort kommen – offen und ehrlich. Ein Insiderbericht, wie es hinter den Kulissen eines Wirtschaftszweigs zugeht, über den meist nur Halbwissen und Pauschalurteile verbreitet werden – ein starker Appell für die Entkriminalisierung einer umstrittenen Berufsgruppe.
»Die meisten Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, sind selbstbewusste Frauen, die sehr genau wissen, was sie wollen.«
Undine de Rivière
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Ähnliche
Über Prostituierte glaubt jeder Bescheid zu wissen: Huren verkaufen ihre Seele. Die meisten werden zum »Anschaffen« gezwungen. Mafiose Strukturen bestimmen das Geschäft.
Mit solchen und anderen Klischees räumt die Sexarbeiterin Undine de Rivière auf. Sie gibt einen unerwartet differenzierten Einblick in die Welt zwischen BDSM-Studio, Laufhaus und Gangbang-Party und lässt Kolleginnen, Freier, Betreiber und Experten zu Wort kommen – offen und ehrlich. Ein Insiderbericht, wie es hinter den Kulissen eines Wirtschaftszweigs zugeht, über den meist nur Halbwissen und Pauschalurteile verbreitet werden – ein starker Appell für die Entkriminalisierung einer umstrittenen Berufsgruppe.
»Die meisten Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, sind selbstbewusste Frauen, die sehr genau wissen, was sie wollen.«
Undine de Rivière
Undine de Rivière
MEINHUREN-MANIFEST
Inside Sex-Business
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 06/2018
Copyright © 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Ulrike Strerath-Bolz
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung eines Fotos von © Philipp Oelwein
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-21794-5V001
www.heyne.de
Inhalt
»Da muss man doch was tun!«
Die Geschichte der U.
»Sie arbeiten also als Domina?«
»Aber warum machen Sie das denn bloß?«
(K)ein Job wie jeder andere – mein Alltag als Sexarbeiterin
Die Reaktionen der anderen
Huren-Politik
Medienrummel – durchaus erwünscht
Wer Erfolg hat, macht sich Feinde
Zuhälterei, Zwangsprostitution, Menschenhandel?
Raus aus der kriminellen Ecke
Entkriminalisierung
Legalisierung heißt nicht »Legalize it«
Sexarbeit ist Arbeit
Neuseeland als gutes Beispiel?
Schluss mit der Diskriminierung
Puff, Studio oder Strich? Wo man uns findet
Der Tod der Peepshow
Voll die Orgie – Reizthema Gangbang-Partys
Undercover im Billigpuff
Große Vielfalt – die Kunden
»Gern bereit, für Können zu bezahlen« – der professionelle Kunde
»Ich will schon mehr sein als nur ein Gast!« – der emotionale Kunde
Dein Freier, das unbekannte Wesen
Nein heißt Nein
Maicon: »Ich buchte die klassische Zwanzig-Minuten-Nummer.«
Manuel: »Knutschen, Blasen, Ficken, Quatschen.«
Markus: »Mein jährliches Paysex-Budget liegt bei dreitausend bis viertausend Euro.«
Andrea: »Ich hatte devote Fantasien.«
Täter-Opfer-Klischees – was sagen die Freier?
Die Kolleginnen
Hannah: »Ohne meine Arbeit wäre mein Leben viel ärmer und grauer.«
Marleen: »Grenzen sind individuell.«
Juliana: »Ich wollte meinem Kind eine gute Zukunft ermöglichen.«
Cornelia: »Für mich gibt es keinen Boss und keine Zuhälter mehr.«
Ina: »Ich habe das Recht, selbst über mein Leben zu entscheiden.«
Mavis: »Für meine Eltern war es ein Schock.«
Keine Lust auf Puffmutter
Lara und Klaus: »Und dann begann der Ärger.«
Die Rechtslage in Deutschland
Sondergesetze
Neue Gesetzesvorhaben
Es geht noch schlimmer – das »Prostituiertenschutzgesetz«
Zwangsregistrierung und Hurenausweise
Gesundheitliche Pflichtberatung und Kondomzwang
Erlaubnispflicht für »Prostitutionsgewerbe«
Übernachtungsverbot
Verbot von Flatrate-Bordellen und Gangbang-Partys
Freierbestrafung bei »Zwangsprostitution«
Ein klarer Fall für die Rundablage
Eine echte Alternative? Sexarbeit als Ausbildungsberuf
Als »Jungdomina« im SM-Studio
Deep Throat und Emotionsarbeit: Sexworker-Kompetenzen
Aus- und Weiterbildung für Profis
Huren und Feminismus
Alice Schwarzer und die EMMA – ein deutscher Skandal
Weibliche Sexworker und männliche Kunden
Sexarbeit als Teil der »Männerwelt«
Das leidige Thema »Zwangsprostitution«
Sexarbeit und Kapitalismus
Pro Sexwork und Feministin – kein Widerspruch
Fragt uns doch mal! Forschung zum Thema Sexarbeit
Ziele, Wünsche und Fallstricke
Alle Fragen offen?
Christiane Howe – der Empowerment-Ansatz
Ausblick …
Nachwort
Anhang
Danke
Anmerkungen
Hilfreiche Adressen
Die wichtigsten Gesetze – und wo man sie findet
Glossar
»Da muss man doch was tun!«
»Ich sehe kein grundsätzliches Problem in Flatrate-Clubs, ich habe auch selbst schon bei Gangbang-Partys mitgemacht.«
»Gäng … was?«
»Gangbang.«
»Gang … bang?«
»Genau, Gangbang!«
»Gang … Bang …«
Ich trinke Tee mit einer distinguierten, gebildeten Dame Mitte sechzig in einem opulent eingerichteten Café an der Hamburger Binnenalster. Gerade machen wir Sprachübungen zu Sexarbeits-Fachvokabular. Mein Gegenüber setzt sich seit vielen Jahren weltweit gegen Menschenrechtsverletzungen ein und hat dafür viele Auszeichnungen bekommen. Und die Dame fordert nun in diesem Sinne: »Prostitution abschaffen!«
Gangbang ist Gruppensex mit mehr Männern als Frauen. Solche Orgien werden sowohl von Privatleuten organisiert – häufig in Swingerclubs – als auch in Bordellen oder Hotelsuiten von Sexarbeiter_innen für zahlende Kunden angeboten. Um Letzteres geht es hier.
Manchmal frage ich mich, ob es nicht ein bisschen demütigend ist für die Jungs, in einer Schlange zu stehen, und mit dem eigenen Gemächt in der Hand zu warten, bis sie dran sind, während ich mich in einer bequemen Liebesschaukel rekle und lasziv den nächsten heranwinke. Aber die Männer, die solche Veranstaltungen besuchen, erregt bereits die Atmosphäre, das Zuschauen vor dem eigenen Akt. Das ist ihr Vorspiel. Verweildauer in mir bis zum Orgasmus: meist zwei bis fünf Minuten. Erst in der Summe komme auch ich manchmal auf meine Kosten – zum Glück ist Vergnügen bei der Arbeit nicht verboten. Wer es gar nicht abwarten kann, darf rechts oder links neben mich treten und bekommt eine Handentspannung. Ich bin da multitaskingfähig. Wer mich bedrängt, Dinge fordert, die ich nicht will, oder unfreundlich ist, wird von seinen Geschlechtsgenossen zurechtgewiesen, meist lange bevor ich überdeutlich werden muss oder einer der anwesenden Veranstalter einschreitet. Es herrscht eine gewisse Sozialkontrolle auf solchen Partys – schlechte Laune verdirbt schließlich allen den Spaß.
Wenn’s mir reicht, vielleicht nach fünf oder zehn Mal Verkehr, mache ich eine Pause, gehe duschen, trinke eine Cola und unterhalte mich ein bisschen. Dann geht es wieder ab auf die Spielwiese. Das Ganze ist eine Form des Flatrate-Sex: Die Euros fließen pauschal für die Anwesenheitszeit, sowohl von den Besuchern an den Veranstalter als auch vom Veranstalter an mich. Soll mir recht sein, ich verliere im Flow sowieso den Überblick und zähle nicht allzu genau mit.
Für jemanden, der kein Problem mit schnellem Sex mit wildfremden Menschen hat, bedeutet so ein Nachmittag angenehm verdientes Geld. Für jemanden, der dem Geschlechtsverkehr eine deutlich größere Bedeutung zuschreibt als einer Rückenmassage oder der die eigenen emotionalen Grenzen nicht wahren kann, muss es der Horror sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob meine Gesprächspartnerin im Café an der Alster das alles so genau wissen will, und es liegt mir fern, ihr Schamgefühl zu verletzen. Aber eigentlich sollte sie es wissen wollen – schließlich behauptet sie, sich für die Belange von Prostituierten einzusetzen. Und die sind heutzutage angeblich alle ganz anders drauf als ich, werden entweder von Menschenhändlern verkauft und zum bezahlten Missbrauch freigegeben, oder sie lassen sich täglich vergewaltigen, auf Druck ihrer Familien, oder um nicht zu verhungern. Ich bin die Ausnahme, um die es in der ganzen Diskussion gar nicht geht. Sollen wir paar selbstbestimmte deutsche Huren doch machen, was wir wollen – aber die vielen armen jungen Mädchen aus Osteuropa … Das darf man doch nicht verharmlosen! Da muss man doch was tun!
Ja, da muss man was tun. Wenn ich einer Kollegin gegenübersitze, die sich in ihrer Situation gefangen fühlt, die nicht Nein sagen kann, weder zu ihrer Familie, die sie als Geldautomaten versteht, noch zu übergriffigen Kunden, die möglichst viel für ihre dreißig Euro herausschlagen wollen, dann blutet mir das Herz. Und ich würde mir auch Sorgen um meine emotionale Gesundheit machen, ließe mich das kalt. Ich spreche mit ihr über mögliche Alternativen innerhalb der Sexarbeit, über andere Arbeitsorte mit angenehmerem Publikum, über Techniken zur Abgrenzung und Gesprächsführung, über Professionalisierung, Spezialisierung, Stammkundenbindung. Manchmal halte ich eine Frau auch für völlig ungeeignet, irgendeinen Job zu machen, in dem sie unmittelbar drängenden Emotionen und Bedürfnissen ihrer Klient_innen ausgesetzt ist. Sie würde auch als Altenpflegerin, Krankenschwester oder im Callcenter einer Beschwerdestelle kaputtgehen. Und wer Sex für etwas Heiliges hält, das nur in einer Beziehung oder zum Kindermachen vollzogen werden soll, der wird in der Sexarbeit sicher nicht glücklich werden.
Ich wünsche mir, dass diese Menschen Alternativen in anderen Berufen finden, und vermittle Kontakte zu Fachberatungsstellen, die individuelle Umstiegsangebote erarbeiten können.
Nur eins will ich ganz sicher nicht: Diesen Leuten die Sexarbeit verbieten. Wenn ich jemanden zwangszuretten versuche, ihn nicht mehr als handelndes Subjekt wahrnehme, sondern ihn vor seinen eigenen Entscheidungen schützen will, bin ich nicht besser als all die anderen, die Druck auf ihn ausüben. Keine aktiv tätige Kollegin und kein aktiv tätiger Kollege, egal wie schlecht es ihnen geht, hat je zu mir gesagt: »Kriminalisiert mich, kriminalisiert meine Kunden, und bitte macht doch noch ein paar Polizeirazzien mehr, dann geht’s mir bestimmt bald besser!« Kriminalisierung und Arbeitsverbote, egal ob sie als »Schutz« daherkommen oder nicht, sind keine bloßen Unannehmlichkeiten, sondern führen zu knallharten Geld- oder Haftstrafen für die Betroffenen. Die wenigen Sexworker, die selbst eine strengere, diskriminierende Regulierung der Branche fordern, tun das meist aus der Überlegung heraus, dass es der Konkurrenz hoffentlich mehr schaden würde als ihnen selbst.
Auch außerhalb der Branche unterstelle ich in der seit vielen Jahren geführten Debatte um die »Eindämmung« oder »Abschaffung« der Sexarbeit einer nicht unerheblichen Zahl von Agitator_innen, dass sie ihre persönlichen, moralischen oder ideologischen Befindlichkeiten unter dem Deckmantel der Betroffenheit durchsetzen wollen. Während noch in weiten Teilen des zwanzigsten Jahrhunderts die Gesellschaft ganz offen vor unserer normabweichenden und Angst machenden Unsittlichkeit geschützt werden musste, hat sich der Zeitgeist zumindest hierzulande glücklicherweise gewandelt: Dass die Freiheit eines Menschen erst dort beschnitten werden darf, wo sie einen anderen greifbar beeinträchtigt, gilt inzwischen auch weitgehend für Minderheiten, und das Strafrecht wird in Deutschland zumindest nicht mehr allzu offen zur Regulierung der Moral eingesetzt. Daher wurde die Argumentation der Prostitutionsgegner_innen subtiler: Statt gefährlich geisteskrank sind wir nun nur noch naiv und manipuliert, statt die Gesellschaft vor uns zu schützen, müssen nun wir selbst geschützt werden. Das aber gern mit denselben Methoden wie damals: Sondergesetze im Strafrecht, möglichst umfassende polizeiliche Kontrolle, Kasernierung in staatlich überwachten Bordellen … Und vor allem sollen die gemeinen Bürger mittels Sperrbezirken, Straßenstrich- und Werbeverboten am besten gar nicht mit unserer Existenz konfrontiert werden.
Aus vielen Gesprächen weiß ich aber auch, dass es gar nicht so wenige Menschen gibt, die es im Grunde wirklich gut mit uns meinen. Die mit Bildern von weinenden jungen Mädchen konfrontiert werden und glauben, wenn ihnen erzählt wird, dass eine Sexarbeiterin so und nicht anders aussieht. Die glauben, dass Zwang, Gewalt und Not zum »System Prostitution« dazugehören und dass der »Verkauf des Körpers« untrennbar mit einer Verletzung der Seele einhergeht. Diese Leute sind dann ganz überrascht, wenn vor der Tür von Veranstaltungen der »Rettungsindustrie« echte, lebende Huren mit Flyern und Transparenten demonstrieren und sich die Bevormundung verbitten, die drinnen als Heilmittel zelebriert wird. »Aber wir wollen euch doch nur helfen … wie jetzt, das wollt ihr gar nicht?«
Wem die Belange von Sexarbeiter_innen wirklich am Herzen liegen, der muss über blinden »Da muss man doch was tun!«-Aktionismus hinauskommen, hinschauen und zuhören. Und zwar auch Menschen wie mir, den angeblich so seltenen »privilegierten Ausnahmen«, die ihren Job professionell und mit gegenseitigem Respekt von und für ihre Kunden ausüben, manchmal seit vielen Jahren.
Wer unser Erleben und die Vielfalt unserer Erfahrungen als irrelevant vom Tisch wischt, verpasst die Chance, wahrzunehmen, wie die Herausforderungen der Branche erfolgreich gelöst werden können. Wir widerlegen die bequeme These, dass Sex gegen Geld an sich das Problem sei. Erst dann kann die kollektive Empörung über das Schicksal der Betroffenen von Gewalt und Armut (die es ja durchaus gibt!) in Strategien fließen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Sexarbeiter_innen wirklich zu verbessern. Das wäre allemal sinnvoller als eine weitere Zementierung der gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung.
Die Geschichte der U.
»Sie arbeiten also als Domina?«
Unter einer Domina stellen sich die meisten Leute eine Frau vor, die ihre Kundschaft mit einer Peitsche bearbeitet oder laut beschimpft und die dabei in Lack und Leder meist hochgeschlossen angezogen bleibt. Manchmal mache ich so was. Manchmal bin ich diejenige, die die Tracht Prügel bekommt. Manchmal habe ich wilden und schmutzigen Sex mit meinen zahlenden Gästen, vielleicht im Rahmen eines Rollenspiels im sexy Sekretärinnenoutfit oder in nichts als meinen hohen Stiefeln. In manchen bezahlten Begegnungen findet das alles zusammen statt. Manchmal lasse ich mich in Swingerclubs oder Pornokinos durchvögeln, oder ich stehe einem männlichen Gast bei seinen ersten Erfahrungen mit einem anderen Mann bei. Manche meiner Kund_innen kennen nur meine Stimme, wenn ich sie per Telefon, Skype oder Audiofile in eine erotische Hypnose führe.
Begonnen hat meine Sexwork-Karriere in einer Peepshow. Ich habe Erfahrungen in verschiedenen Bordellen und SM-Studios gemacht, in Apartments, als Erotikmasseurin, bei Sexpartys, als Telefonsex- und Webcam-Anbieterin und als Escort1. In den letzten Jahren war ich überwiegend im BDSM-, Fetisch- und Rollenspielbereich tätig. Meine derzeitige Zielgruppe sind also im weitesten Sinne Menschen mit sexuellen Interessen abseits des Alltäglichen. Die Bezeichnung für meinen Job, die sich unter meiner Kundschaft etabliert hat, ist »Bizarrlady«. Das Wort kennt aber außerhalb der SM-Paysex-Szene kaum jemand. Daher antworte ich auf die Domina-Frage manchmal »Jaja«, wenn ich keine Lust habe, lange Erklärungen abzugeben. Aber eigentlich beschreibt das nur einen kleinen Teil meiner Arbeit.
Ich finde es immer witzig, wenn man mir unterstellt, ich sei privilegiert, weil bei meiner Arbeit nicht immer der Geschlechtsverkehr im Vordergrund steht, ich also nicht für jeden meiner Kunden »die Beine breit machen muss«. Im selben Atemzug werden die armen Prostituierten bedauert, die ja so oft mit den »abartigen Wünschen perverser Freier« konfrontiert werden. Wie denn nun? Sind Sonderwünsche ein Privileg oder eine Zumutung?
Die Wichtigkeit der Antwort auf diese Frage kann kaum überschätzt werden. Sie lautet: »Es kommt drauf an.« Nämlich auf die persönlichen Wohlfühlbereiche und individuellen Grenzen der Dienstleisterin oder des Dienstleisters. Niemand kann von außen wissen oder gar festlegen, welche Praktiken mit welchen Kunden für individuelle Anbieter_innen okay sind und welche nicht. Es gibt keine allgemeingültigen Standards oder Regeln, was Sexworker tun oder nicht tun wollen oder sollten. Manche küssen ihre Kunden, manchen macht das sogar manchmal Spaß, für andere ist das unvorstellbar. Manche finden Analsex völlig entspannt, haben aber keine Lust auf Rollenspiele. Und manche lassen sich nicht die Füße lecken, weil sie kitzlig sind. Ich mag es zum Beispiel nicht, betrunkene Touristen in Vergnügungsvierteln zu bespaßen, für andere ist gerade diese Zielgruppe eine willkommene Quelle für leicht verdientes Geld. Eine meiner dominanten Kolleginnen findet es höchst unterhaltsam, ihre männlichen Gespielen bis zum völligen Zusammenbruch zu quälen, aber wehe, die wollen dabei Damenunterwäsche tragen! Denn wer sich nur in einer weiblichen Rolle erniedrigen lassen kann, dessen Frauenbild ist für diese Kollegin unerträglich.
Insofern sind Kundenwünsche an sich zunächst neutral und gar nicht zu bewerten. Wenn sich ein erwachsener und mündiger Mensch findet, der die entsprechenden Fantasien einvernehmlich gegen Honorar umsetzen möchte: prima. Dass manche Dienstleister_innen manchmal oder auch öfter aufgrund äußerer (meist wirtschaftlicher) Zwänge oder aufgrund innerer Überzeugungen und Glaubenssätze ihre Grenzen überschreiten und sich auf Dinge einlassen, die ihnen nicht guttun, ist weder wünschenswert, noch gehört es zum »System Sexarbeit«. Und es ist auch nicht auf unsere Branche beschränkt.
Zurück zu den »Perversen«. Ich mag sie. Sicherlich auch, weil ich selbst eine davon bin. Mein Interesse an BDSM hat sich wie bei vielen Sadomasochist_innen recht früh entwickelt. Die Gründe sind mir unbekannt, aber in dieser Hinsicht sind wir Paraphilen ja nach wie vor ein wissenschaftliches Rätsel. Ich hatte jedenfalls schon in meiner frühen Pubertät sowohl aktive als auch passive sadomasochistische Fantasien, und glücklicherweise war ich ignorant genug, mir deswegen keine Sorgen zu machen. Mit derselben Unbekümmertheit habe ich dann als Teenager meine Gespielen dazu verführt, verschiedene Facetten, vor allem Bondage, beim Sex zusammen mit mir auszuleben. Dass man das ganze SM nennt und es gemeinhin für »pervers« hält, dämmerte mir erst mit Anfang zwanzig, als ich Kontakt zur privaten BDSM-Szene aufnahm.
Bezüglich der Sexarbeit als Berufswunsch ging es mir ähnlich. Ein gern genanntes Argument von Sexwork-Gegner_innen ist ja die Behauptung, kein junges Mädchen würde sich je wünschen, später mal Hure zu werden. Ich erinnere mich, dass ich mit vierzehn in billigen Schundromanen der Kurtisanen-Romantik nachhing und mir so ein »verruchtes« Leben durchaus als ernst zu nehmende Perspektive vorstellen konnte.
Aber um mir zu beweisen, dass ich aber auch anders konnte, wenn ich wollte, und weil ich auch noch jede Menge andere Dinge spannend fand, habe ich nach dem Abitur zunächst ein naturwissenschaftliches Studium begonnen. An der Uni lernte ich einen Mitstudenten kennen, der mir nach einer langen und wilden Nacht, in der wir einander gegenseitig mit einem Gürtel verprügelt und uns wundgevögelt hatten, seine regelmäßigen Besuche in Peepshows gestand. Ich war begeistert und bestand darauf mitzukommen.
Die Peepshow befand sich im Keller unter einer Spielhalle, in einer Seitenstraße der Fußgängerzone. In einem winzigen Sexshop gab es an der Seite sechs oder acht Kabinen mit halbdurchlässigen Spiegeln rund um eine kreisförmige Bühne. Gleich am Eingang waren hinter Glas die Fotos der an diesem Tag anwesenden Tänzerinnen angebracht, mit Namen und einer Nummer von eins bis sechs. Um das Bild der Frau, die sich gerade auf der Bühne rekelte, blinkte jeweils ein Rahmen aus kleinen Glühbirnchen. Weiter hinten gab es zwei »Solokabinen«, in denen man die Tänzerinnen für Einzelshows buchen konnte. Es roch nach Desinfektionsmittel, Zigarettenrauch und Sperma.
Schnell kam ich mit der Kassiererin und DJane ins Gespräch. Ich erfuhr, dass die Stripperinnen meist zwei Wochen an einem Ort blieben und dann in eine andere Stadt weiterreisten oder zu Hause Urlaub machten. Es hatten sich lange Schichten von zehn Uhr vormittags bis elf Uhr abends, am Wochenende sogar bis ein Uhr nachts eingespielt. Mit nur einer Stunde Mittagspause, weil die Frauen in möglichst kurzer Zeit möglichst viel verdienen und wenig Leerlauf haben wollten. Einzelne freie Tage planten dann aber doch manche während ihres Aufenthalts ein, weshalb dem Management eine lokale und zeitlich flexible Springerin gerade recht kam.
Was soll ich sagen – am Ende der Unterhaltung hatte ich einen neuen Nebenjob und sollte am nächsten Tag anfangen. Als leidenschaftliche Tänzerin mit lang gehegten Rotlicht-Fantasien konnte ich es kaum fassen, dass ich dafür bezahlt werden sollte, auf einer Drehbühne vor den Augen zahlreicher gieriger Zuschauer meine Hüften kreisen zu lassen …
An meinem ersten Arbeitstag als Sexarbeiterin war ich irrsinnig aufgeregt. Ich war stolze Besitzerin zweier Dessous-Sets von Karstadt, und meine höchsten Schuhe waren ein Paar klobige Pantoletten. Geschminkt hatte ich mich zum letzten Mal mit sechzehn für eine Party, aber zumindest ein Lidschattenset in Brauntönen und einen Lippenstift in zartem Perl-Rosé hatte ich auftreiben können. Die DJane vorn hatte mir geraten, ein großes Tuch mitzubringen, das ich auf der Bühne unter mir ausbreiten konnte. Auf dem Fahrrad kam ich mit meinen Schätzen in einer Stofftasche an und betrat zum ersten Mal den inneren Zirkel der Huren.
Der Aufenthaltsraum war ein langer Schlauch mit einem kleinen Bad mit Kellerfenster an einem Ende, einer Küchenzeile, zwei riesigen Kühlschränken, einem Fernseher und sechs Sesseln mit Beistell-Tischchen. Die Bühne und die Solokabinen befanden sich am anderen Ende des langen Raumes, dem Bad gegenüber. In den Sesseln saßen Frauen verschiedener Nationalitäten. Wie ich erfuhr, wurde von der Geschäftsleitung auf Vielfalt Wert gelegt: meist zwei hellhäutige Europäerinnen, drei »Exotinnen« aus Asien, Südamerika und/oder Afrika und eine Trans-Frau mit Busen und Schwanz, meist ebenfalls Asiatin oder Südamerikanerin. Ungefähr so hatte ich mir immer einen Harem vorgestellt: Die Damen schminkten sich, kochten, lasen, sahen fern oder unterhielten sich, alle halbnackt und wunderschön. Und alle mit viel mehr Ahnung von Erotik als ich junger Hüpfer.
Alexandra, eine blonde Amazone, die sich mit ihrem ertanzten Geld bereits zwei Bauernhöfe in den neuen Bundesländern gekauft hatte, erbarmte sich meiner und brachte mir die Grundlagen bei. Moderne Elektronik: Wer auf die Bühne ging, drückte einen Knopf mit der jeweiligen Nummer an einem kleinen schwarzen Kasten, worauf draußen der zugehörige Bilderrahmen blinkte und die Nummer für Rufe in die Solokabinen gesperrt wurde. Wenn ein Kunde eine der Frauen allein treffen wollte, drückte er in der entsprechenden Solokabine ihre Nummer, die dann laut piepsend auf demselben schwarzen Kasten im Aufenthaltsraum angezeigt wurde. Das Piepsen schaltete die Erwählte auf dem Weg zur Kabine mit einem Kippschalter aus und war dann für weitere Rufe blockiert, bis sie sich nach getaner Arbeit wieder freischaltete. Sauberkeit und Sicherheit: »Lass dein Tuch und deine Wäsche nicht auf dem Boden liegen, der ist immer dreckig.« Und: »Die Kakerlaken erledigt man am besten mit brennendem Haarspray.« Oh. Okay.
Preise in den Solokabinen: Für das Geld, das der Kunde in den Automaten einwarf, damit das Licht anging, gab es eine nette Unterhaltung, für alles weitere wurden wir vom Kunden extra bezahlt. Wir bekamen vom Automaten-Geld die Hälfte, damit wir den Knaben möglichst lange in der Kabine hielten. »Trinkgeld« gab es fürs Ausziehen und Zeigen: zwanzig Mark. »Fingershow« (Masturbieren nach Kundenwunsch): dreißig Mark. Show mit kleinem Vibrator: vierzig Mark. Show mit großem Vibrator: fünfzig Mark. Dildoshow anal oder Handmassage beim Kunden: sechzig Mark. Blasen: hundert Mark. Klar, eigentlich war Prostitution hier nicht erlaubt, aber wenn man hier schraubte und da drückte, konnte man die Blende vor dem Sprechloch der Glasscheibe zwischen Stripperin und Kunde entfernen. »Aber anschließend wieder ordentlich festschrauben, sonst kriegt der Chef Stress mit dem Ordnungsamt oder der Polizei – nicht dass uns der Laden wegen ›Förderung der Prostitution‹ dichtgemacht wird!«
Ich beschloss, es erst einmal bei den diversen Shows zu belassen, und kaufte mir vorn im Sexshop einen kleinen und einen großen Vibrator.
Ich liebte diesen Job vom ersten Tag an. Die Musik, den Tanz, die Verführung, die Anerkennung. Die Haremsatmosphäre. Die Augen des Pizzaboten, wenn wir in den Aufenthaltsraum liefern ließen. Die Gespräche mit den Kolleginnen aus aller Herren Länder, manchmal hochphilosophisch, manchmal mit Händen und Füßen und manchmal beides gleichzeitig. Mein erstes echtes Thai-Essen und die Erkenntnis, dass mein Magen nicht für Gemüse aus scharfen Peperoni gemacht ist. Ich liebte Alexandra, die Ehrgeizige, die jeden Pfennig sparte für ihre Zukunft. Ich liebte Maria aus Brasilien, ehemalige Profitänzerin auf großen Bühnen, die mit Mitte fünfzig immer noch aus dem Stand in den Spagat springen konnte. Die mit ihrem Geld zu Hause ein privates Heim für Straßenkinder unterhielt und uns mit immer neuen Fotos ihrer Schützlinge versorgte. Ich liebte Rosi aus Nürnberg mit ihrem Dialekt und ihrem Hausfrauencharme, Nang, die einen Fetisch für überlange und quietschpink lackierte Zehennägel hatte und deshalb selbst im deutschen Winter grundsätzlich offene Plateausandaletten trug, und Jeanna, bei der ich zum ersten Mal in meinem Leben perfekte Silikonbrüste anfassen durfte. Bei Charlene, der Trans-Frau, die nicht nur jede Menge schrägen Humor, sondern dank großzügigen Prolaktin-Konsums auch in alle Richtungen Muttermilch verspritzte, musste man schon hart im Nehmen sein. Jessica, das Pornosternchen, liebte ich nicht so sehr, weil sie eine arrogante Zicke war. Außerdem war ich fassungslos, dass sie als Profi Anfang der Neunziger immer noch dachte, ein HIV-Test gäbe absolute Sicherheit auch bezüglich der Wochen direkt davor. Da sie sich ihre Finger auf der Bühne regelmäßig abwechselnd in Arsch und Möse steckte, war eine Tube Anti-Pilz-Creme ihr ständiger Begleiter. Aber hey, sie hatte einen großen Fanclub, immer ein paar ihrer Filme zum Verkauf dabei, und sie hat exzellent verdient. Vermutlich war sie auch deswegen nicht ganz so beliebt bei uns Normalsterblichen.
Ich liebte es, abends in meiner kleinen Studentenbude mein Geld zu zählen, wie nur Huren Geld zählen: Einfach alle zerknitterten Scheine aus dem Handtäschchen auf den Boden kippen und in passende Stapel sortieren. Und ja, natürlich liebte ich es auch, nur zwei, drei Tage im Monat arbeiten zu müssen, um mir meine bescheidenen Bedürfnisse und noch ein paar Extras leisten zu können. Es war doch ganz unglaublich! Drei Auslandssemester in Australien, um in Ruhe meine Diplomarbeit schreiben zu können? Na gut, dann arbeiten wir halt mal vier Wochen am Stück …
Ich lernte, auf High Heels zu laufen, während die Mädels sich totlachten, zog zum ersten Mal an einem Joint, gab irgendwann den Versuch auf, in diesem ewig gackernden Hühnerstall Physikbücher zu lesen, und hatte auf einer leise quietschenden Drehbühne vor Publikum den ersten Orgasmus meines Lebens ohne batteriebetriebene Hilfsmittel, allein kraft meiner Finger. Ein Hoch auf absichtloses Handeln! Ich glaube nicht, dass die Kundschaft je meine immer häufiger werdenden echten Höhepunkte von meinen zu Showzwecken gefakten unterscheiden konnte.
Nach und nach erweiterte ich mein Repertoire: erst Handjobs, dann Blowjobs. Letztere waren nur in einer der beiden beengten Solokabinen überhaupt möglich. Und da die Sprachöffnung, deren Abdeckung man zu diesem Zweck abschrauben musste, auf Kopfhöhe des Kunden lag, musste der auf einem Barhocker balancieren, um sein Gemächt zu mir herüberreichen zu können. Das Ganze nicht, ohne sich einmal pro Minute nach hinten unten zu beugen, um Kleingeld in den Automaten einzuwerfen, damit das Licht in der Kabine eingeschaltet blieb. Bis heute ist mir nicht so ganz klar, warum sich irgendeiner der Männer dieser entwürdigenden Zitterpartie aussetzte, wenn derselbe Service eine Parallelstraße weiter für die Hälfte des Preises in deutlich bequemerer Stellung zu haben war. Vielleicht, weil wir »Tänzerinnen« waren und sich die Kundschaft was drauf einbilden konnte, von einer Bühnenkünstlerin beglückt zu werden?
Ich lernte irrsinnig viel über menschliche Sexualität in diesen Jahren. Parallel zu meinem Job als Stripperin nahm ich über das neu entstandene Internet, Usenet und IRC Kontakt zur BDSM-Szene auf und besuchte meine ersten Szene-Partys. Und meine Offenheit für viele Facetten der Lust half mir natürlich auch beruflich. Auch wenn meine ersten Versuche in Richtung kommerzieller Dominanz ein wenig hilflos waren (»Hey, du musst jetzt aber schon machen, was ich sage, sonst funktioniert das hier nicht!«) und ich bei dem Menschen, der sich ein aufgetautes Tiefkühlhähnchen zum Durchvögeln mitgebracht hatte, zuerst ein bisschen grinsen musste, habe ich mich immer bemüht, auch ausgefallene Wünsche zu erfüllen. Sofern sie mit meinen selbst gesetzten Grenzen zu vereinbaren waren. Ich wollte mich beispielsweise nicht aktiv anfassen lassen – bis mir ein Kunde einmal 200 Mark bot, um meine Brüste streicheln zu dürfen. Das war unfassbar viel Geld für mich, und ich stellte fest, dass ich doch irgendwie käuflich bin. Er war zärtlich und respektvoll, und es war okay.
Mein schrägster Kunde zu dieser Zeit war ein Ingenieursstudent mit einem Riesenschwanz, der mich permanent aus meinem Elend retten wollte. Ich hab das damals erst überhaupt nicht verstanden – der kommt an jedem Tag vorbei, an dem ich arbeite, bezahlt mich dafür, dass er sich auf meine gespreizte Pussy einen runterholen darf, belabert mich währenddessen, doch mal privat mit ihm auszugehen. Und erklärt mir im gleichen Satz, wäre ich seine Freundin, dürfte ich so einen Dreck ja nicht mehr machen, und ich sei doch viel zu schade für so was. So viel inneren Widerspruch muss man erst mal aushalten können! Erst im Gespräch mit den Kolleginnen erfuhr ich, dass das kein seltenes Muster ist. Bis heute höre ich immer wieder mal solche Geschichten.
Mein persönliches Highlight mit diesem Vertreter der menschlichen Spezies war eines Abends sein Gejammer über eine schrecklich schwierige physikalische Hausaufgabe, die ich ihm nach kurzem Nachdenken mit einem Kajalstift auf einem Stück Küchenrolle in fünf Zeilen löste und durch das Sprechloch schob. Das erschütterte sein Weltbild von der hilflosen kleinen Nutte dermaßen, dass er fortan überhaupt nicht mehr wusste, wie er mich einordnen sollte – und als Mysterium wurde ich natürlich noch interessanter. Zum Glück studierte er an der FH und ich an der Uni, sodass wir einander nie privat über den Weg gelaufen sind.
Nach einigen Jahren als Springer in meiner kuscheligen Provinz-Peepshow und gelegentlichen Dienstreisen in andere Städte in den Semesterferien stand meine Diplomarbeit an. Ich wollte schon seit Längerem endlich Auslandserfahrung sammeln, also suchte ich mir ein interessantes Forschungsprojekt an einer australischen Universität und bearbeitete meinen hiesigen Prof und die australischen Kolleg_innen mit Engelszungen. Ich karrte einen gefühlten Umzugskarton an Papieren zusammen und tanzte ein paar Wochen durch, um Flug und Zusatzausgaben bezahlen zu können. Schließlich verbrachte ich knapp anderthalb Jahre in einem Land, in dem auf den Laternenmasten Pelikane sitzen wie hierzulande Tauben und wo sich nachts riesige Flughunde auf meiner Gartenpalme lautstark um die Palmfrüchte stritten.
Eine Arbeitserlaubnis für Australien hatte ich leider nicht – allerdings hielt mich das nicht davon ab, mich fortzubilden. Ich hatte in den vergangenen Jahren auch meine BDSM-Kenntnisse immer mehr erweitert, viele Workshops und Partys besucht, aber immer nur mit Partnern, Affären oder zumindest engeren Freunden gespielt. In Australien nahm ich Kontakt zu einem privaten SM-Verein mit Clubhaus und wöchentlichen Veranstaltungen auf. Nachdem ich mich dort eingelebt hatte und sicher fühlte, fing ich an, systematisch meine Grenzen auszutesten und mit so ziemlich jedem alles zu machen, worauf wir beide gerade Lust hatten. Im Clubhaus verkehrten auch mehrere Profidominas, die ich mit Fragen löcherte und deren Arbeitsstätten ich mir anschauen durfte.
Da ich nach ein paar Monaten immer noch nicht die Nase voll hatte und allmählich meine Rückreise anstand, begann ich, SM-Studios in Deutschland zu recherchieren. Meinen Wohnsitz in Deutschland hatte ich aufgegeben und meine Sachen eingelagert, daher war ich vollständig flexibel für einen Neuanfang. Und zunächst hatte ich sowieso vor, erst einmal für ein halbes Jahr Sexarbeit auszuprobieren und dann weiterzusehen. Die Physik fand ich ja auch immer noch spannend. Schließlich fiel die Wahl auf Hamburg, das ich bisher nur von der Durchreise Richtung Nordsee kannte. Aber wo anschaffen gehen, wenn nicht dort? Außerdem gab es in Hamburg eine aktive SM-Szene, die ich inzwischen nicht mehr missen wollte. Die Website eines bestimmten Studios gefiel mir besonders gut – kein Geblubber von wegen »Drücke den ›Enter‹-Button in Demut, Sklave!«, sondern eine freundliche Kundenansprache auf Augenhöhe mit Auflistung von Anbieterinnen und Service. So hatte ich mir das vorgestellt, und dort rief ich an, nachdem ich in Hamburg in meiner provisorischen Unterkunft angekommen war. Wir verabredeten einen Termin.
Das »Studio« war eine Villa, zwei Stockwerke plus ausgebautem Keller. Acht wunderschöne Arbeitszimmer, zwei Bäder, eine riesige Wohnküche und ein Garten, alles sehr sauber und gepflegt. Ich kam mir vor wie im Schlaraffenland. Zwei sympathische Betreiberinnen, selbst aktive Dominas, begrüßten mich. Es gab in dem riesigen Haus zu diesem Zeitpunkt nur eine Mieterin, eine weitere Frau war also hochwillkommen. Ich wollte als »Sklavin« – also submissive beziehungsweise passive Rollenspielerin – einsteigen; das erschien mir für den Anfang am einfachsten. Hundert Mark Tagesmiete fand ich bei einem Stundenpreis von fünfhundert Mark für passive Dienste in Ordnung. Mir wurde erklärt, dass ich zuerst einen Werbetext entwerfen und auf einen Anrufbeantworter aufsprechen sollte – mit dieser Nummer wurde dann in der Tagespresse annonciert, und erst auf diesem Wege erfuhren die Interessenten neben Service und Adresse auch meine persönliche Mobiltelefonnummer. Ein Segen, wie ich später feststellte, denn diese ABs wurden pausenlos abgerufen. Ebenso pausenlos klingelten die Handys der bedauernswerten Kolleginnen, die gleich ihre direkte Durchwahl in die Zeitung setzten. »Wie siehst du aus, und was machst du alles?« Zwanzig, dreißig Mal am Tag. Um Himmels willen!
Ich schrieb also einen Text und las ihn der Maschine zig Mal verführerisch vor, bis mir das Ergebnis gefiel (ich kann ihn heute noch auswendig), kaufte mir neue Klamotten und mein erstes Mobiltelefon. Die beiden Chefinnen waren zufrieden – ich hatte bereits jahrelange Erfahrung als Sexarbeiterin, ich hatte Ahnung von SM, der Rest sollte Feinschliff sein und Learning by Doing.
Die ersten zwei Wochen waren in der Tat eine steile Lernerfahrung, vor allem in Sachen Grenzziehung. Ich habe es auch später immer wieder erlebt, wenn ich irgendwo neu war, aber nie so krass wie in dieser ersten Zeit im SM-Studio als Passive: Frischfleisch zieht Hyänen an. Ich hatte die übergriffigsten und anstrengendsten Kunden, die man sich vorstellen kann. Leute, die eigene Unsicherheiten mit dominantem Gehabe zu überspielen versuchten. Männer, die Rollenspiel und Realität nicht trennen konnten. Und Idioten ohne jede Sozialkompetenz, die andere Sexworker schon längst hatten abblitzen lassen und die es daher nur noch bei unerfahrenen Anfängerinnen versuchten. Einer erklärte mir mitten im Vorgespräch, er nehme seine dominante Rolle so ernst, dass dies nun der letzte Satz gewesen sei, in dem ich ihn straflos habe duzen dürfen. Ein anderer verbrannte mich trotz mehrfacher Warnung mit einer nachglühenden Wunderkerze und hinterließ eine Narbe auf meinem Bauch, die noch fast ein Jahr lang zu sehen war. Ein spontan klingelnder Interessent war der Meinung, wenn nun keine von uns Zeit für eine Session mit ihm habe, sei es doch wohl das Mindeste, dass er mich zur Entschädigung mal kurz kostenlos oben ohne sehen dürfe. Ein Gast wollte mich unbedingt intim rasieren, merkte dann aber, dass das nicht in fünf Minuten erledigt war, wurde hektisch und verletzte mich mit der Rasierklinge. Einer überrumpelte mich mit einem Zungenkuss, schneller als ich Nein sagen konnte, und fragte mich dann, was ich denn für eine sei und ob ich mit jedem rumknutschen würde. Ich kannte die Gepflogenheiten im kommerziellen SM nicht, hab mich überfahren und zu Dingen drängen lassen, für die ich einen Kunden heute wahlweise herzlich auslachen oder vor die Tür setzen würde. So sehr ich meinen Beruf in seiner Gesamtheit mag, ich will auch nichts schönreden: Diese zwei Wochen habe ich fast jeden Abend zu Hause erst mal eine Runde geheult, bevor ich mein Geld zählen konnte.
Aus solchen Erlebnissen kann man nun verschiedene Schlüsse ziehen: Zum Beispiel, wie wichtig es ist, dass Sexworker legal in Zusammenschlüssen und gemeinsamen Infrastrukturen arbeiten können, um gegenseitige Supervision zu ermöglichen. Oder wie sinnvoll Aus- und Weiterbildungen und das flächendeckende Angebot einer fundierten, bedarfsgerechten (und freiwilligen!) Einstiegsberatung wären, auch bei einer Umorientierung in ein anderes Sexarbeitssegment. Dass sich gute Betreiber_innen nicht nur dadurch auszeichnen, dass sie ihre Mieter_innen nicht finanziell ausbeuten, sondern auch dadurch, dass sie hinter ihnen stehen und sie darin bestärken, Grenzen zu setzen und ihre Integrität zu wahren, auch wenn das Geld noch so sehr lockt.
Darin waren mir meine damaligen Vermieterinnen leider nicht immer ein Vorbild. Ich hatte auch bei ihnen den Eindruck, dass sie einige ungesunde Geschäftsbeziehungen pflegten. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass eine der Ladys einem Stammgast die Illusion einer Liebesbeziehung in einem Ausmaß verkaufte, das mich fassungslos machte. Irgendwann stellte sie ihn sogar ihren Eltern vor. Das brachte ihr einen Mercedes ein – glücklich schien es sie aber nicht zu machen. Und natürlich endete das Ganze in einem Desaster: Sie fühlte sich emotional ausgesaugt, er fühlte sich betrogen. Und sein Auto nahm er wieder mit, denn es hatte nie einen offiziellen Vertrag darüber gegeben.
Ich persönlich wollte von Anfang an immer einen eindeutigen Deal: Meine Zeit und Aufmerksamkeit gegen ein Honorar. Damit werde ich nicht reich, aber dafür kann ich nachts gut schlafen. Bald lernte ich auch den Wert meiner Dienstleistung besser einzuschätzen, und das Machtverhältnis zwischen meinen Kunden und mir normalisierte sich. Ich wurde selbstbewusster und ließ mir weniger bieten. Ich fing an, diejenigen Kunden konsequent abzulehnen, die mit ihrer SM-Neigung nicht im Reinen waren, bei denen ich jedes Mal nach der Session das Gefühl hatte, sie hätten mit ihrem Selbstekel einen Eimer Gülle über uns beide ausgekippt. Ich wurde klarer in meinem Marketing und in meinen Infogesprächen mit neuen Interessenten und fing an, gesunde, normale Perverse anzuziehen, die mir auf Augenhöhe begegneten. Im Spiel konnte er dann wieder problemlos zum Chef werden – und ich zur Privatsekretärin auf Jobsuche, die zu allem bereit war, um die Stelle zu bekommen. Es gibt einen Unterschied zwischen »Augen zu und durch« und »eine sexuelle Dienstleistung erbringen«. Ich muss es wissen. Ich habe beides erlebt.
Gar nicht so viel später kam ich wie die Jungfrau zum Kind zu einem eigenen Domizil. Als die Gattin unseres Hauseigentümers irgendwann erfuhr, dass der werte Herr Gemahl sich von den beiden Chefinnen die Miete teilweise in Naturalien hatte bezahlen lassen, mussten wir ausziehen, und zwar ganz, ganz schnell. Die eine Kollegin hatte zu diesem Zeitpunkt ohnehin die Nase voll vom Sexgeschäft, die andere hatte eine weitere Ausbildung angefangen und wollte ebenfalls kürzertreten. Ich ließ mich breitschlagen, den Mietvertrag für das neue Objekt zu unterschreiben. Übernahm Möbel und Spielzeuge, kratzte mein Erspartes zusammen und renovierte, sägte und bastelte ein paar Wochen lang mit Kolleginnen und Freund_innen wie eine Geisteskranke. Da ich mir einen kompletten Verdienstausfall nicht leisten konnte, arbeitete ich nebenbei in einem kleinen Wohnungsbordell um die Ecke: Das Telefon klingelt, raus aus dem Overall, schnell unter die Dusche, Haare kämmen und Turboschminken, über die Straße, eine Runde vögeln, wieder umziehen und weiter Wände streichen. Das war … nun, sagen wir: anstrengend.
Aber auch diese Erfahrung bot wieder Einblicke in neue Arbeitsphilosophien: Die Betreiberin der Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung mit Bad im Treppenhaus war völlig wahllos, was ihre Mieterinnen anging, von denen mindestens eine sowohl die Chefin als auch die Kunden beklaute, wann immer sie Gelegenheit dazu hatte. Eine andere war psychisch so labil, dass sie meiner Ansicht nach für ihren Job völlig ungeeignet war. Nach mehreren hochdramatischen Nervenzusammenbrüchen kam sie dann auch irgendwann nicht mehr wieder. Und dazwischen sprang munter der Nuttenwolf der Hausherrin umher, ein ständig kläffender Papillon, der die Gäste zum Stolpern brachte und mich in den Wahnsinn trieb. Dort habe ich viel darüber gelernt, was ich nicht wollte: Zum Beispiel Haustiere im Gästebereich zu dulden. Oder mich von den Mietzahlungen von Kolleg_innen abhängig zu machen. Sowohl das Studio, das ich damals eröffnete, als auch meine spätere Location waren so dimensioniert, dass ich sie problemlos alleine tragen konnte und die Anmietungen durch Kolleg_innen lediglich ein angenehmer Nebenverdienst waren. Ich will genauso wählerisch bezüglich meiner Untermieter_innen sein können wie mit meinen Kund_innen. Das Konzept hat sich bewährt.
»Aber warum machen Sie das denn bloß?«
Diese Frage stellte mir meine distinguierte Gesprächspartnerin im Café an der Alster am Ende unseres gemeinsamen Interviews. Solche Fragen höre ich immer mal wieder. Von Kunden, die eine »echt veranlagte« Gespielin wünschen (da hört sich das dann eher nach »Macht dich das auch wirklich geil?« an), oder von besorgten Zivilist_innen bei Infoveranstaltungen und Podiumsdiskussionen, die mich fragen, ob man bei so einem Job überhaupt noch Spaß am Sex haben kann.
Ich habe eine tief verwurzelte sadomasochistische Veranlagung und hatte BDSM und Fetische, meine eigenen und die meiner Partner_innen, bereits über zehn Jahre im Privaten ausgelebt, bevor ich meine Leidenschaft zum Beruf machte. Ähnliches gilt für meine promiske Ader, also die Lust daran, mit verschiedenen, auch fremden Menschen Sex zu haben. Zu meiner Studentenzeit, auch noch während meines Peepshow-Jobs, war mein zweites Wohnzimmer ein Swingerclub in der Nähe meines Wohnortes. Mit dem überzeugenden Argument, dass wir bei den damaligen Eintrittspreisen für junge Pärchen als arme Studenten damit billiger als in einem Restaurant wegkommen würden, landeten meine Begleitung und ich dort regelmäßig mit dem Vorsatz »nur das Buffet und die Sauna zu nutzen«. Nicht, dass es auch nur ein einziges Mal dabei geblieben wäre … aber ich schweife ab.
Ich mag meinen Beruf, den ich freiwillig, wohlüberlegt und im Wissen um ebenfalls spannende und lukrative Alternativen gewählt habe. Daran hat sich auch nach vielen Jahren in diesem Gewerbe nichts geändert. Mich befriedigen die Sessions mit meinen Gästen. Diese Befriedigung kann unterschiedlicher Natur sein: emotional, intellektuell oder körperlich. Und meist kommen mehrere Aspekte zusammen. Manchmal finde ich tiefe Befriedigung darin, mein inneres sadistisch-dominantes Tier von der Leine lassen zu können: ein Rausch, in dem die Welt genau so funktioniert, wie ich das will. Manchmal ist es meine eigene Kontrollabgabe, die mich kickt: die Entspannung und Hingabe in einer erotisch-sanften passiven Session mit einem Aktiven, der meinen Körper spielt wie ein Musikinstrument. Oder das Anfluten der Endorphine bei einer heftigen Flagellation, die Hitze und die Druckwellen in meinem Becken. Und Sex im engeren Sinne mag ich sowieso, mit einem oder mit mehreren Menschen gleichzeitig.
Sowohl aktive als auch passive Sessions als auch zarter Blümchensex können bei mir körperliche Erregung auslösen, aber das muss nicht notwendigerweise so sein. Und nicht jedem diesbezüglichen Impuls gebe ich innerhalb der Session nach – manchmal passt es einfach nicht in den Spielfluss. Wenn ich mich zwischen meinem eigenen Spannungsbogen und dem meines Gastes entscheiden muss, bin ich natürlich Dienstleisterin. Aber gelegentlich habe ich auch Orgasmen unter Mitwirkung eines Gastes, durchaus.
Die intellektuelle Befriedigung besteht darin, ein bestimmtes Szenario auf den Punkt umgesetzt, einen ausschlaggebenden Trigger meines Spielpartners gefunden oder eine komplizierte Technik elegant angewandt zu haben. Man kann diesen Aspekt auch schlicht »befriedigte Eitelkeit« nennen. Ich mache den Job, weil ich’s kann, und zwar gut und erfolgreich.
Emotional befriedigt es mich, einem Menschen ein schönes Erlebnis beschert zu haben. Ich liebe leuchtende Augen, Atemlosigkeit, das Lächeln meines Gegenübers beim langsamen Aufwachen aus seiner Trance. Selbst wenn eine Session inhaltlich nicht die Erfüllung meiner persönlichen Leidenschaften war, was zweifellos vorkommt, zählt für mich, zum Glück eines Menschen beigetragen zu haben, der sich mir anvertraut hat. Und das ist wirklich unbeschreiblich schön.
Natürlich befriedigt es mich auch, aus einer persönlichen Leidenschaft meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und ja, ich habe auch privat noch Sex, vielen Dank der besorgten Nachfrage. In meinem eigenen Interesse achte ich darauf, die Anzahl meiner kommerziellen Kontakte auf ein Maß zu begrenzen, das mich quantitativ nicht überfordert. Ich muss nicht reich sein, um mein Leben zu genießen. Lieber habe ich Zeit für weitere, oft brotlose Projekte, für Hobbys und Familie.
(K)ein Job wie jeder andere – mein Alltag als Sexarbeiterin