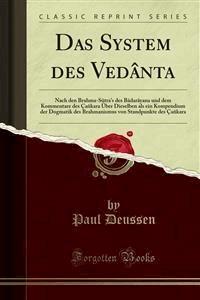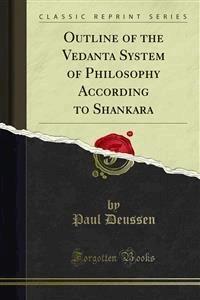Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Paul Deussen war ein deutscher Philosophie-Historiker und Indologe. Überdies war er Gründer der Schopenhauer-Gesellschaft und lebenslanger Freund von Friedrich Nietzsche. Deussen, der mit dem indischen Philosophen und Hindu-Heiligen Vivekananda bekannt wurde, gilt als erster westlicher Gelehrter, der das indische Denken der abendländischen Philosophie gleichwertig an die Seite stellte. Dies ist seine Autobiographie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mein Leben
Paul Deussen
Inhalt:
Paul Deussen – Lexikalische Biografie
Mein Leben
Meine Kindheit am Rhein.
Gymnasialzeit in Elberfeld.
In Schulpforta.
Universitätsjahre in Bonn, Tübingen, Bonn, Berlin und Oberdreis.
Minden und Marburg.
Hauslehrer.
Zehn Jahre in Berlin.
Professor in Kiel.
Mein Leben, Paul Deussen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849609634
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Paul Deussen – Lexikalische Biografie
Philosoph und Indianist, geb. 7. Jan. 1845 in Oberdreis, Kreis Neuwied, studierte Theologie, Philosophie, Philologie und Sanskrit in Bonn, Tübingen und Berlin. 1869–72 war D. Lehrer an den Gymnasien zu Minden und Marburg, von 1872–80 Erzieher in russischen Familien in Genf, Aachen und im Gouv. Charkow, habilitierte sich 1881 in Berlin, wurde 1887 daselbst außerordentlicher Professor und ist seit 1889 ordentlicher Professor der Philosophie in Kiel. In seinen philosophischen Anschauungen schließt er sich vielfach an Kant, namentlich aber an Schopenhauer an, ist auch durch indische Philosophie beeinflusst. Die materielle Welt in Raum und Zeit und Werden ist nur Erscheinung, die wahre Realität ist im zeitlosen, raumlosen, kausalitätlosen Gebiet. Von ihm sind unter anderem erschienen: »Die Elemente der Metaphysik« (3. Aufl., Leipz. 1902); »Das System des Vedanta« (das. 1883); »Die Sûtras des Vedânta«, aus dem Sanskrit übersetzt (das. 1881); »Allgemeine Geschichte der Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der Religionen«, Bd. 1, 1. u. 2. Abteil. (das. 1894–99); »Sechzig Upanishads des Veda«, aus dem Sanskrit übersetzt (das. 1897); »Erinnerungen an Friedrich Nietzsche« (das. 1901).
Mein Leben
Meine Kindheit am Rhein.
1845–1857.
Am rechten Ufer des Rheines zwischen Lahn und Sieg erhebt sich das waldreiche, zum Teil rauhe Hochland des Westerwaldes. Auf ihm liegt, fünf Stunden vom Rheintale entfernt, und noch ehe dessen mildere Lüfte sich fühlbar machen in weltentrückter Einsamkeit, die erst in den letzten Jahrzehnten durch Erbauung der immer noch über eine Stunde entfernten Westerwaldbahn sich zu beleben beginnt, das kleine und arme Dorf Oberdreis, wo ich am 7. Januar 1845 geboren wurde. Ein Arzt war bei diesem sehr leicht und glücklich verlaufenden Ereignisse nicht zugegen; die Hebamme, welche Beistand leistete, mußte aus dem schon jenseits der Landesgrenze im Herzogtum Nassau gelegenen Dorfe Roßbach geholt werden. Oberdreis als Kirchdorf bildet mit dem nördlich gelegenen sehr armen Dorfe Lautzert und mit den abwärts in dem westlichen Tale schon einer milderen Luft und etwas größeren Wohlstandes sich erfreuenden Dörfern Dendert und Hilgert eine Pfarrgemeinde evangelisch-unierten Bekenntnisses, welcher mein Vater von 1844 bis 1884 vierzig Jahre und fünf Monate als Pastor vorgestanden hat. Wie mein Vater der Seelsorger, ebenso und noch mehr war meine Mutter während dieses langen Zeitraumes eine wahre Seelsorgerin der Gemeinde, immer bereit, den Notleidenden mit Rat, Trost und tätiger Hilfe beizustehen. Inniger noch als mein Vater war sie mit allen Verhältnissen des Kirchspiels vertraut und hat je später um so mehr neben der Sorge für Haus und Familie auch einen großen Teil der Pastoratsgeschäfte mit Umsicht und bestem Erfolge verwaltet. Und doch waren beide Eltern ursprünglich Fremdlinge in der Gegend, in welcher sie den Wirkungskreis ihres Lebens fanden. Denn Oberdreis liegt noch in fränkischem Sprachgebiete ziemlich nahe an dessen nordwestlicher Grenze, da, wo die oberdeutsche Mundart durch das Hereinspielen des Niederdeutschen ein eigentümliches und seltsames Gepräge annimmt. Meine Eltern hingegen stammten beide aus dem Niederlande, jenseits des Rheines, so daß das Deutsche im Pfarrhause anfänglich mit ganz anderm Akzent als im Dorfe gesprochen wurde. Diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß das Deutsch, welches wir Kinder sprachen, sehr bald jede dialektische Färbung verlor. Zum besseren Verständnisse des Weiteren wird es notwendig sein, zunächst einiges über die Herkunft meiner Eltern zu sagen.
Weder von väterlicher noch von mütterlicher Seite her ist meine Abkunft eine rein bürgerliche, sofern von der einen Seite bäurisches, von der andern adliges Blut in meinen Adern zusammengeflossen ist. Gehe ich in der Reihe meiner Väter aufwärts, so war noch mein Großvater ein wohlhabender Bauer, und ebenso steht es mit seinen Vorfahren, soweit sie sich auf einem noch vorhandenen Stammbaume etwa zwei Jahrhunderte zurückverfolgen lassen. Gehe ich hinwiederum auf der mütterlichen Seite immer von Mutter zu Mutter aufwärts, so gehörte meine Urgroßmutter zu der in Mühlhofen angesessenen Adelsfamilie derer von Au. Wilhelmine von Au, eine wegen ihrer Vortrefflichkeit hochverehrte und von allen, die sie kannten, geliebte Frau, heiratete den in dem kleinen Landstädtchen Wevelinghoven bei Neuß wirkenden Prediger Trappen und blieb auch nach dessen frühzeitigem Tode mit ihren sieben Kindern in Wevelinghoven wohnhaft. Sein Nachfolger im Amte war mein Großvater, Jakob Weimar Ingelbach, der einzige Sohn eines wohlhabenden Farbwaren- und Drogenhändlers in Düsseldorf. Nur ungern fügten sich die Eltern seinem brennenden Wunsche, zu studieren. Nachdem er zu Duisburg und Göttingen das theologische Studium absolviert hatte, wurde dieser, mein Großvater Ingelbach, im Jahre 1805 der Amtsnachfolger meines Urgroßvaters Trappen zu Wevelinghoven. Zunächst führte ihm die eine und sodann eine zweite Schwester die Wirtschaft, aber auch nachdem sich beide verheiratet hatten, war es den Schwestern und der befreundeten Frau Werner Koch nicht möglich, ihn zu einer Heirat zu bestimmen. Er lebte ganz in seinen theologischen und astronomischen Studien, saß bis tief in die Nacht hinein, um die Sterne zu beobachten und zu berechnen, und oft trieb ihn erst der über den Büchern aufdämmernde Morgen, das Bett aufzusuchen. Eine ganze Reihe vollgeschriebener und schwer zu entziffernder Bände von seiner Hand sind noch erhalten. Daneben war er ein großer Freund der Musik und soll die Sonaten von Haydn, Mozart und Beethoven mit vollendeter Meisterschaft gespielt, wie auch Eigenes komponiert haben. Die Noten kaufte er nicht, sondern entlieh sie und schrieb sie für seinen Gebrauch ab. Da starb im Februar 1810 die Frau seines Amtsvorgängers Trappen. In ihren schweren Leiden hatte sie mein Großvater oft besucht und getröstet, und als er die sieben hilflosen Waisen um ihre Bahre stehen sah, da erfaßte ihn ein Mitleid, welches stärker war als alle Grundsätze des Junggesellenlebens, und rasch entschlossen bat er die älteste, von ihm selbst unterrichtete Tochter, die erst sechzehnjährige Wilhelmine Trappen, um ihre Hand. Sie erschrak und konnte sich nicht entschließen, ihrem so hochverehrten Seelsorger als Gattin zu folgen, und erst als wohlmeinende Freunde ihr vorstellten, daß die jüngeren Geschwister bei den Verwandten verteilt werden müßten, sie selbst aber nur die Wahl habe, entweder bei fremden Kindern oder als Ladenmädchen ihr Brot zu verdienen oder den Pastor zu heiraten, da wählte sie als das kleinste Übel die Heirat, und so geschah es, daß der Großvater die Großmutter nahm.
Ihre Ehe war mit neun Kindern gesegnet, von denen sechs am Leben blieben, vielfach mir nähergetreten sind und wohl noch öfter in dieser Geschichte vorkommen werden. Jakobine, meine Mutter, war die Älteste, geboren während der Leipziger Schlacht am 15. Oktober 1813. Dann folgten noch zwei Töchter, Hannchen und Nettchen; erstere heiratete später den Gerber Aretz in Wevelinghoven, letztere reichte nach langer Mädchenschaft dem Buchhändler Falk in Duisburg die Hand. Auf die drei Mädchen folgten drei Knaben: Friedrich, der als Kaufmann in Paris zu großem Reichtum und Ansehen gelangte, August, der als Buchbinder in Wevelinghoven trotz aller Hilfe durch seinen älteren Bruder nie recht auf einen grünen Zweig gekommen ist, und der kurz vor dem Tode des Vaters geborene Gerhardt, der von rastlosem Ehrgeize getrieben nach Paris ging, um es seinem Bruder Friedrich gleichzutun, aber kein Glück hatte, in immer steigende Verbitterung verfiel und schließlich in geistiger Umnachtung endete. Das Leben dieser Familie war infolge der eigentümlichen Grundsätze meines Großvaters bis zu seinem Tode 1830 nach außen hin ein sehr abgeschlossenes. Zwar übte er gewissenhaft vie Pflichten seines Amtes, besuchte als Seelsorger einmal im Jahr jede Familie seiner Gemeinde, wie er denn auch jeden Morgen abwechselnd drei Familien in sein Gebet einschloß und ihre besonderen Bedürfnisse und Nöte in seinem Herzen bewegte. Im übrigen aber verkehrte er mit niemandem und schloß sich und seine Familie gegen die Außenwelt vollständig ab. Abgesehen von den Sonntagnachmittagsbesuchen bei der Tante und ganz seltenen Ausflügen durch Gärten und Felder, waren die Kinder durchaus auf das eigene Haus und den zugehörigen Garten beschränkt, in welchem sie sich kleine Erdhöhlen bauten und nach Lust herumtummeln durften. Hingegen war es ihnen verboten, das nach der Straße führende Hoftor zu öffnen, so daß sie nur durch die Fenster der Wohnung das Leben auf der Straße beobachten konnten. Eine Schule wurde nicht besucht, in allem unterrichtete der geistig überaus regsame Vater seine Kinder selbst. Ja, er gab daneben auch noch fremden Kindern Lektionen, zuerst unentgeltlich, und als die Eltern dies nicht mehr annehmen wollten, rechnete er für die Stunde 21/2 Stüber (10 Pfennig). Der Unterricht war vielseitig und anregend. Nach den Stunden erzählte der Vater seinen Kindern Geschichten, biblische wie weltliche, musizierte mit ihnen und leitete sie zum Zeichnen und Malen an. Meine Mutter bewahrte noch dicke Hefte, in denen sie alle Gegenstände und Personen der Umgebung vielfach unter seiner Leitung gezeichnet und gemalt hatten. Erst abends, wenn die Kinder zu Bett waren, holte der treffliche Mann seine dicken alten Bücher hervor, vertiefte sich in theologische und astronomische Probleme, schrieb und rechnete, und meine Großmutter bedurfte ihrer ganzen Geduld und Sanftmut, wenn er oft nicht zu bewegen war, die Ruhe aufzusuchen. Diese Lebensweise bewahrte die Kinder vor schlechten Einflüssen, hatte aber auch ihre Schattenseiten, und meine Mutter beklagte, daß es ihr infolge der Abschließung in ihrer Jugend all ihr Leben lang an Gewandtheit im Umgange gefehlt habe. Indessen kann ich versichern, daß sie bei einem sehr sichern Taktgefühl in ihrem Berufskreise niemals der erforderlichen Kunst, mit Menschen umzugehen, ermangelt hat. Übrigens sollte sie sehr bald Gelegenheit haben, sich in schwierigeren Lebenslagen zu bilden.
Schon 1830 erlag mein Großvater den Anstrengungen, welche ihm die Ausübung seines Amtes im Winter auferlegte, und während die Großmutter mit den übrigen Kindern in Wevelinghoven blieb, wurde meine bereits konfirmierte Mutter nach Elberfeld in das Haus ihres Onkels, des Oberbürgermeisters Brüning, gebracht, zunächst für ein Jahr zu ihrer weiteren Ausbildung. Dann aber wollten beide Teile nicht voneinander lassen, und so blieb meine Mutter noch fünf weitere Jahre in dem Hause des Onkels, indem sie sich der Pflege einer dort lebenden Großmutter widmete. Diese sechs Jahre in Elberfeld waren für sie die Hochschule, in welcher sie die Ausbildung fürs Leben gewann. Dort wurde der von Haus aus aufrichtig fromme Sinn meiner Mutter durch die Einflüsse in Elberfeld zu einem Pietismus zugespitzt, der später in meinem Elternhause in zahlreichen Andachtsübungen zum Ausdrucke kam, aber auch meiner Mutter manchen Kummer brachte, wenn sie ihre Kinder auf freieren Bahnen wandeln sah und erst spät im Leben eine gewisse Toleranz üben lernte.
Inzwischen wuchsen in Wevelinghoven die drei Brüder meiner Mutter heran, und es wurde notwendig, für ihre Ausbildung zu sorgen. Um dazu beizutragen, verließ meine Mutter das liebgewordene Elberfeld und nahm eine Stelle als Pflegerin bei der schon erwähnten Frau Koch an, mit hundert Talern jährlich, von denen sie die Hälfte an die Mutter abgab. Ihr Dienst war schwer; Frau Koch litt an einem Krebsleiden, und meine Mutter mußte sie verbinden, pflegen und bedienen. Nach kurzem Aufenthalte in Wiesbaden unterwarf sich die Kranke einer Operation in Düsseldorf; aber ehe die Wunde an der Brust noch geheilt war, brach das Übel aufs neue wieder aus. Jetzt zog sich Frau Koch in ihr großes und schönes Haus nach Wevelinghoven zurück und hier gab es noch einen zweiten Patienten zu pflegen. Frau Kochs einziger Sohn hatte sich durch seinen Reichtum zu einem ausschweifenden Leben verleiten lassen, und nun saß er zu Hause, blind und mit verkrümmten Gliedmaßen zusammengebückt im Lehnstuhl und mußte wie ein Kind gepflegt werden. Geistig war er noch frisch und geneigt, über alles zu spotten, was meiner aus dem Wuppertale zurückkehrenden Mutter heilig war. Sie ertrug alles mit Geduld, und nur einmal, als er ihr zumutete, am Karfreitagmorgen aus dem vor kurzem erschienenen, aber von den Elberfeldern zum untersten Pfuhle der Hölle verdammten Leben Jesu von Strauß vorzulesen, da verweigerte ihm meine Mutter den Gehorsam, und er mußte sich darein fügen.
Um diese Zeit hörte der junge Koch, daß sein alter Freund und Schulkamerad, der Kandidat Adam Deussen zu Kelzenberg, aus Westfalen zurückgekehrt und augenblicklich ohne Stellung sei. Sofort schickte er nach ihm und band ihn als Gesellschafter an sein Haus. So trafen in dem Hause des Reichtums und des Unglücks die beiden Personen zusammen, welche dazu bestimmt waren, den Knoten meines Daseins zu schürzen.
Adam Deussen war der Sohn eines begüterten Bauern in dem anderthalb Stunden westlich von Wevelinghoven gelegenen Dorfe Kelzenberg. Er war geboren nach der eigenhändigen Aufzeichnung seiner Mutter in ihrer Familienbibel am. 26. November 1801. Hingegen verzeichnen ihn die damals in der Kriegszeit sehr unordentlich geführten offiziellen Listen als geboren am 10. Frimaire des zehnten Jahres der fränkischen Republik, und sonach muß es unentschieden bleiben, ob mein Vater 1801 oder 1803 geboren ist. Außer ihm war noch ein älterer Bruder, Hannes, und drei jüngere Brüder, Wilhelm Heinrich, Neras (Kornelius) und Köbchen (Jakob) da, während ein sechster, mit Namen Werner, als Soldat in Köln starb. Die übrigen sind mir als wohlhabende Bauern des Jülicher Landes noch in guter Erinnerung. Der Schulunterricht in der Dorfschule wurde nur im Winter betrieben, im Sommer wurde die Jugend teils zur Feldarbeit herangezogen, teils sich selbst überlassen. Oft noch erzählte mein Vater, wie er eine Kuh am Strick führen hatte, den Strick sich selbst ums Bein schlang und so auf einen Kirschbaum stieg, eine Verbindung des Angenehmen mit dem Nützlichen, welche ihm übel hätte bekommen können. Obgleich in dieser Weise seine Jugend wenig vom Bücherstaube berührt wurde, wie er denn all sein Leben durch kein sonderlicher Freund der Bücherweisheit gewesen ist, so entdeckte man doch in ihm höhere Anlagen und beschloß, ihn studieren zu lassen. Nach anderer Version soll er sich zu den ländlichen Arbeiten so unlustig und ungeschickt erwiesen haben, daß man ihn, um doch etwas Brauchbares aus ihm zu machen, zum Studium, selbstverständlich der Theologie, bestimmte. Dies war unzweifelhaft ein Mißgriff. Mein Vater hätte vermöge seines intuitiven Verstandes, seiner Gewandtheit, Jovialität und eines sicheren Taktgefühls in hundert Fächern Bedeutendes, vielleicht Eminentes leisten können, aber zum Prediger und Seelsorger mochte er sich weniger eignen als manche andere, die an Klarheit der Auffassung, Sicherheit des Urteils und richtigem erfolgreichen Eingreifen weit hinter ihm zurückstanden. Notdürftig wurde er drei Jahre hindurch durch Privatunterricht vorbereitet und wanderte dann zu Fuß mit einem Freunde nach Marburg, wo er zwei Jahre, und hierauf nach Bonn, wo er ein drittes Jahr seine Theologie studierte. Von seinen Lehrern erwähnte er mir gegenüber den Professor der Philosophie Suabedissen in Marburg und den Theologen Nitzsch in Bonn, den er oft rühmte, und der wohl am tiefsten auf ihn eingewirkt hat. Übrigens war er nicht nur ein fleißiger, sondern auch ein lustiger Student, wie er denn auch später nie ein Kopfhänger gewesen ist. Wenn mich eine etwas unsichere Erinnerung nicht täuscht, so gehörte er als Konkneipant dem Korps der Westfalen an. Ich fragte ihn einmal: »Papa, hast du auch ein Duell gehabt.« – »Es war geplant«, erwiderte er; »ich hatte einen gefordert, aber der Kerl kam nicht, hatte peurs, so unterblieb's.« In Köln wurde 1825 das erste und in Koblenz 1826 das zweite theologische Examen mit Ehren bestanden. Dann aber folgte eine vierzehnjährige Kandidatenschaft, ohne daß eine Stelle sich für ihn eröffnete, so beliebt er auch überall bei den Gemeinden war, in denen er Aushilfedienste geleistet hat. So wandte er sich, nachdem er vier Jahre hindurch an sechs verschiedenen Orten als Hilfsprediger tätig gewesen war, 1831 nach Kamen und vertrat dort sechs Jahre hindurch den altersschwachen Pastor in der sichern Hoffnung, nach dessen Tode in seine Stelle einzurücken. Das Leben verlief dort unter einer schwerfälligen, fast allein materiellen Interessen hingegebenen Bevölkerung ohne alle geistige Anregung, und eine innere Stagnation trat ein, deren Folgen nie ganz überwunden wurden. Mit getäuschter Hoffnung kehrte er 1837 mutlos und gebrochen in die Heimat zurück, und hier war es, wo ihn sein Jugendfreund Koch entdeckte und in sein Haus zog. Das bescheidene, verständige und fromme Mädchen, welches in so aufopfernder Weise seinen schweren Dienst versah, erweckte bald seine Neigung. Sie aber fand an dem um zwölf Jahre älteren und durch ein langes Junggesellenleben etwas verwahrlosten Kandidaten kein sonderliches Wohlgefallen, und erst als Papa eines Tages durch die Küche ging, seine Pfeife am Herdfeuer ansteckte und in die Worte ausbrach: »Mir muß aber auch alles fehlschlagen!« da fühlte sie sich von tiefem Mitleid erfaßt, ohne daß es fürs erste zu einer Aussprache gekommen wäre. Aber die kluge Frau Koch sah voraus, was kommen würde, und nahm meiner Mutter das Versprechen ab, bei ihrem Sohne wenigstens so lange auszuhalten, bis Deussen sie als Pfarrersfrau in sein Haus einführen könne. Sie starb im Februar 1838, und einige Monate darauf erfolgte die Verlobung. Nun ging mein Vater zur Aushilfe nach Feldkirch bei Neuwied; aber so beliebt er auch dort in kurzer Zeit geworden war, so scheiterten doch die einmütigen Bitten der Gemeinde, ihn zum Pfarrer zu erhalten, an dem von dem Fürsten zu Wied als Patronatsherrn festgehaltenen Grundsatze, eine so einträgliche Stelle nur einem älteren Geistlichen seines Fürstentums zu verleihen. Endlich eröffnete sich eine bescheidene Aussicht und im März 1840 wurde mein Vater zum zweiten Pfarrer der Gemeinde Dierdorf ernannt, welcher gleichzeitig eine nur von wenigen Schülern besuchte Rektoratsschule zu unterhalten verpflichtet war. Am 19. Juni feierten meine Eltern im Hause der Großmutter in Wevelinghoven ihre Hochzeit, und als beide eine Woche später von Neuwied aus zu Fuß kommend in Dierdorf eintrafen, da wurden sie, nachdem ausgestellte Wachtposten ihr Herannahen gemeldet, vor dem bekränzten Pfarrhause mit dem Gesang der Schulkinder und mit einer herzlichen Ansprache des die erste Stelle verwaltenden Pfarrvikars Reinhardt empfangen. Dieser Reinhardt und seine noch heute im hohen Alter lebende Gattin wurden nach Übernahme der Pfarrei in dem eine Stunde von Oberdreis entfernten Puderbach unsere nächsten Nachbarn und innigsten Freunde. Diese Freundschaft hat sich auch auf die Kinder übertragen, und noch heute wüßte ich kaum einen, der meinem Herzen so nahe stünde, wie der einzige Sohn dieser Familie, Karl Reinhardt, Direktor des Goethegymnasiums zu Frankfurt a.M.
In Dierdorf wußten die Eltern unter engen Verhältnissen sich behaglich einzurichten. Dem praktischen Sinn meines Vaters gelang es, aus unbenutzten Räumen durch Umbau eine behagliche Wohnung herzustellen, in welcher sich meine beiden älteren Brüder Johannes am 16. Juni 1841 und Werner am 25. November 1842 als hochwillkommene Insassen einfanden. Ein Legat des um diese Zeit verstorbenen Koch von tausend Talern zusammen mit 500 von seiner Mutter übermachten Talern legte den Grund zum späteren Vermögen der Familie, von dem noch die Rede sein wird. Da die mit der zweiten Pfarrstelle in Dierdorf verbundene Lateinschule meinem Vater bei seiner Vorliebe für ein zwangloses Leben zu einer immer größeren Last wurde, so verzichtete er gerne auf die Vorzüge des Lebens in einer kleinen Stadt, als sich eine Dorfstelle für ihn eröffnete, und so siedelte die kleine Familie im Oktober 1843 nach Oberdreis über. Hier wurde ich als dritter Sohn fünfzehn Monate später geboren, hier verbrachte ich die ersten zwölf Jahre unter den Vorzügen und Nachteilen des ländlichen Lebens. Die frische, etwas rauhe Luft des Westerwaldes bei ausreichender, wenn auch überaus einfacher Ernährung führte zu einer Stählung des Körpers, welche mir das Leben hindurch zugute kam, aber die Einförmigkeit und die Dürftigkeit der äußeren Eindrücke ließ es zu keiner gehobeneren Lebensstimmung kommen. Wie im Dämmerlicht flossen meine Tage dahin, und charakteristisch ist, daß mich die Wonne des Daseins zum erstenmal durchschauerte, als ich zehn Jahre alt in Vaters altem und wenig benutztem griechischen Neuen Testamente das Griechische lesen lernte.
Wenn ich im Familienkreise es wagte, die Umgebung von Oberdreis für einförmig, unbedeutend, nichtssagend zu erklären, so konnte dies gelegentlich einen Sturm der Entrüstung veranlassen, und teilweise mochte mein Urteil aus einer mir tief eingepflanzten Neigung entsprungen sein, an jedem gegenwärtigen Zustande die Schattenseiten hervorzuheben, oder, wie man sagt, darauf zu schimpfen, eine Neigung, die ich von meinem Vater geerbt haben mag, und welche bei uns beiden keineswegs den behaglichsten Genuß der Gegenwart ausschloß, vielmehr, wenigstens was mich betrifft, ihre Wurzel in einer geheimen, halb unbewußten Angst hat, durch Zufriedenheit mit dem bestehenden Zustande den Sporn zum weiteren Streben abzustumpfen.
Doch, um auf Oberdreis zurückzukommen, so mag ich es wohl oft zu hart beurteilt haben. Einsam war das Dorf und einförmig das Leben in ihm, aber eine gewisse Lieblichkeit läßt sich doch weder den um den Kirchhügel mit Kirchhof und uralter Riesenlinde herumgeworfenen, strohbedachten Häusern absprechen noch auch dem Wiesental und murmelnden Bach da unten und den kornbewachsenen Feldern, welche sich in sanftem Ansteigen bis zu den waldbewachsenen Höhen fortsetzen. Da war im Süden der mit Tannen bewachsene Oberdreiser Berg, den ich meinen Neriton1 zu nennen pflegte, und die nach Osten und Westen sich fortsetzende Hügelkette, bestanden mit prachtvollen Eichen, nur daß eine blödsinnige Verwaltung früherer Zeiten sich hatte einreden lassen, daß die Eichen besser gedeihen würden, wenn man die Spitze der Kronen abschnitte, und nun standen sie da für alle Zukunft verstümmelt und verunstaltet und boten meinem Vater ein unerschöpfliches Thema, wenn er gelegentlich das Bedürfnis fühlte, über den Westerwald, über seine Zurückgebliebenheit, Verkommenheit und Dummheit sich weidlich zu ereifern. Auf der entgegengesetzten Seite des Tales stieg man den Rodenbacher Weg hinauf zu einer auf der Höhe zwischen Wäldern von Lautzert nach Steimel und Puderbach verlaufenden Landstraße. Im Frühling, wenn die Schneemassen der umliegenden Wälder schmolzen, pflegte diese Landstraße stellenweise zu einem undurchdringlichen Morast zu werden, und man mußte sich an der Seite einen Weg durch das Gestrüpp bahnen. Im Sommer hingegen bot diese Landstraße einen beliebten Spaziergang. Auf beiden Seiten wuchsen im Gebüsch unerschöpfliche Mengen von Waldbeeren, und rechts hatte man wiederholt einen Gesamtblick auf die blauen Berge des Siebengebirges. Und nun vollends Steimel, welche Erinnerungen weckt nicht dieser Ort! Hierhin ging Papa, wenn er mit den zu den Ferien eintreffenden Söhnen ein Glas Bier trinken wollte; dann wurde es gewöhnlich später als gut war; der Rückweg nach dem eine halbe Stunde entfernten Oberdreis war im Dunkel des Waldes kaum noch zu finden, und Mama, mit dem Abendessen wartend, empfing den Gatten und die Söhne mit ernstem Gesichte oder wohl gar mit einer Strafpredigt. In Steimel war jeden zweiten Dienstag im Sommer großer Viehmarkt. Schon frühmorgens zogen dorthin in langen Reihen die Bauern der umliegenden Dörfer mit ihren Kühen, Kälbern und Schweinen. Und während dort die als Käufer und Unterhändler geschäftig hin-und herlaufenden Juden mit den Bauern handelten und feilschten, wurden in den weiterhin gelegenen Buden Obst und Kuchen, Spielzeug und mancherlei Bedarfsartikel feilgehalten. »Was kann man auf dem Steimeler Markt kaufen?« fragte ich als sehr kleiner Knabe mein Kindermädchen. »Alles«, war ihre lakonische Antwort, und ich malte mir aus, wie schön es wäre, wenn ich mir auf dem Steimeler Markt eine Königskrone kaufen würde. Eine halbe Stunde hinter Steimel lag Puderbach, wo der schon in Dierdorf mit meinen Eltern befreundete Pastor Reinhardt seinen Wirkungskreis hatte. Oftmals besuchten sich die Familien, und das schönere Haus, der große Garten mit dem Ouittenbaum, vielleicht auch die etwas reichere Lebensführung in Puderbach übten eine mächtige Anziehungskraft. Wiederholt träumte ich als Kind, wie die Eltern auf überspanntem Leiterwagen mit uns nach Puderbach zogen, wie dort bei Tante Reinhardt der Kaffee, der große Kuchen aufgetragen wurde, worauf ich dann gewöhnlich erwachte und beklagte, nicht weitergeträumt zu haben.
So war die Umgebung des Orts, an welchem ich am 7. Januar 1845 kurz vor 3 Uhr morgens leicht und glücklich ins Leben trat und am 24. Januar auf die Namen Paul Jakob getauft wurde. Den letzteren Namen erhielt ich, weil ihn meine beiden Großväter geführt hatten; da aber in Oberdreis auch ein Jude namens Jakob wohnte, welcher Kühe schlachtete, und meine Geschwister mich gelegentlich damit neckten, daß sie mich Paul-Jakob-schlacht-die-Küh nannten, so mißfiel mir dieser zweite Name höchlich; ich warf ihn fort und verleugnete ihn, wo immer dieses möglich ist. Den andern Namen erhielt ich namentlich zum Andenken des Apostels Paulus, und meine Mutter ermahnt mich in dem Büchlein, welches vor mir liegt und Aufzeichnungen über meine ersten Kinderjahre enthält, dem großen Apostel nachzueifern. In der Tat fühle ich mich ihm wie wenig andern Erscheinungen verwandt. Seine unermüdliche Geduld und Sanftmut, mit der er alles über sich ergehen ließ, um nur seinen Zweck zu erreichen, die Beharrlichkeit und Zähigkeit, mit der er die vorgesetzte Aufgabe verfolgte, die Unbarmherzigkeit, mit der er den falschen Schein angreift (Galater 2) und die stolze Demut, mit der er von sich selbst redet, das alles sind Züge, welche ich auch in mir zu finden glaube, und schließlich habe auch ich meine Lebensaufgabe darin gefunden, einem großen Verkannten bei den Menschen Eingang zu verschaffen, nicht zu erwähnen, daß so ziemlich alle Lehrsätze im System des Apostels Paulus nur unter verändertem Namen integrierende Teile meiner eigenen philosophischen Weltanschauung geworden sind. Als ominös will ich noch erwähnen, daß bei meiner Taufe das Taufbecken umgestoßen, aber noch glücklich von dem anwesenden Ohm Hannes, dem ältesten Bruder meines Vaters, aufgegriffen wurde, wie er mir noch selbst erzählt hat.
Nach den Schilderungen meiner Mutter in dem erwähnten Büchlein war ich ein gesundes und fröhliches, ungewöhnlich sanftmütiges und geduldiges Kind. Dabei aufgeweckt und von großer Lebhaftigkeit. Alles kam bei mir sehr früh; schon mit zehn Tagen soll ich mit Bewußtsein gelacht haben, zur großen Verwunderung meiner Amme, welche dergleichen nie vorher gesehen hatte. Mit sechs Monaten und drei Tagen soll ich zuerst Papa gesagt, mit elf Monaten und acht Tagen mich selbständig aufgerichtet und eine Strecke gelaufen haben usw. Mit drei Jahren, so erzählt meine Mutter, an einem der ersten schönen Frühlingstage habe ich lange bei den Denkmälern auf dem Kirchhofe gestanden und sei dann zur Mutter geeilt mit den Worten.
»Der Winter ist gefangen;
Der Frühling kommt gegangen.«
In diese Zeit fällt auch meine älteste Erinnerung. Sie ist datierbar, denn sie betrifft meinen dritten Geburtstag am 7. Januar 1848. Noch sehe ich den hohen runden Tisch vor mir, und auf ihm als bescheidene Gaben ein Täßchen aus chinesischem Porzellan und einen Biskuitkuchen. Von letzterem schnitt der Vater uns Kindern von Zeit zu Zeit ein Stück ab, und deutlich erinnere ich mich, wie ich mich im stillen darüber wunderte, daß der Vater den beiden andern ebenso große Stücke gab wie mir, obgleich der Kuchen eigentlich doch mir allein geschenkt war. An Naschhaftigkeit war ich meinen Brüdern entschieden überlegen. Ich erinnere mich, wie uns einst Süßigkeiten geschenkt worden waren. Ich verschlang meinen Anteil sofort, während Bruder Werner den seinigen in einem offenen Raum unter dem mit runder Öffnung versehenen Sitze des Kinderstühlchens aufbewahrte. Länger stand ich im Kampfe mit mir selbst, aber plötzlich übermannte es mich, und ich fuhr zu, um vor Werners Augen ein Stück zu erbeuten. Natürlich wurde meine Absicht unter allgemeiner Entrüstung vereitelt. Das moralische Gesetz predigt sich unter den Menschen ganz von selbst, indem wir uns von Mitmenschen umgeben sehen, an deren Rechten die unsern ihre Grenze finden.
Noch eine datierbare Erinnerung aus dieser frühesten Zeit ist die Geburt meiner Schwester Maria am 10. Dezember 1848. Vier Knaben waren ihr vorhergegangen, welche an jenem Morgen in dem engen Schlafzimmer im ersten Stock des alten Hauses ungewöhnlich lange sich selbst überlassen blieben, ohne daß jemand daran dachte, sie zum Aufstehen zu veranlassen. Wir benutzten diesen willkommenen Aufschub, um zu rolzen, wie wir es nannten, d.h. wir türmten in den Betten Kissen und Federbetten übereinander, um uns kopfüber von ihrer Höhe in die Betten herabzustürzen und ähnliches mehr. Da erschien Papa mit gerötetem Kopfe und meldete: »Jungens, ihr habt ein Schwesterchen bekommen.« Ein ungeheueres, nicht endenwollendes Freudengeheul war die Antwort, welches mir bis heute noch in den Ohren gellt.
Im Sommer 1849 unternahm die Familie eine Reise zu den beiden Großmüttern ins Niederland. Bis Neuwied wurde im Leiterwagen gefahren, und der Weg war so holperig, daß die mitgenommene Milch von selbst zu Butter wurde. Unvergeßlich ist mir die Szene beim Einsteigen ins Dampfboot. Als der schnaubende Koloß an der Landungsbrücke anlegte, stiegen die vier Ältesten, Johannes, Werner, Paul und Friedrich, ohne Schwierigkeit ein, und die erst halbjährige Maria wurde auf Mamas Arm hineingetragen. Von dem Aufenthalte bei den Verwandten in Wevelinghoven und Kelzenberg sind mir nur ganz flüchtige, vereinzelte Erinnerungsbilder geblieben. Sehr lebendig aber steht mir noch die Rückfahrt vor der Seele. Einer unserer Bauernonkel lud die ganze Familie auf einen mit Leinwand überspannten Karren und fuhr uns nach Grimlinghausen am Rhein zum Nachtdampfer. Ein zierliches Hündchen, welches uns geschenkt worden war, wurde in einer Hutschachtel untergebracht. Unterwegs erhob sich ein greuliches Unwetter; die Nacht war hereingebrochen, und der Regen prasselte in Strömen auf das Leinentuch des Karrens. Wir krochen zusammen und schützten uns so gut wir konnten, kamen auch glücklich an, aber das Hündchen war verschwunden, und man hat nie wieder davon gehört. In dunkler Nacht und unter fortwährend strömendem Regen gelangten wir mit Sack und Pack an der steilen Böschung des Ufers hinunter auf den Dampfer, wo wir bald alle vier in der Kajüte einschliefen, während Papa die naßgewordenen Kleidungsstücke um den Dampfkessel zum Trocknen aufhing.
Das kleine Schwesterchen war natürlich unser aller Liebling. Eines Morgens, während die Eltern sich ankleideten, war sie, die noch nicht sicher stehen konnte, in einem Gitterbett zwischen Kissen eingebaut worden, und wir wetteiferten, mit ihr zu spielen. Friedrich zeigte sich täppisch, und ich holte aus, um ihm einen Backenstreich zu versetzen, traf aber zu meinem Schreck nicht seine Wange, sondern die des geliebten Schwesterchens. Laut ertönte ihr Wehgeschrei, wütend stürzten die Brüder auf mich los, und so sehr ich auch beteuerte, daß meine Absicht eine andere gewesen, man hätte mich gelyncht, wenn die Eltern nicht dazwischengetreten wären.
Im Jahre 1849 war die Aufregung sehr groß, als des Morgens eine Kompagnie Soldaten, dergleichen nie vorher gesehen war, in das Dorf einmarschierte und auf dem Kirchhofe unter der Linde sich gruppierte. Zuerst hatten wir Kinder große Angst, als aber Papa, der den Weg zum Herzen dieser Tapfern wohl kannte, mit einem Kruge voll Schnaps auf sie zuschritt, da wagten wir es, Werner als der Mutigste voran, in bedächtigen Zwischenräumen ihm zu folgen. Bald mischten wir uns dreist unter die Krieger, bewunderten aus der Nähe ihre Helme, Knöpfe und Waffen und wurden für den gespendeten Schnaps mit Backwerk beschenkt. Es waren von den bei uns zu Weihnachten üblichen Hasen und Puppen, so genannt, weil sie mit diesen Dingen eine entfernte Ähnlichkeit haben.
Diese Truppendemonstration in dem friedlichsten aller Dörfer stand, wenn ich nicht irre, im Zusammenhang mit dem revolutionären Geiste des Jahres 1848, dessen Wellenschlag sich bis zu unserm entlegenen Gestade fortgepflanzt hatte. Von alters her behaupteten die Oberdreiser und einige Nachbargemeinden ein Anrecht auf den zu ihrer Gemarkung gehörigen Wald zu haben, welchen der Fürst zu Wied, der ehemalige, aber seit 1806 mediatisierte Landesherr, in dunkeln Zeiten durch nicht ganz klare Manipulationen an sich gebracht hatte. Auf dem Wege des Prozesses war bisher nichts zu erreichen gewesen, und um einen solchen wieder in Gang zu bringen, zogen eines Morgens auf Verabredung alle Familienhäupter der drei Gemeinden in den fürstlichen Wald, und ein jeder holte sich dort gleichsam als Zeichen der Besitzergreifung eine kleine Fuhre Holz. Sogleich erhoben sich warnende Stimmen, und die Leute brachten denn auch am folgenden Tage das Holz in den Wald zurück; aber der Frevel war begangen, und noch dazu in einer Zeit, wo es ohnehin den Potentaten etwas warm auf ihren Sitzen wurde; die Bestrafung blieb nicht aus: jeder Familienvater sollte ein halbes Jahr, die weniger belasteten ein viertel Jahr ins Gefängnis wandern. Hier fand nun mein Vater Gelegenheit, seine großen Gaben zum Wohl der Gemeinde zu verwenden. Er reiste nach Berlin, erbat bei Friedrich Wilhelm IV. eine Audienz und stellte ihm vor, daß die Abwesenheit aller Ernährer für ein halbes Jahr den Ruin der ohnehin armen Gemeinden herbeiführen würde. Der König zeigte sich entgegenkommend, erklärte aber, daß nicht er, sondern der Fürst zu Wied der beleidigte Teil sei, und daß ohne diesen nichts geändert werden könne. Der Fürst zu Wied aber verweilte fern von dem Schweiß und der Not seiner ehemaligen Untertanen in Paris. Ohne sich lange zu besinnen, reiste nun mein Vater auch noch nach Paris und erreichte endlich, daß die Strafe nur zur Hälfte und zu gelegener Zeit, wie namentlich im Winter verbüßt wurde.
Aber auch nach andern Seiten hin entfaltete mein Vater in seiner Gemeinde eine gesegnete Wirksamkeit, wenn auch nicht gerade in theologischem oder gar pietistischem Sinne. Langjährige Prozesse wußte er durch Vergleich zu schlichten, eine rationellere Bewirtschaftung des Bodens regte er an und ging selbst mit gutem Beispiel voran, den Schlemmereien bei den Hochzeiten, welche einen großen Teil der von den Gästen dem jungen Paare nach Landessitte zur Begründung des Hausstandes dargebrachten Geldgeschenke verschlangen, trat er energisch, wenn auch ohne merklichen Erfolg entgegen, und als die in meinem Geburtsjahre zuerst auftretende Kartoffelkrankheit große Not über die hauptsächlich von Kartoffeln lebende Bevölkerung brachte, da reiste mein Vater kollektierend in der Provinz umher und trug wesentlich zur Linderung der Not bei, indem er irgendwelche Erdarbeiten ausführen ließ und dafür Brote verteilte.
Kirche und Pfarrhaus waren, als sie mein Vater übernahm, in kläglichem Zustand. Die Kirche, um 1800 erbaut, war durch die Kriegszeiten nie recht fertig geworden. Von außen fehlte der Anstrich, im Innern die Orgel, durch das Dach regnete es durch und zwischen den halbzerbrochenen Bänken wuchs das Gras. Noch schlimmer stand es mit dem Pfarrhause, in welchem ich die ersten acht Jahre meines Lebens zugebracht habe. Durch die altmodische Haustür gelangte man in eine große rauchige Küche, links war die mit blauen Vöglein austapezierte gute Stube, rechts führten einige Stufen zu der nur durch Übersteigen einer hohen Schwelle erreichbaren Wohnstube, in deren Hintergrunde wieder Stufen zur Gesindestube herabführten. In diesem Hintergrunde stand ich mit vielen geputzten Gästen, als mein Vater die Taufe Marias oder vielleicht die des um zwei Jahre jüngeren Immanuel vollzog. Aufmerksam folgte ich der heiligen Handlung. Als aber der Kopf des Kindleins entblößt und unter feierlichen Sprüchen und Gebärden Wasser mitten in das Gesichtchen geträufelt wurde, da spürte ich eine unbezwingliche Anwandlung zu lachen, und schnell zog ich mich hinter die Röcke der umstehenden Tanten zurück, um meinen Frevel zu verbergen. An einen andern Geniestreich muß ich denken, wenn ich mir die Küche mit dem rußigen, bei Sturmwetter nicht selten durch herabfallende Schornsteintrümmer gefährdeten Küchenherd vergegenwärtige. Einige Bauersleute waren zu Besuch gekommen und hatten mir ein leider noch nicht gekochtes Ei mitgebracht. Ich bat, es mir zu kochen, fand aber für den Augenblick kein Gehör, da alles mit dem Besuch in der Stube beschäftigt war. Ich schlich mit meinem Ei in die Küche, um mir selbst zu helfen, aber das Feuer war erloschen, alles war leergebrannt und kalt. Ich füllte ein Gefäß mit kaltem Wasser, legte das Ei hinein und hoffte meinen Zweck zu erreichen, indem ich ein Streichhölzchen nach dem andern anzündete und in das kalte Wasser tauchte. Erst als die Zahl der weggeworfenen Streichhölzer sich in beängstigender Weise mehrte, ohne daß sich das Wasser merklich erwärmt hätte, erkannte ich die Vergeblichkeit meiner Bemühungen.
Aus dieser Küche führte eine gewundene und bei dem Mangel jeder Lehne für uns Kinder gefährliche Treppe nach dem ersten Stock, wo links und rechts die Schlafzimmer und geradeaus der sehr dunkle und etwas unheimliche Söller lag. Man stieg einige Stufen herunter und befand sich in einem sehr langen, schmalen Raum, dessen Decke und eine Seitenwand nur durch das auf dieser Seite sehr tief herunterreichende Strohdach des Hauses gebildet wurde. Hier sollte es angeblich spuken, und die Leute erzählten, wie ein früherer Pastor mit der Bibel hinaufgestiegen sei, um den Teufel zu beschwören. Diese gruselige Geschichte hielt uns nicht ab, von Zeit zu Zeit und bei hellem Tage dem Söller einen Besuch zu machen und irgendwelchen alten Kram zum Spielen zu benutzen. Dieses alte Haus wurde von Jahr zu Jahr baufälliger, und es mußte an ein neues gedacht werden. Da hierzu die Mittel gänzlich fehlten, so beschloß mein Vater, wie er schon früher durch Kollektieren eine Kirchenorgel beschafft und den Notstand der Gemeinde gelindert hatte, so jetzt auf demselben Wege die Mittel für ein neues Pfarrhaus zusammenzubringen. Diese Angelegenheit hielt ihn einen großen Teil der Jahre 1851 und 1852 von Hause fern. Wieder trug er die Angelegenheit zu Koblenz in persönlicher Audienz dem König vor. »Ich habe kein Geld«, erwiderte dieser mit Lachen, spendete aber dann doch 300 Taler; auch wurde die Erlaubnis erteilt, in ganz Rheinland und Westfalen zu sammeln, und als dies geschehen war, dehnte mein Vater seine Kollektenreisen auch noch auf Holland und die Schweiz aus. So waren, zum großen Teile schon im Jahre 1851, zehntausend Mark zusammengebracht. Wenn es irgend möglich war, kam der Vater zum Sonntag nach Hause. Oft erschien er am Sonnabend spät abends, besorgte am Sonntag den Dienst in der Kirche und was sonst vorkommen mochte und ging Montag früh wieder auf Reisen. Schon längst waren die Pläne für das neue Haus entworfen und der Regierung eingesandt worden. Aber am grünen Tisch beeilte man sich nicht mit der Antwort, zog auch durch allerlei Einwände die Sache in die Länge. Indessen wurde der Aufenthalt im alten Hause immer unerträglicher. Da erklärte mein Vater: Morgen wird gebaut, mag die Regierung sagen was sie will. Nun entwickelte sich ein reges Treiben. Alle Mitglieder der Gemeinde taten Hand- und Spanndienste. Der Keller wurde gegraben dicht neben dem alten Hause, welches man stützen mußte, da es anfing zu rutschen. Bald aber erhob sich das Grundgemäuer des neuen Hauses und auf diesem das Zimmerwerk, zu welchem das Holz aus dem Gemeindewalde geliefert wurde. Dies alles und der ganze weitere Ausbau war für uns Kinder ebenso belehrend wie unterhaltend. In jeder freien Stunde kletterten wir auf den Balken herum, und jeder der vier älteren Brüder, mit Ausnahme meiner selbst, hat einen mehr oder weniger schweren Fall getan. Wir konnten die Zeit des Einzuges kaum erwarten. Sobald die Treppen gelegt waren, richteten wir uns schon in den ungetünchten Zimmern wohnlich ein, und am 23. September 1853, es war ein Sonntagmorgen und der Umzug war beendet, setzte sich Mama ans Klavier und spielte mit Rührung: Unsern Eingang segne Gott. Drei Tage darauf schenkte sie meinem Bruder Reinhard das Leben. Er war das siebente Kind, auf welches als achtes und letztes zwei Jahre später noch Elisabeth folgte. So war denn den Eltern nach und nach die stattliche Reihe von sechs Söhnen und zwei Töchtern beschieden worden, deren Erziehung zur Hauptaufgabe ihres Lebens wurde, welcher sie sich denn auch mit aller Treue gewidmet haben. Das Einkommen der Stelle war gering; es bestand in dem Nießbrauch von Pfarrwohnung nebst Stallungen und Scheune, von Wiesen, Gärten und Äckern sowie aus einer jährlichen Lieferung von Holz aus dem Gemeindewalde. Hierzu kam bis zu seiner späteren Ablösung der sogenannte »Zehnte«. Der zehnte Teil alles Feldertrages in der Gemeinde, z.B. beim Korn die zehnte Garbe, wurde ohne Auswählen ausgesondert, und zur Hälfte dem Fürsten zu Wied, zur Hälfte dem Pfarrer überwiesen. Bares Geld war ursprünglich, d.h. bis zur Ablösung des Zehnten, gar nicht mit der Stelle verbunden, es wären denn die Stolgebühren gewesen, bestehend in ganz kleinen Abgaben bei Kindtaufen, Heiraten u. dgl. Eine Wöchnerin wurde beim ersten Kirchgange mittels einer Einschaltung im Kirchengebete »ausgezeichnet«, wofür zwölf Eier entrichtet wurden. Endlich hatte jeder Hausstand in der Gemeinde zu Ostern zwölf Eier zu liefern, deren mühsame Eintreibung sich durch das ganze Jahr hinzog. Wie oft bin ich selbst, wenn man mal Eier brauchte, mit einem Körbchen unter dem Arme und einer Liste der Säumigen in der Hand von Haus zu Haus gegangen und habe die Ausreden und Vertröstungen der Leute anhören müssen. Manche zogen es auch vor, anstatt der zwölf Eier den hierfür feststehenden Satz von neun Kreuzern (25 Pfennig) zu entrichten. Amtlich war die Stelle unter denen verzeichnet, welche einen Ertrag von weniger als vierhundert Talern lieferten. Denn regelmäßig wurden die jährlichen Beiträge zur Witwenkasse zurückgesandt, wie es in diesem Falle gesetzlich vorgeschrieben war. In Wahrheit ließen sich die Erträgnisse der Stelle doch auf sechshundert Taler und wohl noch mehr bringen, wenn Felder und Wiesen nicht verpachtet, sondern vom Inhaber selbst rationell bewirtschaftet wurden. Und hieran ließen es beide Eltern nicht fehlen. Ein Knecht und zwei Mägde wurden gedungen, ein Pferd zur Bestellung der Felder gekauft, ein Dutzend Kühe füllte die Ställe Schafe, Schweine und eine Ziege waren stets vorhanden, und auf dem Hofe wimmelte es von Hühnern, Enten und Tauben. Eine Anzahl Gänse kam erst später als besondere Liebhaberei des Vaters hinzu, während die Mutter ihnen das Zertreten der Wiesen nicht verzeihen konnte und froh war, wenn sie einen dieser Schreihälse als Festtagsbraten auf den Tisch bringen oder lieben Verwandten in Elberfeld zum Geschenk machen durfte. So machte denn unser Pfarrhaus von außen ganz den Eindruck eines besser situierten Bauernhofes oder kleinen Herrenhauses. Die Felder wurden regelrecht bestellt und abgeerntet, das Heumachen, Kornschneiden, Kartoffelgraben usw. wiederholten sich im Kreislaufe des Jahres, und im Winter konnte man schon vom ersten Morgengrauen an das melodische Klipp klapp der Dreschflegel von der Scheune her vernehmen. An manchen Arbeiten durften auch wir Kinder teilnehmen, wie namentlich an dem Wenden des Heues oder an dem Einernten der reichlich vorhandenen Kirschen, Pflaumen, Birnen und Äpfel. Weniger angenehm war es, wenn wir von Mama in den großen Gemüsegarten zum Ablesen der Raupen befohlen wurden oder in Stellvertretung Papas in herbstlicher Kühle bei den Kartoffelgräbern stehen mußten, da sonst zu wenig getan wurde. Eine Beihilfe, wenn auch zweifelhafter Art, war es, daß bei den Hauptarbeiten, wie namentlich beim Heumachen, Kornschneiden und Kartoffelgraben, jeder Familienvater der Gemeinde an einem Tage »die Stunde tun«, d.h. dem Pastor bei der Arbeit helfen mußte. Der Vorteil dieser Einrichtung wurde indes durch die im Pfarrhaus nachfolgende Bewirtung stark geschmälert. Immerhin reichte die auf diese Weise bewirtschaftete Pfarrstelle hin, um die zahlreiche Familie zu ernähren, wie auch, um durch den Verkauf von Korn und Vieh, von Butter, Eiern u. dgl. so viel Geld zu lösen, wie nebenbei unbedingt erforderlich war.
Bei dieser Lage der Sache, wo die Pfarrstelle fast nur Naturalien eintrug und die Zinsen des kleinen Kapitals, das die Eltern besaßen und das durch den Onkel Wilhelm Heinrich, von dem später noch die Rede sein wird, verwaltet wurde, nicht angetastet werden sollten, eröffnete sich uns zu der Zeit eine dritte Einnahmequelle, welche es ermöglichte, den Überschuß der Wirtschaft an Brot und Fleisch, an Butter, Milch und Eiern vorteilhafter als durch den bloßen Verkauf zu verwerten und nach und nach immer erheblichere Beiträge für unser Fortkommen lieferte. Schon in meinen ersten Lebensjahren war meiner Mutter eine junge Kusine, Elise Brüning aus Elberfeld, zur Ausbildung im Haushaltungswesen für ein Jahr anvertraut worden, und dies hatte sich so gut bewährt, daß ohne jede Bekanntmachung in den Zeitungen nach und nach immer mehr Familien ihre Töchter für ein Jahr nach Oberdreis schickten. Gewöhnlich waren in der späteren Zeit sechs bis zwölf solcher jungen Damen in dem einsamen Oberdreis, trugen durch ihr Kommen und Gehen, durch die Briefe, Sendungen und Besuche ihrer Angehörigen gar sehr zur Belebung des abgelegenen Bergtales bei, und man kann sich denken, mit welchem Interesse wir als heranwachsende Jünglinge bei unserer Heimkehr in den Ferien die Reihen »der lieben Mädchen« (dies war die übliche Bezeichnung) zu mustern pflegten. Sie bezahlten im Jahre einen Pensionspreis von 120, später, wenn ich nicht irre, 180 Talern, wofür sie Wohnung und Tisch, der jetzt an Fleisch, Weißbrot usw. besser bestellt war, sowie Anweisung in den wochenweise abwechselnden Hausarbeiten erhielten. Es gab da eine Stubenwoche, eine Vormittags- und eine Nachmittags-Küchenwoche, eine Bettenwoche usw. Auch Klavierunterricht wurde erteilt, und unzählige Male erklangen »Die Klosterglocken« und stieg das »Gebet der Jungfrau« zum Himmel auf. Kamen wir vom Gymnasium oder der Universität in den Ferien nach Hause, so wurde mancherlei zur Unterhaltung veranstaltet. Gewöhnlich las ich aus Goethe oder Shakespeare vor, oft ein ganzes Drama ohne Unterbrechung in einer Sitzung. Im Herbste 1867 ging ich mit »den lieben Mädchen« die Geschichte der Philosophie nach Schwegler durch, was nur dadurch möglich wurde, daß wir alle täglich eine Stunde früher aufstanden. Mit Fanny Poadt, einer Engländerin, trieb ich Englisch, Deutsch, Lateinisch, und ein andermal habe ich mit zwei oder drei Schülerinnen Shakespeares Macbeth auf englisch durchgearbeitet. Daneben wurden jeden Nachmittag weitere Spaziergänge unternommen, wir besuchten zusammen den Steimeler Markt, die alte Burg Reichenstein, oder wir erklommen den Beulstein, eine Felsmasse mitten im Wald, blickten von dort auf Oberdreis und das idyllische Tal, sahen die Sonne hinter den Bergen untergehen und sangen dazu: »Seht, wie die Sonne dort sinket.« Weniger harmlos war es schon, wenn wir mit »den lieben Mädchen« in ein Wirtshaus einkehrten, um Kaffee, Milch und Bier zu trinken, was eigentlich nur für weitere Touren erlaubt war. Indessen gelang es uns mitunter sogar in Steimel, die »lieben Mädchen« zu einem Glase Bier hereinzunötigen, namentlich wenn ein besonderer Anlaß vorlag, z.B. wenn wir Besuch hatten, was in dem gastlichen Pfarrhause fast immer der Fall war. Übrigens ist alle die Jahre hindurch alles in den Grenzen des strengsten Anstandes geblieben; kein Mädchen ist bei uns zu Schaden gekommen, und sogar die Pfänderspiele wurden ohne Küsse gespielt. Das Stärkste, was vorkam, geschah vielleicht, als ich Weihnachten 1869 aus Minden in die Ferien zurückkam und wie immer eine von den »lieben Mädchen«, gewöhnlich die Schönste, zur Königin meines Herzens erkor und durch stille Aufmerksamkeiten auszeichnete. Der Weihnachtsabend kam heran. Unter dem strahlenden Christbaume wurden zahlreiche Pakete ausgeliefert, und nun ging es an ein Auspacken, Lesen der Briefe, Enthüllen der Geschenke, wobei des Jubels kein Ende war. Unter anderm packte meine Angebetete ein hübsches und für die ganze Familie nützliches Geschenk aus und überreichte es meiner Mutter. Ich stand natürlich daneben. Meine Mutter bewundert das Geschenk, ich bewundere es noch viel mehr und meine Mutter schließt das liebe Kind in ihre Arme und drückt einen Kuß des Dankes auf ihre Stirn. Was war natürlicher, als daß ich auch hierin ihrem Beispiel folgte, und vor aller Augen, ehe man sich dessen versah, einen Kuß von den rosigen Lippen des Mägdeleins geraubt hatte. Die Sache ging im Festgetümmel so hin, kam aber doch am andern Tage, als die Familie unter sich allein war, zur Sprache. Friedrich, der überhaupt immer geneigt war, mir etwas am Zeuge zu flicken, entwickelte mit ungestümer Beredsamkeit, daß durch dergleichen Vorkommnisse der Ruf des Pensionats leiden könne, dessen Erträge doch für den Unterhalt der Familie unentbehrlich seien und nicht am wenigsten auch von mir selbst oft genug in Anspruch genommen würden; er zeigte, immer hitziger werdend, wie ich somit meine eigenen Subsistenzmittel untergrübe und verstieg sich schließlich zu dem klassischen Ausspruche: »Der Paul vertilgt sein eigenes Brot!« Ein allgemeines herzliches Lachen belohnte diese rednerische Leistung und zeigte, daß man für diesmal nicht geneigt war, die Sache allzu tragisch zu nehmen.
Die meisten Pensionärinnen blieben nur ein Jahr bei uns. Ausnahmsweise kam es vor, daß ein Mädchen zwei, drei, ja wohl vier Jahre in Oberdreis verweilte. So blieb Klementine W., ein sehr schönes, aber auch sehr schwer zu leitendes Mädchen, ein Schützling und soviel mir bewußt, entfernte Verwandte von Alfred Krupp in Essen, von 1851 bis 1854 in Oberdreis. Sie war, als sie bei uns einzog, schon lange Zeit so heiser, daß sie keinen lauten Ton hervorbringen konnte. Man nahm an, daß sie ihre Stimme für immer verloren habe. Aber die gesunde Bergluft des Westerwaldes wirkte hier ein Wunder. Eines Abends kehrten die Mädchen von einem längeren Spaziergange auf den Oberdreiser Berg zurück, legten sich schlafen, und als am andern Morgen Klementine herunterkam, hatte sie ihre Stimme wieder erlangt und sprach klar und laut wie ein anderer Mensch. In der Folge wußte sie der Langweile des Landlebens dadurch abzuhelfen, daß sie allerlei dumme, zum Teil auch schlechte Streiche verübte. Dabei hatte sie die merkwürdige Eigenschaft, im Schlafe zu sprechen, und so verlogen sie auch sonst sein mochte, wenn meine Mutter sie im Schlafe ansprach, so konnte sie nichts verschweigen und beichtete alles bis ins kleine, ohne beim Erwachen sich daran zu erinnern. Was später aus ihr geworden ist, weiß ich nicht zu sagen. Jedenfalls wurde sie ein Segen für die Gegend. Denn als durch Mißwuchs und andere Umstände das Elend unter den Leuten immer größer wurde, da überredete mein Vater mit großer Mühe ein paar Leute, mit einer Empfehlung von ihm nach Essen zu Krupp zu gehen. Sie glaubten auf Nimmerwiedersehen zu scheiden, fanden aber bei Krupp Verwendung und konnten bald reichliche Beträge an die Ihrigen in der Heimat senden. Jetzt fand das Beispiel Nachahmung. Immer mehr Leute verlangten, nach Essen zu gehen, und da Krupp sich bereit erklärte, jeden anzustellen, den mein Vater mit einer Empfehlung ihm senden würde, so bildete sich in Essen nach und nach noch eine ganze Kolonie von Leuten aus Oberdreis und der Umgegend, welche dort viel Geld verdienten und nach Hause sandten oder mit sich zurückbrachten und dadurch sehr dazu beitrugen, den Notstand in der Heimat zu lindern.
Eine Hauptursache des Elends war die Leichtfertigkeit, mit welcher meine guten Landsleute Schulden machten, wodurch sie mehr und mehr in die Hände jüdischer und auch christlicher Wucherer gerieten, die es dann verstanden, die Leutchen um all ihr Hab und Gut zu bringen. Um diesem Unheile zu steuern, gründete mein Vater mit einem geringen, ich weiß nicht woher geschenkten, Fonds den Wohltätigkeitsverein in Steimeln, dessen lebenslänglicher Präsident er blieb und dem so ziemlich alle besseren Leute der Gegend sich anschlossen. Dieser Verein lieh Kapitalien zu 5 und verlieh sie gegen Hypothek zu 51/2 Prozent. Jeder Schuldner mußte außerdem noch einen Bürgen stellen. Diese Einrichtung erwies sich als außerordentlich wohltätig und half gar sehr, dem Wucher in der Gegend zu steuern.
Haben wir im bisherigen die Verhältnisse geschildert, unter deren Eindrücken meine Jugend gestanden hat, so wäre nun weiter von dem zu reden, was direkt für meine Erziehung und Bildung geschehen ist.
Während mein Vater seinen Kirchendienst mit Anstand und Würde verrichtete, ohne doch den Eindruck zu machen, als wenn ihm dergleichen sonderlich tief zu Herzen ging, so war meine Mutter beseelt von einem nicht nur sittlich strengen, sondern auch aufrichtig frommen Geiste, welcher mitunter des Guten vielleicht zuviel tat. Allezeit, soweit ich denken kann, wurde täglich vor dem Frühstück ein Morgensegen abgehalten, zu dem Sonntags auch die Dienstboten hereingerufen wurden. Die Mutter setzte sich ans Klavier; einige Verse wurden gesungen; dann wurde von dem Vater und später, wo dieser zum Morgensegen nicht mehr zu erscheinen pflegte, von der Mutter ein Kapitel aus der Bibel gelesen, worauf ein freigesprochenes Gebet, wie es gerade der Augenblick eingab, folgte. War dieser Vorgang im Angesichte des aufgetragenen Frühstücks für Kinder oft eine Geduldsprobe, so gab er doch als feierliche Einweihung des Tages diesem ein gewisses sittliches Gepräge und wirkte ohne Zweifel disziplinierend. Schwerer zu ertragen waren die lange Jahre bestehenden Abendsegen, während man schon mit dem Schlafe kämpfte, ohne doch einschlafen zu dürfen. Sogar ein Mittagsegen wurde, vielleicht unter dem Einflusse pietistischer Amtsbrüder, eine Zeitlang versucht, jedoch bald wieder aufgegeben. An diese Andachtsübungen schlossen sich frühzeitige religiöse Belehrungen durch die Mutter. Eine alte Bilderbibel wurde besonders Sonntagnachmittags hervorgeholt, wobei die Mutter uns die zugehörigen biblischen Geschichten erzählte; keine Dämmerstunde ließ sie gern vorübergehen, ohne ihre Kinder um das Klavier zu versammeln, mit ihnen zu singen und erbauliche Erzählungen und Ermahnungen einzuflechten, und in der Passionszeit, namentlich in der Karwoche, lag es auf dem ganzen Hause wie ein Schatten des Todes. An diesen religiösen Unterricht schloß sich frühzeitig der profane. Mein älterer Bruder Johannes unternahm es, mir das Lesen und zunächst die Buchstaben beizubringen. Infolge seiner nervösen und hastigen Art verfuhr er, selbst erst acht Jahre alt, allerdings sehr unpädagogisch dabei. Er zeigte und erklärte mir eine Anzahl von Buchstaben zusammen, und wenn ich sie dann nicht wieder nennen konnte oder verwechselte, so kniff er mich mit seinen scharfen und nicht immer sauberen Nägeln in den Hals. Er nannte dies »mieken«. Eines Tages betrachteten mich die Eltern, und Mama rief: »Je noch, das Kind hat ja einen ganz wunden Hals! Was hast du gemacht?« – »Ei, das ist doch vom Mieken«, antwortete ich. – »Was ist Mieken?« – »Nun, ich lerne doch jetzt lesen, und dabei wird man gemiekt.« Die Eltern hatten Mühe, den mir so natürlich scheinenden Zusammenhang zwischen Lesenlernen und Mieken zu verstehen und suspendierten das kaum begonnene Studium. Ich weiß nicht, wer sich dann weiter meiner annahm. Tatsache ist, daß ich mit fünf Jahren fließend lesen konnte und daß es nicht mehr lange dauerte, bis mich die Lesewut ergriff und mir das Lesen zeitweilig für eine Woche verboten werden mußte. Einem der nächsten Jahre, ich weiß nicht mehr welchem, gehört das folgende Vorkommnis an. Es war an einem heißen Sommertag nach dem Mittagessen; Mama hatte die kleine Maria schlafen gelegt und beauftragte mich, die Fliegen von ihr abzuwehren, während sie selbst im Nebenzimmer sich ein wenig zur Ruhe legte. Ich versuchte das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, indem ich mit der einen Hand dem Kinde die Fliegen wehrte, während ich aus einem in der andern Hand gehaltenen Buche las. Es waren Grimms Kinder- und Hausmärchen, welche uns Tante Marie Reinhardt kurz vorher geschenkt hatte. Ich weiß nicht, ob das Wedeln über dem Lesen allzu lässig betrieben wurde; Tatsache ist, daß das Schwesterchen erwachte und anfing zu schreien. Mama, aus dem Schlafe aufgeschreckt, eilt herbei, sieht das Märchenbuch und konfisziert es. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß mir dieses liebste aller Bücher für längere Zeit vorenthalten bleiben sollte. Mein Kummer war groß, und ich brachte meine Sehnsucht in einem Gedichte zum Ausdruck, welches anfing: »O Märchenbuch, o Märchenbuch«, welches noch längere Zeit vorhanden war, jetzt aber, wie es scheint, verloren ist. Die Sache sprach sich herum, ich mußte es am andern Morgen beim Frühstück vortragen, und man fand es so rührend, daß Mama mir auf allgemeine Bitte das Buch zurückgab.
Wir besuchten nun zunächst die Elementarschule des Orts, welche gegen hundert Kinder verschiedenen Alters aus Oberdreis, Dendert und Hilgert umfaßte. Es war nur eine Schulstube wie auch nur ein Lehrer vorhanden. Die Heizung der Schule wurde in der Art besorgt, daß jedes Kind allmorgendlich im Winter ein Scheit Holz von Hause, oft eine halbe Stunde weit her mitbrachte und beim Eintritt neben den Schulofen warf. Beim Unterricht saßen die Kinder auf Bänken ohne Lehne an langen flachen Tischen, die Knaben auf der einen, die Mädchen auf der andern Seite. Der Unterricht war in manchen Fächern für alle gemeinsam, in andern widmete der Lehrer sich nur einer Abteilung, während er die übrigen still beschäftigte. Am schwersten war für den Lehrer wohl die Schreibstunde. Stahlfedern waren nur dem Hörensagen nach bekannt und galten für einen nicht zu billigenden Luxus. Auch Hefte gab es nicht. Man schrieb auf zusammengefaltete Papierbogen mit Gänsefedern, welche sämtlich der Lehrer schneiden mußte, so daß immer eine Anzahl um ihn herumstand mit der Bitte: »Zepter (Präzeptor), schneid mir die Feder.« Der damalige Lehrer namens Becker war ein kleiner, lebendiger, sehr geschickter und beliebter Mann, und es tut mir noch heute leid, ihn einmal gröblich beleidigt zu haben. Es war in der Dämmerung und wir spielten mit der ganzen Dorfjugend auf der Wiese. Auf einmal hieß es: Stille, der Zepter kommt. Ich hatte gegen den seelenguten Ohm Becker, wie wir Kinder ihn im Pfarrhause nannten, nicht den mindesten Groll, und es war nur die Sucht, mich hervorzutun, vielleicht auch die schon damals in mir liegende Neigung zur Opposition, welche mich verführte, über den auf dem Hohlwege außerhalb des Spielplatzes still und von mir selbst ungesehen Vorübergehenden während des scheuen Stillschweigens der andern einige sehr ungezogene Worte zu sagen, wie sie sonst nur hinter dem Rücken des Lehrers unter den Schülern von Mund zu Mund zu gehen pflegen. Die Sache wurde zu Hause bekannt, ich wurde für einige Stunden eingesperrt, und das Härteste war, daß ich am andern Morgen zum Lehrer gehen und diesen um Verzeihung bitten mußte.
Der Unterricht des Lehrers Becker wurde sehr gerühmt, und auch ich erinnere mich noch wohl, wie anregend es war, wenn der kleine Mann auf ein Bänkchen stieg, um mit seinem Stäbchen die Landkarte zu erklären, oder wenn er eine Kugel in der Mitte der Schulstube aufhing, um die jährliche Wanderung der Sonne durch die rings an den Wänden befestigten zwölf Bilder des Tierkreises anschaulich zu machen.
Immerhin konnte ein Unterricht in Gemeinschaft mit soviel Kindern verschiedenen Alters auf die Dauer für unsere Zwecke nicht genügen, und da mein Vater selbst zum Lehren ebensowenig Neigung wie Geschick hatte, so entschloß er sich, für uns drei einen besonderen Hauslehrer zu halten, und indem er den Unterricht im Lateinischen sich selbst vorbehielt, konnte er sich mit einem seminaristisch gebildeten Elementarlehrer fürs erste begnügen. Die Wahl fiel auf Heinrich Hoffmann aus Offdillen in Nassau, welcher Herbst 1852 bei uns eintrat und fast zwei Jahre bis Herbst 1854 unsere Erziehung leitete. Er war ein offenherziger, harmloser junger Mann von nicht sonderlich feinen Manieren und hat sich unserer ganz treu angenommen, sowohl im Unterricht als außerhalb desselben. Er war noch nicht lange bei uns, da wurden wir in der Nacht des 9. Januar 1853 durch Feuerlärm geweckt. Es brannte bei der Hanne im Judenviertel, dessen zwei oder drei Häuser ganz nahe dem Pfarrhause und noch näher der Kirche sich an der Kirchhofsmauer hinzogen. Wir standen auf, kleideten uns an und jeder packte seine Habseligkeit an Büchern, Traktätchen und Spielsachen in einen Korb. Unsere Befürchtung, daß die umfliegenden Funken das Strohdach des Pfarrhauses oder das im Rohbau schon fertigstehende neue Haus entzünden möchten, erfüllte sich nicht. Wohl aber hieß es plötzlich zum allgemeinen Schrecken: Die Kirche brennt! In der Tat hatten umherfliegende brennende Massen das morsche Holz eines Dachfensters der Kirche angezündet. Die Gefahr war groß und niemand wußte zu helfen. Denn man mußte mit einem Eimer Wassers unter dem Dach der Kirche über das aus Balken und Flechtwerk hergestellte Gewölbe der Kirche sich im Dunkeln zum brennenden Dachfenster hintasten, und jeder befürchtete, dabei durchzubrechen und in die Kirche herunterzustürzen. Da entschloß sich der wackere Lehrer Becker, gestützt auf seine Lokalkenntnis, das Wagnis zu unternehmen. Es gelang ihm, die Kirche zu retten. Hierbei aber zog er sich in der kalten Winternacht eine Erkältung zu, welche in eine hitzige Krankheit ausartete, die in kurzer Zeit zu seinem Tode führte. Wir durften hin, den Leichnam zu sehen, es war der erste in meinem Leben. In seinem schönen neuen, von ihm selbst gebauten Hause lag er aufgebahrt in schwarzem Sarge, kalt und blaß, die Augen geschlossen, die weiße Zipfelmütze auf dem Kopfe. Wir durften zum Abschied seine Hand ergreifen; die fiel schwer und starr herab, sowie wir sie losließen. So etwas vergißt sich nicht, auch wenn in halbes Jahrhundert uns davon trennt. Der Tag des Begräbnisses war gekommen. Meine Brüder wollten in Tränen zerfließen. Ich aber sprach: »Nur nicht geweint! Der liebe Ohm Becker ist im Himmel. Da ist ihm viel wohler als hier.« Man hat mir dieses Verhalten und ähnliches im späteren Leben als Herzlosigkeit ausgelegt. Aber ich glaube, daß dabei eine Begriffsverwechslung vorliegt. Herzlos ist der, welcher sein Herz vor der Not des andern verschließt, und das habe ich nie getan. Ich habe stets für andere etwas übrig gehabt, wenn auch nicht soviel wie für mich selbst. Wohl aber ist mir von Natur an die Gabe zuteil geworden, fremdes wie eigenes Mißgeschick gelassen hinzunehmen, sobald ich dessen Unabwendbarkeit erkannte.
Als Ersatz für Lehrer Becker gewann Oberdreis einen andern nicht weniger trefflichen Mann, den Lehrer Alsdorf aus Wienau. Wir empfingen ihn eine halbe Stunde vor dem Dorfe mit Gesängen, die unser Herr Hoffmann uns mit den Schulkindern zusammen eingeübt hatte. Alsdorf blieb mit Hoffmann befreundet. Unserer Familie aber war und blieb er über dreißig Jahre lang ein lieber Freund und Helfer, der in allen Nöten herbeigerufen wurde, mochte es sich um das Erkennen einer Kinderkrankheit oder den Ankauf eines Pferdes oder das Stimmen des Klaviers handeln. Seine ersten Kinder starben alle in den ersten Lebensjahren, es war herzzerbrechend, ihn an den kleinen Gräbern weinen zu sehen. Später sind ihm vier prächtige Kinder herangeblüht, dem ältesten werden wir noch öfter begegnen.