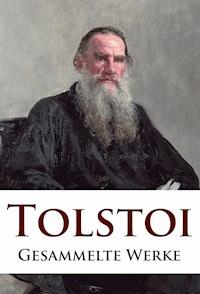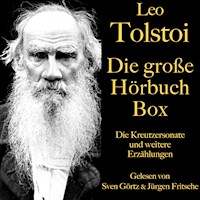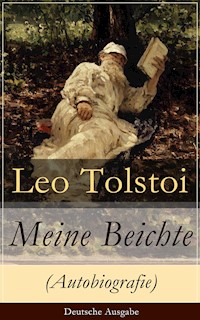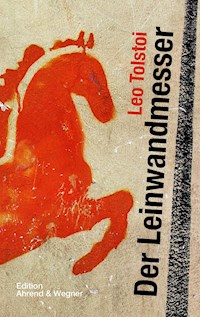Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 'Meine Beichte: Autobiografisches Werk Lew Tolstois' gewährt uns Leo Tolstoi einen tiefen Einblick in sein Leben und seine Gedanken. Das Buch ist eine persönliche Auseinandersetzung mit den eigenen Fehlern und dem Streben nach Wahrheit und spiritueller Erfüllung. Tolstois literarischer Stil ist unverkennbar ehrlich und introspektiv, voller tiefgreifender Gedanken und philosophischer Betrachtungen. Das Werk steht im Kontext von Tolstois späten Schriften, die von einem starken Sinn für Moral und Ethik geprägt sind. In 'Meine Beichte' reflektiert Tolstoi über seine eigenen Schwächen und die Suche nach dem wahren Sinn des Lebens. Leo Tolstoi, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, war bekannt für seine tiefgründigen Werke, die die menschliche Natur und Moral erforschten. Seine eigenen Erfahrungen und inneren Konflikte finden in diesem autobiografischen Werk einen Ausdruck, der den Leser zum Nachdenken anregt. 'Meine Beichte' ist ein Buch, das nicht nur Einblicke in Tolstois persönliche Gedankenwelt bietet, sondern auch eine inspirierende Lektüre für alle, die sich mit Fragen nach Wahrheit, Ethik und dem Sinn des Lebens beschäftigen möchten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Beichte: Autobiografisches Werk Lew Tolstois
Books
Inhaltsverzeichnis
1
Ich bin im orthodoxen christlichen Glauben getauft und erzogen worden. In diesem Glauben wurde ich von Kindheit an und während meiner Knaben- und Jünglingsjahre unterrichtet. Als ich aber mit achtzehn Jahren nach dem zweiten Kursus die Universität verließ, glaubte ich an nichts mehr von alle dem, was man mich gelehrt hatte.
Wenn ich nach manchen Erinnerungen urteilen darf, war ich auch nie ernsthaft gläubig gewesen, ich hatte nur Vertrauen zu dem gehabt, was man mich gelehrt hatte, und zu dem, was die Erwachsenen in meiner Gegenwart bekannten; dieses Vertrauen war aber sehr schwankend gewesen.
Ich erinnere mich, als ich elf Jahre alt war, kam ein Knabe, der nun längst gestorben ist, Wolodja M., ein Gymnasiast, eines Sonntags zu uns und erzählte uns als größte Neuigkeit eine Entdeckung, die am Gymnasium gemacht worden war. Die Entdeckung bestand darin, daß es keinen Gott gebe und daß alles, was man uns lehrt, nichts als leere Erfindung sei. (Das war im Jahre 1838.) Ich erinnere mich, wie meine älteren Brüder sich für die Neuigkeit interessierten und auch mich zur Beratung zuzogen, und wir alle, erinnere ich mich, gerieten in lebhafte Erregung und nahmen diese Mitteilung als etwas höchst Interessantes und durchaus Mögliches auf.
Ich erinnere mich ferner, daß wir alle, auch die Älteren, als mein älterer Bruder Dmitrij während seiner Universitätsstudien plötzlich mit der ihm eigenen Leidenschaftlichkeit sich dem Glauben hingab, jeden Gottesdienst besuchte, fastete und ein reines und sittliches Leben führte, ihn unaufhörlich verspotteten und ihm den Beinamen „Noah“ gaben. Ich erinnere mich, wie Mussin Puschkin, der damals Kurator der Universität von Kasánj war, uns zu einem Balle einlud und meinem Bruder, der absagte, in spöttischer Weise zuredete, da ja auch David vor der Bundeslade getanzt habe. Diese Späße der Älteren hatten damals meinen Beifall, und ich zog aus ihnen den Schluß, daß man den Katechismus lernen und in die Kirche gehen müsse, daß man das alles aber nicht allzu ernst zu nehmen brauche. Ich erinnere mich ferner, daß ich in sehr jungen Jahren Voltaire las und daß mich seine Spöttereien nicht nur nicht empörten, sondern sogar erheiterten.
Mein Abfall vom Glauben vollzog sich ganz so,3 wie er sich stets bei Leuten von unserer Bildungsschicht vollzogen hat und noch gegenwärtig vollzieht. Er vollzieht sich, wie ich glaube, in der Mehrzahl der Fälle so: man lebt, wie alle leben, und alle leben auf Grund von Prinzipien, die nicht nur nichts mit der Glaubenslehre gemein haben, sondern ihr meistens widersprechen; die Glaubenslehre hat keinen Anteil an unserem Leben; weder in unseren Beziehungen mit anderen Menschen stoßen wir auf sie, noch setzen wir uns selbst in unserem eigenen Leben mit ihr auseinander; zur Glaubenslehre bekennt man sich dort, irgendwo, fern vom Leben und unabhängig von ihm. Stößt man einmal auf sie, so geschieht es nur wie auf eine äußere, mit dem Leben nicht innerlich verbundene Erscheinung.
An dem Leben des Menschen, an seinen Handlungen kann man jetzt so wenig wie in früheren Zeiten erkennen, ob jemand gläubig ist oder nicht. Giebt es überhaupt einen Unterschied zwischen einem Menschen, der sich offen zum orthodoxen Glauben bekennt, und einem, der ihn leugnet, so ist er nicht zu gunsten des ersteren. Wie in vergangener Zeit, begegnet man auch jetzt der offenen Anerkennung und Bekennung des orthodoxen Glaubens meist bei stumpfen, grausamen Menschen, die sich selbst für höchst bedeutend halten. Verstand aber, Ehrenhaftigkeit, Ge-radheit, Herzensgüte und Sittlichkeit trifft man meist bei Menschen, die sich selbst für ungläubig erklären.
In den Schulen lehrt man den Katechismus und führt die Schüler in die Kirche; von den Beamten fordert man Zeugnisse über den Besuch des Abendmahls. Aber der Mensch unserer Gesellschaftsklasse, der nicht mehr Schüler ist und kein Amt im Staatsdienst inne hat, kann in der Gegenwart, und konnte mehr noch in der Vergangenheit, Jahrzehnte durchleben, ohne auch nur ein einzigesmal daran zu denken, daß er unter Christen lebt und sich selbst als Bekenner des christlichen orthodoxen Glaubens ansieht.
So schmilzt jetzt und schmolz ehedem der vertrauensvoll überkommene und durch äußeren Zwang aufrechterhaltene Glaube allmählich unter dem Einfluß der Wissenschaften und der Lebenserfahrungen, die mit der Glaubenslehre im Widerspruch stehen, und der Mensch lebt häufig in der Vorstellung, es sei in ihm die Glaubenslehre, die ihm in der Kindheit übermittelt worden, unversehrt, während er sie längst bis auf die letzte Spur verloren hat.
Mir hat einmal S., ein kluger und wahrhaftiger Mensch, erzählt, wie er aufgehört hat zu glauben. Er war schon sechsundzwanzig Jahre alt, als er einmal in einem Nachtquartier während einer Jagd nach alter Kindheitsgewohnheit abends zum Gebete niederkniete. Sein älterer Bruder5 der mit ihm auf der Jagd war, lag ausgestreckt auf dem Heu und sah ihm zu. Als S6. fertig war und sich niederlegen wollte, sagte sein Bruder zu ihm: „Du machst also immer noch die Sache?“
Weiter sprachen sie kein Wort miteinander. Und von diesem Tage an hörte S. auf zu beten und die Kirche zu besuchen. Und nun sind es dreißig Jahre her, daß er nicht betet, nicht das Abendmahl nimmt und nicht die Kirche besucht. Und nicht etwa, weil er die Überzeugung seines Bruders gekannt und sie sich zu eigen gemacht hatte, nicht etwa, weil er in seiner Seele zu einem bestimmten Entschluß gekommen war, sondern nur, weil das Wort, das der Bruder gesprochen, gleichsam wie ein Fingerstoß an eine Wand war, die durch die eigene Schwere zum Fallen geneigt war; das Wort war nur ein Hinweis darauf gewesen, daß dort, wo, nach seiner Meinung, der Glaube in ihm wohnte, schon längst ein leerer Raum gewesen war, und daß daher die Worte, die er flüstert, die Bekreuzigungen, die Kniebeugungen während des Gebets völlig sinnlose Handlungen seien.7 Er hatte ihre Sinnlosigkeit erkannt und konnte sie nun nicht mehr ausüben.
So ging es, und so geht es, denke ich, der ungeheuren Mehrzahl der Menschen. Ich spreche von Menschen unserer Bildung, von Menschen, die gegen sich selbst aufrichtig sind, und nicht von denen, die aus dem Glauben ein Mittel zur Erreichung irdischer Zwecke machen. (Diese Menschen sind die echten Ungläubigen, denn ist der Glaube für sie ein Mittel zur Erreichung irgendwelcher weltlicher Zwecke, so ist er doch sicherlich kein Glaube.) Diese Menschen unserer Bildung befinden sich in solcher Lage: Das Licht des Wissens und des Lebens hat das künstliche Gebäude schmelzen lassen; die einen haben das schon bemerkt und haben den Platz abgeräumt, andere haben es noch nicht bemerkt.
Die Glaubenslehre, die mir von Kindheit an überliefert war, entschwand mir ebenso wie anderen, nur mit dem Unterschiede, daß mir die Lossagung von der Glaubenslehre sehr früh zum Bewußtsein kam, weil ich mit fünfzehn Jahren philosophische Schriften zu lesen begann. Ich hörte mit sechzehn Jahren auf, zu beten, und hörte aus eigenem Antriebe auf, die Kirche zu besuchen und mich zum Abendmahl vorzubereiten. Ich glaubte nicht an das, was man mir von Kindheit an überliefert hatte, aber ich glaubte an ein Etwas. An was ich glaubte, hätte ich unmöglich in Worten sagen können. Ich glaubte auch an Gott, oder richtiger, ich leugnete Gott nicht; aber an was für einen Gott ich glaubte, hätte ich nicht sagen können; ich leugnete auch Christus und seine Lehre nicht, aber worin seine Lehre bestand, hätte ich auch nicht sagen können.
Wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, sehe ich klar, daß mein Glaube – das, was neben den animalischen Instinkten mein Leben bewegte – mein einziger wahrer Glaube zu jener Zeit, der Glaube an die Vervollkommnung war. Worin aber die Vervollkommnung bestand und was ihr Ziel war, hätte ich nicht sagen können. Ich bemühte mich, mich geistig zu vervollkommnen – ich lernte alles, was ich konnte und was mir das Leben zuführte; ich bemühte mich, meinen Willen zu vervollkommnen; ich stellte mir Lebensregeln zusammen und bemühte mich, sie zu befolgen; ich vervollkommnete mich körperlich durch allerlei Übungen, indem ich meine Kraft und meine Geschicklichkeit förderte, und mich durch allerlei Entbehrungen zu der Fähigkeit des Ertragens und des Duldens erzog. Und all dies betrachtete ich als Vervollkommnung. Die Grundlage bildete selbstverständlich die sittliche Vervollkommnung. An ihre Stelle trat aber bald die Vervollkommnung im allgemeinen, d. h. der Wunsch, nicht vor mir selber oder vor Gott, sondern der Wunsch, vor anderen Menschen besser zu sein. Und sehr bald trat an die Stelle dieses Strebens, vor den Menschen besser zu sein, der Wunsch, stärker zu sein, als die anderen Menschen, d. h. berühmter, bedeutender, reicher zu sein, als die anderen.
2
Ich gedenke einmal die Geschichte meines Lebens zu erzählen, die in diesen zehn Jahren meiner Jugend rührend und lehrreich zugleich ist. Ich glaube, viele, sehr viele haben ganz dasselbe erlebt. Ich hatte in tiefster Seele den Wunsch gut zu sein, aber ich war jung, ich besaß Leidenschaften, und ich stand allein, ganz allein, als ich das Gute suchte. Immer, wenn ich versuchte, in Worten das auszudrücken, was meinen sehnlichsten Wunsch bildete, daß ich nämlich ein sittlich-guter Mensch sein wollte, begegnete ich der Verachtung und der Verspottung; und so oft ich mich häßlichen Leidenschaften ergab, wurde ich gelobt und angeeifert.
Ehrgeiz, Herrschsucht, Eigennutz, Wollust, Stolz, Zorn, Rachsucht, all das stand in Ansehen. Ergab ich mich diesen Leidenschaften, so wurde ich den Erwachsenen ähnlich und fühlte, daß man mit mir zufrieden war. Meine gute Tante, bei der ich wohnte, das reinste Geschöpf, pflegte mir immer zu sagen, sie wünschte für mich nichts so sehr, als ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau: „Rien ne forme un jeune homme, comme une liaison avec une femme comme il faut“; auch noch ein zweites Glück wünschte sie für mich, daß ich nämlich Adjutant würde, und am liebsten beim Kaiser; und das allerhöchste Glück – daß ich ein sehr reiches Mädchen heiratete, und daß ich infolge dieser Heirat möglichst viel Leibeigene hätte.
Ich kann nicht ohne Entsetzen, ohne Abscheu, ohne tiefen Schmerz im Herzen an diese Jahre zurückdenken. Ich habe im Kriege Menschen getötet, ich habe zum Zweikampf gefordert, um zu töten; ich habe Geld im Kartenspiel vergeudet, habe die Arbeit der Bauern verschlemmt, ich habe sie gezüchtigt, habe ein ausschweifendes Leben geführt, habe betrogen. Lüge, Diebstahl, Wollust jeder Art, Völlerei, Vergewaltigung, Totschlag … kein Verbrechen, das ich nicht begangen hätte. Und für all dies lobten mich meine Genossen, hielten sie mich und halten sie mich für einen verhältnismäßig sittlichen Menschen.
So habe ich zehn Jahre gelebt.
Um diese Zeit begann ich meine schriftstellerische Thätigkeit – aus Eitelkeit, Eigennutz und Stolz. In meinen Schriften that ich, was ich in meinem Leben that. Um Ruhm und Geld zu haben, um derentwillen ich schrieb, mußte das Gute unterdrückt, das Häßliche ausgesprochen werden. Und so that ich denn auch. Wie oft suchte ich künstlich in meinen Schriften unter dem Scheine der Gleichgültigkeit, ja des leichten Spottes, jenes Hinstreben zum Guten zu verschleiern, das den Sinn meines Lebens bildete. Und was erreichte ich damit? Daß man mich lobte.
Mit sechsundzwanzig Jahren kam ich nach dem Kriege nach Petersburg und wurde mit Schriftstellern bekannt. Man nahm mich als ebenbürtigen Genossen auf und schmeichelte mir. Und ich hatte noch nicht Zeit gehabt, mich umzusehen, als ich die zünftigen Lebensanschauungen dieser Menschen, mit denen ich verkehrte, mir zu eigen gemacht hatte, die alle meine früheren Versuche der Veredelung vollends vernichteten. Diese Anschauungen boten meinem ausschweifenden Leben die Stütze einer Theorie, die es rechtfertigte.
Die Lebensanschauung dieser Menschen, meiner Kameraden im Schriftstellerberuf, bestand darin, daß das Leben im allgemeinen sich fortschreitend entwickele, daß an dieser Entwickelung wir, die Männer der Gedankenarbeit, den größten Anteil hätten, und unter den Männern der Gedankenarbeit den größten Einfluß wir – die Künstler, die Poeten. Unser Beruf sei es, die Menschen zu belehren. Damit sich uns aber nicht die natürliche Frage aufdrängte: Was weiß ich, und was kann ich also lehren? legte diese Theorie dar, daß man dies nicht zu wissen brauche, und daß der Künstler und der Poet unbewußt lehre. Ich hielt mich für einen wunderbaren Künstler und Poeten, und darum war es für mich selbstverständlich, daß ich mir diese Theorie aneignete. Ich, der Künstler, der Poet, schrieb und lehrte, ohne zu wissen was. Ich erhielt dafür Geld, ich hatte vortreffliches Essen, eine schöne Wohnung, Weiber, Verkehr; ich war berühmt. So mußte also das, was ich lehrte, sehr gut sein.
Dieser Glaube an die Bedeutung der Poesie und an die Fortentwickelung des Lebens war ein Glaube, und ich war einer seiner Priester. Es war höchst vorteilhaft und angenehm, sein Priester zu sein. Und so lebte ich recht lange in diesem Glauben, ohne je an seiner Wahrhaftigkeit zu zweifeln. Im zweiten, besonders aber im dritten Jahre dieses Lebens fing ich an, an der Unfehlbarkeit dieses Glaubens zu zweifeln, und begann ihn zu erforschen. Die erste Anregung zum Zweifel war die Wahrnehmung, daß die Priester dieses Glaubens untereinander nicht alle einig waren. Die einen sagten: Wir sind die besten und nützlichsten Lehrer, wir lehren, wie man muß, und die anderen lehren falsch. Die anderen sagten: Nein, wir sind die echten, und ihr lehret falsch. Und sie stritten, zankten, schimpften, betrogen und verspotteten einer den anderen. Zudem waren unter uns viele, die sich gar keine Sorge darum machten, wer Recht hatte, wer nicht, die mit dieser unserer Thätigkeit einfach ihre eigennützigen Zwecke verfolgten. All dies regte zum Zweifel an der Wahrhaftigkeit unseres Glaubens an.
Nachdem ich an der Wahrhaftigkeit dieses Schriftsteller-Glaubens selbst zu zweifeln begonnen, fing ich überdies an, aufmerksamer seine Priester zu beobachten und überzeugte mich, daß fast alle Priester dieses Glaubens, die Schriftsteller, unsittliche und zum größten Teil schlechte, charakterlose Menschen waren, daß sie weit tiefer standen, als die Menschen, denen ich in meinem früheren lockeren Leben und in meinen Soldatenjahren begegnet war, daß sie selbstbewußt und selbstgerecht waren, wie es nur ganz Heilige sein können oder solche Menschen, die gar nicht wissen, was Heiligkeit ist. Ich empfand Abscheu vor diesen Menschen und Abscheu vor mir selber, und ich begriff, daß dieser Glaube eine Täuschung war.
Und doch, seltsam! obgleich ich diese ganze Lüge früh erkannte und mich von ihr lossagte, sagte ich mich doch von dem Range, den mir diese Menschen verliehen hatten – dem Range eines Künstlers, eines Poeten, eines Lehrers – nicht los. Ich hatte die naive Vorstellung, ich sei ein Poet, ein Künstler, und könne alle belehren, ohne selbst zu wissen, was ich lehre. Und so handelte ich auch.
Aus dem Verkehr mit diesen Menschen nahm ich ein neues Laster an – einen bis zur Krankhaftigkeit gesteigerten Dünkel und die wahnwitzige Überzeugung, ich sei berufen, die Menschen zu lehren, ohne selbst zu wissen, was.
Wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, an meine Gemütsverfassung in jenen Tagen und an die Gemütsverfassung jener Menschen (auch jetzt giebt es solche übrigens zu Tausenden), so ist mir weh, schrecklich und lächerlich zu Mute – überkommt mich ein Gefühl, wie man es in einem Irrenhause empfindet.
Wir alle waren damals überzeugt, wir müßten immer nur so schnell als möglich, so viel als möglich reden, schreiben, drucken, und all dies sei für das Wohl der Menschheit notwendig. Und Tausende von uns druckten, schrieben, belehrten andere, obwohl sie sich gegenseitig widersprachen und beschimpften. Wir beachteten nicht, daß wir nichts wußten, daß wir die einfachste Frage des Lebens: was ist gut, was schlecht? nicht zu beantworten verstanden, und redeten alle auf einmal, ohne daß der eine dem anderen zuhörte. Bald stimmte einer dem anderen zu, lobte einer den anderen, damit auch ihm zugestimmt werde und auch er gelobt werde, bald wieder reizte einer den anderen – ganz wie in einem Irrenhaus.
Tausende von Arbeitern arbeiteten Tag und Nacht mit Erschöpfung ihrer Kräfte, setzten und druckten Millionen Wörter, und die Post verbreitete sie über ganz Rußland, wir aber lehrten immer mehr und mehr, und es wollte uns nimmer gelingen, alles zu lehren. Wir hörten nicht auf, uns zu ärgern, daß man uns zu wenig Gehör schenkte.