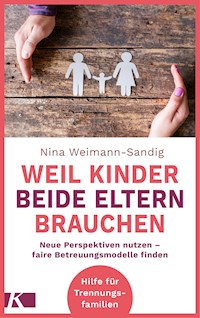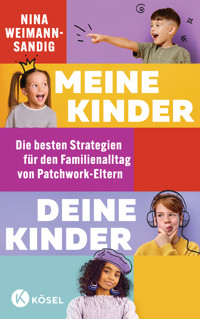
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Was man bei Patchwork alles richtig machen kann!
Willkommen in der Patchwork-Familie – dem turbulenten Leben mit Kindern, die nicht die eigenen sind! Das bedeutet, Rollen zu erfüllen, auf die einen niemand vorbereitet hat, viel Zeit und Zuwendung in Beziehungen zu investieren und Antworten auf Fragen zu finden, die sich biologische Eltern nie stellen würden. Was es aber nicht bedeutet: Dass man damit allein ist. 13 Prozent der deutschen Familien sind Bonusfamilien, auch die von Familiensoziologin Nina Weimann-Sandig. Die erfahrene Patchwork-Mutter und Autorin hilft allen, die im gleichen Boot sitzen, fundiert und sachlich ihre eigene Haltung zu reflektieren, Wünsche und Erwartungen realistisch einzuschätzen sowie Lösungen für die häufigsten Probleme im Familienalltag zu finden. Ihr Ratgeber stärkt allen Patchwork-Eltern den Rücken, damit sie ein harmonisches und stabiles neues Familiennetz knüpfen können!
»Nina Weimann-Sandig schafft es auf erfrischend ehrliche, klare und einfühlsame Weise, das Wirrwarr, das Patchwork-Familien manchmal darstellen können, zu entknoten. Eine große Bereicherung für alle, die in dieser einzigartig schönen Konstellation leben!«
Simone Riegler (@simi.mit.kindern)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
WASMANBEIPATCHWORKALLESRICHTIGMACHENKANN!
Der Alltag von Patchwork-Eltern ist herausfordernd: viele unterschiedliche Bedürfnisse, ein hoher Abstimmungsaufwand, dabei der Wunsch nach einer harmonischen und liebevollen Atmosphäre und nicht selten Zweifel, wie all das im neuen Familien-Mix gelingen kann.
Mit diesem Ratgeber gibt die erfahrene Patchwork-Mutter und Familiensoziologin Nina Weimann-Sandig allen Bonus-Eltern einen realistischen Leitfaden an die Hand. Mit konkreten Handlungsempfehlungen bietet sie wertvolle Unterstützung, um das Zusammenwachsen der verschiedenen Familienteile erfolgreich zu begleiten. Ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die in ihrer Rolle als Patchwork-Eltern sicherer werden möchten!
Praxisnahe Tipps: So gelingt mehr Patchwork-HarmonieExpertenwissen: Rechtliche und finanzielle Aspekte verständlich erklärtWertvolle Erfahrungen: Ehrliche Einblicke und bewährte Lösungen für den AlltagPROF. DR. NINAWEIMANN-SANDIGlehrt als Professorin Soziologie und Empirische Sozialforschung an der Evangelischen Hochschule Dresden. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Familiensoziologie in Deutschland und anderen Ländern. Dabei hat sie die Situation der unterschiedlichen Familienmodelle nicht nur theoretisch erforscht, sondern auch selbst erfahren: Sie lebt seit einigen Jahren in einer Patchwork-Konstellation mit zwei leiblichen und zwei Bonus-Kindern.
Ebenfalls von der Autorin erhältlich: »Weil Kinder beide Eltern brauchen«
Nina Weimann-Sandig
Die besten Strategien für den Familienalltag von Patchwork-Eltern
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright © 2024 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Diane Zilliges
Umschlag: FAVORITBUERO, München
Umschlagmotive: Shutterstock.com (Roman Samborskyi; UfaBizPhoto; ViDI Studio; Studio Romantic; puruan; Dadan Andriyana)
Innenteilmotive: ONYXprj/stock.adobe.com
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN978-3-641-31377-7V001
www.koesel.de
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Was dieses Buch ist – und was es nicht ist
Zum Auftakt: Was sagen Stiefelternteile über ihre aktuelle familiäre Situation?
Teil 1: Rahmenbedingungen
Patchworkfamilien sind besonders – warum?
»Stiefeltern sein ist nicht Fisch, nicht Fleisch.«:Die rechtliche Stellung von Stiefeltern in Deutschland
Finanzielle Aspekte: Wie kann eine gerechte Verteilung der finanziellen Verantwortung in der Patchworkfamilie aussehen?
Böse, böser, Stiefmutter?!: Aufräumen mit Mythen
Der Unterschied, ob man selbst Kinder in die Beziehung mitbringt oder nicht
Teil 2: Hilfe, wir werden Patchworkfamilie!Erste Schritte im neuen Familienmodell
Wie sag ich’s meinen Kindern?:Tipps für eine kindgerechte Kommunikation
Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt
Erklären Sie die neue Familienstruktur
Gemeinsam die Wohnung planen
Wie sag ich’s den Großeltern (und anderen Familienmitgliedern)?
Gemeinsam oder doch getrennt?: Das beste Wohnarrangement finden
Die Flicken werden zusammengesetzt: Die Phasen des Patchworkfamilienlebens
Die Findungsphase: »Wie nenne ich dich jetzt am besten?«
Die Orientierungsphase: Meins, deins, unseres
Die Verstetigungsphase: Das Netz ist gewebt, jetzt folgt die Belastungsprobe
Teil 3: Die Patchworkfamilie gestaltenHerausforderungen meistern
»Bei Papa gibt’s die Gans aber immer am ersten Feiertag!«: Harmonisierung von Familientraditionen in der Patchworkfamilie
»Die Bezeichnung Stiefvater oder Stiefmutter muss man sich schon verdienen.«: Beziehungsqualität und die Rolle der Stiefelternteile
»Meine Kinder, deine Kinder.«: Strategien für eine starke vertrauens-volle Beziehung zwischen allen Familienmitgliedern
»Muss ich meine Stiefkinder lieben?«: Zum Umgang mit Ambivalenz in der Stiefeltern-Stiefkind-Beziehung
»Mein Stiefkind mag mich nicht und sagt das auch immer wieder – was kann ich tun?«
Häufige Stolpersteine in einer Patchworkfamilie:Konkurrenzdenken und Eifersucht
»Aber du bist nur meine Mama!«: Umgang mit der Dynamik zwischen Stiefgeschwistern und leiblichen Geschwistern
»Wenn ich das gewusst hätte, dann …«: Patchwork braucht Gelassenheit
Gleichwürdige Kommunikation: Der Schlüssel einer gelingenden Elternschaft in der Patchworkfamilie
Entwicklung der emotionalen Intelligenz: Ein Leitprinzip der Partnerschaft in Patchworkfamilien
Leibliche Eltern und Stiefeltern: Der emotionale Rucksack unserer Kinder
Kooperative Erziehung in der Patchworkfamilie: Geht das?
Zum guten Ende: Wie kann das Modell Patchworkfamilie unterstützt werden?
Anmerkungen
Vorwort
An einem schönen Sommertag im Juni sitzen meine Freundin Inge und ich auf der Terrasse. »Wie läuft es momentan bei euch als Patchworkfamilie?«, will Inge wissen – wie so oft in den mittlerweile fast neun Jahren seit unserer Patchworkfamiliengründung. »Ganz gut«, erwidere ich, ohne nachzudenken. »Ich akzeptiere die Dinge, die ich nicht ändern kann, zumindest versuche ich es. Ich habe meine Rolle für mich gefunden. Ich bin nicht die Mutter meiner Stiefkinder, denn die haben sie ja. Ich bin nicht die Freundin meiner Stiefkinder, denn das ist mir zu unverbindlich. Ich bin ihre Stiefmutter!«
Inge schaut mich nachdenklich an. »Du weißt, dass die Stiefmutter im Märchen die Böse ist und nicht gerade den besten Ruf hat? Willst du dich wirklich mit diesem Titel schmücken? Du bist doch gar nicht so gemein.« Sie sieht mich verschmitzt an und lacht dann laut los. Ich lache mit ihr. Nein, die böse Stiefmutter aus dem Märchen möchte ich natürlich nicht sein.
Als Inge an diesem Abend den Heimweg antritt, bleibe ich nachdenklich auf der Terrasse sitzen und erinnere mich zurück: Wann bin ich an dem Punkt angelangt, dass ich ohne Probleme den Begriff Stiefmutter nutzen kann, und wie? Was hat mir geholfen, meine persönliche Art zu finden, unsere Patchworkfamilie und die Beziehung zu meinen Stiefkindern zu gestalten? Was kann und will ich meinen Stiefkindern bis heute mitgeben? Woran bin ich gescheitert?
Gerade in den vergangenen Jahren hat das Thema Stieffamilien oder Patchworkfamilien durch viele Familienblogs, aber auch durch den zahlenmäßigen Anstieg dieser Familienform in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Meine Analyse der Berichterstattung und der Blogs zeigt deutlich, wie unsicher sich Stiefelternteile in ihren neuen Rollen fühlen, wie sehr sie aber auch dafür kämpfen, dieses besondere Familienmodell sichtbarer zu machen, mit seinen Sonnen- wie auch Schattenseiten. Denn tatsächlich ist das Projekt Patchworkfamilie nicht immer ein Erfolgsprojekt. Im Gegenteil: Es ist mit vielen Stolpersteinen verknüpft, es braucht Zeit, viel Engagement, und dennoch gibt es keinerlei Garantie für ein Gelingen. Diese Ehrlichkeit in der Betrachtung von Patchworkfamilien fehlt aus meiner Sicht bisher und wird den vielen Herausforderungen, denen Patchworkfamilien, vor allem aber Stiefelternteile begegnen, nicht gerecht. Insofern möchte ich mit diesem Buch insbesondere diese Perspektive beleuchten. Meine Vorgehensweise ist dabei vielleicht etwas anders als bei anderen: Als Wissenschaftlerin und Schriftstellerin braucht es für mich den analytischen Blick. Als Stiefmutter kann ich zudem mein Bauchgefühl zusteuern. Zum Beispiel das Unbehagen, das auch ich oft heute noch im Umgang mit meinen Stiefkindern verspüre, weil ich Angst davor habe, alles falsch zu machen. Die Verletzlichkeit und Niedergeschlagenheit, die ich auch nach vielen Jahren ab und an fühle, weil manche Probleme einfach unlösbar scheinen.
Da ich im Laufe meiner Analysen festgestellt habe, dass es unterschiedliche Anspruchshaltungen und Bewältigungsmechanismen von leiblichen Elternteilen und Stiefelternteilen in der Patchworkkonstellation gibt, und da ich beides bin, versuche ich, beide Perspektiven im Buch aufzugreifen. Allerdings fehlt es Stiefmüttern und Stiefvätern meiner Meinung nach in Deutschland ganz entscheidend an Unterstützung, was eigentlich nicht fair ist. Denn die meisten Stiefelternteile eint eine große Gemeinsamkeit: das Bedürfnis, im Leben der Stiefkinder präsent zu sein und eine möglichst gute Familienzeit miteinander zu gestalten. Dementsprechend gibt es in diesem Buch Kapitel, die bewusst generell für Stiefelternteile verfasst wurden, und zudem Elemente, die individuelle Perspektiven von Stiefmüttern gezielt in den Blick nehmen, denn das liegt mir natürlich sehr nahe.
Letztlich ist dieses Buch aber auch ein Leitfaden für leibliche Elternteile. Diese wissen oftmals gar nicht, mit welchen Herausforderungen die Stiefelternteile konfrontiert sind, und wollen die Probleme manchmal auch nicht wahrhaben. Vielleicht, weil es schmerzhaft ist, zu akzeptieren, dass das eigene Kind, das einem selbst so viel Liebe entgegenbringt, durchaus gemein und ablehnend gegenüber dem Stiefelternteil sein kann. Aber gerade leibliche Elternteile müssen sich eines bewusst machen: Stiefelternteile haben keine große Lobby. Viele Probleme müssen sie mit sich selbst ausmachen. Es ist also unbedingt notwendig, dass Patchworkfamilien eine Stimme verliehen wird und wir unsere Augen nicht davor verschließen, welche Probleme Stiefmamas und -papas meistern müssen. Aber auch welche große Bereicherung die Patchworkkonstellation für alle Beteiligten und speziell für die Kinder in ihrem Aufwachsen sein kann.
Nina Weimann-Sandig, im Oktober 2024
Einleitung
Was dieses Buch ist – und was es nicht ist
Wenngleich Patchworkfamilien oftmals entstehen, weil Eltern sich trennen und dann neue Partner:innen finden, steht die Trennungsbewältigung in diesem Buch nicht im Fokus. Wer hierzu Rat sucht, muss dennoch nicht ratlos bleiben. In meinem ersten Buch Weil Kinder beide Eltern brauchen beschäftige ich mich ausführlich mit Trennungserfahrungen aus der Perspektive der Eltern und der Kinder. Ebenso gebe ich dort Informationen zu den unterschiedlichen Trennungsmodellen und versuche, deutlich zu machen, wie wichtig eine gemeinsame Elternschaft auch nach der Trennung ist. Dieses Buch, mein zweites, beginnt nun mit dem Zeitpunkt, an dem sich Menschen, die bereits aus früheren Beziehungen Kinder haben, entschieden haben, miteinander zu leben und dementsprechend eine neue Familie zu gründen. Eine Patchworkfamilie. Dies ist eine ganz besondere Herausforderung. Auf der einen Seite stehen die Verliebtheit und das Gefühl, als Paar so oft wie möglich zusammen sein zu können, den Alltag gemeinsam zu gestalten und eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Auf der anderen Seite steht die Verantwortung für Kinder aus einer früheren Beziehung, die vielleicht noch unter der Trennung leiden und eigentlich keinen zusätzlichen Vater, keine zusätzliche Mutter in ihrem Leben haben wollen. Der gemeinsamen Zukunft steht also immer auch eine Vergangenheit gegenüber, die man als Elternteil oft regelrecht auslöschen möchte, die aber für die Kinder wichtig ist.
Patchworkfamilien entstehen häufig aus komplexen Lebenssituationen, in denen fast immer Trennungen eine Rolle spielen. Es ist jedoch wichtig, über diese Trennungen hinauszublicken und das Positive zu sehen. Ein Buch über Patchworkfamilien sollte daher aus meiner Sicht die Chancen und Möglichkeiten, die diese Familienkonstellation bietet, in den Vordergrund stellen. Dementsprechend geht es in diesem Buch darum, wie die neue Familie in den Mittelpunkt gerückt werden kann. Es geht darum, wie neue Bindungen geknüpft werden können, wie Vertrauen aufgebaut und ein liebevolles und harmonisches Umfeld für alle Familienmitglieder geschaffen werden kann. Dabei sollen die Schattenseiten der Patchworkfamilie nicht ausgeblendet werden. Gerade weil ich selbst seit über neun Jahren erlebe, wie sehr man als Patchworkmutter gefordert ist und welche unterschiedlichen Gefühle das in mir auslöst, möchte ich in diesem Buch nichts beschönigen. Es ist notwendig, dass wir Patchworkeltern offen und ehrlich über unsere komplexen und oft überfordernden Gefühle und Erfahrungen sprechen. Dieses Buch soll praktische Ratschläge, erprobte Strategien und inspirierende Geschichten aus meinem turbulenten Patchworkfamilienleben enthalten, die Ihnen helfen, Ihre eigene Patchworkfamilie zu stärken und zu bereichern. Am Ende dieses Buches werden Sie hoffentlich erkennen können, dass Patchworkfamilien eine einzigartige Dynamik haben. Indem wir uns auf den Aufbau einer starken, liebevollen und unterstützenden Familie konzentrieren, können wir gemeinsam eine solide Grundlage schaffen, um die Herausforderungen zu meistern, die auf diesem Weg auftreten können. Letztendlich wollte ich gern das Buch schreiben, von dem ich gewünscht hätte, es wäre schon auf dem Markt gewesen, als ich meine Patchworkfamilie gegründet habe. Über 20 Kapitel sind nun entstanden – das verdeutlicht noch einmal die Vielzahl und Komplexität der Themen und Herausforderungen, mit denen Patchworkfamilien und insbesondere Stiefelternteile konfrontiert sind.
Im ersten Teil dieses Buches werden wir einen Blick auf die Rahmenbedingungen für Patchworkfamilien werfen. Wie steht es denn um Rechte und Pflichten von Stiefelternteilen? Welche finanziellen Aspekte müssen bei einer Patchworkfamiliengründung bedacht werden? Ist es gut, wenn man sofort als Patchworkfamilie zusammenzieht, oder gibt es auch alternative Wohnformen? Aber auch mit dem Mythos der bösen Stiefmutter werden wir uns beschäftigen, indem wir uns fragen, woher dieses grauenvolle Bild kommt und ob es denn mehr Fiktion als Tatsache ist.
Der zweite Teil des Buches konzentriert sich auf die ersten Schritte im neuen Patchworkfamilienmodell. So ist die Kommunikation über die Entscheidung, Patchworkfamilie zu werden, ein heikles Thema. Wie sage ich meinen Kindern, dass wir zukünftig nicht mehr allein leben werden, sondern sie auch Stiefgeschwister haben werden? Was werden Großeltern und Freundeskreis sagen, wie werden sie reagieren? Welche Wohnarrangements eignen sich für Patchworkfamilien, und wie kann es gelingen, dass sich alle wohl und eingebunden fühlen? Ebenso blicken wir in diesem Teil auf die einzelnen Phasen des Patchworkfamilienlebens, ihre Eigenheiten und spezifischen Herausforderungen.
Der dritte Teil des Buches ist den konkreten Herausforderungen des bunten Patchworkfamilienalltags gewidmet. Hier geht es um Beziehungsqualität und ganz besonders auch um die Frage nach Liebe, die nach wie vor ein Tabuthema in der Beschäftigung mit Stieffamilien ist: Kann oder muss ich als Stiefelternteil meine Stiefkinder lieben, damit die ganze Sache klappt? Auch eine Partnerschaft im Patchworkfamilienkontext ist vor einzigartige Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam näher betrachten werden. Nicht zuletzt ist es wichtig, die Beziehung zu den getrennt lebenden Elternteilen im Blick zu behalten, damit ein Patchworkfamilienmodell gut funktionieren kann.
Wie schon in meinem ersten Buch ist es mir auch hier ein Anliegen, zusätzlich die Perspektive der Kinder herauszuarbeiten und zu hinterfragen, was das Aufwachsen mit Stiefelternteilen in einer Patchworkfamilie für sie bedeutet. Auch hier spreche ich bewusst Tabuthemen an, etwa wie man damit umgehen kann, wenn man vom Stiefkind rigoros abgelehnt wird.
Zum Auftakt
Was sagen Stiefelternteile über ihre aktuelle familiäre Situation?
Um nicht Gefahr zu laufen, in diesem Buch ausschließlich meine subjektive und gefilterte Wahrnehmung darzulegen, bin ich in dieses Projekt mit einer kleinen Stiefelternbefragung eingestiegen. Ich habe versucht, sie möglichst unkompliziert zu halten. Ein Online-Fragebogen zu aktuellen Fragestellungen rund um das Thema Stiefelterndasein und Patchworkfamilie wurde über einige Stiefelternblogs geteilt mit der Bitte, sich an dieser kurzen und anonymen Befragung zu beteiligen. Selbstverständlich erhebt eine solche unkomplizierte Vorgehensweise keinen Anspruch auf Repräsentativität, die getroffenen Aussagen können keinesfalls auf alle Stiefelternteile in Deutschland verallgemeinert werden. Darum ging es mir aber auch gar nicht. Ich wollte wissen, wie Stiefelternteile ihre Rolle in der Patchworkfamilie definieren und wie sie die Beziehung zu ihrem Stiefkind bzw. zu ihren Stiefkindern beschreiben, um entsprechend differenzierte Empfehlungen in diesem Buch machen zu können. 30 verwertbare Fragebögen kamen bei dieser kleinen Befragung zusammen, mehrheitlich von Stiefmüttern ausgefüllt. Dies kann zum einen daran liegen, dass sich mehr Stiefmütter als Stiefväter durch die ausgewählten Blogs angesprochen fühlen, auf denen die Befragung gepostet wurde. Zum anderen gibt es aber einen natürlichen Befragungseffekt in der Sozialforschung: Generell nehmen Frauen häufiger an Befragungen teil als Männer.
Wie wichtig es ist, dass sich Ratgeber gezielt mit dem Thema Stiefelterndasein und Patchworkfamilie auseinandersetzen, zeigen beispielsweise die Ergebnisse meiner kleinen Umfrage zum Spannungsfeld zwischen leiblicher Elternschaft und Stiefelternschaft. Sehr selbstkritisch gibt hier die überwiegende Mehrheit der Befragten an, doch immer wieder einen Unterschied hinsichtlich der Zuwendung und Aufmerksamkeit, die den leiblichen Kindern bzw. den Stiefkindern zuteilwerden, zu machen – zulasten der Stiefkinder. Dies liegt einerseits daran, dass die Beziehungsintensität, also die Zeit, die man mit den leiblichen Kindern verbringt, von einem Großteil der befragten Stiefelternteile als höher eingeschätzt wird, zum anderen aber auch an oftmals ungeklärten Rollenerwartungen und Rollenbildern.
Bei der Frage, wie Stiefelternteile von ihrem Stiefkind bzw. ihren Stiefkindern gesehen werden, dominierten zwar die Angaben »als Elternteil/Ersatzelternteil«, »Vertraute:r oder Begleiter:in«, allerdings wurde auch die Rolle des Konkurrenten/der Konkurrentin bzw. des Eindringlings oft genannt. Einige Stiefelternteile gaben auch an, überhaupt keine Vorstellung darüber zu haben, wie sie von ihrem Stiefkind bzw. ihren Stiefkindern gesehen werden. Interessanterweise besteht ein Zusammenhang zwischen der Rolle, in der man sich aus der Perspektive des Stiefkindes sieht, und der Beziehungsintensität. Diejenigen Elternteile, die in der Befragung angaben, sich in einer begleitenden und freundschaftlichen Rolle zu ihrem Stiefkind zu befinden, gaben auch an, kaum oder gar keine Unterschiede hinsichtlich der Zuwendung und Aufmerksamkeit zwischen leiblichem Kind und Stiefkind zu machen. Umgekehrt haben diejenigen Stiefelternteile, die sich als Eindringling oder Konkurrent:in fühlen, sehr viel größere Probleme, eine Beziehungsqualität zu ihren Stiefkindern zu etablieren.
Dass ein Patchworkfamiliendasein gerade auch für die Partnerschaft oftmals eine sehr große Belastungs- und Bewährungsprobe darstellt, verdeutlichen die Ergebnisse zu den Konfliktanfälligkeiten und Streitthemen mit dem Partner bzw. der Partnerin. Der Streit über Stiefelternthemen wie Kontaktgestaltung zu ehemaligen Partner:innen nach der Trennung, unterschiedliche Erziehungsstile der jeweiligen Familien des Kindes oder der jetzigen Partner:innen, aber auch finanzielle Aspekte dominieren hier deutlich.
In der nachfolgenden Grafik habe ich besonders hervorstechende Themen anhand sogenannter Mittelwerte grafisch dargestellt, die Zahlen auf der Achse entsprechen der Antwortskala von »nie« (0) bis »sehr häufig« (3):
Quelle: Eigene Darstellung.
Die fünf häufigsten Streitthemen sind hier abgebildet. Auf Platz eins ist klar der Streit hinsichtlich des Verhaltens und Auftretens des Stiefkindes, gefolgt von klassischen Erziehungs-, aber auch Ernährungsfragen. Auch das Thema Schule und Ausbildung sorgt für Uneinigkeit in der Patchworkfamilie, gerade weil Stiefelternteile hier oft das Gefühl haben, ihre Perspektiven zu wenig einbringen zu können. Freizeitgestaltung, aber auch die Auswahl von Freund:innen sowie die Kontaktgestaltung zum anderen leiblichen Elternteil bergen ebenfalls, wenn auch abgeschwächt, Konfliktpotenzial. Diese Palette an Streitigkeiten ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass sich moderne Stiefelternteile heute in hohem Maße in ihre neue Patchworkfamilienstruktur einbringen und sehr viele Aufgaben übernehmen, die vorher allein von den leiblichen Elternteilen ausgeführt wurden. Die gemeinsame familiäre Sorgearbeit hat in heutigen Patchworkfamilien einen hohen Stellenwert, das hat mir die Abfrage von Aufgaben, die von den Stiefelternteilen übernommen werden, deutlich vor Augen geführt.
Auf die Frage »Wie würden Sie Ihr Selbstverständnis als Stiefelternteil mit Blick auf folgende Alltagsaufgaben beschreiben?«, antwortete die große Mehrheit der Teilnehmenden, dass man die Stiefkinder unterstützen wolle, soweit es die eigenen und die rechtlichen Möglichkeiten zuließen. Die Alltagsstruktur ist demnach angepasst an das Alter und die Bedürfnisse der leiblichen Kinder wie auch der Stiefkinder. Fahrten zum Arzt, Besuche von Therapiemaßnahmen, Freizeitgestaltung und das Fahren zu Freund:innen oder Sportaktivitäten stehen ebenso auf dem Plan der Stiefelternteile wie die Teilnahme an Infoveranstaltungen von Schulen oder Betreuungseinrichtungen. Dies zeigt, welche Mühe sich Stiefelternteile heute geben, ihr Familienmodell am Laufen zu halten und ihr persönliches Familienglück zu realisieren.
Dennoch macht bereits diese kleine Befragung das Spannungsfeld deutlich, in dem sich Stiefelternteile heute bewegen. Ihren eigenen Ansprüchen und Erwartungshaltungen stehen die Perspektiven der Stiefkinder gegenüber, die durchaus anders ausfallen können. Die Beziehungsarbeit muss nicht nur im Rahmen der Partnerschaft und zu den leiblichen Kindern (und deren getrennt lebendem zweiten leiblichen Elternteil), sondern gerade auch zu den Stiefkindern gestaltet werden und irgendwie ja außerdem zu dem getrennt lebenden leiblichen Elternteil der Stiefkinder. Es ist also kein Wunder, dass die Stiefelternteile in der Befragung auch immer wieder sehr ehrlich antworten, dass sie sich das Zusammenleben in einer Patchworkfamilie einfacher und rosiger vorgestellt haben und dass die Realität sehr ernüchternd sein kann. Dennoch – und das zeigt, wie lohnenswert es ist, nicht aufzugeben – gab die deutliche Mehrheit der befragten Stiefelternteile an, das Stiefkind bzw. die Stiefkinder im eigenen Leben nicht mehr missen zu wollen!
Quelle: Eigene Darstellung.
Es braucht also Aufklärung und Information über Vorurteile gegenüber Stiefelternteilen oder auch hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen von Patchworkfamilien. In einem ersten Schritt wollen wir uns im nachfolgenden Kapitel mit diesen Rahmenbedingungen auseinandersetzen und uns zunächst die Merkmale von Patchworkfamilien als Familien einer besonderen Art ansehen.
Rahmenbedingungen
Patchworkfamilien sind besonders – warum?
Im Ursprung bezeichnet der Begriff der Stieffamilie nichts anderes als eine Partnerschaft, bei der mindestens eine:r der beiden Partner:innen bereits Kinder hat.1
Im Verlauf dieses Kapitels wird sich jedoch zeigen, dass es mittlerweile eine große Variationsbreite an Stieffamilien bzw. Patchworkfamilien gibt und worin sich beide Begriffe unterscheiden.
Betrachtet man die Zahlen zur Verbreitung von Patchwork- bzw. Stieffamilien in Deutschland, dann handelt es sich hierbei keinesfalls um besondere Familien. Besonderheit im Sinne von Ausnahme zumindest trifft mit Blick auf die steigende Zahl von Patchworkfamilien in Deutschland, der Schweiz und Österreich nämlich nicht mehr zu. Die aktuellsten Zahlen stammen hier aus dem Jahr 2011 (sind damit also überhaupt nicht aktuell …) und beziffern den Anteil von Stieffamilien an allen Familienformen in Westdeutschland auf 13 Prozent und in Ostdeutschland sogar auf 18 Prozent.2 Tatsächlich werden bei diesen Erhebungen aber nur Stieffamilien mit Kindern bis 16 bzw. 18 Jahren inkludiert, insofern dürfte die Zahl der realen Stieffamilien deutlich höher liegen. Die zunehmende Zahl von Stieffamilien ist auch dadurch begründet, dass nicht mehr der Tod eines Elternteils für die Wiederverheiratung des anderen ausschlaggebend ist, wie es in früheren Generationen üblich war. Vielmehr gehören Trennung und Scheidung heute zum Alltag deutscher Familien, da jede dritte Ehe geschieden wird.3
Die Begriffe Stieffamilie und Patchworkfamilie werden oft synonym verwendet. In der Wissenschaftsliteratur werden sie dahingehend unterschieden, dass in die Stieffamilie Kinder aus früheren Beziehungen eingebracht werden, während es in der Patchworkfamilie zu diesen Stiefkindern dann auch noch mindestens ein gemeinsames Kind gibt. Weniger gebräuchlich ist hingegen der Begriff Bonusfamilie. Aber auch die Begriffe wie Fortsetzungsfamilie, binukleare Familie oder rekonstruierte Familie sind gebräuchlich. Wenngleich Stief- und Patchworkfamilie also einen kleinen, aber feinen Unterschied aufweisen, werden beide Begriffe zusehends synonym verwendet, denn der Begriff Patchworkfamilie wird als neutraler und weniger stigmatisierend angesehen als der Begriff Stieffamilie.
Im Althochdeutschen bedeutet Stief so viel wie »verwaist«, »zurückgelassen«.4 Während »Stieffamilie« also manchmal negative Assoziationen haben kann, die auf Vorurteilen oder Vorstellungen von Konflikten in solchen Familien basieren, wird Patchworkfamilie eher als eine Beschreibung der Vielfalt und des Zusammenkommens verschiedener Teile angesehen. Denn der Begriff Patchworkfamilie betont die Idee, dass Familien aus verschiedenen Teilen bestehen können, die zusammengefügt werden, ähnlich wie bei einem Patchworkquilt. Dieser Begriff sensibilisiert folglich für eine größere Vielfalt von Familienkonstellationen (zu denen auch alleinerziehende Elternteile gehören, Stiefeltern, Halbgeschwister und andere Verwandtschaftsverhältnisse). Jedoch gibt es mittlerweile auch etliche Autor:innen, die bewusst den Begriff Stieffamilie gebrauchen, um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht nur die Sonnenseiten des miteinander Verschmelzens und Verwachsens gibt, sondern dass der Weg dieser besonderen Familienform oft sehr steinig ist und einzelne Flicken manchmal leider auch abreißen. So verweist beispielsweise die Soziologin Anja Steinbach5 darauf, dass viele alternative Begrifflichkeiten zur Stieffamilie unscharf sind und die Benennung der Familienmitglieder vernachlässigen, weshalb bei der Beschreibung der Beziehungsgestaltung auf bewährte Begriffe wie Stiefeltern, Stiefkind und Stiefgeschwister zurückgegriffen wird. Auch gibt Steinbach zu bedenken, dass neue Terminologien nicht dazu führen, bestehende Vorurteile gegenüber der Familienform abzubauen.
Bewusst möchte ich in diesem Buch beide Begriffe gebrauchen, um deutlich zu machen, dass es nicht um die Begrifflichkeiten gehen darf, sondern dass immer die Besonderheit dieses Modells, seine Zerbrechlichkeit, aber auch seine immensen Potenziale im Vordergrund stehen müssen. Hilfreich ist es meiner Meinung nach auch, beide Begriffe zu verwenden, weil man einerseits die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Herausforderungen betonen kann, gleichzeitig aber mit dieser begrifflichen Vielfalt auch auf die Buntheit der Stief- bzw. Patchworkfamilien verweisen kann. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob es sich bei den Eltern um eine heterosexuelle Paarbeziehung oder eine Regenbogenkonstellation handelt, in den Blick genommen wird stets der Verwandtschaftsgrad der Elternteile zu ihren Kindern.
Stieffamilien sind bunt!
Wichtig für die Definition ist folglich also die Frage, ob es sich bei den Elternteilen um die biologischen oder sozialen Elternteile handelt. Und in Stieffamilien gibt es eben einen biologischen und einen sozialen Elternteil. Die wohl gängigste Definition lautet:
»Eine Stieffamilie ist eine um Dauer bemühte Lebensgemeinschaft, in die mindestens einer der Partner mindestens ein Kind aus einer früheren Partnerschaft mitbringt, wobei das Kind bzw. die Kinder zeitweise auch im Haushalt des jeweils zweiten leiblichen Elternteils leben kann bzw. können.«6
Diese Definition ist deshalb so beliebt, weil sie nicht unterscheidet, ob die Patchworkfamilie in einem Haushalt lebt oder in getrennten Wohnungen (Living-apart-together wird letzteres Modell in der Fachsprache genannt) und ob die Partner:innen sich verheiraten oder in unverheirateten Lebensgemeinschaften leben. Tatsächlich zeichnen sich Stieffamilien durch eine große Bandbreite an Beziehungsformen aus (eben auch stark davon abhängig, welche Trennungsmodelle für die Kinder aus den früheren Partnerschaften vereinbart wurden) und sind oftmals auch größer als die klassische deutsche Kernfamilie, denn mehr als die Hälfte dieser Familien hat nur ein Kind.7
Natürlich macht es sich die Wissenschaft noch einmal schwieriger, indem auch unterschiedliche Typen von Stieffamilien unterschieden werden. Nämlich einfache, zusammengesetzte und komplexe Stieffamilien.8