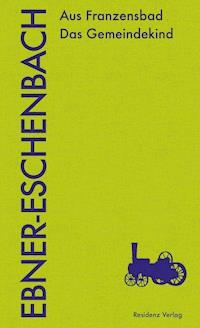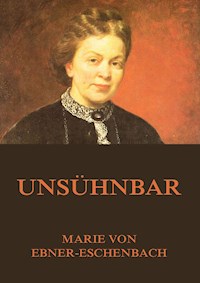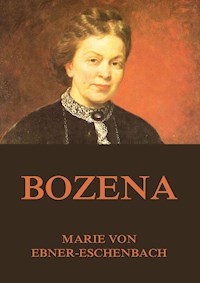1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In 'Meine Kinderjahre (Biographische Skizzen)' gibt Marie von Ebner-Eschenbach intime Einblicke in ihre Jugend und frühe Lebenserfahrungen. Das Buch ist in einem klaren und präzisen Stil geschrieben, typisch für die Werke der österreichischen Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Von Ebner-Eschenbachs Erzählungen reflektieren nicht nur ihre eigenen Erfahrungen, sondern werfen auch ein Licht auf die gesellschaftlichen und kulturellen Normen ihrer Zeit. Sie nimmt den Leser mit auf eine Reise durch ihre prägenden Jahre und zeigt, wie diese sie zu der Schriftstellerin geformt haben, die sie wurde. Marie von Ebner-Eschenbachs 'Meine Kinderjahre' bietet daher nicht nur persönliche Einblicke, sondern auch Einblicke in die literarische Entwicklung einer bedeutenden Autorin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Meine Kinderjahre
(Biographische Skizzen)
Books
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Geschichte des Erstlingswerkes, die K.E. Franzos vor zwölf Jahren herausgegeben hat, brachte auch einen Beitrag von mir. Alles, was darin ausgesagt ist, unterschreibe ich heute noch, einen Irrtum aber muß ich berichtigen. Meine Erinnerungen an die Kinderzeit, meinte ich damals, sind nicht besonders lebhaft, und erfahre nun, daß sie, um es zu sein, nur geweckt zu werden brauchten. Es unterblieb zu jener Zeit; denn so alt ich schon war, lag doch noch etwas wie Zukunft vor mir, und auf sie, nicht zurück zur Vergangenheit, lenkten sich meine Gedanken.
Nun stehe ich am Ziel, der Ring des Lebens schließt, Anfang und Ende berühren sich. Mit einer Macht des Erinnerns, die nur das hohe Alter kennt, lebt die Kindheit vor mir auf. Aber nicht wie ein kräftig ausgeführtes Gemälde auf hellem Hintergrund, in einzelnen Bildern nur, die deutlich und scharf aus dem Dämmer schweben. Die Phantasie übt ihr unbezwingliches Herrscherrecht und erhellt oder verdüstert, was sie mit ihrem Flügel streift. Sie läßt man ches Wort an mein Ohr klingen, das vielleicht nicht genauso gesprochen wurde, wie ich es jetzt vernehme; läßt mich Menschen und Begebenheiten in einem Lichte sehen, das ihnen eine an sich vielleicht zu große, vielleicht zu geringe Bedeutung verleiht. Ihrer über das Kindergemüt, dessen Entfaltung ich darzustellen suchte, ausgeübten Macht wird dadurch nichts genommen. Das Schwergewicht liegt auf dem Eindruck, den sie hinterlassen haben, und ihn bestimmt die Beschaffenheit des Wesens, das ihn empfing. Dieses Wesen ist treu geschildert, buchstäblich und im Geiste.
Rom, Januar 1905
Biographische Skizzen
Unter den Augen der Meinen, unter dem Einfluß ihrer verwöhnenden Liebe sind diese Skizzen entstanden. Ein Reflex der Teilnahme, die sie erweckten, fiel auf sie, und ich dachte: Ihr seid etwas.
Jetzt bin ich allein und bin in Rom, und hierher werden sie mir nachgesandt, wenn auch erst im Negligé der Korrekturbogen, doch schon als »Drucksache« und vorbereitet zur Fahrt in die Fremde. – Meine Kleinen, ihr kommt mir recht armselig vor mit eurem Geplauder von Puppen und Ammenmärchen. Mich beschäftigen andere Dinge als eure Geringfügigkeiten. Die Weltgeschichte spricht zu mir, ich lebe an der Stätte, an der Jahrhunderte hindurch ihr mächtiger Puls geschlagen hat, und bin da, ein dankbarer Gast, fortwährend zu hohen Festen und großartigen Schauspielen geladen ... Ich kann durch den Steineichenhain auf die Höhe in der Villa Medici wandeln und die Sonne untergehen sehen hinter dem Janiculus. Majestätisch ist das Tagesgestirn versunken; in den feurigen Himmel ragt die Kuppel von Sankt Peter, und durch die Lüfte gleiten, andachtweckend, auf tönenden Schwingen die silbernen Klänge ihrer Glocken ... Der graue Streifen, der links am Horizont emporzusteigen scheint, das ist das Meer, das Tyrrhenische, das auf seiner ruhelos wogenden Brust die Flotten Roms getragen hat, zur Eroberung vergänglicher Reiche und unvergänglicher Kunst ... Und bei der Tassoeiche kann ich stehen und ihrem Gestöhn im Winde lauschen. Quercia del Tasso! Der Blitz hat sie getroffen und ihren Stamm zerspellt, der Sturm hat wild in ihrem Geäste gehaust, aber noch begrünt sich alljährlich ihr gelichteter Wipfel. Sie strotzte in Kraft, war jung und reich bekleidet, als der Poet sich todesmatt zu ihr herüberschleppte von Sankt Onofrio, wo er »im Verkehr mit den heiligen Vätern den Verkehr mit dem Himmel begonnen hatte«. Was galten ihm noch seine höchsten Erdenwünsche, die Dichterkrönung auf dem Kapitol, die Huld der angebeteten Frau? ... Aber der Mai war nahe, in Duft und in Blüte stand die Welt, und Sehnsucht nach dem herben Glück der letzten Abschiedsgrüße zog ihn hierher in den Schatten seiner Eiche. Seine sterbenden Augen haben auf dem Bilde geruht, das vor uns liegt, und der Gedanke verleiht der traumhaften Schönheit des Anblicks eine wehmütige Verklärung. Ein Hauch ewigen Frühlings weht über den Geländen der holden Berge, aber der Monte Gennaro besinnt sich, daß Winter ist, und trägt seine Tiara aus Schnee ... Und in der Tiefe liegt die Stadt, die heute noch keine Fabriken hat mit rauchenden Schlöten und keine berußten Dächer, und selbstleuchtend erscheinen im Abendlichte ihre schimmernden Mauern. Wie tot liegt sie da, die soviel verbrochen und soviel erduldet hat. Kein Laut dringt herauf, vernehmbar nur dem inneren Ohr ist ihre feierliche Sprache des Schweigens.
Mein stilles Fest auf dem Janiculus habe ich gestern begangen und heute auf dem Forum einige Stunden zugebracht, geleitet von einem liebenswürdigen und gar zuverlässigen Führer, dem jüngsten Buche meines verehrten Freundes, Professor Hülsen. Doch was sind einige Stunden auf dem Forum! Nicht mehr als ein eiliges Vorüberwandeln an Stätten, die durch herrliche Taten geweiht, durch entsetzliche Greuel gebrandmarkt worden. Von der Basilika Julia bin ich zum Heiligtum der Juturna gewandert, zu Santa Maria Antiqua, zum Atrium Vestae und hinauf zur Velia, zum schönsten der römischen Triumphbogen. Und dann auf dem Rückweg betrat ich die Sacra Via und meinte den Boden unter meinen Füßen erzittern zu fühlen und dröhnen zu hören vom Marsche der Legionen. Eine Riesenschlange, die Reiche erdrückt hat in ihren gewaltigen Ringen, bewegt sich der Siegeszug zum Kapitol, umbraust vom Zuruf der Menge. Goldene Beutestücke funkeln, die Ketten der Gefangenen klirren. Sie kommen am Tullianum vorbei, und dort, in seine »abschreckende Dunkelheit« hinabgeschleudert, verschwinden Heerführer, Fürsten, Könige. Niemals staut der Zug, unaufhaltsam strebt er vorwärts, dem Triumphwagen nach zur Höhe, auf der Jupiter in seinem Heiligtume thront ...
Noch ganz erfüllt von den Eindrücken, die ich Tag für Tag empfange, hier in diesem großen Rom, kehre ich in meine Behausung zurück und sollte meine Skizzen vornehmen, auf die Druckfehlerjagd ausziehen und entgleisten Sätzen auf die Beine helfen. Das wird mir schwer. Mein Glauben an euer Etwas ist mir entschwunden, ihr armen Blätter. Weil ihr aber eure papiernen Flügel schon entfaltet habt, so fliegt denn, so gut ihr könnt. Heimwärts, rate ich euch, dorthin, wo ihr geboren seid und wo immerwache Liebe euch empfängt. Indessen wird Rom den Purpurmantel seiner Rosen umgetan haben, und bei uns zu Hause werden an Bäumen und Sträuchern die Knospen schwellen und Schößlinge in Unzahl hervorsprießen. Das ist dann auch für das grüne Seelchen, dessen Geschichte ihr erzählt, der richtige Augenblick, sich ans Licht zu wagen.
Meine Schwester Friederike war vierzehn Monate, ich war vierzehn Tage alt, als unsere Mutter starb. Dennoch hat eine deutliche Vorstellung von ihr uns durch das ganze Dasein begleitet. Ihr lebensgroßes Bild hing im Schlafzimmer der Stadtwohnung unserer Großmutter. Ein Kniestück, gemalt von Agricola. Er hat sie in einem idealen Kostüm dargestellt, einem bis zum Ansatz der Schultern ausgeschnittenen dunkelgrünen Samtgewand mit hellen Schlitzen und langen, weiten Ärmeln. Der Kopf ist leicht gewendet und etwas geneigt; der Hals, die auf der Brust ruhende Hand sind von schimmernder Weiße und gar fein und schön geformt. Das liebliche Gesicht atmet tiefen Frieden; die braunen Augen blicken aufmerksam und klug, und aus ihnen leuchtet das milde Licht eines Geistes so klar wie tief.
Zu diesem äußeren Ebenbilde stimmten die Schilderungen, die uns von dem Wesen, dem Sein und Tun unserer Mutter gemacht wurden. So einhellig wie über sie habe ich nie wieder über irgend jemand urteilen gehört. Wenn die Rede auf sie kam, hatten die verschiedensten Leute nur eine Meinung. Und gern und oft wurde von ihr geredet. Besonders hoch in Ehren stand ihr Gedächtnis auf ihrem väterlichen Gute Zdißlawitz, wo der größte Teil ihres Lebens verflossen war.
Ich glaube, daß meine Liebe zu den Bewohnern meiner engsten Heimat ihren Ursprung hat in der Dankbarkeit für die Anhänglichkeit und Treue, die sie meiner Mutter über das Grab hinaus bewahrten. Die Diener sprachen von ihr, die Beamten, die Dorfleute, die Arbeiter im Garten. Ein alter Gehilfe nannte ihren Namen nie, ohne das Mützlein zu ziehen: »Das war eine Frau, Ihre Mutter! ... Gott hab sie selig.« Da wurde mir immer unendlich stolz und sehnsüchtig zumute: »Ich seh ihr ähnlich, nicht wahr? Geh, sag ja!« – Er zwinkerte mit den Augen und schob die Unterlippe vor: »Ähnlich? Ähnlich schon, aber ganz anders.« Es sollte sich niemand mit ihr vergleichen wollen, nicht einmal ihre eigene Tochter. – »Ja«, fuhr er nach einer Pause fort, »blutige Köpfe hat's gegeben bei ihrem Begräbnis; geschlagen haben sie sich um die Ehre, ihren Sarg zu tragen. – Das war eine Frau!«
Man hatte uns die Überzeugung beigebracht, daß sie vom Himmel aus über uns wache und uns als ein zweiter Schutzengel umschwebe in Stunden der Krankheit oder der Gefahr. Ich vergesse nie, mit welcher Zuversicht und mit welcher geheimnisvollen Glückseligkeit das Bewußtsein ihrer Nähe mich oft erfüllte.
In einem Punkte hatte ich dasselbe Schicksal erfahren wie sie. Auch ihr Leben war um den Preis des Lebens ihrer Mutter erkauft worden, und auch ihr war die auserlesene Schicksalsgunst zuteil geworden, für den schwersten Verlust den denkbar besten Ersatz zu finden – die liebreichste und gütigste Stiefmutter. Die ihre, unsere vortreffliche Großmutter Vockel, erreichte, unserer Kindheit zum Heile, vorgerückte Jahre. Sie blieb bei uns nach dem Tode ihrer Tochter; sie verließ uns auch dann nicht, als unser Vater sich wieder verheiratete.
In Wien bezog sie eine Wohnung im ersten Stock seines Hauses, dem sogenannten »Drei-Raben-Haus«, auf dem damals sogenannten »Haarmarkt«. Wir bewohnten den zweiten Stock. Im Sommer lebte sie mit uns auf dem Lande.
Sie war klein und mager und hatte einen für ihre zarte Gestalt etwas zu großen Kopf. Ihr Gesicht blieb noch im Alter schön. Ein edel und kräftig gebautes Gesicht. Die Stirn von klassischer Bildung, die Nase schlank und leicht gebogen, mit feinen, beweglichen Flügeln. Der Mund schmal und gerade, die Lippen fest geschlossen – so charakteristisch für die vereinsamte, stolze, schweigsame Frau. Ihre großen, tiefdunkeln Augen hatten einen schwermütigen Ausdruck. Ich habe ihn manchmal sich wandeln gesehen in einen schmerzlich-geringschätzigen; zu einem verachtungsvollen, verdammenden wurde er nie. Sie wunderte sich nicht leicht über ein Unrecht, das sie begehen sah; durch eine hochherzige Handlung, deren Zeugin sie war oder von der sie hörte, konnte sie so freudig überrascht werden wie durch ein unerwartetes selbsterlebtes Glück. Ein solches, ein eigenes, war ihr gleichsam nur im Vorübergehen zuteil geworden. Unser Großvater und sie hatten geheiratet aus Liebe – nicht zueinander, sondern zu einem Kinde, zu seinem Kinde. Und in dieser Liebe erst hatten sie sich gefunden, und ihr anfangs geschwisterliches Verhältnis reifte langsam zu einem schönen ehelichen heran.
Der Tod löste den Bund und nahm auch bald darauf der Verwitweten die einzige vielgeliebte Tochter. Diese hatte in ihrem Testamente ihren Gatten zum Herrn auf Zdißlawitz eingesetzt. So war nun unsere Großmutter ein Gast geworden in ihrem ehemaligen Haus und Heim. Sie beschied sich. Sie wünschte nichts mehr, als nur in der Nähe der Kinder ihres Kindes leben zu dürfen.
In der kleinen Erzählung Die erste Beichte habe ich eine Skizze von der herrlichen Frau entworfen. Die eigentümliche Art ist erwähnt, in der sie, die kaum je eine Besorgnis, geschweige denn eine Klage aussprach, Klagen aufnahm. »Alles geht vorüber, alles wird gut«, sagte sie halblaut vor sich hin. Und wenn es in ihrer Macht lag, das Üble und Traurige gutzumachen, dann wurde es gut.
Ausgesprochen hat sie es nicht, im stillen soll sie aber sehr gelitten haben, als unser Vater sich wieder vermählte und an die Stelle unserer Mutter eine jüngere und schönere Frau trat, »Maman Eugénie«, eine geborene Freiin von Bartenstein. Das erste Kind, das sie zur Welt brachte, war ein Knabe und das zweite wieder ein Knabe, während die Verstorbene ihrem Gatten nur Töchter geboren hatte. Nun würden wir nichts mehr gelten, besorgte die Großmutter. Zurückgesetzt würden wir werden und zu fühlen bekommen, daß es eigentlich uns, den Älteren, zugestanden hätte, männlichen Geschlechts zu sein.
Die Besorgnisse der lieben alten Frau erwiesen sich als ganz ungerechtfertigt. Unsere junge Mama schloß uns ebenso innig ins Herz wie ihre eigenen Kinder, die kleinen Brüder und das holde Schwesterlein, das ihnen nachfolgte. Wir ließen es uns sehr wohl sein unter der milden mütterlichen und großmütterlichen Herrschaft, und unser Übermut wäre allmählich stark ins Kraut geschossen, wenn ihn die Hand der temperamentvollen Kinderfrau nicht niedergehalten hätte.
Sei gesegnet noch in deinem Grabe, in dem du seit so langen Jahren ruhst, du brave Josefa Navratil, genannt Pepinka! Du hast dir ein unschätzbares Verdienst um uns erworben. Du hast uns zu einer Zeit, in der die weisesten Vorstellungen keinen Weg zu unserem Verständnis gefunden hätten, durch eine rechtzeitig angebrachte demonstratio directa bewiesen, daß der Schuld unerbittlich die Strafe folgt. Gewiß trifft das auch im Leben ein, aber oft so spät und in so verhüllter Weise, daß menschliche Augen den Zusammenhang nicht mehr entdecken. In unserer Kinderstube ging die Sache rasch und einfach vor sich. Wenn eine Tür heftig zugeworfen wurde, wenn es beim Spiel allzu lautes Geschrei oder arge Streitigkeiten gab, kam Pepi daher auf ihren großen, weichen Schuhen und hielt Gericht. Ohne erst zu fragen, wer der Schuldigste sei, teilte sie – darin ein ganz getreues Bild des Schicksals – ihre Schläge aus. Wir nahmen sie ohne Widerspruch in Empfang und liebten unsere Pflegerin und Richterin. Wir fürchteten sie nicht einmal sehr, so laut sie manchmal auch zankte und so zornig sie uns anfunkeln konnte mit ihren feurigen schwarzen Augen.
Hatte eine erziehliche Maßregel unserer Schicksalsgöttin sehr hart getroffen, dann ging man zu Anischa, meiner ehemaligen Amme, und weinte sich bei ihr aus. Sie war der lichte Stern unserer Kinderstube und immer freundlich und gut. Auch bildhübsch war sie und lieblich anzusehen in ihrer heiteren hannakischen2 Tracht. Sie verwandte viel Sorgfalt auf ihr Äußeres, sie schlang das bunte Tuch mit den langen Fransen kunstvoll um ihren Kopf, trug immer nur schimmernd weiße Halskrausen, seidene, mit Flittern benähte Leibchen und tadellos gesteifte und geplättete Röcke.
Pepinka brummte sie manchmal an: »Was putzen Sie sich so auf? Er kommt heute doch nicht.«
Die arme Anischa wurde jedesmal feuerrot und antwortete leise und demütig: »Heute nicht und morgen nicht.«
Er kam auch nicht. Hingegen erschien alljährlich im Herbste eine ältliche Frau, die wir, dem Beispiel Anischas folgend, »pani kmotřenka3« nannten, in Zdißlawitz. Ein derber Junge in schmucker hannakischer Tracht begleitete sie. Er stand im selben Alter wie ich, und Pepi sagte, daß er eine Art Bruder von mir sei. So erwiesen wir ihm denn alle geschwisterlichen Ehren, fütterten ihn, beschenkten ihn, luden ihn ein, an unseren Spielen teilzunehmen. Er aß, was man ihm auftischte, er nahm, was man ihm anbot, aber er dankte nicht, er lächelte nicht; er verhielt sich uns gegenüber trotzig wie ein Bock. Leichten Herzens sagten wir ihm Lebewohl, wenn er sich wieder empfahl. Anischa begleitete ihren Besuch zum Wägelchen, das ihn vor dem Dorfwirtshaus erwartete. Sie hatte rote Augen, wenn sie zurückkam, war aber nicht mehr so bedrückt und befangen wie tagsüber während der Anwesenheit des wortkargen Bäuerleins.
Ein anderes Ereignis wiederholte sich gleichfalls alljährlich, dieses aber im Frühjahr und fast unmittelbar nach der Ankunft auf dem Lande. Da war es gewöhnlich unsere Großmutter, die eines Morgens eintrat und sagte: »Pepi, der Bader ist da«, worauf Pepi ihrem Schranke ein Pack Wäsche entnahm und das Zimmer verließ. An einem solchen Tage sahen wir sie nicht mehr; sie kam erst am folgenden wieder, hatte einen verbundenen Arm und speiste uns mit einer ausweichenden Antwort ab, wenn wir fragten, wo sie gestern gewesen sei und warum sie einen Verband trage.
Einmal aber schlichen Adolf, der ältere der Brüder, und ich ihr nach bis zum ersten Absatz der Treppe, und von dort aus sahen wir sie in eines der sonst immer verschlossenen ebenerdigen Zimmer treten.
Wir schlichen weiter bis zum nächsten Absatz und bis zum dritten und endlich bis zur Tür, hinter der Pepi verschwunden war. Drinnen im Zimmer wurden Sessel gerückt, es wurde Wasser in Gläser und in Lavoirs geschüttet, und eine fremde Männerstimme sprach höhnisch: »Fürchten S' Ihnen? Recht haben S'. Warten S' nur, was Ihnen heut geschieht!«
Du lieber Gott, was ging da vor? Von Angst und von Helfedrang ergriffen, warfen wir uns gegen die Tür. Sie war verschlossen. Wir schrien und klopften und hörten Papa klagen: »Jesses, die Kinder!«
»Ruh geben! Draußen bleiben!« wetterte die Männerstimme.
In starrem Entsetzen schwiegen wir eine Weile. Endlich wurde die Tür von innen aufgesperrt, geöffnet, und heraustrat das Stubenmädchen und hielt in der Hand eine große Schale voll Blut. Nun überstieg unsere Bestürzung alle Grenzen. Blut! Blut! Soviel Blut! Von wem das viele Blut?
»Von der Pepi«, antwortete das unbegreifliche Mädchen ganz gleichgültig. »Der Doktor hat ihr zur Ader gelassen. Und jetzt seien Sie still, sonst wird der Doktor auch Ihnen zur Ader lassen.«
»Zur Ader gelassen! Was ist das? Wie ist das? Muß man sterben, wenn man zur Ader gelassen bekommt?«
Sie lachte und riet uns, gleich hinaufzugehen, wenn wir nicht noch gestraft werden wollten für unsere Neugier.
Die Neugier blieb vorläufig ungestillt, aber unsere Seelenruhe wurde uns zurückgegeben, denn drinnen in der Stube erhob die Stimme Pepinkas sich in alter Kraft und befahl den »verdunnerten Kindern«, sogleich zur Anischa zu gehen.
Wir gehorchten und hatten dann noch einen sehr guten Tag fast uneingeschränkter Freiheit, und am Abend erzählte uns Anischa, viel länger als ihr sonst erlaubt wurde, schöne, wundervolle Märchen.
O welch ein Erzählertalent war unsere Anischa! Wie verstand sie zu schildern, zu spannen, ihre Phantasiegebilde klar und lebendig hinzustellen, sie aufsteigen, vorüberschweben, entschwinden zu lassen! Jammervoll nüchtern erscheint mir die Kinderstube, aus der die Märchenerzählerin »grundsätzlich« verbannt ist. Wir haben das Glück genossen, uns nach Herzenslust in einer Wunderwelt ergehen zu dürfen, sowohl als kleine wie später als größere Kinder. Es war uns ein stolzes Vergnügen, eine Menge zu hören und zu sehen, was andere nicht hörten und nicht sahen: im Gurgeln des Brunnens am Ende des Gemüsegartens die Stimme des Wassermanns; im Glanz, der im Hochsommer über die Ähren fliegt, huschende Lichtgeister, und Elfchen im Laube, wenn es leise zu rascheln beginnt. Diese Elfchen, wußte Anischa, sind zu Mittag nicht größer als Libellen. Aber sie wachsen sehr, sehr geschwind, und um Mitternacht sind ihre Flügel wie Adlerflügel, und das Laub stöhnt, wenn sie mit Windeseile hindurchfegen.
»Ja, gewiß! ja, es stöhnt!« Wir alle behaupteten es. Jedes von uns wollte einmal um Mitternacht wach gewesen sein und das Stöhnen vernommen haben. Nur unsere Sophie, die nicht; die wußte noch nichts von Wassermännern, Irrwischen und Elfen. Sie schlief schon lang, diese Kleine, zur Stunde des Märchenerzählens, und Anischa saß neben ihrem Bettchen, und wir saßen auf Schemeln zu ihren Füßen.
Ganz anders arg und grausig als das Stöhnen des Laubes beim Wehen leiser Lüfte waren die schrillen Schmerzenslaute, die sich erhoben, wenn ein heftiger Sturm die Ecke des Hauses, die wir bewohnten, umrauschte. Es brach aus ihm wie Schluchzen, flüsterte wie hastiges Flehen, glitt über die Fensterscheiben mit tastenden Fingern ...
»Hört ihr?« fragte dann eines von uns die andern, »das ist Melusine, die ihre Kinder sucht, nach ihnen ruft, um ihre Kinder jammert und weint.« Melusine ... Grad ist sie vorbeigeflogen; meine Schwester hat ihren weißen Schleier erblickt und sagt ganz leise: »Lösche das Licht, Anischa, daß sie uns nicht sieht; sie glaubt vielleicht, wir sind ihre Kinder, und holt uns.«
Ein Märchen gab's, das erzählte Anischa nur mir allein, weil ich so couragiert war. Meine Schwester, die kleinen Brüder durften nichts hören von der »zlá hlava«; sie hätten lang nicht einschlafen können und schwere Träume gehabt.
Diese »hlava«, das war ein Kopf, nichts weiter als ein Kopf, ohne alles Zubehör. Er hatte struppige Haare und einen struppigen, feuerroten Bart, Teufelsaugen und Ohren so groß, daß er sie als Flügel gebrauchen konnte. Aber nicht lange, weil er sehr schwer war und bald wieder zu Boden plumpste. Der Kopf war ein König und hatte ein Heer, und im Kriege rollte er ihm voran, eine fürchterliche Kugel, und biß den Menschen und den Pferden in die Füße, daß sie reihenweise tot hinfielen. Er hatte auch eine Königin, die neben ihm schlafen mußte auf demselben Polster und vor Schrecken über seinen Anblick ganz weiß wurde, immer weißer und endlich selbst ein Gespenst.
Greuliche Untaten beging die »hlava«, und eine ihrer schlimmsten war, daß sie der Großmutter Anischas, als diese einmal des Nachts von einem Botengang heimkehrte, auf der Hutweide nachgerollt kam ... Die Großmutter hörte sie pusten, knirschen und schnauben und rannte! rannte! Bis zu ihrem Hause rannte sie; dort aber stürzte sie zusammen und wußte nichts mehr von sich, eine Stunde lang – o länger als eine Stunde! Am nächsten Tag ging der Großvater und mit ihm das halbe Dorf auf die Hutweide, und an der Stelle, wo die Großmutter das Scheuel zuerst pusten, knirschen und schnauben gehört, lag ein großer, runder, weißer Stein, den – man schwor darauf – noch niemand da gesehen hatte. Nur der Hirtenbub behauptete steif und fest, daß der Stein von jeher da gewesen sei. Aber der Hirtenbub war dumm und ein halber Trottel. Der Stein wurde eingegraben, und heute noch machen die Leute einen Umweg, wenn sie an dem Platz, wo er liegt, vorüberkommen.
Ich nahm natürlich Partei gegen den Hirtenbuben. Ich wäre am liebsten gleich nach Trawnik, wo Anischa zu Hause war, gefahren, hätte die Hutweide besucht und den gespenstischen Stein ausgegraben. Und je entsetzter Anischa sich stellte über meine Tollkühnheit, desto mehr fühlte ich sie wachsen und verstieg mich zu den Versicherungen: »Ach, ich möchte, ich möchte, daß die hlava einmal mir nachgerollt käme! Ich würde nicht davonlaufen, o nein! o nein! Ich würde stehenbleiben – ich! Ich würde mich umsehen und der hlava dreimal nacheinander recht ins Gesicht das heilige Zeichen des Kreuzes machen. Da wäre sie gleich weg. O ich fürchte mich nicht – ich weiß nicht, wie das ist, sich fürchten; ich hab eine große Courage!«
Es war viel Geflunker bei dieser Behauptung. Ich wußte sehr gut, was Furcht sei, denn in der Furcht vor dem Papa waren meine Schwester und ich aufgewachsen. Man hatte sie uns in der Kinderstube eingeflößt durch eine Drohung, die sich nie erfüllte, stets aber wirksam blieb: »Wartet nur, ich sag's dem Papa, und dann werdet ihr sehen!«
Was wir sehen würden, blieb in ein Dunkel gehüllt, das unsere Phantasie mit Schrecknissen bevölkerte. Kein Wunder. Den Zorn unseres Vaters zu erfahren wäre entsetzlich gewesen. Nicht nur kleinen, auch erwachsenen Leuten leuchtete das ein. So liebenswürdig Papa in guten Stunden sein konnte, so furchtbar in seinem unbegreiflich leicht gereizten Zorn. Da wurden seine blauen Augen starr und hatten den harten Glanz des Stahls, seine kraftvolle Stimme erhob sich dräuend – und vor diesen Augen, dieser Stimme hätten wir in den Boden versinken mögen, wenn wir uns auch nicht der geringsten Schuld bewußt waren.
Zum Schaden unseres Verhältnisses zu ihm ließ sich Papa in gereizter Stimmung manchmal zu dem unglückseligen Ausspruch hinreißen: »Nicht geliebt will ich sein, sondern gefürchtet!« Wie sehr er sich damit täuschte, lernten wir später einsehen; als Kinder nahmen wir die Sache als ausgemacht an und taten ihm den Willen, weit über seine eigene Erwartung. Wir zwei Schwestern zitterten und bebten vor ihm; die Brüder waren in seiner Nähe viel unbefangener, obwohl Pepi mit ihrer Drohung, sie der Strenge Papas zu überliefern, gegen sie besonders freigebig war.
Ich erinnere mich eines Tages, an dem meine Schwester das Mißgeschick erfuhr, beim Spielen mit dem Balle eine Fensterscheibe einzuschlagen. Nun war uns die peinlichste Sorgfalt für alles Zerbrechliche, das uns umgab, zum Gesetz gemacht worden, und die arme Kleine, die sich so schwer daran vergangen hatte, geriet in sinnlose Verzweiflung.
»Der Papa! Der Papa!« rief sie in Todesangst, kniete auf den Boden nieder, rang die Händchen, faltete sie und schluchzte herzzerreißend.
Wir umstanden sie betroffen und ratlos. Großmama, die neben uns wohnte, war auf Fritzis Geschrei herbeigeeilt, und sie und Pepinka sprachen der Armen Trost zu und bemühten sich, sie zu beruhigen. Ganz umsonst. Sie war schon blau im Gesichte, stoßweise rang sich der Atem aus ihrer Brust, in Bächen rannen die Tränen über ihre Wangen.
Großmama, sehr besorgt, tauschte leise einige Worte mit Pepi. Dann, nach einem neuen, vergeblichen Versuch, ihre kummervolle Enkelin zu beschwichtigen, verließ sie das Zimmer. Bald darauf betrat sie es wieder, und wer kam hinter ihr hergeschritten? Der unbewußte Urheber all dieses Leids und Schreckens – der Papa.