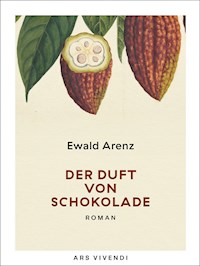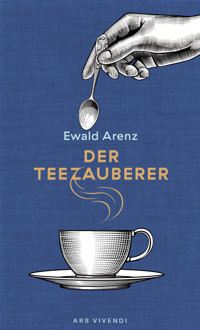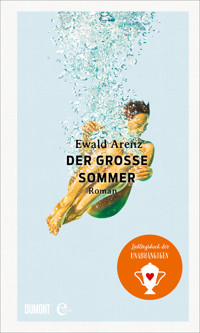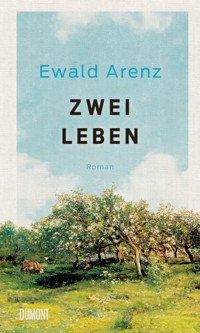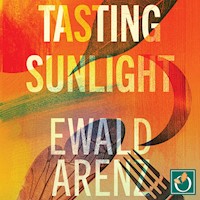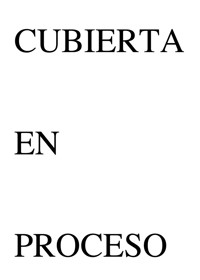Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
FAMILIENGESCHICHTEN - Heiter und liebevoll Die gesammelten Familiengeschichten von SPIEGEL-Bestsellerautor Ewald Arenz Eine völlig normale fünfköpfige Familie steht im Mittelpunkt dieser heiteren kleinen Geschichten. Eine beinahe normale jedenfalls. Wenn nicht gerade der vierjährige Otto mit gutem Gewissen böse Spielfiguren im Klosett versenkt. Oder die dreizehnjährige Philly die Eltern penetrant in fortschrittlichem Denken unterweist. Oder ihr eben volljährig gewordener, spätpubertärer Bruder Theo mal wieder meint, den Monarchisten und Provokateur mimen zu müssen. Also streitet und liebt man sich, lacht mit- und übereinander und bietet, wenn es darauf ankommt, der Welt geschlossen die Stirn. Ewald Arenz lässt uns mit feinem Witz und sanfter Ironie am nie alltäglichen Familienalltag teilhaben. Und seinem Alter Ego Heinrich gelingt es auf bewundernswerte Weise, über all den Widrigkeiten Humor zu bewahren und augenzwinkernd zu zeigen, um wie viel ärmer seine kleine Welt ohne diese kleinen Katastrophen wäre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: © Birkefeld
Ewald Arenz’ umfangreiches Werk wurde vielfach ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Bei ars vivendi erschienen u. a. sein Bestseller Der Duft von Schokolade, der Kriminalroman Das Diamantenmädchen über das Berlin der Goldenen Zwanzigerjahre, sein heiter-apokalyptischer Roman Herr Müller, die verrückte Katze und Gott und sein Erzählband Eine Urlaubsliebe.
Ewald Arenz
MEINE KLEINE WELT
FAMILIENGESCHICHTEN
Originalausgabe
1. Auflage Januar 2022
© 2022 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG,
Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Ein Teil der Geschichten erschien als gleichnamige Kolumnenserie in den
Nürnberger Nachrichten
Umschlaggestaltung: finken + bernhard, Stuttgart
Einbandfotos: © Natalia Vovk / shutterstock.com (Cover)
© Duntrune Studios / shutterstock.com (Buchrückseite)
ISBN 978-3-7472-0351-4
eISBN 978-3-7472-0404-7
Meine kleine Welt
Inhalt
Vorwort
Familieneinkauf
Schlüsselerlebnis
Modediktat
Die Pokalkatze
Hohe Zeit
Kino
Handy
Bob Dylan retten
Gangsta-Berufe
Billigflug
Spritztour
Klugheit
Naturkino
Philly und die Pille
Graffiti
Zirkus
Vernissage
Camping
Friedensnote
Schwarze Pädagogik
Glaubenskrieg
Familienverhältnisse
Generationenkonflikt
Mother’s Day
Häusliche Hölle
Playmobilmärtyrer
Herr von Ribbeck im Garten-Center
Revolution
Königreich Familie
La Famiglia
Sekundärtugenden
Spontankauf
Zoobesuch
Der Geist der Lektorin
Katastrophennacht
Beruhigungsmittel
Kindergeburtstag
Emanzipation
Geschichtsstunde in Bayern
Landvermessung
Terrorehe
Geburtstagsgeschenk
Theo und mehr
Stilfragen
Frühlingsmorgen
Allergien
Hellness
YouTube
Vorsorgeuntersuchung
Die Zahnfee
Bad Bank
Lost Generation
Kalter Krieg
Völkerverständigung
Parforce-Literatur
Musikschule
Regengöttin
Verkaufsgespräch
Reeperbahn
Zeugnisverweigerungsrecht
Urlaub
Traumhafter Abend
Führungsqualitäten
Vorratshaltung
Schulmonster
Treibjagd
Vorwort
Die Familie weiß alles, mißbilligt es aber grundsätzlich. Andere wilde Indianerstämme leben entweder auf den Kriegsfüßen oder rauchen eine Friedenszigarre: die Familie kann gleichzeitig beides.
Kurt Tucholsky
Mir war das früher nicht so ganz klar, aber nach einem Dutzend Romanen und unzähligen Geschichten weiß ich es endgültig: Ohne meine Familie gäbe es sie nicht. Die Familie ist immer wieder die Quelle meiner Literatur, und vor allem in den vorliegenden Geschichten ist das am deutlichsten zu erkennen.
Ich selbst bin das älteste von sieben Pfarrerskindern, und seit meiner Geburt haben die Zahlen sich zunehmend unübersichtlich entwickelt: Nach unserer Zählung auf dem letzten großen Familienfest besitzen meine Geschwister und ich fünfunddreißig Cousins und Cousinen. Und sie uns. In der Generation meiner Kinder setzt sich dieser Hang zur Vielzahl nur wenig vermindert fort. Wir sind ein Clan. Uns gibt es von München bis Itzehoe und an ein paar verstreuten Orten im Ausland. Aber dass ich mit meinen drei Kindern auch ein Teil dieser Großfamilie sein würde, war mir noch nicht so ganz klar, als ich vor mehr als fünfzehn Jahren begann, Geschichten aus meiner vermeintlich kleinen Welt zu erzählen. Es sind Vignetten; kleine Einblicke in den manchmal absurden Alltag. Es sind Geschichten über all die Ärgernisse und Freuden des Familienlebens, aber vor allem immer wieder über das kleine und manchmal große Glück, Teil einer solchen Familie zu sein.
Nett sind sie nicht immer. In dieser Familie herrscht Konsens darüber, dass Pointe vor Pädagogik geht, und eine meiner Schwestern bemerkte einmal über die Kindheit ihrer Nichten und Neffen ohne großes Mitleid: »Sie sind durch eine harte Schule der Ironie gegangen.« Ich bin denn auch auf Lesungen mehr als einmal gefragt worden, was wohl meine Kinder dazu sagten, in diesen kleinen Glossen nicht immer unbedingt »bella figura« zu machen. Dann musste ich manchmal leise lächeln. Denn es war nicht nur so, dass ich den Kindern vor der Veröffentlichung jeden Text vorgelesen habe, sondern es wurde vorher auch immer begierig gefragt: »Komme ich drin vor?« Manchmal gab es sogar kleine Eifersüchteleien, wenn etwa Otto in ein paar Geschichten häufiger als Theo oder Philly auftauchte oder Philly die schlagfertigeren Antworten in den Mund gelegt wurden. Heute lesen meine Kinder diese Miniaturen, wie sie sich Fotos aus ihrer Kindheit ansehen – mit einem ganz leicht melancholischen Lächeln auf den Lippen: »Ach ja, wisst Ihr noch?« Und genau so sollten sie auch gelesen werden. Denn natürlich sind die letzten fünfzehn Jahre an diesen Geschichten nicht spurlos vorübergegangen. Der iPod Nano, den sich Philly einmal wünscht, ist längst Technikgeschichte. Aber ihre fünfzehnjährige Verachtung der hoffnungslos altmodischen Eltern – die ist zeitlos … und macht hoffentlich auch heute noch Spaß.
Diese Geschichten zu schreiben war für mich immer wie ein unbeschwertes Spiel und ein großes Vergnügen. In ihnen durfte ich alles tun, meiner Phantasie freien Lauf lassen und mein Alter Ego auch mal zum schlechtesten Drogendealer der Welt werden. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass sie hier zum ersten Mal gesammelt erscheinen.
Es sind Geschichten, die eigentlich nur eins tun: Mal nachdenklich, mal wehmütig und manchmal laut lachend die Familie feiern. Viel Vergnügen beim Lesen!
Ewald Arenz
Familieneinkauf
Ich will fahren!«, schrie Otto, als wir auf den Parkplatz fuhren. Otto ist drei.
»Die Polizei erlaubt es nicht«, sagte ich. Außerdem war der Parkplatz völlig überfüllt. Theo lächelte überlegen und machte Otto wortlos klar, was er von der Polizei und einem Vater hielt, der Angst vor ihr hat. Theo ist siebzehn. Otto kicherte. Philly schluchzte leise los.
»Was?«, fragte ich resigniert. »Was ist schon wieder?«
»Immer nur Otto!«, heulte Philly. »Ich darf nie fahren, ihr hasst mich ja sowieso alle!« Philly ist dreizehn.
»Du hast schon wieder so eingeparkt, dass ich die Tür nicht öffnen kann«, sagte Juliane. Juliane ist meine Frau. Sie muss um die dreißig sein.
»Ich kann meine Tür auch nicht öffnen«, erklärte ich geduldig, »das Auto ist zu groß. Weil diese Familie zu groß ist. Wir müssen durch den Kofferraum.« Mein gefühltes Alter ist zweihundertelf, wenn wir alle zusammen einkaufen fahren.
Otto kletterte als Erster über die Rückbank und trat auf die Katze, die sich immer heimlich ins Auto schleicht. Sofort brach schreiendes und fauchendes Chaos aus, und ein rücksichtsloser Kampf um die Kofferraumklappe begann. Ich blutete noch immer am Ohr, als wir den Schuhladen betraten.
»Das sind Faschistenschuhe«, sagte Theo zehn Minuten später, »so was ziehe ich nicht an!«
Philly dagegen legte das sechste Paar auf den Kaufen-Haufen. Auf dem anderen lagen zehn. Ich trug weitere acht Paar auf einem und Otto auf dem anderen Arm, während Juliane Theo zu erklären versuchte, dass Herrenschuhe nicht dasselbe wie Herrenmenschenschuhe sind.
Otto entdeckte den Schuhputzautomaten und schrie: »Ich will fahren!«, drückte auf den Knopf, die Bürsten rollten an, und Julianes Tasche mit all unserem Geld verschwand irgendwo im Blechkasten. Es gab hässliche Geräusche, als der Riemen sich verwickelte und die Bürsten bremste. Dann stieg dünner Rauch aus dem Motor auf.
Eine gelangweilte Verkäuferin kam, polierte sich im Gehen die Nägel, hatte ein Handy zwischen Schulter und Ohr geklemmt und fragte, ob alles in Ordnung sei. Aber wahrscheinlich meinte sie das Telefon, denn sie ging wieder, ohne meine Antwort abzuwarten. Das war gut, denn ich versuchte, Juliane zu verdecken, die eben den Schuhputzautomaten aufbrach.
»Herrenmenschenschuhe«, erklärte Theo Otto, als wir den Laden verließen, und zeigte ihm seine neuen Schuhe, »sag’s nach!«
»Hemenesch!«, sagte Otto zufrieden.
Nur Philly heulte schon wieder.
»Was?«, fragten Juliane und ich im Chor.
»Die Tüten sind zu schwer!«, schluchzte sie. »Ihr hasst mich alle!«
Aber dann gingen wir Kaffee trinken. Und daheim durfte Otto in die Einfahrt lenken. Alles in allem war es ein sehr gelungener Samstagmorgen in der Stadt.
Schlüsselerlebnis
Was meine Schlüssel betrifft, bin ich ganz anders als meine Frau – fast pedantisch sorgfältig. Als ich also nach einem sehr langen Theaterabend gegen ein Uhr nach Hause kam, hatte ich meinen Schlüssel natürlich dabei. Leider hatte meine Frau den ihren diesmal auch gefunden, und der stak jetzt von innen im Schloss. Die Tür war zu, das Haus dunkel.
Ich klopfte vorsichtig, um die Kinder nicht zu wecken. Das gelang auch. Ich weckte niemanden. Die Tür blieb zu.
Ich klingelte einmal kurz. Leider ist meine Frau das, was man bei Hunden »schussfest« nennt. Außerdem ist sie Mutter dreier Kinder. Lärm hat auf ihren Schlaf so viel Einfluss wie Mondphasen auf den Friseur.
Ich klingelte jetzt länger. Philly hört beim Einschlafen mit ihren Kopfhörern gern Techno. Türklingeln kommen in dieser Welt nicht vor, weil sie meist unter 90 Dezibel liegen.
Und Theo? Theo feierte seit drei Monaten seinen achtzehnten Geburtstag vor. Keine Klingel der Welt dringt durch zwei Liter Guinness im Blut eines Jugendlichen, der sich für erwachsen hält.
Ich klingelte jetzt, bis innen die Batterie aufgab. Stille. Dunkelheit.
Dann – plötzlich – das Klatschen kleiner Füße auf dem Steinboden. Otto war aufgewacht.
Ich hörte eine verschlafene dreijährige Stimme: »Papa?«
»Ja«, sagte ich erfreut, »hör mal, Otto, zieh den Schlüssel raus und mach die Tür auf, ja?«
Schweigen. Dann die etwas wachere Stimme: »Papa, bist du ein Böser?«
Das war tagsüber ein beliebtes Spiel. Jetzt war ich aber vor allem müde. »Nein, Otto. Mach die Tür auf!«
Tapsende Füße. »Ich hol mein Swert, böser Mann. Dann slag ich dich!«
»Otto!«, rief ich. »Nein!«
Aber Otto war oben und kramte nach seinem Schwert. Ich setzte mich etwas resigniert vor die Tür. Die Katze kam und zeigte mir eine frisch gefangene Maus. Ich lobte sie pflichtbewusst.
Plötzlich war Otto wieder da: »Papa, darf ich fernsehn?«
»Was?«, rief ich. »Otto, es ist mitten in der Nacht. Weck Mama und sag ihr, sie soll die Tür aufmachen. Und du darfst nicht fernsehen!«
Otto dachte nach. Dann hörte ich ihn am Schlüssel hantieren. Leider drehte er in die falsche Richtung. Es war jetzt doppelt abgesperrt.
»Andersrum!«, rief ich. »Andersrum, Otto!«
»Papa«, fragte Otto stattdessen, »kannst du nicht rein?«
Froh sagte ich: »Genau! Kluger Junge. Jetzt dreh den Schlüssel …«
»Überhaupts nicht?«, fragte Otto. »Die ganze Nacht nicht?«
»Nein!«, sagte ich ermunternd. »Dreh den …«
»Dann«, sagte Otto fröhlich, »seh ich jetzt fern.«
Am Anfang winkte Otto mir noch fröhlich zurück, wenn ich an das Fenster des Wohnzimmers klopfte, aber später sah ich, dass er vor dem Fernseher eingeschlafen war. Freundlich und bläulich flackerte das Licht, als ich endlich aufgab und mich in den kalten Liegestuhl auf der Veranda legte.
Ich musste dann doch eingeschlafen sein, denn als die Sonne mich weckte, stand meine Frau vor mir, die Kaffeekanne in der Hand.
»Wieso hast du nicht geklingelt? Wieso schläft Otto vor Apocalypse Now? Und wieso«, fragte sie noch strenger, »hast du eine tote Maus in der Brusttasche?«
Die Katze auf meinem Bauch räkelte sich schnurrend in der Sonne, und ich zuckte nur die Schultern. Schlüsselfragen kann man nie wirklich beantworten.
Modediktat
Ich mag es, alleine zu frühstücken. Ich bin sehr gut gelaunt, wenn ich in größtmöglicher Stille morgens Tee trinken und lesen kann. Egal, was der Tag bringt: Wenn ich in Ruhe Zeitung gelesen habe, kann danach kommen, was mag. Glaube ich jedenfalls. Ich bin aber schon in sehr jugendlichem Alter auf die perfide familienpolitische Werbung der CSU hereingefallen. Deshalb habe ich Kinder und seit siebzehn Jahren keine Möglichkeit mehr herauszufinden, ob Morgenstunden wirklich schön sein können.
Ich goss eben den Tee auf, als Philly versuchte, die Badezimmertür zu öffnen. Der Lautstärke nach verwendete sie Plastiksprengstoff dafür. Mir fiel die Teekanne um.
»Theo, komm raus!«, schrie sie hysterisch. »Ich muss Haare waschen!« Dann schlug sie mit den Fäusten gegen die Tür. Philly ist dreizehn, und deshalb müssen ihre Haare im Dreizehn-Stunden-Rhythmus gewaschen werden.
Theo kam aber nicht raus. Wahrscheinlich las er auf dem Klo. Dafür kam Otto fröhlich aus Julianes Bett gestolpert: »Mama sagt, du sollst Philly hauen. Ganz fest. Machst du mir eine Flasche?«
Juliane ist fröhlich, wenn sie in größtmöglicher Stille morgens noch im Bett liegen kann. Sie ist aber damals auch auf die CSU hereingefallen, und ich kann mich nur noch vage erinnern, dass sie vor über siebzehn Jahren morgens mal gut gelaunt war.
Schließlich saßen wir alle am Tisch. Philly sah voller Verachtung auf das Müsli und sagte dann: »Papa, ich brauche heute 75 Euro!«
Ich bin, da ich in Bayern lebe, an zusätzliche Kosten für die Schule gewöhnt, aber trotzdem verschüttete ich etwas Tee.
»Wofür?«, fragte ich fassungslos.
»Für Chucks«, sagte sie, »soll ich’s mir aus deinem Portemonnaie nehmen?«
»Was sind Chucks?«, fragte ich.
»Schuhe«, sagte Philly, »alle haben sie jetzt. Ich mag kein Müsli. Haben wir Schokopoppies?«
»Turnschuhe«, erklärte Theo mürrisch.
Juliane mischte sich ein: »Bloß weil alle diese völlig überteuerten Leinendinger tragen …«
Philly verdrehte die Augen.
Ich versuchte es mit Logik: »Hör zu, Tochter, man muss sich nicht um jeden Preis anpassen. Und schon gar nicht um 75 Euro …«
Philly sah, dass Theo las, und füllte ihr Müsli schnell in seine Schüssel um. »Das ist keine Anpassung«, sagte sie, »das ist postfeministische Strategie. Ich tue so, als beuge ich mich dem Modediktat, und unterwandere damit die Globalisierungsversuche der multinationalen Turnschuhkonzerne und …«
»Das Kind hat Fernseh- und Radioverbot«, fuhr Juliane dazwischen, »vor allem für Arte, 3sat und Bayern 2. Und es kriegt keine 75 Euro.«
Philly verzog das Gesicht: »Ja, traumatisiert mich ruhig«, sagte sie weinerlich, »ich kann bloß sagen: Psychotherapie ist viel teurer als Chucks!«
Aber Juliane blieb hart. Beleidigt ging Philly zur Schule, gefolgt von einem still grinsenden Theo. Wir dagegen saßen müde und übel gelaunt beim Frühstück, voller Gewissensbisse, die sich erst besserten, als wir Otto auf dem Weg zum Kindergarten eine Spiderman-Kappe gekauft hatten. Die haben sie jetzt nämlich im Kindergarten alle – und wer will schon einen Dreijährigen traumatisieren?
Die Pokalkatze
Ich war mit der Katze auf dem Weg zum Tierarzt. Otto kann nämlich noch nicht lesen, hatte versucht, der Katze Sahne zu geben, und hatte ihr statt richtiger Sahne die Calvadossahne für die morgige Einladung aus dem Kühlschrank in den Fressnapf geschüttet. Wir hatten das erst bemerkt, als die Katze versuchte, rechts vom Türstock die Küche zu verlassen, und nach dem dritten oder vierten Mal das Gleichgewicht verlor, umkippte und in heiterer Resignation liegen blieb.
Katzen können nicht grinsen. Aber sie können schielen. Der Effekt ist ähnlich. Die Katzenschale wurde untersucht, die leere Schüssel Calvadossahne entdeckt, Otto geweckt und befragt.
Die Katze fing an, brünstig zu schreien. Philly kam alarmiert aus dem Bett, nahm die Katze auf den Arm und drohte schluchzend damit, zur Oma zu ziehen, falls ich sie nicht sofort zum Tierarzt brächte.
Ich wollte darauf hinweisen, dass es elf Uhr abends war, außerdem Samstag und die Katze einfach nur besoffen, aber Juliane hatte keine Lust, eine hysterische Tochter und eine angeschickerte Katze zu pflegen: »Eine von den beiden muss zum Arzt!«, hatte sie gesagt, und deshalb war ich mit der Katze auf dem Weg zum Tierarzt.
Es war aber dieser Samstagabend. Ich habe von Fußball weniger Ahnung als meine Katze von französischem Schnaps. Aber dass am Samstag oft Fußball gespielt wird, weiß ich. Der 1. FC Nürnberg schien ausgerechnet heute Abend irgendein wichtiges Spiel gewonnen zu haben, denn als ich auf die Straße zur Tierklinik einbog, war ich auf einmal in einem hupenden, singenden, fahnenschwenkenden Autokorso gefangen. Die Katze sprang entweder vor Schreck oder vor Begeisterung auf meinen Kopf. Die Fußballfans in den Autos neben mir schienen das für einen besonderen Ausdruck der Freude zu halten, denn sie winkten mir lachend und jubelnd zu.
Ich jubelte nicht. Ich habe nicht viele Haare auf dem Kopf, und die Katze konnte ihr Gleichgewicht nicht gut halten. Ich schrie vor Schmerz und gestikulierte wild. Aus den Augenwinkeln konnte ich sehen, wie mir zwei Polizisten freundlich zurückwinkten. Das Hupen war ohrenbetäubend, Schlachtengesänge stiegen in den Himmel über der Stadt, und ich war im Korso gefangen. Ich hupte wütend, aber es hatte keinen Sinn. Runde um Runde fuhr ich mit jubelnden Fußballfans um die Stadt.
Es war gegen zwei Uhr morgens, als ich endlich durch eine Lücke preschen konnte. Die Katze war längst eingeschlafen. Ihr Kopf baumelte über die Kante des Sitzes. Als ich von der Stadtautobahn nach Hause abbog, wurde ich angehalten. Polizeikontrolle.
Einer der freundlichen Polizisten von vorhin kam auf mein Auto zu. Er wirkte jetzt nicht mehr freundlich. Ich kurbelte die Scheibe herunter, er steckte den Kopf hinein, schnupperte und prallte zurück: »Sagen Sie, was haben Sie denn getrunken?«
Ich musste pusten. Schließlich ließen sie mich aber wieder fahren.
»Die tote Katze da«, sagte der andere Polizist kopfschüttelnd, »dürfen Sie aber nicht im Garten begraben.«
Ich nickte müde und ließ den Motor an. Aber bevor ich fuhr, hörte ich noch, wie der eine zum anderen sagte: »So sind die Fürther*. Wenn wir den Pokal gewinnen, fahren die mit einer toten Katze auf dem Kopf im Korso mit …«
Am nächsten Morgen hatte die Katze einen Kater. Wie wohl die meisten Nürnberg-Fans auch. Aber sie sah schuldbewusst aus, und das, fand ich, war nur gerecht.
* Nürnberg und Fürth sind Nachbarstädte und befinden sich in immerwährender fußballerischer Konkurrenz.
Hohe Zeit
Im direkten Vergleich mit den Paaren aus unserer Bekanntschaft haben wir schon mehr Zeit miteinander verbracht, als andere in zwei bis drei Ehen verbrauchen können. Manchmal allerdings habe ich das Gefühl, dass ich mehr Zeit in dieser Ehe verbringe als Juliane. Um genau zu sein: Zeit ist das Problem, das unsere Ehe – vor allem vor Theaterabenden – an den Rand eines Atomkriegs bringt.
»Es fängt um halb acht an, ja?«, fragte Juliane, während sie die Waschmaschine leerte.
»Ja«, sagte ich, »und wir müssen um sieben weg, weil ich um Viertel nach die Karten …«
»Ich bin gleich fertig«, sagte Juliane, »ich muss nur noch die Wäsche in den Trockner tun.«
Sie verschwand im Bad. Ich dagegen nahm mich zusammen, zog schon mal den Mantel über und sah dann im Bad nach, was Juliane tat. Juliane war nicht im Bad. Gut, wahrscheinlich war sie im Schlafzimmer und zog sich um. Ich ging hinaus und ließ das Auto schon mal an. Nach zehn hoffnungslosen Minuten im Auto erinnerte ich mich auf einmal daran, dass es vorhin im Haus geplätschert hatte. Wieso plätscherte es, wenn Juliane sich umzog? Ich rannte zurück ins Haus. Es war jetzt bereits kurz nach sieben. Im Haus plätscherte es immer noch, aber nicht im Bad. Eine böse Ahnung beschlich mich und ich riss die Tür zur Küche auf. Dort stand Juliane. Sie spülte ab.
»Weib!«, sagte ich mit mühsam unterdrückter Wut. »Es ist gleich Viertel nach sieben! Wir müssten längst da sein!«
»Die Uhr geht vor«, sagte Juliane leichthin, »ich kann es nicht leiden, wenn ich heimkomme und die Wohnung ist nicht aufgeräumt!«
»Wenn wir nicht bald weggehen«, knirschte ich, »brauchen wir nicht mehr heimzukommen! Los jetzt!«
»Nur noch schnell duschen!«, sagte Juliane und trocknete den letzten Topf ab.
Ich überlegte, ob ich sie einfach schnell ins Spülbecken tauchen und dann zum Auto zerren sollte. Juliane aber schlenderte mit zwei oder drei möglichen Abendkleidern ins Bad. Ich versuchte, tief ein- und auszuatmen, was die Ehe-Therapeutin empfohlen hatte, aber ich atmete natürlich viel zu schnell und mir wurde schwarz vor Augen. Es war jetzt 19.13 Uhr.
»Juliane!«, brüllte ich verzweifelt. Draußen hustete das Auto, und der Motor ging aus. Im Bad dagegen ging der Fön an. Wahrscheinlich war es auf Julianes Uhr noch Nachmittag.
»Sei nicht immer so hektisch!«, rief Juliane fröhlich zurück. »Das geht sowieso nie pünktlich los. Kannst du mir bitte das Kleid zumachen?«
Ich sah den Tacker, der im Gang auf dem Schrank lag, und hatte für einen Augenblick Lust, das Kleid zuzunageln. Zwei Minuten später saß ich wieder im Auto, ließ den Anlasser gurgeln und sah meiner Frau zu, die barfuß durch den Hof lief, Lippenstift in der linken und Schuhe in der rechten Hand.
»Du hättest schon mal rausfahren können«, sagte sie, als sie einstieg.
»Der Motor«, sagte ich mühsam beherrscht, »springt nicht an!«
Juliane sah mich vorwurfsvoll an: »Du hattest doch jetzt ewig Zeit, dich darum zu kümmern!«
Eine Bergtour, dachte ich rasend vor Wut, im Sommer machen wir eine Bergtour. Aber es muss wie ein Unfall aussehen.
»Zu langsam!«, rief Juliane eine Minute später, »du schiebst zu langsam, so springt er nie an!«
Dann ließ sie die Kupplung kommen, und ich fiel der Länge nach hin.
Ich bedeckte voller Angst die Augen, als sie beim Theater in die Bremsen trat, das Auto um die eigene Achse schlitterte und im absoluten Halteverbot zum Stehen kam.
»Siehst du?«, wies Juliane fröhlich auf die Uhr, »fast pünktlich.«
Die Uhr zeigte zehn nach acht. Vielleicht ist sie in Wirklichkeit eine Außerirdische, dachte ich resigniert, und kommt von einem Planeten, auf dem die Tage zweiundsiebzig Stunden haben. Das hätte was Gutes, dachte ich weiter, Ehen mit Aliens sind wahrscheinlich ungültig.
Noch einmal blieb sie vor einem Schaufenster stehen, um die Lippen nachzuziehen. Dann betraten wir das Theater. Genau rechtzeitig, um den Rest der Durchsage zu hören, die alle Besucher bat, jetzt ihre Plätze einzunehmen, und sich noch einmal für die technisch bedingte Verspätung entschuldigte. Klugerweise sagte Juliane jetzt nichts, sondern holte einfach vergnügt die Karten ab. Bleich und mit zusammengepressten Lippen folgte ich ihr in die Loge. Gott, fand ich, war nicht gerecht. Aber dann, als das Stück begann, verrauchte meine Wut allmählich, nur die Erschöpfung blieb, und schließlich schlief ich ein.
Erst als der Beifall aufrauschte, schrak ich hoch, sah auf die Uhr und fragte verschlafen: »Schon?«
Juliane sah mich streng an.
»Morgen«, sagte sie, »gehen wir ins Kino.«
»Morgen«, sagte ich und lächelte, »ist Lichtjahre weit weg!«
Kino
Kino ist eine wunderbare Erfindung für Menschen ohne Kinder. Für Eltern dagegen ist Kino meist nur eine Station weiter auf dem Weg in die gesellschaftliche Isolation.
»42 Euro«, sagte das Kaugummimädchen an der Kasse.
Ich bin Historiker. Ich weiß, dass Geld etwas Relatives ist. Aber ich bin kein Kommunist. Ich kann unmöglich mein Gesamtvermögen an einem Nachmittag verteilen.
»Die gehören nicht zu mir«, sagte ich und wies auf meine drei Kinder.
»Das wolle Gott!«, sagte Theo gelangweilt.
Philly lehnte sich über den Tresen und fragte das Kaugummimädchen: »Haben Sie Spucktüten?«
Otto fiel mit dem Ständer der Kinoprogramme um.
»42 Euro«, wiederholte das Kaugummimädchen, »und sehen Sie’s mal so: Das sind vier Komma zwei KinoPlusCredits. Wenn Sie hundert haben, kriegen Sie eine Freikarte.«
Ich hätte gerne gesagt, dass man für den Gegenwert von hundert KinoPlusCredits bereits zwei sehr ordentliche Kalaschnikows bekäme, und für die wiederum eine ganze Menge Freikarten, wenn nicht das Kino selbst, aber ich bin eher ein stiller Anarchist. Ganz im Gegensatz zu meinen Kindern.
Als wir Platz nahmen, drehte sich Otto nach kurzer Zeit um und fragte die Frau hinter uns vertraulich: »Hast du gepupst?«
Philly kicherte. Theo machte sein Don-Corleone-Gesicht.
Juliane sagte: »Die gehören nicht zu mir.« Die Frau dagegen warf Otto einen bösen Blick zu. Dann begann der Film. Eine deutsche Komödie.
Theo begann sich für das gestern erhaltene Zwischenzeugnis an seinen Eltern zu rächen und begleitete die Texte Katja Riemanns mit akustischen Untertiteln. Es waren Verse aus Dantes Inferno dabei, glaube ich, und ein paar Stellen aus Marquis de Sades Justine. Als Katja Riemann aber zu Ulrich Noethen sagte: »Du – im Licht der Morgenröte«, und Theo übersetzte: »Wenn ich dich am Morgen töte!«, wurde es im Saal allmählich laut, weil manche gingen. Juliane zischte Theo etwas zu, und er schwieg todbeleidigt. Ich blickte fragend zu Juliane hinüber, und sie machte grinsend das Zeichen für Handyentzug.