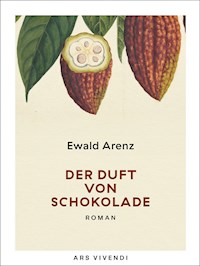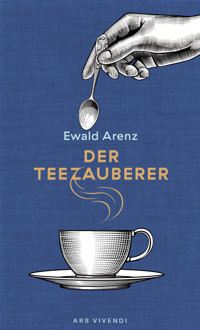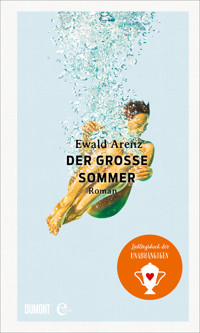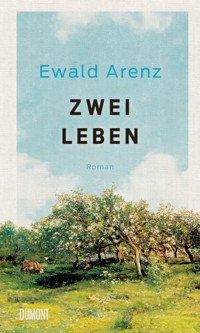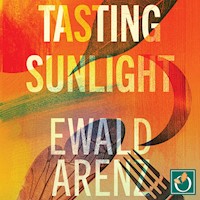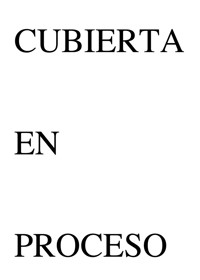Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin in den zwanziger Jahren Um Reparationsforderungen der Alliierten zu umgehen, erhält Diamantenschleifer Paul van der Laan von der deutschen Reichsregierung den Geheimauftrag, eine Reihe kostbarer Rohdiamanten für den verdeckten Verkauf zu schleifen. Zur gleichen Zeit wird ein ermordeter Schwarzer auf dem Balkon des Theaters am Nollendorfplatz gefunden - neben seiner Leiche liegt ein Rohdiamant. Die Kommissare Schambacher und Togotzes nehmen die Ermittlungen auf und stoßen schon bald auf das Diamantenmädchen … Ein funkelnder Kriminalroman über die Liebe, den Tod und das Geheimnis der Diamanten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Ewald Arenz
Das Diamantenmädchen
Roman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage September 2011)
© 2011 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: Philipp Starke, Hamburg unter Verwendung eines Werbeplakats von Ludwig Hohlwein, 1925 akg-images © VG Bild-Kunst, Bonn 2011
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-161-0
1
Die Photographen brachten sich in Stellung. Die beiden Saaldiener huschten mit hastigen Verbeugungen von einem zum anderen und gaben sich vergeblich Mühe, die Herren zu bitten, den Boden zu schonen: Die großen Holzstative schurrten trotzdem mit ihren Stahlspitzen auf dem Parkett der Halle. Lilli sah den alten Männern in ihren viel zu großen Uniformen mit einem flüchtigen Mitleid zu. Denen steckte noch die alte Zeit in den Knochen, noch vor zehn Jahren hatte man wohl niemanden darauf aufmerksam machen müssen, welches Benehmen bei solchen Anlässen angebracht war. Sie hatte schon viel zu oft gesehen, wie nachlässig, überheblich und schnodderig sich die Bildreporter der großen Berliner Zeitungen gerne gaben. Es hatte auch kaum einer von ihnen die Mütze oder den Hut abgenommen, obwohl die Saaldiener mit lächerlich übertriebenen Handzeichen immer wieder vormachten, was die Höflichkeit eigentlich gebot. Auch die meisten ihrer Kollegen hatten den Hut noch auf. Vielleicht lag es einfach daran, dass sie neben Notizblock und Bleistift nicht noch etwas in der Hand halten wollten, aber wahrscheinlich waren es einfach die modernen Tage. Alles hastete, eilte, telephonierte; jeder war so beschäftigt, dass er keine Zeit mehr hatte, den Hut zu ziehen – oder auf diese Weise wenigstens so tun konnte, als ob er wichtig sei. Berlin war zu einer Stadt geworden, in der die Uhren nicht mehr gemächlich gingen und gewichtig die Stunden schlugen, sondern nervös tickten und unruhig läuteten. Der Verkehr rauschte Tag und Nacht, die Straßenlaternen brannten bis zum Morgen, irgendein Café hatte immer auf. Es war wunderbar, aufregend, spannend – und trotzdem war da etwas von der Gelassenheit des Kaiserreichs verloren gegangen. Lilli musste auf einmal über die Saaldiener lächeln, die so gar nicht aufgeben wollten. Es hatte etwas Rührendes, wie sie nicht wahrhaben wollten, dass Livree, Adel und Etikette nicht mehr galten, dass sie Überbleibsel einer alten, versunkenen Zeit waren. Sie sah sich um. An den Wänden entlang standen einige mit rotem Samt bezogene Stühle, darüber hingen Porträts der großen Außenminister des alten Reichs; allen voran Bismarck, von dem es zwei Gemälde gab. Die hohen Fenster des Auswärtigen Amtes hatte man der kühlen Vormittagsluft geöffnet. Blendend weiß leuchteten schiefe Vierecke auf dem hellen Holzboden. Eine strahlende Herbstsonne war an diesem klaren Morgen über die Wilhelmstraße gestiegen und zeichnete sogar hier im Saal alle Konturen überscharf. Es war wunderbares Wetter, aber kein ideales Licht für Photos, dachte sie flüchtig, die Photographen würden dagegen blitzen müssen, und das machte die Schatten hart.
Die großen Flügeltüren öffneten sich, und Lilli konnte Staatssekretär von Schubert sehen, den sie bei einem Wohlfahrtsessen ihrer Redaktion kennengelernt hatte. Er war in der Tür stehen geblieben und sah über die bunte Versammlung der Reporter. Von Schubert trug einen tadellos sitzenden Cutaway, wie es sich für Staatsbesuche gehörte, und Lilli meinte, einen ganz leisen Spott in seinen Mundwinkeln sehen zu können, als er all die karierten Knickerbockers, die zu kurzen Jacketts, die zweifarbigen Budapester Schuhe und die zerknautschten Jagdmützen und Hüte sah. Sie machte sich eine Notiz darüber. Das konnte man vielleicht brauchen. Von Schubert sagte nichts, aber er erreichte innerhalb weniger Sekunden das, was die beiden Saaldiener in der letzten Viertelstunde nicht geschafft hatten: Es wurde still.
»Meine Damen und Herren«, sagte er dann, ohne die Stimme zu erheben, aber mit professioneller, präziser Artikulation, »Seine Majestät, der König von Irak, Emir Faisal.«
Er trat einen Schritt beiseite, und aus dem Dunkel des Konferenzraumes kam der erste wirkliche König, den Lilli in ihrem Leben sah. Komisch, dachte sie belustigt, als der Emir in die Helligkeit des Saales trat, ich bin im Kaiserreich geboren und aufgewachsen, aber erst in der Republik begegne ich dem ersten lebenden Monarchen. Doch dann riss sie plötzlich ganz unerwartet ein kollektives, scharfes Einatmen aus ihren Gedanken. Zwei Meter hinter dem Emir, der einen makellos weißen Burnus mit einem blauen Mantel darüber trug, einen beeindruckenden Dolch im Gürtel hatte und ziemlich gut aussah, wie Lilli fand, strich lautlos ein Panther in den Raum. Er war angekettet, aber der Emir hielt das Ende nur lose in der linken Hand. Seine Schulterblätter bewegten sich beim Gehen in einem so weichen Rhythmus auf und ab, dass Lilli unwillkürlich und unvermittelt ein völlig anderes, sehr erotisches Bild vor Augen hatte und merkte, wie ihr eine flüchtige Hitze in die Wangen stieg. Ein Panther. Mitten in Berlin. Lilli verstand jetzt, worüber von Schubert vorhin fast unmerklich gelächelt hatte. Es war ein fast diebisches Vergnügen gewesen, eine Vorfreude auf die Gesichter der ach so weltstädtischen Herren.
»Ein Panther!«, sagte jetzt einer von ihnen in einem Ton völliger Verblüffung, und ein paar andere lachten. Der Bann war gebrochen. Plötzlich brauste es. Alle riefen durcheinander.
»Sprechen Sie Deutsch?«
»Euer Majestät …«
»Müller, Die Weltbühne. Wie stehen Majestät zur Judenfrage …«
Dann, klar und hell und in Berliner Schnauze:
»Kiek ma hier rüber!«
Das war einer der Photographen gewesen. Von Schubert hatte es förmlich herumgerissen, und er war wohl schon drauf und dran, den Delinquenten für immer aus dem Haus zu weisen, aber dann sah er, dass der den Panther gemeint hatte und nun mit hochrotem Gesicht dastand. Der Emir hatte sich ihm nämlich zugewandt, wortlos, und dann wieder zu den anderen gesehen. Lilli unterdrückte ein Lachen und machte sich eilig Notizen. Was für ein Glück, dass sie auf die Schule der Englischen Fräulein gegangen war.
»May I ask a question, Your Majesty?«, rief sie klar und deutlich.
Blitzlichter glühten auf. Kameraverschlüsse klickten. Die Saaldiener zuckten zusammen, als sie das eilige Schleifen von Stativbeinen auf dem Parkett hörten.
Der Emir hatte sich zu Lilli gedreht und nickte knapp. Er sah wirklich gut aus, fand sie.
»Kornfeld, Berliner Illustrirte Zeitung«, stellte sie sich kurz vor, »would you mind telling our readers what you brought a panther for?«
Der Emir sah Lilli kurz und prüfend an. Sie gab dem Blick nicht nach. Dann hob er flüchtig die Augenbraue, wandte sich um und sagte leise zwei Sätze zu von Schubert. Dieser lächelte kurz und richtete sich auf. Es wurde leiser. Nur die Kameraverschlüsse klickten immer weiter.
»Seine Majestät, der Emir Faisal, meint«, sagte von Schubert jetzt wieder völlig gefasst, »dass die arabische Politik viel zu schwierig sei, um sie bei einem Pressetermin von einer Viertelstunde zu erklären; noch dazu in Europa. Deshalb hat sich Seine Majestät angewöhnt, zu solchen Anlässen regelmäßig einen Panther mitzunehmen, um für die Damen und Herren der Presse ein geeignetes Gesprächsthema zu haben.«
Der Saal lachte. Der Emir verzog keine Miene, aber von Schubert sah zu Lilli hinüber und nickte ihr zu. Lilli lächelte. Von Schubert rief jetzt einen Reporter nach dem anderen auf, und dann kam es doch noch zur Politik. Lilli schrieb fleißig mit. Es lohnte sich, die anderen fragen zu lassen; man bekam dann meist mehr mit, als wenn man selber fragte. Aber die Leser ihrer Zeitung wollten sowieso nicht wissen, was in Palästina geschah. Die wollten den Panther des Emirs auf einem möglichst großen Bild sehen und wissen, wo der Emir essen war und ob er den Dolch an seinem Gürtel schon mal gebraucht hatte. Sensationen. Exotische Bilder. Sie sah hinüber zu Hertwig, aber der war schon auf die Knie gegangen, um den Panther von unten zu bekommen, auf den konnte man sich verlassen. Faisal sprach von der Notwendigkeit, sich mit Weizman zu versöhnen, wenn man dauerhaften Frieden im Nahen Osten wollte. Von Schubert übersetzte für die Kollegen, die nicht Englisch sprachen. Lilli hatte den Notizblock in die Handtasche gesteckt. Sie war fertig. Der Panther hatte sich in eines der hellen Vierecke unter den Fenstern gesetzt. Es war etwas von Verlorenheit um ihn. Die Haarspitzen seines Fells glitzerten in der Sonne, und Lilli empfand zum zweiten Mal an diesem Tag das Gefühl eines flüchtigen Mitleids – der Panther passte hier genauso wenig hin wie die beiden Saaldiener. Schließlich war die Pressekonferenz beendet. Der Emir hatte sich kaum zum Gehen umgedreht, der Panther war kaum widerwillig aufgestanden, als alles Interesse schon wieder verflogen war, die Photographen schon geräuschvoll ihre Stative zusammenklappten, die Kollegen schon aus dem Saal drängten und Zigaretten angesteckt wurden. Von Schubert fing Lillis Blick auf und gab ihr ein Zeichen, sie solle noch bleiben. Dann hielt er dem Emir die hohen Türen auf und begleitete ihn durch den Konferenzraum aus dem Saal. Für einen Augenblick war Lilli allein. Die plötzliche Stille, zusammen mit der kühlen, reinen Herbstluft, die durch die offenen Fenster kam, war wie ein Aufatmen. Das gibt es so selten, dachte sie, alles ist schnell geworden, und ich renne mit.
Von Schubert kam zurück, diesmal allein.
»Fräulein Kornfeld«, sagte er lächelnd und schüttelte ihr die Hand. Die Förmlichkeit von vorhin war verschwunden und hatte einer natürlichen Höflichkeit Platz gemacht. Von Schubert bewegte sich im Cut völlig unbefangen.
»Der Panther war eine Überraschung, was?«, grinste er bubenhaft. »Da waren die Herren nicht drauf vorbereitet.«
»Na, ich auch nicht«, sagte Lilli und lächelte ebenfalls, »was verschafft mir denn die Ehre dieser kleinen Privataudienz?«
»Ach«, sagte von Schubert mit gut gelaunter Nachlässigkeit, »nichts Wichtiges. Ich wollte Sie eigentlich nur etwas fragen. Aber …« Er machte eine Handbewegung, die den Saal umfasste, »das könnten wir ja vielleicht auch bei einem Kaffee tun. Darf ich Sie einladen?«
Lilli war etwas überrascht. Schließlich hatten sie sich erst einmal bei diesem Essen damals unterhalten, und sie hatte sich schon etwas geschmeichelt gefühlt, dass er sie vorhin überhaupt wiedererkannt hatte. Sie sah auf die Uhr; eigentlich hatte sie gar keine Zeit.
»Also – für eine halbe Stunde bin ich gut. Danach müssen Sie wahrscheinlich sowieso weiterregieren, und ich muss in die Redaktion. Wie soll Berlin sonst von Ihrem Panther hören?«
Sie verließen den Saal und gingen die breiten Treppen hinunter. Lilli kam ein Gedanke, und sie musste lachen.
»Was?«, fragte von Schubert höflich.
»Wenn denn der Panther …« sie stockte kurz, weil sie fürchtete, einfach albern zu sein, aber irgendwie interessierte es sie dann doch: »Wenn der Panther denn dann mal … also wenn er raus muss, wird er dann von Ihren Saaldienern im Tiergarten Gassi geführt? Oder die Wilhelmstraße auf und ab? Wie habe ich mir das denn vorzustellen?«
Von Schubert war amüsiert.
»Andere Sorgen haben Sie nicht? Ehrlich gesagt – ich weiß es nicht. Und wenn der Panther bei seinem kleinen Ausflug jemanden frisst, dann ist das zum Glück eine Staatsaffäre, und Dr. Stresemann ist dafür verantwortlich, nicht ich.«
Sie waren auf die Straße getreten. Es ging gegen halb elf Uhr, und der Morgenverkehr war etwas abgeflaut. Am Straßenrand standen vereinzelt die schweren schwarzen Autos der verschiedenen Ministerien. Manche Chauffeure nutzten die Zeit, um die Haube zu polieren oder die Scheiben zu putzen, aber die meisten standen einfach zusammen, hatten die Mützen aus der Stirn geschoben, rauchten und lasen sich aus der Zeitung vor. In ihren Uniformen mit langschäftigen Stiefeln und Lederjacken sahen sie fast aus wie Soldaten.
Lilli blinzelte in die Sonne. Vor anderthalb Stunden war es noch sehr kühl gewesen, jetzt wurde ihr in ihrem Tweedkostüm fast zu warm.
»Nur um die Ecke«, sagte von Schubert und nahm sie leicht beim Arm, »da ist ein sehr nettes Café.«
Sie saßen an einem Ecktisch am Fenster. Lilli hatte sich Kaffee bestellt, von Schubert hatte eine heiße Schokolade mit Schlagsahne vor sich. Er lächelte charmant und wies auf die Tasse:
»Eins meiner Laster … Süßigkeiten.«
Lilli lächelte auch, aber sie war jetzt doch gespannt, was von Schubert von ihr wollte, und deshalb antwortete sie nicht. Er schob mit dem Löffel die Schlagsahne etwas beiseite, blies über die heiße Schokolade und nahm vorsichtig einen Schluck.
»Fräulein Kornfeld«, sagte er dann, »wissen Sie, wie viel das Reich jedes Jahr an Reparationen an die Alliierten zahlen muss?«
Lilli hatte so ziemlich jede andere Frage erwartet. Verblüfft zuckte sie mit den Schultern.
»Ich habe keine Ahnung!«
»Ja«, lächelte von Schubert, »wir auch nicht.«
Er lehnte sich zurück und genoss Lillis überraschtes Gesicht. Er sah genau so zufrieden aus wie vorhin, als der Panther den Raum betreten hatte. Anscheinend mochte von Schubert diese kleinen unvorhergesehenen Wendungen.
»Es ist einfach so«, erklärte er dann, während er an seiner Tasse Schokolade nippte, »dass die Höhe nirgends festgelegt ist. Wir haben keine Ahnung, wie lange und wie viel wir zahlen müssen. Wir wissen nur, dass wir jedes Jahr unglaubliche Summen an Goldmark – keine Reichsmark, Goldmark – an England, an die Staaten und vor allem an Frankreich zahlen müssen. Von Kohle und Eisenbahnen und Weizen und Roggen und allem anderen mal abgesehen.«
Lilli sah auf die Uhr. Sie wusste nicht, was von Schubert von ihr wollte, aber einen Vortrag über die Reichsfinanzen brauchte sie jetzt nicht unbedingt. Oder versuchte er gerade, auf bizarre Weise mit ihr zu flirten?
»Herr von Schubert«, begann sie, aber er unterbrach sie lächelnd.
»Ich weiß, dass Sie das wahrscheinlich nicht sehr interessiert. Ich nehme an, Sie haben Ihr Auskommen. Die Berliner Illustrirte zahlt ganz gut, denke ich.«
»Wie Sie sagen«, gab Lilli reserviert zurück, »ich komme aus. An das Gehalt eines Staatssekretärs reicht es noch sehr lange nicht hin.«
Von Schubert lächelte wieder:
»Sie sind selbstverständlich eingeladen.«
Lilli reichte es jetzt eigentlich. Das war frech gewesen. Sie zog ihre Handtasche zu sich heran – die meisten ihrer Herrenbekanntschaften begriffen, dass das ein Signal zum Gehen war. Von Schubert blieb vergnügt und gelassen.
»Fräulein Kornfeld, bitte! Geben Sie mir eine Minute, ja?«
Lilli nickte. Der Staatssekretär wurde plötzlich ernst und beugte sich ein wenig vor. Das Revers seines Cuts streifte raschelnd über das gestärkte weiße Hemd.
»Die Reichsfinanzen«, sagte er, »werden von den Alliierten Jahr für Jahr kontrolliert. Wir zahlen solche ungeheuren Summen, dass wir manchmal nicht mehr wissen, wo wir noch sparen sollen. Wir können das Arbeitslosengeld kaum bezahlen, die Renten nicht und was weiß ich. Das Reich ist arm und wird jedes Jahr ärmer.«
»Na ja«, sagte Lilli nun wieder etwas interessierter, weil sie merkte, dass er auf etwas Bestimmtes hinauswollte, »wir haben einen Krieg verloren. Aber von meinem Reportergehalt kann ich wirklich nichts abgeben, falls die Regierung mich eben um einen Kredit bitten wollte.«
Von Schubert lachte.
»Ich mag Sie, Fräulein Kornfeld. Aber jetzt zur Sache. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen, aber bei dem Essen neulich haben Sie erwähnt, dass Sie einen Freund haben, der Diamantenschleifer ist.«
Lilli erinnerte sich. Ja. Sie hatten von Paul gesprochen.
»Diamantenschleifer war. Er arbeitet nur noch für sich. Seit dem Krieg nimmt er keine Aufträge mehr entgegen, soweit ich weiß.«
»Ja«, sagte von Schubert, und jetzt wurde seine Stimme sehr leise, »das ist genau das, was wir brauchen. Es hat sich vor Kurzem herausgestellt, dass die Regierung überraschend zu einer … nun ja, nicht unerheblichen Menge Diamanten kommen wird, die vor allem nicht im Reichshaushalt auftaucht. Das heißt …«
»Das heißt«, ergänzte Lilli, »dass es sich hier um Werte handelt, von denen die Alliierten nichts wissen. Ich habe verstanden. Und Sie brauchen jemanden, der die Diamanten zu Geld macht, nehme ich an. Das wird nichts. Ich sage Ihnen ja – mein Freund arbeitet schon seit Jahren nicht mehr für die Branche.«
Soviel sie von Freunden und ihrer Mutter wusste, arbeitete Paul höchstens manchmal als Gutachter, auf jeden Fall verkaufte er keine Steine, die er schliff. Von Schubert löffelte etwas Schlagsahne aus seiner Tasse.
»Wir brauchen keinen Verkäufer«, sagte er dann, »das ist kein Problem. Wir brauchen einen Diamantenschleifer.«
»Aber bitte!«, sagte Lilli, die sich einerseits geschmeichelt fühlte, weil von Schubert sie ins Vertrauen zog, andererseits dieses Gespräch einigermaßen seltsam fand. »Es muss doch im Reich genügend Diamantenschleifer geben, die …«
Von Schubert unterbrach sie.
»Fräulein Kornfeld, bitte glauben Sie doch nicht, dass ich das nicht alles schon überlegt hätte. Das hier ist kein gewöhnlicher Auftrag, und es gibt einige Details, die mich dahingehend bewegt haben, einen Schleifer zu suchen, der in der Branche weitgehend unbekannt ist. Alles, worum ich Sie bitte, ist, den Kontakt zu Ihrem Freund herzustellen. Das Weitere würde ich dann mit ihm persönlich besprechen.«
Er lächelte sehr charmant und leerte seine Tasse Schokolade in einem Zug.
»Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie in Zukunft Presseinformationen durchaus auch mal vor den Kollegen erhalten, wenn Sie mir diesen kleinen Gefallen tun. Ja?«
Er legte den Kopf schief und sah für einen Augenblick aus wie ein treuherziger Dobermann. Lilli musste lächeln.
»Ich kann Ihnen nichts versprechen«, sagte sie, »er ist sehr … unzugänglich geworden.«
»Wie ich Sie verstanden habe«, antwortete von Schubert, während er aufstand und ihr galant in ihr Tweedjackett half, »sind Sie doch Freunde von Jugend auf. Und bei Ihrem Charme …«
Er ließ den Satz unvollendet. Vor dem Café reichte er ihr die Hand und verabschiedete sich eilig. Lilli sah ihm nach, als er – elegant und aufrecht – den Gehsteig hinunterging und dann in die Wilhelmstraße abbog. Paul also. Na ja, dachte sie, immerhin habe ich so einen Grund, ihn zu besuchen. Es war jetzt richtig warm geworden. Sie zog ihr Jackett wieder aus, nahm es über den Arm und machte sich auf den Weg in die Redaktion. Ein leichter Wind ging durch die Straßen Berlins und bewegte sacht die Blätter, die eben begonnen hatten, sich zu färben. Der Himmel war von dem vollendeten, kühlen Blau, das er nur nach einem langen Sommer haben konnte. Die Dächer der Häuser leuchteten rot, die der Kirchen am Pariser Platz kupfergrün. Sie dachte an Paul, und was er ihr vor Jahren gesagt hatte: »Wenn man einen Stein so schleifen könnte, dass er von sich aus strahlt – in allen Farben strahlt wie ein perfekter Oktobertag – dann, glaube ich, wäre ich für einen Augenblick, nur für diesen einen kleinen Augenblick, vollkommen glücklich.«
2
Es regnete in Strömen. Wenn es bis gestern so ausgesehen hatte, als würde der Herbst vor der Stadt haltmachen, war der Tag heute trotz der noch belaubten Bäume so düster wie im November. Dr. Schambacher saß im Benz auf dem Rücksitz, wartete auf seinen Kollegen Togotzes und fror. Der Fahrer hauchte immer wieder in seine kalten Hände. Die Scheiben des Wagens waren beschlagen, und die Luft innen fühlte sich fast so feucht an wie draußen. Schambacher schlug den Mantelkragen hoch und wischte mit seinem Taschentuch über die Scheiben, aber es nützte beides nichts. Er fror immer noch, und mehr sehen konnte man auch nicht. Togotzes war im Automatenrestaurant und kam nicht wieder. Verständlich. Dort war es vermutlich warm. Schambacher rückte die Fliege zurecht und sah auf die Uhr. Sie hätten eigentlich schon am Nollendorfplatz sein sollen, aber so war Togotzes. Schneidig bleiben. Wenn es drängte, gab er sich bewusst gelassen. Schambacher lächelte kurz und selbstironisch. Eigentlich mochte er ja genau das an Togotzes, aber heute regnete es einfach, und es war kalt. Er öffnete den Schlag einen Spalt und sah über die spiegelnde Straße hinüber zum Restaurant. Schemenhaft konnte er hinter der Scheibe die schlanke Silhouette seines Kollegen sehen. Anscheinend stand er immer noch vor dem Stullenautomaten. Nein. Jetzt kam er. Alle anderen wären bei dem Regen über die Straße zum Auto gerannt, aber Togotzes schlenderte quer über die Chaussee wie bei schönstem Sonnenschein.
»Wir kommen zu spät«, sagte Schambacher, als sein Kollege in den Wagen stieg. Der hielt ihm ein Paket hin.
»Leberwurst«, sagte er, »magst du doch, oder? Außerdem bist du erst achtundzwanzig, mein Lieber. ›Zu spät‹ ist in deinem Alter noch keine Kategorie.«
Schambacher nahm die Stulle und drehte sie hin und her.
»Du bist nur ein Jahr älter als ich«, sagte er höflich, »und ich mag Leberwurst, aber nicht um halb sieben Uhr morgens, wenn ich vor Dienstbeginn aus dem Bett geklingelt wurde. Warum hast du keinen Kaffee mitgebracht?«
»Dem Jlücklichen schlägt keene Stunde!«, verkündete Togotzes in breitem Berlinerisch mit vollem Mund. »Und dem Mörder ooch nich. Kaffee war aus.«
Er klopfte an die Scheibe, und der Wagen fuhr an.
Schambacher sah dem Schupo zu, wie er krachend schaltete, und wandte sich dann nachdenklich an Togotzes, der sich jetzt der Leberwurststulle seines Kollegen angenommen hatte.
»Ich frage mich, ob es vielleicht so was wie eine Mordzeit gibt«, sagte er im Plauderton, »so Stunden, in denen die meisten Morde passieren. Zwischen zehn und zwölf Uhr abends vielleicht.«
»Nee«, sagte Togotzes mit vollem Mund, »jemordet wird ümma.«
»Werner!«, seufzte Schambacher. »Wir sind doch unter uns. Studiert hast du auch. Kannst du bitte Hochdeutsch mit mir reden und dir das Berlinerische fürs Verhör aufheben? Es ist noch so früh!«
»Erst ab zehne!«, sagte Togotzes, grinste aber dabei und strich sich ein paar Krümel vom Trenchcoat. Sie passierten den Kurfürstendamm und bogen nach Schöneberg ab. Neben ihnen stiegen die Bögen der Untergrundbahn aus dem Boden. Ein Stück weiter sah man durch den Regen schon die Lichter des Theaters am Nollendorfplatz.
»Wir sind da«, sagte Togotzes zwei Minuten später und öffnete die Tür schon, bevor der Wagen stand, »kommst du?«
Schambacher steckte das Notizbuch wieder ein, in dem er hastig die wichtigsten Dinge notiert hatte, zog den Schirm zwischen den Sitzen hervor und stieg auch aus. Beide sahen nach oben. Im ersten Stock des Theaters waren über dem kleinen Zierbalkon die großen Fenster geöffnet, und man sah einige Polizisten, von denen zwei Wache standen, während die anderen mit Zeugen redeten. Es regnete jetzt so stark, dass die Dachrinnen das Wasser nicht mehr fassen konnten und es an den Fassaden herunterlief.
»Auf!«, sagte Togotzes, und die beiden rannten vor der wütend klingelnden Straßenbahn in langen Schritten durch knöcheltiefe Pfützen hinüber.
»Du gehst doch sonst nie ins Theater!«, sagte Schambacher boshaft zu seinem Partner, als sie die Treppen in den ersten Stock hochstiegen und dabei das Wasser aus den Mänteln schüttelten.
»Ja«, gab Togotzes grinsend zu, »bis eben war ich kulturell gesehen Jungfrau.«
Schambacher grinste auch. Es war ein Spiel zwischen ihnen. Togotzes gab gerne den schnoddrigen Polizeikommissar, den muskulösen Turner, der von den feineren Dingen des Lebens nichts wissen wollte. Schambacher dagegen rauchte sein Pfeifchen und markierte den kleinen Doktor. Tatsächlich hatten sie beide nach dem Krieg studiert, und Schambacher war trotz seines Doktortitels nicht viel weniger sportlich als Togotzes. Aber die Aufteilung hatte sich bewährt, nicht zuletzt bei Vernehmungen. Sie waren im ersten Stock angekommen. Es war auch hier kühl, weil ja die Fenster alle offen standen. Zwei Meter vor den Fenstern hatten die Schupos ein Handseil gespannt. Die Kommissare stiegen darüber, und Schambacher grüßte einen der Schupos, den er näher kannte, mit Namen. Dann traten sie an die Fenster. Draußen, auf dem Zierbalkon, der vielleicht anderthalb Meter breit war, lag der Tote mit dem Gesicht nach unten. Er hatte einen Smoking an, aber die Strümpfe, die man sehen konnte, weil die Hosenbeine nach oben gerutscht waren, leuchteten selbst durch das trübe Wetter hellblau. Daneben trug er auch Glacéhandschuhe. Es wirkte alles sehr sauber, aber das lag daran, dass irgendwo am Dach wohl ein Regenrohr gebrochen sein musste. Ein fast armdicker Wasserstrahl pladderte auf den Rücken des Toten herab. Durch die steinerne Balustrade triefte das Wasser auf die Markise über dem Theatereingang. Schambacher hob die Augenbrauen und Togotzes zuckte wütend mit den Achseln, als sich ihre Blicke trafen. Togotzes drehte sich um und rief die Schupos zu sich.
»Wer war als Erster hier?«, fragte er schneidend.
Zögernd meldete sich ein untersetzter Polizist mit seinem Tschako unter dem Arm.
»Was ist das?«, herrschte ihn Togotzes an und zeigte auf den Wasserstrahl. Der Schupo folgte seinem Arm und verstand erst nach einem Augenblick, was Togotzes meinte.
»Kriminalrat Gennat hat uns schon tausendmal erklärt, dass wir Schupos am Tatort nichts anrühren dürfen!«, verteidigte er sich trotzig. »Nicht das Geringste!«
Togotzes drehte die Augen zum Himmel und rief:
»Na, aber ihr sollt die Toten auch nicht ins Brausebad stecken! Hättet ihr nicht wenigstens einen Schirm aufspannen können? Wenn da irgendwann mal Spuren da waren, dann haben die sich jetzt wahrscheinlich über den ganzen Nollendorfplatz verteilt. Großartig!«
Er drehte sich um und stieg auf das niedrige Fensterbrett. Schambacher folgte ihm mit seinem aufgespannten Schirm über das andere Fenster und dann standen sie draußen im strömenden Regen neben dem Toten. Jetzt erschien auch ein weiterer, großer, schwarzer Schirm, der von einem der Schupos schuldbewusst und linkisch nach draußen über die Leiche gehalten wurde.
»Det is ja ’n Nejer!«, sagte Togotzes überrascht. In der Tat. Der Mann, der dort im Regen lag, war schwarz. Das war ungewöhnlich. Das hatten sie noch nicht gehabt. Schambacher blieb stehen und versuchte, sich alles genau einzuprägen. Er machte das immer, auch wenn photographiert wurde. Er hatte dann einfach ein besseres Bild vom Fundort. Togotzes dagegen kniete schon in den Pfützen und suchte nach einer Spur, die der Täter vielleicht hinterlassen hatte. Rund um den Hinterkopf des Opfers lag auf dem Stein des Balkons noch ein Hauch von Rosa, wo das Blut aus der Schusswunde fortgespült worden war. Der Polizeiphotograph war jetzt auch da, beugte sich aus dem Fenster und photographierte. Der Blitz ließ die Konturen des Toten in Schambachers Augen nachleuchten.
»Wenn Sie ordentliche Bilder wollen, werden Sie sich herausbemühen müssen!«, bemerkte er boshaft lächelnd.
»Das ist eine Hasselblad«, sagte Müller und deutete auf seine Kamera, »und ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, dass es regnet. Zahlen Sie mir eine neue?«
»Gennat wird Ihnen den Kopf abreißen, wenn die Photographien nichts taugen«, sagte Togotzes trocken, »wir beide hier sind schon nass bis auf die Knochen. Kommen Sie sofort raus und machen mir ein paar schöne Bilder von dem schweigsamen Kollegen hier.«
Manchmal ging Schambacher die Schnoddrigkeit seines Kollegen zu weit, aber meistens funktionierte sie. Müller stieg jetzt beleidigt, aber immerhin mit einem Bein aus dem Fenster und photographierte den Toten. Das Blitzlicht spiegelte sich in den tiefen Pfützen um ihn. Die Krempe des Hutes, der neben der Leiche lag, schwamm sogar ein bisschen auf und bewegte sich mit dem abfließenden Wasser. Der Regen prasselte und verschluckte die Straßengeräusche von unten. Schambacher gab es endgültig auf, trocken bleiben zu wollen, legte den Schirm weg und kniete sich auch hin. Die Hände des Toten hatten sich im Sterben geöffnet, aber wenn da jemals Wollflusen oder etwas anderes von einem Kampf gewesen waren, dann hatte der Regen sie längst fortgespült.
»Na gut!«, sagte Schambacher nach einer Minute vergeblichen Suchens, wollte aufstehen und die Schupos rufen, um den Toten hereintragen zu lassen, als ihm doch noch etwas auffiel. Der Zierbalkon hatte einen Abfluss, damit das Regenwasser nicht durch die Balustrade auf die Freitreppe vor dem Theater traufen sollte. Eigentlich war es bloß ein kleines Loch, das ins Fallrohr führte. Aber da es so stark regnete, hatte sich das Wasser gestaut und floss nur langsam ab. Und in der Pfütze, vielleicht zwei Zentimeter vor dem Rohr, lag ein Glassplitter im Wasser und wurde allmählich zum Loch hingetrieben. Schambacher sah hoch. Es gab keine zerbrochene Scheibe. Er langte vorsichtig in die Pfütze, um den Splitter nicht durch eine unachtsame Bewegung noch ins Loch zu spülen. Aber er hätte ihn dennoch beinahe verloren, denn das Ding wollte eben in den Abfluss rutschen, als Schambacher den Splitter, der sich mittlerweile schon im Fallrohr befand, noch schnell mit dem Zeigefinger gegen die Wand presste und dann millimeterweise allmählich hochschob. Schließlich hatte er ihn doch nach oben gebracht und konnte ihn aufnehmen. Aus seinem Zeigefinger quoll ein Blutstropfen heraus, der vom Regen gleich wieder abgewaschen wurde. Schambacher sah auf das Glas in seiner Hand.
»Werner«, sagte er dann langsam und mit stillem Vergnügen zu Togotzes, »sieh mal, was ich hier habe.«
Togotzes stieg über den Toten, kam zu Schambacher und ließ sich den Glassplitter geben, der eigentlich mehr wie ein Glassteinchen aussah.
»Und?«, fragte Togotzes. »Was ist das?«
»Das, lieber Graf«, sagte Schambacher sanft und fast zärtlich zu seinem Kollegen, »ist ein Diamant.«
3
Es musste ein Junitag im Jahr 1908 gewesen sein, an dem Wilhelm und Paul sich trafen, um, wie immer in diesem Sommer, Indianer zu spielen. Lilli hatte so lange gebettelt, bis Wilhelm die Augen nach oben gedreht und sie an der Hand gepackt hatte, um sie mitzunehmen:
»Wenn du dich ein einziges Mal beklagst, dass es zu schnell geht, lasse ich dich stehen. Dann darfst du nie wieder mit.«
Lilli hatte strahlend genickt. Sie liebte es, mit dabei sein zu dürfen, wenn die Jungs spielten. Und sie war stolz darauf, dass sie von allen Mädchen in ihrer Klasse am schnellsten rennen konnte. Vielleicht nahm Wilhelm sie nur deshalb widerstrebend mit, weil sie ein halber Junge war, wie Papa manchmal im Scherz sagte. Es war schon später Nachmittag, als sie durch den lang gestreckten Garten liefen, um über die Mauer in Pauls Garten zu klettern. Dort gab es eine Weide, deren Äste so geschickt wuchsen, dass man auf diesem Wege schneller bei Paul war, als wenn man vorne herum durch das benachbarte Haus ging. Außerdem musste man dann immer warten, bis einem Gerda geöffnet hatte. Gerda war van der Laans Hausmädchen und immer schlecht gelaunt. Lilli grauste sich ein bisschen vor ihr, weil sie einen kleinen Damenbart hatte. Außerdem sprach sie nicht ordentlich Deutsch, fand Lilli.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!