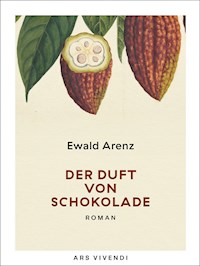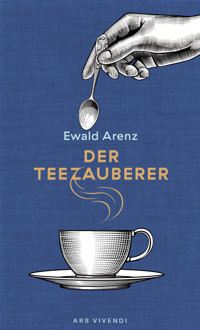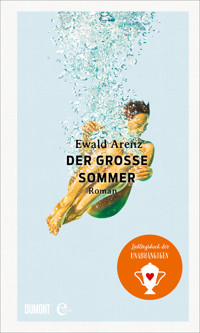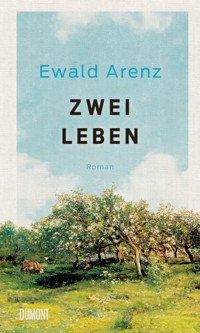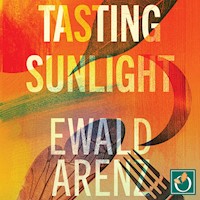10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach langer Zeit ist Elias der erste Mann, den Clara wirklich näher kennenlernen will. Und Elias stellt erstaunt fest, dass er sich bei Clara nicht ständig an einen anderen Ort wünscht. Sie genießen die ersten gemeinsamen Wochen in vollen Zügen. Stück um Stück erfahren sie mehr voneinander. Alles scheint zu passen, auch die vorherigen Leben. Dennoch macht der Altersunterschied der älteren Clara Angst. Elias wiederum weiß nicht so recht, wie man im Leben zu etwas steht, denn als Schauspieler versteht er es, sich immer wieder aus der Wirklichkeit ins Spiel zu retten. Als Clara ein Jobangebot in einer anderen Stadt annimmt, kommt es zum ersten Konflikt, denn sie will auf keinen Fall eine Fernbeziehung führen. Elias kann sich nicht sofort entscheiden, mit ihr zu gehen. Voller Wut trennt sie sich kurzerhand von ihm. Eine voreilige Entscheidung, wie sie bald feststellt, denn als Elias‘ Ex-Freundin sich mit Nachrichten von ihm meldet, gerät ihr ganzes Leben ins Wanken … »Ewald Arenz ist erneut ein wunderbares Buch gelungen. Feinfühlig erzählt er in ›Die Liebe an miesen Tagen‹ von großen, wilden Gefühlen.« ANDREA GERK, NDR KULTUR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nach langer Zeit ist Elias der erste Mann, den Clara wirklich näher kennenlernen will. Und Elias stellt erstaunt fest, dass er sich im Zusammensein mit Clara nicht ständig an einen anderen Ort wünscht. Sie genießen die ersten gemeinsamen Wochen in vollen Zügen. Kein Gezerre aneinander, kein Wunsch, den anderen zu verändern. Stück um Stück erfahren sie mehr voneinander. Clara besucht mit Elias dessen Tochter, und Elias begleitet Clara auf der Suche nach ihrer dementen Mutter, die sich mal wieder selbstständig gemacht hat. Alles scheint zu passen, auch die vorherigen Leben. Dennoch macht der Altersunterschied der älteren Clara Angst. Elias wiederum weiß nicht so recht, wie man im Leben zu etwas steht, denn als Schauspieler versteht er es, sich immer wieder aus der Wirklichkeit ins Spiel zu retten. Als Clara ein Jobangebot in einer anderen Stadt annimmt, kommt es zum ersten Konflikt, denn sie will auf keinen Fall eine Fernbeziehung führen. Elias kann sich nicht sofort entscheiden, mit ihr zu gehen, woraufhin sie sich kurzerhand voller Wut von ihm trennt. Eine voreilige Entscheidung, wie sie bald feststellt, denn als Elias’ Ex-Freundin sich mit Nachrichten von ihm meldet, gerät ihr ganzes Leben ins Wanken …
© lowarig
Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, hat englische und amerikanische Literatur und Geschichte studiert. Er arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. ›Alte Sorten‹ (DuMont 2019) stand auf der Shortlist »Lieblingsbuch der Unabhängigen« 2019 und platzierte sich als Hardcover wie als Taschenbuch auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Sein Roman ›Der große Sommer‹ (DuMont 2021), ebenfalls als Hardcover und als Taschenbuch auf den Spiegel-Bestsellerlisten vertreten, erhielt 2021 die Auszeichnung »Lieblingsbuch der Unabhängigen«. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Fürth.
Ewald Arenz
Die Liebe an miesen Tagen
Roman
Von Ewald Arenz sind bei DuMont außerdem erschienen:
Alte Sorten
Der große Sommer
Das Diamantenmädchen
E-Book 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Newspaper and Coffee © Tomasa Martín
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8277-9
www.dumont-buchverlag.de
1
Wie schnell der Garten verwildert war! In den ersten Jahren war sie immer noch herausgefahren. Im Spätwinter die Apfelbäume beschnitten. Im März das Frühbeet bepflanzt. Im Juni Johannisbeeren geerntet … alles Dinge, die sie vorher nie getan hatte. Alles Dinge, die Paul ihr gezeigt hatte. Waren es nicht immer die Frauen, die Gartenarbeit liebten? Ihr hatte das nie viel bedeutet, aber sie hatte immer gemocht, Paul dabei zuzusehen. Weil er so sehr in dem aufging, was er gerade tat.
Clara stieg aus dem Auto. Die Tür schlug heftiger zu als beabsichtigt. Es war ungewöhnlich windig. Unbeständig und kühl – so waren diese frühen Apriltage bisher gewesen. So wie sie. Unbeständig und kühl. Aber etwas hatte sich geändert, etwas war in Bewegung gekommen. Deswegen war sie so lange nicht hier gewesen, und deswegen war sie jetzt kurz entschlossen hergefahren.
Das Häuschen erschien ihr wie immer, wenn sie angekommen waren. Die blau gestrichenen Läden zugeklappt. Das Dach womöglich noch ein wenig niedriger als früher. Der alte Weinstock, dessen Stamm sich müde an die Fassade lehnte, hatte noch nicht ausgetrieben. Der Wein kam immer spät. Aber die Heckenrose am Zaun mit ihren jahrelang ungestutzten Ranken sah aus, als hätte sie Angelschnüre in Richtung des Hauses ausgeworfen. Das Rot der letztjährigen Hagebutten eine leuchtende Verlockung gegen den wilden, wolkeneilenden Himmel an diesem winddurchwehten blauen Frühlingstag. Wenn sie es so fotografierte, würde es sicher nicht so schwer sein, einen Käufer zu finden. Sie nahm die Kamera und versuchte ein paar Bilder. Ein wenig von der Stimmung konnte sie einfangen. Der Stimmung um das Haus. Nicht von der, die in ihr war und die sie eigentlich nicht anrühren mochte, um sie nicht zu zerstören. Sie klappte den Briefkasten auf. Der Schlüssel lag noch immer darin, begraben unter uralter Werbung. Und dann, wie mit einem starken Windstoß, war doch alles da. Die Erinnerung an die vielen Male, die sie gekommen waren, um zu renovieren, zu streichen, alte Möbel herzubringen, die sie auf Trödelmärkten gekauft hatten, und schließlich, um einfach ein Wochenende hier zu sein. Diese kleinen, schon fast vergessenen Zufriedenheiten, die erst im Rückblick zu Glück wurden. Dass man die Augenblicke nicht genug genossen hatte! Dass immer eine Kleinigkeit nicht gepasst hatte! Wenn Clara daran zurückdachte, fiel es ihr schwer, zu verstehen, dass sie das damals nicht aufgesogen hatte, in sich hineingetrunken, bis sie von diesem Glück satt war, erfüllt, so erfüllt, dass sie müde wurde und ihr weich die Lider zufielen vor Glück. Sie straffte sich und nahm die Kamera wieder hoch. Das würde nicht noch einmal passieren. Nie wieder.
Später saß sie auf der Veranda, die sie miteinander gebaut hatten. Sie hatte sich einen der Stühle aus dem Holzschuppen geholt und ihn gegen die Mauer gekippt. Sie liebte es, so zu sitzen. Schon seit der Schule. In der Schwebe; immer um diesen Punkt der Balance herum, den man nur für wenige Augenblicke halten konnte, ohne sich anzulehnen oder wieder nach vorne zu fallen. Manchmal leuchtete die Sonne rot vor ihren geschlossenen Augen auf, und sie spürte eine flüchtige Wärme im Gesicht, dann zog in rascher Folge wieder eine Wolke vorbei und es wurde ebenso schnell kühl. So allein und so still hatte sie noch nie hier gesessen. Die Stille ließ die alten Bilder aufsteigen. Sollten die Erinnerungen ruhig kommen, sie hauten sie nicht mehr um. Eine Bö fegte um die Hausecke, traf Clara und sie riss reflexhaft die Beine hoch, um nicht hintüberzukippen der Stuhl landete hart auf den Beinen, und sie musste lachen. Die Erinnerungen vielleicht nicht, aber der Wind. Die Realität. Das Heute. Nur, weil man im Gestern überlebt hatte, hieß das noch nicht, dass es nun wieder klappen würde.
Sie sah die Fotos durch. Ein paar Aufnahmen von den Innenräumen musste sie noch machen. Gerade war der Himmel ziemlich frei und das Licht innen sicher schöner.
Sie ging zurück ins Haus. Es war, als träte man in eine winterliche Kirche. Das Haus war seit Ewigkeiten nicht mehr geheizt worden, und die Kälte nahm ihr den Atem. Dabei schien die Sonne durch die Fenster und zeichnete alles freundlich und weich. Das lichtbraune Holz des niedrigen Tischs. Die verblichenen Polster der alten Sessel aus den Fünfzigerjahren. Sogar die verwaschen altweißen Kacheln der kleinen Küche. Alles sah honigwarm aus, ließ sich wunderbar fotografieren und war doch eiskalt. Sie atmete auf, als sie durch die Vordertür wieder ins Freie trat. Der Wind kam ihr auf einmal freundlich mild vor.
Das Museum meiner Liebe, dachte Clara. Zu verkaufen.
2
Elias rollte die schmale Gasse zwischen dem Friedhof und den ältesten Häusern der Stadt bis zum Kopf der Treppe, die in den unteren Teil der Stadt führte, stieg ab und nahm das Rad auf die Schulter. Er hätte wie sonst auch die längere Strecke um den Friedhof herum nehmen können, aber dieser Weg war der schönere. Diese Apriltage, bevor der Frühling mit Macht kam, die waren die schönsten. Wenn es noch kühl war und windig, so wie heute, aber die Sonne durch die ziehenden Wolken hindurch schon überall lichte, flüchtige Versprechen auf die Mauern und den Asphalt und die vorbeifahrenden Straßenbahnen zeichnete. Versprechen von etwas, das er gar nicht richtig benennen konnte. Manchmal quälte ihn das. Wie verlorene Töne eines wunderbaren Songs, die zu einem herüberwehten. Ein Song, den man unbedingt ganz hören wollte, aber man konnte nicht einmal genau sagen, aus welcher Richtung die Töne kamen, und wenn man anfing zu gehen, dann war man schon zu laut, um sie noch hören zu können. In solchen Momenten fühlte sich die Alltagszufriedenheit immer leer an. Als ob es viel mehr geben müsste.
Es war noch früh, und er hatte viel Zeit. Er hätte Vera nicht so früh verlassen müssen, aber manchmal hielt es ihn einfach nicht mehr bei ihr. Dann lag er neben ihr wach, hörte ihr ruhiges Atmen, und die Gedanken strömten durch seinen Kopf, ohne dass er einen davon weiterverfolgte. Es war, als ob man sich selbst beim Denken zusähe. Diese Morgenmomente waren die ehrlichsten. Genau dann hielt er es nicht mehr aus, dort zu liegen, weil er das Gefühl hatte, am falschen Ort zu sein. Hier am Fuß der Treppe in der morgenkühlen Stadt zu stehen, das fühlte sich richtig an. Er stieg auf und fuhr gemächlich die Straße zur Stadtmauer entlang. Es gab da einen Vorgarten, auf den er sich jeden Frühling freute. Er gehörte zu einer der wenigen Villen aus der Gründerzeit, die es in der Vorstadt noch gab. In dem Garten stand eine uralte Magnolie, deren Zweige bis über den zweiten Stock reichten. Jedes Jahr, seit er das erste Mal hier gewesen war, freute er sich wieder auf die Blüte. Es lag etwas Beruhigendes und Vertrautes darin, dass sich jedes Jahr die Knospen öffneten. Wenn er im Winter den Zaun passierte, über den die Zweige der Magnolie hingen, hielt er manchmal an, um die Ansätze der Knospen zu betrachten. Die kamen immer wieder. Er würde irgendwann nicht mehr vorbeikommen.
Flüchtig dachte er an Vera. Nicht, sagte er sich selber. Warum mussten Beziehungen immer schwierig sein? Warum konnte sie ihn nicht einfach lassen, wie er war?
Er war an dem Vorgarten angekommen, stützte sich mit einem Fuß auf den Sandsteinsockel und hielt sich am eisernen Zaun fest. Noch hatten sich die Blüten nicht geöffnet. Die brauchten wohl noch ein paar Tage. So sollte es sein. An den Magnolienknospen zupfte auch keiner, damit sie sich öffneten. Entweder blühten sie oder eben nicht. Ja, dachte Elias, als er sich abstieß und in die Pedale trat, Menschen waren keine Pflanzen und Beziehungen keine Magnolien. Aber das Bild war trotzdem passend.
Obwohl er ungewöhnlich früh kam, stand Mareike schon auf der Bühne und schob die Kübel mit den Gummibäumen hin und her. Elias setzte sich in den kleinen Zuschauerraum und sah amüsiert zu. Mehr hätte er auch nicht tun können. Mareike hatte großartige Ideen, konnte sie aber nicht immer so mitteilen, wie man das von einer Regisseurin erwartete. Er mochte die Atmosphäre eines Theaters am Morgen. Sie war in fast allen Häusern, in denen er bisher gespielt hatte, ähnlich. Die Stille, bevor die Techniker kamen oder die anderen Schauspieler. Es roch ganz leicht und trocken nach Schminke und unverwechselbar nach verbranntem Staub unter den Scheinwerfern. Das würde es irgendwann nicht mehr geben, dachte er, wenn sie auch hier LED-Scheinwerfer bekämen. Ob er es merken würde? Oft merkte man ja lange Zeit gar nicht, dass etwas fehlte. Wie alte Leute, die immer schlechter hörten und erst merkten, dass sie die Vögel nicht mehr akustisch wahrnahmen, wenn sie über ihnen scheinbar lautlos in den Bäumen sangen.
»Sieht das so besser aus?«, fragte Mareike atemlos, als sie alle Kübel in eine Reihe an den vorderen Bühnenrand gezerrt hatte. Elias hob beide Hände in einer unschuldigen Geste.
»Kommt darauf an, was du willst«, meinte er. »Wenn du uns auf diese Weise sagen möchtest, dass wir dir nicht gut genug sind … dass die Zuschauer uns besser nicht beim Spielen sehen sollten, dann ist es gelungen.«
»Man muss die Bühne nicht ganz sehen!«, sagte Mareike, komplett in ihrer Idee gefangen. »Ihr räumt sie dann nach und nach weg. Im Laufe des Stücks. So wie die Wahrheit auch nach und nach ans Licht kommt.«
Es war gar keine so schlechte Idee.
»Zimmerlinden und Gummibäume sind also unsere Lebenslügen. Hm«, machte Elias, »ich hatte es immer geahnt.«
Er hatte nur einen Scherz machen wollen, aber es waren diese Augenblicke, in denen sein Beruf so großartig war. Auch der Applaus, klar. Nach einem intensiven Spiel am Rand der Bühne stehen, wenn man allmählich aus der Rolle zurück ins Leben glitt und die Zuschauer wieder wahrnahm und merkte, dass man selbst es war, dem der Beifall galt. Das auch, ja. Aber die tiefen Augenblicke waren meistens die stillen, so wie jetzt. Die, in denen in seinem Inneren plötzlich ein Wort widerhallte wie in einer Kathedrale. Lebenslüge.
»Tja«, sagte er zu Mareike, während er aus dem Zuschauerraum zu ihr auf die Bühne stieg, »es gibt wohl kein richtiges Leben im falschen.«
»Guter Satz«, sagte Mareike nachdenklich. »Wirklich gut. Den könnten wir fürs Programmheft verwenden.«
»Ich weiß.«
Er war für eine Sekunde versucht, nichts weiter zu sagen.
»Ist nicht von mir. Hätte er aber sein können«, fügte er lächelnd, schnell, hinzu. Mareike grinste gutmütig.
»Die Probe fängt erst in einer halben Stunde an. Du musst noch nicht spielen.«
Sie kannte ihn schon ganz gut, dachte er, während er quer über die kleine Bühne in die Garderobe ging, die sich fast direkt anschloss. Das Theater war nicht groß. Im Treppenaufgang hingen die Plakate der Produktionen der letzten Jahre. Ein paar Jugendstücke. Eine Minioper. Natürlich ein Stück von Sarah Kane … das hatten sie nicht hingekriegt. Es war nicht schlecht, hier zu sein, dennoch vermisste er manchmal die großen Häuser. Den ganzen Apparat um einen herum. Man hatte dort immer das Gefühl, dass sich alles um einen drehte, selbst wenn man keine Hauptrolle spielte. Hier mussten sie sich sogar selbst schminken. Aber dafür konnte er Jule öfter sehen.
Er trat ans Fenster und sah in den Hinterhof hinab. Auf drei Seiten rote, fensterlose Ziegelfassaden. Er hätte noch enger gewirkt, wenn da nicht die große Linde in der Mitte gewesen wäre, die sich über die wenigen Tische wölbte.
Damals hatte sich alles richtig angefühlt. Mona und er, kurz nach der Schauspielschule. Das Theater: eine ganz neue Welt. Und sie beide neu an der Küste angelandet; voller Lust, sie zu durchstreifen, zu erforschen, zu entdecken. Alles, was dort war. Alles sein können, was man wollte. Aber vor allem: Kämpfende und Liebende.
Bühnenfechten. Dabei hatten sie sich kennengelernt. Die Fechtmeisterin war wirklich einmal Fechterin gewesen und zeigte ihnen ab und an die echten Stöße, Ausfälle, Paraden. Mona, die so sanft sein konnte, war dabei wild. Wenn du ohne blaue Flecken aus der Stunde kommst, ist es nicht richtig, hatte sie einmal lachend gesagt. Und sie beide immer zusammen: Stockkampf. Schwertkampf. Bühnenprügeleien. Die waren das Beste. Einmal hatten sie auf der Straße eine Schlägerei gemimt. Hatten die Leute zusammenlaufen und die Polizei rufen lassen, um sich dann, mitten aus den Ohrfeigen heraus, zu küssen und lachend Hand in Hand davonzurennen.
So war auch ihr erster Sex gewesen. Wie Bühnenfechten: Sie hatten wohl beide das Gefühl gehabt, dass sie nur so taten, als ob; dass alles noch ein Spiel war, niemals ernst sein konnte. Es war großartig. Und als Mona dann schwanger war … Jule hätten sie niemals anders nennen können als eben Jule. Wie hätte die Tochter von zwei einundzwanzigjährigen Theaterverrückten sonst heißen sollen? Und so wie sie ineinander verliebt gewesen waren, so waren sie dann in Jule verliebt. Bis irgendwann aus dem Bühnenfechten die echten Kämpfe wurden. Darüber, wie das Leben jenseits der Bühne aussehen sollte.
Wir können nicht spielen, dass wir zusammenleben, hatte Mona geschrien. Wir müssen es wirklich.
Alles ist nur ein Spiel, hatte er zurückgeschrien und es auch wirklich so gemeint. Wie anders sollte man das Leben sonst leben?
Sie hatten sich getrennt, wie sie sich gefunden hatten, aber es war ein ungleicher Kampf. Wie konnte man mit einem Schaudegen ein echtes Florett parieren? Er zerbricht, und das Florett trifft dich und geht durch dich hindurch, und plötzlich kannst du nicht mehr atmen vor Schmerz, weil deine Liebe auseinanderfliegt wie in einer Explosion. Liebe alleine reichte nicht. Liebe war wie ein weiches Metall. Sie musste erst im Alltag gehärtet werden, um biegsam und fest zugleich zu sein. Wie ein Florett. Mona hatte das verstanden. Ihm hatte das Gefühl gereicht, und der Alltag hatte ihn nicht interessiert.
Er stieß das Fenster auf und atmete die kühle Frühlingsluft, den Blick nachdenklich in die noch lichte Linde gerichtet. Damals …
Und trotzdem: Was für ein Glück Mona gewesen war. Für ihn. Für Jule. Weil sie trotz allem nie vergessen hatte, wie und weshalb sie sich damals ineinander verliebt hatten. Wenigstens das hatte zwischen ihnen die letzten fünfzehn Jahre gehalten.
Überhaupt hatte Mona recht gehabt: Man konnte das Leben nicht spielen. Wahrscheinlich war er deswegen zu früh zur Probe gekommen. Weil er schon wieder mit einer schwierigen Beziehung spielte.
»Diesmal aber«, vertraute er der Linde halblaut an, »diesmal aber kein Kind.«
3
Clara lehnte sich zurück, legte den Brief neben die Teetasse auf den Tisch und sah aus dem offenen Fenster in den wolkenzerfetzten Aprilhimmel.
Schweine!
Ein Brief! Sie waren nicht mal mutig genug, sie zu einer Besprechung ins Büro zu holen und ihr zu sagen: Sorry, Clara, du weißt, es läuft nicht gut. Alle Zeitungen müssen sparen. Du hast doch sowieso nicht Vollzeit gearbeitet. Schau dich einfach nach was anderem um.
Nein. Ein Brief.
… bedauern wir, Ihnen mitteilen zu müssen, dass aufgrund unumgänglicher Einsparmaßnahmen … eine Weiterbeschäftigung ist deshalb nur unter veränderten Bedingungen … würden wir uns freuen, Ihre Entscheidung innerhalb der nächsten vierzehn Tage …
All das wusste sie selbst: Welche Zeitung brauchte noch Fotografinnen? Für das, was die Zeitung an Fotos benötigte, reichte das Handy zehnmal. Dafür musste man keine ausgebildete Fotografin einstellen.
Verdammt! Sie hatte immer angenommen, dass es notfalls genau andersherum laufen würde. Dass sie die Stelle behalten würde, weil sie in Teilzeit arbeitete und weniger kostete. Aber anscheinend rechnete es sich mehr für sie, Stefan zu behalten. Der hatte außerdem noch kleine Kinder. Konnte sie auch verstehen. Sozialer Verlag. Mitarbeiterfreundlich. Aber leider nur zu den anderen.
Clara sah wieder aus dem Fenster. Gestern war der Frühling in der Luft gewesen. Heute trieb feiner Regen durch das Grau. Manchmal wehte die Feuchtigkeit in Schwaden herein. Eigentlich mochte sie das, aber jetzt gerade ließ es sie frösteln.
Sie nahm den Brief noch einmal in die Hand. Auf Honorarbasis! Da konnte sie gleich Pizza ausfahren.
Sie stand auf, weil sie irgendetwas tun musste. Weil sie nicht einfach sitzen bleiben konnte, wenn man ihr gerade den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Sie ging durch die Küche in ihr Arbeitszimmer und trat dort auf den kleinen Balkon. Schön. Jetzt musste sie sogar rechnen, ob sie sich diesen Blick in den Hinterhof noch würde leisten können. Sie hing sehr an der Wohnung. Es hatte damals fast ein halbes Jahr gedauert, bis sie endlich aus der anderen, viel zu großen Wohnung hatte ausziehen können und diese hier gefunden hatte. Die beiden Kastanien im Hinterhof. Ein Balkon, der ihr erlaubte, über die Häuser hinweg auf das breite, gemütliche Kupferdach der Schule mit dem imposanten Glockenturm zu sehen. Im Sommer konnte man von hier aus das Falkenpaar sehen, das dort nistete, und an den Abenden den unbeschwerten Flug der Schwalben. Obendrein eine lebendige Gegend. Sie wohnte gerne in der Stadt. Sie korrigierte sich in Gedanken: Sie wohnte gerne hier in der Stadt.
Ein kurzer Moment der Panik, dann atmete sie tief ein und erinnerte sich: Es gab viel Schlimmeres als das. Das hier war gar nichts. Sie verhungerte nicht. Sie musste nicht sofort ausziehen. Ihre Wohnung war immer noch ihre Wohnung, und der Kühlschrank war zumindest gestern Abend noch ordentlich gefüllt gewesen. Und außerdem war da noch das Häuschen. Warum war sie manchmal so? Warum erlaubte sie sich diese völlig unbegründete Angst? War das so, wenn man nicht mehr jung war? Ja. Sie war gekündigt. Aber das war alles. Sie musste sich etwas Neues suchen. Das ging tausend anderen auch so.
In Wirklichkeit war es keine schlimme Nachricht. Als Paul damals nach Hause gekommen war, hatte sie sich eben darüber geärgert, dass er wieder keinen Joghurt besorgt hatte. Normalerweise stand sie eher auf, aber an diesem Freitag hatte er so früh gehen müssen. Auf dem Frühstückstisch hatte das leere Joghurtglas gestanden. Eine dieser Kleinigkeiten. Lächerlich, wenn sie heute daran dachte. Aber vielleicht verhielt man sich so, wenn man noch nicht wusste, was im Leben tatsächlich Bedeutung hatte. Dass man dann versucht, den anderen zu ändern, um nicht selbst gelassener sein zu müssen. Dass man am anderen zieht, ohne zu merken, dass man dadurch von ihm verlangt, einen selbst weiterzubewegen. Weil man nämlich stillsteht, wenn man so etwas tut.
Das leere Joghurtglas war wichtiger gewesen als die eigentliche Frage, als Paul vom Arzt nach Hause gekommen war. Vielleicht auch, weil man nie damit rechnet, dass diese Dinge einem selbst zustoßen. Man ist nie Teil der Statistik, die man liest.
Hast du Joghurt mitgebracht? Er war schon wieder alle. Warum …
Er war anders gewesen, als er die Tür aufgeschlossen hatte. Nicht bleich, wie es immer in den Büchern hieß. Nur anders.
Nein, hatte er still gesagt. Vergessen. Ich … der Arzt hat gesagt, ich soll ins Krankenhaus.
Was?
Sofort. Ich soll sofort ins Krankenhaus.
Sie hatte nicht gleich verstanden. So ist das manchmal. Etwas hören und etwas verstehen ist nicht das Gleiche.
Wieso?
Paul hatte sich an den Tisch gesetzt und wie verloren auf das Frühstück gesehen, das noch so freundlich dastand. Die Toastscheiben auf dem Tellerchen. Die gekochten Eier wie immer eingeschlagen in den roten Topflappen. Die Quittenmarmelade orangefarben im Morgensonnenlicht. Und, natürlich, das leere Joghurtglas.
Es hat gleich zu bluten angefangen, hat der Arzt gesagt. Er ist nicht mal bis in den Magen gekommen. Am Mageneingang ist ein Geschwür, und das hat gleich geblutet. Sie haben wahrscheinlich Krebs, hat er gesagt.
Damals, wie lächerlich, war das erste Gefühl Empörung gewesen. Wie konnte der Arzt einfach so etwas sagen? Wie konnte er so gefühllos, so unglaublich herzlos, so grausam sein?
Heute, dachte sie und sah auf den Brief mit der Kündigung, heute würde ich wollen, dass man mir die Dinge sofort sagt.
Was für ein Arschloch!
Paul hatte nur die Schultern gehoben, und sie hatte sich auf einmal entsetzlich gefühlt. Wegen des Joghurts. Weil auf einmal alles gefühllos erschien, was sie vorher gesagt und getan hatte. Das Frühstück. Ihr kleiner Ärger, der mit all dem seit Jahren Ungesagten zwischen ihnen zu einer unerklärten Wut auf ihn geworden war. Einer Wut, die sie in dem Moment nur noch auf den Arzt lenken konnte, weil Paul hilflos am Tisch saß.
Dieses Arschloch. Das kann gar nicht sein. Woher will er das wissen, wenn er den Magen nicht spiegeln konnte? Es kann alles Mögliche sein!
War es dann auch gewesen. Alles Mögliche. Und dazu gehörte auch Magenkrebs. Selbst bei jemandem, der gerade Mitte dreißig war.
Eine Kündigung war gar nichts.
Sie trat zurück in ihr Zimmer und an das Regal mit den alten Alben. Sie waren auf dem Rücken alle beschriftet. Das Papier längst völlig vergilbt, aber die Jahreszahlen in Tusche immer noch gut lesbar. Sie mochte, wie sich der früher schwarze, jetzt dunkelgrau verblichene schwere Karton anfühlte. Hatte sie schon immer gemocht. Rau. Ein wenig staubig. Sie setzte sich auf den Dielenboden und schlug das Buch einfach irgendwo in der Mitte auf. Ein Abzug, auf dem nur vier, fünf leere Tassen zu sehen waren. Der Zauber lag in den genauen Art-Deco-Linien der Formen: schmale dreieckige Henkel am dünnen, fast durchscheinenden Porzellan der Tassen, die das Dreieck verspielt wiederholten. Das Licht dagegen umspielte die scharfen Konturen der Porzellanränder und ließ sie durch einen feinen, kaum wahrnehmbaren Dunst weich und ihre Schatten wie dunkle Teiche erscheinen, über denen die Tassen schwebten. Das konnten kein Schwarzweißfilter auf Instagram und kein Effekt auf TikTok. Abzüge wie diese hatten bewirkt, dass sie Fotografin werden wollte. Schon als Kind, als die Alben noch bei Tante Elly im Atelier gestanden hatten, waren diese Bilder Fenster gewesen, durch die man neugierig hineinsehen konnte, in andere Häuser, Städte, Länder. Ja, in Welten sogar. In ihnen lag etwas zutiefst Tröstendes; eine Art Versprechen, dass es mehr gab als das eigene Leben.
Wahrscheinlich hatte sie deswegen irgendwann aufgehört, Paul zu fotografieren. Weil das Versprechen gebrochen war.
Sie sah sich das Foto noch einmal an. Wie hatte man vor hundertfünfzig Jahren glauben können, dass Fotos das Ende der Kunst wären? Sie erzählten ihre Geschichten nur auf andere Art. So, wie sie Geschichten erzählen wollte … und es in den letzten Jahren gar nicht mehr getan hatte.
Sie klappte das Album zu, stellte es zurück und stand auf. Geschichten erzählen.
Sie musste lächeln. Zeitung – das hatte sie ja sowieso nie für immer machen wollen.
4
Es war zu kühl, um draußen zu sitzen. Das Blau des Morgens war längst verschwunden und der Himmel einheitlich grau. Elias konnte Vera durch das große Fenster des Cafés am Lutherplatz an dem kleinen Tisch sehen, den sie am liebsten nahm. Sie las und sah versunken und dabei sehr schön aus. Die Haare zum Pferdeschwanz gebunden, das um eine freche Kleinigkeit zu stupsnasige Profil, das Buch in ihrer Hand. Wie für ein Foto.
Ich liebe die Bilder, dachte er, als er das Rad an einen Laternenpfahl schloss, die Bilder, nicht sie. Aber das war auch die Abmachung gewesen. Verlieb dich nicht in mich, hatte sie am Anfang lachend gesagt, als sie das erste Mal für zwei Tage verreist waren und am frühen Morgen in einem viel zu weichen Doppelbett in einer Pension lagen.
Werde ich nicht, hatte er damals ebenso lächelnd geantwortet und dabei das kleine überhebliche Gefühl unterdrückt, das hieß: Ich nicht. Aber du.
Sie sah auf, als er hereinkam, und legte das Buch auf den Tisch.
»Lange Probe? War Mareike zufrieden?«
Sie küssten sich flüchtig. Er setzte sich zu ihr auf die Bank. Vera mochte, wenn sie nebeneinandersaßen, wenn sich ihre Beine berührten, wenn er die Hand auf ihren Rücken legte. Am Anfang hatte er sich ihr immer gegenüber gesetzt, weil er fand, dass es schöner war, sich ins Gesicht sehen zu können, wenn man miteinander sprach. Aber vielleicht hatte sie recht.
Du hast gerne einen Tisch zwischen uns, oder? Immer ein bisschen auf Distanz.
Seitdem setzte er sich neben sie. Aber er tat es nur für sie. Weil sie es so lieber hatte.
»Ach was«, sagte er leicht, »Mareike ist nie zufrieden. Aber das ist ja gut. Ich mag das lieber als Regisseure, die einen nicht richtig führen. Die einem nie sagen, was sie sich eigentlich vorstellen. Und dann probierst du was, und sie …«
»… sagen: Mach bitte keine Angebote«, ergänzte Vera seinen Satz. Im selben Ton.
Warum gefiel ihm das nicht? Genau so erzählte er selbst doch auch. Aber es war, als nähme sie etwas an sich, das ihr nicht gehörte. Diese Theatersprache, diese alten Scherze zwischen Kollegen, die man immer wieder machte, das … es war einfach, als ob ihr nicht zustünde, auch in diesem Ton zu sprechen. Aber – egal. Es gab ja immer etwas, das einen am anderen störte. So wie sie nicht leiden konnte, wenn er sich ihr gegenübersetzte. Wahrscheinlich musste man das einfach hinnehmen. Es gab nichts Perfektes.
»Ja, so ungefähr«, sagte er. »Ach, ich glaube, es kann ganz gut werden. Du wirst es ja sehen.«
Vera freute sich.
»Hast du eine Karte für mich gekriegt?«
»Ja. Kein Problem – ich bin der Hauptdarsteller.«
Sie lachte.
»Es ist ein Zweipersonenstück …«
»Eben«, sagte Elias zufrieden, »siehst du?«
Sie nahm ihr Handy aus der Handtasche.
»Fährst du mit mir ein Haus ansehen? Wir könnten einen Ausflug machen. Da ist ein See ganz in der Nähe. Hast du Lust?«
Es gab ein paar Bilder, die sich selbst auf dem kleinen Display sehr hübsch ausnahmen. Er mochte alte Häuser. Die Bilder erinnerten ihn an die großen Räume seiner Kindheit, den Hausgang mit Solnhofener Platten, die im Sommer unter den nackten Füßen so wunderbar kühl waren, die schwere eichene Haustür.
»Wozu? Ich kann mir kein Haus kaufen.«
Warum war er so brüsk? Eigentlich hatte er Lust auf einen Ausflug. Es war … vielleicht war es einfach diese Art, ihn zu fragen. Er riss sich zusammen.
»Warum schaust du dir Häuser an? Du bist doch gerne in deiner Wohnung. Sie ist perfekt. Vor allem das Schlafzimmer.«
Er lächelte. Lehnte sich zu ihr hinüber und küsste sie. Manchmal überkam ihn das, und dann stieg in ihm ein warmes Gefühl für sie hoch. Das waren die schönen Augenblicke.
»O ja, das Schlafzimmer.« Sie lehnte ihr schlankes Bein an seines. »Warum bist du heute Morgen so früh weg?«
»Ich musste Mareike mit der Bühne helfen.«
Es war wahr und nicht wahr. Er nahm das, was sich später zufällig ergeben hatte, als Grund, weil er den eigentlichen nicht fassen konnte.
Die Bedienung kam, und er bestellte. Das Café war nur zur Hälfte besetzt. Die Musik leise und unaufdringlich. Das Zischen der Kaffeemaschine, das gedämpfte Klappern von Geschirr, das durchscheinende Gewebe aus Gesprächen, von denen man nur die Stimmung mitbekam, die man aber nicht verstand – er liebte das.
»Also, kommst du mit?«
Er nickte.
»Klar. Und wenn da ein See ist, gehen wir schwimmen.«
Er sagte es ganz ernst.
»Es ist April!«, rief Vera, aber dann merkte sie: Er zog sie nur auf. Ihre Züge hellten sich auf.
»Fein! Ich freue mich. Ich freue mich sehr!«
Sie trank aufgeregt ihren Cappuccino aus. Das war so hübsch an ihr. Man konnte ihr alles ansehen, jede Gefühlsregung. Ihr Gesicht war ein offenes Buch.
»Möchtest du noch einen?« Er deutete auf ihre leere Tasse. »Meiner kommt wahrscheinlich erst, wenn wir gegangen sind. Anscheinend wirst du bevorzugt bedient.«
»Weil ich hübscher bin«, sagte sie.
Er lehnte sich zurück.
»Die meisten Kellner orientieren sich am Portemonnaie, weniger am Aussehen ihrer Gäste. Ich habe Geld mit. Du hast wahrscheinlich keins dabei. Die Bedienung weiß es nur noch nicht und glaubt, du seist wohlhabend.«
»Weil ich hübscher bin«, wiederholte Vera.
Elias seufzte übertrieben.
»Wenn du es oft genug wiederholst, merke ich es mir vielleicht irgendwann. Nutz es aus und mach die Bedienung aufmerksam. Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Kaffee.«
Sie winkte dem Kellner, und er bemerkte sie genauso wenig, wie er Elias bemerkt hatte. Sie mussten beide lachen. In solchen Augenblicken, wenn man einfach an der Oberfläche blieb, fühlte es sich gut an und nicht falsch.
5
»Annemarie ist schon wieder weg. Ich muss mich jetzt erst mal hinlegen.«
Die Stimme ihres Vaters klang brüchig und alt. Wann hatte das angefangen?, dachte Clara flüchtig, während sie automatisch auf dem Display nach der Zeit sah. Papa war nie ein sportlicher, junger Typ gewesen. Immer ein Denker. Bedächtig. Nein, dachte sie und musste bei der Erinnerung spöttisch den Mund verziehen, nicht bedächtig. Verloren und unglaublich langsam in allen Alltagsdingen. Außer beim Reden. Da war er immer energisch, fast feurig gewesen. Wahrscheinlich war es das, was ihre Mutter dazu gebracht hatte, ihn zu heiraten. Wo sie doch in so vielen Dingen das genaue Gegenteil war. Reden, das konnte er. Denken konnte er. In praktischen Dingen war er so verloren, wie sie in ihnen geschickt gewesen war.
»Weißt du, wo sie hin ist?«
»Was?«
Clara drehte die Augen nach oben. Das sah er am Telefon zum Glück nicht.
»Papa! Kannst du bitte dein Hörgerät benutzen, wenn du mich anrufst?«
»Die Batterien sind leer. Da kannst du mir auch welche mitbringen. Das sind diese kleinen …«
Clara unterbrach ihn.
»Papa! Bitte! Weißt du, in welche Richtung sie gegangen ist?«
»Nein. Ich muss mich jetzt hinlegen. Ich habe Unterzucker gehabt und jetzt … kannst du kommen? Oder bist du in der Zeitung?«
Das fragt er mich jetzt, dachte sie. Nachdem wir schon drei Minuten telefoniert haben.
»Nein, ich bin nicht in der Zeitung. Die haben mir gekündigt. Was ist mit Jan? Kann der nicht fahren?«
Das Interesse ihres Vaters erwachte, ging aber in eine völlig andere Richtung.
»Wieso haben die dir gekündigt? Was ist passiert? Dürfen die das denn einfach so?«
Clara musste widerwillig lächeln. Wieso war ihr Vater so? Vergaß alles andere, sobald ein Thema auftauchte, das ihn interessierte. Sie könnte jetzt vermutlich noch eine halbe Stunde zuhören, wie er ihr dozierte, was juristisch erlaubt war und was nicht, wieso die Weltfinanz – was immer sie sein mochte – letztlich ihre Kündigung zu verantworten hatte, und so würde es weitergehen, ohne dass sie ein Wort sagen musste. Oder besser: ohne dass sie ein Wort sagen konnte. Das war wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Jan einen möglichen Anruf nicht angenommen hatte. Sie kürzte das Gespräch brüsk ab.
»Papa, ich fahre jetzt. Bis später.«
»Ist gut«, antwortete er und legte auf. Ohne Gruß. Vermutlich bereits mit all den rechtlichen Implikationen beschäftigt, die eine Kündigung seiner Tochter für den Weltfrieden bedeuteten.
Als sie aus dem Haus trat, spürte sie den feinen Nieselregen im Gesicht. Regen machte ihrer Mutter nicht viel aus. Besser Regen als Schnee. Im Winter war es immer viel schlimmer. Die Tage waren kurz und kalt und gefährlich. Jetzt, im Frühling, konnte nicht so viel passieren. Außer natürlich, dass sie sie nicht fand.
Sie brauchte über eine halbe Stunde bis in die westliche Vorstadt. Trotz allem gefiel ihr das, diese plötzlichen Ausbrüche aus dem Alltag. Wie wenn Hochwasser war oder heftiger Schneefall in einer Winternacht allen Verkehr stillstehen ließ. Ein Innehalten, das sie nicht selbst zu verantworten hatte. Eine Ausnahmesituation, in der andere Regeln galten. Nicht zur Arbeit gehen, alles unterbrechen, was man sonst tat, nur noch ein einziges klares Ziel vor Augen haben: die Situation bewältigen. Sie war ziemlich gut darin. Schwierigkeiten hatte sie mehr damit, in den Alltag zurückzukehren.
Die Wohnung ihrer Eltern lag in einem ziemlich hässlichen Mehrfamilienhaus, aber das Viertel war ganz hübsch. Man konnte die Dorfstruktur noch erkennen, auch wenn die Neubauten der Achtzigerjahre sie eingekreist und fast überwuchert und manche alte Bauernhöfe sich in Parkplätze mit Supermarkt verwandelt hatten. Zum Glück war sie längst aus dem Haus gewesen, als ihre Eltern die Wohnung gekauft hatten.
Wo war Mama? Sie fuhr langsam die Anwohnerstraßen ab, langsam genug, damit sie auch einen Blick in die Vorgärten und die Einfahrten werfen konnte. Hinter ihr hupte es immer wieder; sie machte eine ungeduldige Handbewegung aus dem Fenster, damit das andere Auto sie überholte, und setzte den Blinker. Der Wagen zog mit aufröhrendem Motor an ihr vorbei, um ihr auf diesem Wege mitzuteilen, dass sie zu langsam war. Das wusste sie selbst. Aber sie konnte sich ja kein Warnlicht aufs Dach montieren: Suche meine demente Mutter.
Meistens wanderte ihre Mutter in Richtung Innenstadt. Aber eben nicht immer. Es konnte genauso gut sein, dass sie durch irgendetwas abgelenkt wurde und dann in das nächstbeste Haus ging, wenn die Tür offen stand.
Systematisch fuhr sie Straße um Straße ab und hatte bei jeder Kurve den Gedanken, dass ihre Mutter gerade dann in der Straße hinter ihr auftauchte. Egal. Nicht suchen war auch keine Lösung. Sie schlich an einem älteren Mann vorbei, der im Regen seinen Hund ausführte. Als er zu ihr hinübersah, gab er ein Zeichen, anzuhalten. Clara stoppte und ließ das Fenster hinunter.
»Suchen Sie jemanden?« Der Mann deutete hinter sich. »Da war gerade eine alte Dame mit einer Katze auf der Schulter … die war etwas desorientiert … aber sie wollte sich nicht helfen lassen.«
Clara lächelte.
»Danke. Genau. Das ist meine Mutter. In diese Richtung?«
Der Mann nickte und deutete auf eine der Seitenstraßen. Sackgasse. Deswegen war sie nicht hineingefahren. Clara wendete. In der schmalen Straße erkannte sie ihre Mutter sofort an dem energischen Gang. Wie bitter das war! Mama hatte immer Angst davor gehabt, gebrechlich zu werden. Und das war sie nicht. Mit Mitte siebzig ging sie kein bisschen wie eine alte Frau. Aus der Entfernung hätte man sie für fünfzig halten können. Sie hielt neben ihr an, sah aus dem Fenster zu ihr hoch und war erleichtert.
»Hallo, Mama.«
»Toni!«, sagte ihre Mutter. »Da bist du ja endlich.«
Ungeduldig, aber erfreut, als ob sie seit Stunden verabredet gewesen wären. Ihre Haare waren durch die Feuchtigkeit etwas gekräuselt. Ihre Wangen rot vom Laufen. Die Katze auf ihrer Schulter hatte sie fest im Griff. Sie ging sofort um das Auto herum, um einzusteigen.
»Ich bin Clara, Mama.« Namen waren Schall und Rauch, und vielleicht war Tochter eben einfach Tochter. Ganz gleich, welche. Immerhin erkannte sie noch, dass sie zueinander gehörten.
»Na, wo wolltest du denn hin?«
Ihre Mutter deutete auf die Katze.
»Die …«, ihr fiel das Wort nicht ein. »Die … Flieger. Die Katze ist weggerannt, und die Flieger wollten sie … schroten.«
Clara übersetzte im Kopf. Raubvögel. Töten.
»Mama«, sagte sie beruhigend, »Raubvögel schlagen keine Katzen.«
»Ja ja«, sagte ihre Mutter. So wie früher, wenn sie keine Lust auf Diskussionen hatte, weil sie völlig anderer Ansicht war und sich sowieso nicht umstimmen lassen würde. Die Angst, dass Bussarde die Katze holen würden, die stammte noch aus gesunden Zeiten und war schon mindestens drei Katzengenerationen alt. Obwohl … man wusste ja nicht, wann das anfing. Vielleicht war das damals schon ein erstes Zeichen gewesen, und sie hatten es alle nicht bemerkt.
Mama hatte den Gurt zu sich gezogen und versuchte nun, die Zunge in die Lüftungsschlitze zu stecken. Clara half ihr.
»Sollen wir einen Kaffee trinken gehen?«
Das funktionierte fast immer. Mama hatte es immer geliebt, ins Café zu gehen. Das haben wir Kinder wohl geerbt, dachte Clara, oder wir sind von Anfang an so konditioniert worden. Plötzlich kam die Erinnerung an einen Wintervormittag – es musste ein Samstag gewesen sein. Mama hatte sie alle vier in eine Konditorei mitgenommen, wo sie einen Freund getroffen hatte. Aber es gab für die Kinder immer nur zwei Tassen Kakao, die man sich teilen musste. Papa hatte die Kanzlei erst aufgemacht und Mama immer zu wenig Geld gehabt. Seltsame Kindheit. Aber auch schön.
»Gerne!«
Wie leicht man ihr eine Freude machen konnte. Als Clara in der Sackgasse zurücksetzte, hatte sie einen Anflug von schlechtem Gewissen. Vielleicht war sie einfach nicht oft genug bei ihren Eltern.
»Weißt du was, Mama?«, sagte sie kurz entschlossen. »Vergiss den Kaffee. Wir gehen jetzt Sekt trinken. Du, die Katze und ich.«
Mama lachte wie früher.
Aus dem Nieselregen war richtiger Regen geworden, als sie wieder nach Hause fuhr. Sie nahm nicht den direkten Weg, sondern kreuzte fast so langsam wie vorhin durch Nebenstraßen und Gassen. Es war nicht viel Verkehr. Als ob die anderen Autos nicht nass werden wollten. Die Bäume in ihrem Viertel waren nicht mehr ganz kahl, aber heute sahen sie fast so aus wie im Herbst. Der Regen nahm allem ein wenig die Farbe. Die Hausdächer. Die Vorgärten. Das Kopfsteinpflaster: die ganze Stadt, die im Frühling manchmal so leuchten konnte, ein verwaschenes Pastell. Das Bild hatte eine verlorene Schönheit.
Sie stellte das Auto ab, nahm die Kamera und stieg aus. Es war schwer, Regen zu fotografieren. Obwohl es so wunderbare Regenfotos gab, sah man darauf eigentlich nie den Regen selbst, sondern nur, was er mit Stadt und Menschen tat. Das junge Paar, das sich gemeinsam den Mantel des Mannes über die Köpfe hielt und lachend über die Straße rannte. Die ältere Frau mit dem Kopftuch aus durchsichtigem Plastik, das es irgendwie aus den Siebzigern bis ins Heute geschafft haben musste. Schwer vorstellbar, dass die Frau das Ding schon in ihrer Jugend getragen hatte. Sie sah unglaublich altmodisch aus. Der glänzende Asphalt. Die Gischtfontänen, wenn ein Laster durch die Pfützen im Rinnstein fuhr. Die Straßenbahn, die durch die fast leere Stadt glitt. Clara versuchte, diese Bilder einzufangen, aber den fallenden Regen, das unablässige Rauschen, die graue Luft – das würde man auf den Fotos nicht sehen können oder zumindest nicht so, wie es in Wirklichkeit aussah.
Sie streifte durch den Regen und nahm hin, dass sie immer nasser wurde. Nein, sie genoss es sogar, weil sie endlich wieder etwas spürte, das über die Alltagsempfindungen hinausging. Der Regen schaffte es, dass die Einsamkeit sich in etwas verwandelte, das Alleinsein hieß. Er machte sie auf eine sanfte Weise traurig; eine Trauer, die nicht schmerzte, sondern in der ein Trost lag wie ein flüchtiges, kaum wahrnehmbares Aroma. Wie Wasser leicht süß schmeckte, wenn man zuvor etwas sehr Bitteres gegessen hatte, auch, wenn es nur Wasser war und sonst nichts. Es war lange her, dass sie sich so gefühlt hatte. Der Regen fiel wunderbar gleichmäßig, und da waren nur sie und der Regen.
Am Beethovendenkmal gab es eine Treppe nach unten in den Park. Als sie an ihm vorbeiging, fiel ihr das erste Mal in all den Jahren auf, wie ungewöhnlich es war, dass Beethoven saß. Sonst standen sie doch immer alle, die großen Männer. Goethe und Schiller und Bismarck und all die Wilhelms. Bestenfalls saßen sie auf einem Pferd, wodurch sie nur noch größer wurden. Aber der Beethoven hier – der saß. Zwar auf einer Art Thron, aber er saß und blickte missmutig über sie hinweg in die Stadt. Sie verzog den Mund. Ja, das gefiel ihr. Wahrscheinlich hatte er niemals für die Statue Modell gesessen, aber wenn es so gewesen wäre, dann sicher mit dieser leichten Verachtung für die Welt. Dieser ungnädige Blick … ihre Mutter sah auch so aus, wenn sie sie fotografieren wollte. Und das schon sehr lange. Als sie sich selbst nicht mehr schön fand, wollte sie keine Bilder mehr von sich haben. Das jedenfalls hatte sie noch nicht vergessen. Clara hatte ganz am Anfang die Idee gehabt, die Eltern jedes Jahr zu fotografieren. Immer am gleichen Tag. Aber ihre Mutter hatte irgendwann nicht mehr mitgemacht. Da war sie vielleicht Mitte vierzig gewesen und eine schöne Frau. Jünger als sie selber heute … Sie dachte daran, wie ihr Vater vorhin ihre Mutter begrüßt hatte, als Clara sie nach Hause gebracht hatte. Vor zwanzig Jahren hätte sie nicht geglaubt, dass ihre Eltern jemals so innig miteinander sein würden. Früher hatten sie immer sehr für sich gewirkt, nie miteinander, als führten sie ihre Leben unabhängig voneinander. Musste wahrscheinlich auch so gewesen sein, wenn sie so zurückdachte. Keine gemeinsamen Urlaube. Mama war die Königin gewesen und Papa ein rebellischer Fürstbischof. Sie lächelte in der Erinnerung. Wie es wohl war, miteinander alt zu werden?
Sie schüttelte den Gedanken ab und stieg die Treppen hinunter in den Park. Ein vergessener Ball lag unter einem der Büsche, an dessen erstem frischen Grün die Tropfen perlten. Ein gutes Bild. Sie machte ein paar Aufnahmen. Es spiegelte wider, was sie nur schwer benennen konnte: dieses schwebende Gefühl zwischen Trauer und Leichtigkeit, das sie – genauso wie echtes Glück – immer nur haben konnte, wenn sie allein war.
Als sie die Kamera senkte, tropfte es aus dem Saum ihres Pullovers. Jetzt war sie richtig nass. Zeit, nach Hause zu gehen. Das erste Mal seit Jahren fühlte es sich nicht an, als würde der Frühling wieder schal werden und keines seiner Versprechen erfüllen können. Sie verstaute die Kamera in der Tasche und zuckte die Schultern, denn vielleicht war auch das nur wieder ein Gefühl.
6
Sie fuhren mit ihrem Auto. Elias’ Wagen war schon wieder in der Reparatur. Während sie die Vorstadt durchquerten, sah er schweigend aus dem Fenster, wie die Gärten größer wurden und die Bebauung lockerer und sich dann das Land weitete. Er mochte diesen plötzlichen Übergang ins Offene. Der Himmel war von einem leichten Grau, und in die Kronen der Kastanien entlang der Landstraße war ein lichter grüner Schleier geworfen. Manche Felder waren schon angesät, andere waren noch fahl. Dieses Nebeneinander von noch nicht und schon spiegelte auf seltsame Weise sein Inneres. Dieses Gefühl, das im Frühling am stärksten war: dass alles noch kommen würde. Dass er auf etwas wartete. Dass sich in diesem Jahr erfüllen müsste, worum es eigentlich ging, das Leben.
»Woran denkst du?«
Vera fuhr gut. Ab und zu warf sie einen Blick auf ihr Handy, obwohl die Straße die ganze Zeit geradeaus ging.
»Daran, dass es Gefühle gibt, die man nur im Frühling hat.«
Vera sah kurz zu ihm hinüber.
»Verliebtheit?«, fragte sie. Ihr Lächeln öffnete eine Tür, durch die er nicht gehen wollte. Warum tat sie das immer wieder? Zuneigung einfordern, ein Geständnis. Klar, man konnte nicht anderthalb Jahre … na ja … zusammen sein, ohne Gefühle füreinander zu haben. Aber er wollte nicht nach diesen Gefühlen gefragt werden. Weil er in solchen Augenblicken feststellen musste, dass er für Vera nicht so empfand, wie es sein sollte. Dass er mehr nahm, als er gab.
»Ich bin gegen Liebe«, antwortete er leicht, »Liebe bringt immer alles durcheinander und ist für alle großen Kriege der Weltgeschichte verantwortlich.«
»Was für ein Blödsinn. Du hast bloß keine Lust, es zuzugeben, weil du dich dann angreifbar machst. Weil man schwächer wird, wenn man liebt.«
Die Landschaft wurde sanft hügelig, und er dachte, dass er sich die Gegend für eine Fahrradtour merken musste. Und weil ihm die Wendung nicht gefiel, die das Gespräch nahm, kehrte er zu ihrer ersten Frage zurück.
»Im Vorfrühling ist alles offen. Es ist ein Gefühl, als könnte alles passieren, auch das Große. Da ist dann so eine … es ist eigentlich keine richtige Sehnsucht. Ich kann das schwer sagen … es ist so, als ob es an einem zöge; sachte, aber immer spürbar. In die Ferne und nach oben, und du darfst für einen Moment nicht mal atmen, weil du für diese wenigen Augenblicke meinst, dass es wirklich irgendwo ein großes Glück gibt, das für eine Sekunde hell in der Ferne aufblitzt, wenn du nur still genug bist. Und dann wüsstest du, in welche Richtung du gehen müsstest. Zum Glück.«
Vera sah ihn nicht an, als sie nach einer kleinen Pause sagte: »Wenn du so redest, dann … ich weiß dann, was ich an dir mag. Wie kannst du nur so sensibel sein, und dann ist dir so oft alles ganz egal?«
Elias lachte und legte ihr die Hand auf den Oberschenkel.
»Ich bin Schauspieler. Die Sensibilität spiele ich nur.«
»Idiot«, sagte sie halb im Scherz, halb ernst, aber sie ließ seine Hand, wo sie war.
Vermutlich wäre der Weg nicht länger als zwanzig Minuten gewesen, aber sie fuhren zweimal an der fast unsichtbaren Abbiegung vorbei. Die Karte auf Veras Handy war nicht detailliert genug, und Elias hatte behauptet, das sei gar keine Straße, sondern nur ein Feldweg, der sie bestenfalls zu einem Lebkuchenhaus führen würde. Sie fuhren einen großen Umweg, bis sie schließlich doch auf der schmalen Straße endeten, die sie in den kleinen Ort führte. Es gab ein großes Wirtshaus, es gab eine Kapelle, und es gab eine Bäckerei.
»Soll ich dort mal nach Lebkuchen fragen?«
Elias lachte.
»Ja, ich geb’s zu, du hattest recht. Die Straße war richtig. Aber das heißt nicht, dass es hier keine Hexe gibt. Du hast doch die Besitzerin noch gar nicht gesehen, oder? Wo ist das Haus?«
Sie stiegen aus. Vera überprüfte noch einmal die Adresse.
»Holzgasse 18. Das muss dahinten sein.«
Sie liefen an der Kapelle vorbei über den kleinen Dorfplatz, der hauptsächlich durch eine Linde in der Mitte zu erkennen war, und dann in die Holzgasse. Elias gefiel das Dorf. Überhaupt nicht schick. An der niedrigen Mauer um die Kapelle und den kleinen Friedhof bauchte sich der Putz hie und da und war an manchen Stellen schon abgefallen. Elias klopfte im Vorübergehen mit dem Knöchel gegen eine der Blasen. Es klang hohl, und er widerstand der Versuchung, sie einzudrücken und den Putz abzubröckeln. Das hatte er als Kind gerne gemacht.
Auch die Häuser in der Gasse waren einfach; es gab noch zwei bewirtschaftete Bauernhöfe.
»Sieh mal.« Er deutete auf die Steintafel unter dem Giebel eines zweistöckigen Hauses. Die Grundmauern waren unverputzt und aus schwerem Jurakalk. Gebrochene Quader, nicht geschnitten. Vera sah hoch und las laut.
»Rottner. 1896. Das gefällt dir, oder?«
Elias hob die Hände in einer Geste der Kapitulation.
»Natürlich gefällt es mir. Das ist wie Heimkommen. Ich bin in so einem Dorf aufgewachsen. Aber glaube mir – das trügt.« Er deklamierte wie auf der Bühne. »Hinter all diesen schönen Mauern ist Enge. Enge des Herzens. Enge des Gefühls.«
Vera lachte.
»Na, jetzt wohnst du ja in der Stadt.«
»Nein«, sagte er wieder im Gesprächston, »natürlich ist das schön. Ich vermisse das oft. Einen Garten. Feuer machen können. Nackt auf die Terrasse gehen, wenn ich Lust dazu habe. Und ich verstehe, was dir gefällt. Aber du kannst dir kein Haus leisten, und ich kann mir kein Haus leisten.«
»Es ist doch nur so, als ob wir ins Museum gingen«, sagte Vera leicht. »Ich mag das. Du siehst, wie die Leute wohnen. Ihre Häuser erzählen Geschichten. Du doch auch, oder?«
Sie hatte recht. Er mochte das. Eigentlich. Aber es war wie so oft – es fühlte sich an, als wäre er dazu aufgefordert. Er wusste, es war eine kindliche Trotzreaktion, von der er nicht einmal sagen konnte, woher sie kam, aber sobald sie es aussprach, wollte er es sich auf einmal nicht mehr gefallen lassen.
Sie gingen ein paar Meter schweigend. Elias zählte die Hausnummern. Die Gasse machte eine Kurve nach links, es gab ein langes Anwesen, eigentlich eine Wiese mit einer baufälligen Scheune darauf. Sie war nicht mehr winterbraun, auch auf ihr lag schon ein durchsichtiger Teppich von Grün. Auf dem Dach saß eine Singdrossel, und ihr einsamer Gesang, dieses lockend sehnsüchtige Pfeifen und das vergnügte Gezwitscher dazwischen erinnerte ihn daran, wie sich für ihn als Kind der Frühling angefühlt hatte. Er blieb stehen und sah hoch zum First der Scheune. Die zwei Fahrspuren, die unter dem morschen Tor hindurch hineinführten, waren mit groben Steinen gepflastert, zwischen denen das Gras wuchs. Ein schönes Bild.
»Komm«, sagte Vera, »die Frau wartet sicher schon.«
»Ja«, sagte Elias. »Lassen wir die Frau nicht warten.«
Dann kam das Haus. Es war klein. Und ausgesprochen hübsch. Es war wohl vor einigen Jahren frisch gestrichen worden, aber die Farbe war schon wieder sanft verblichen. Eine verwilderte Heckenrose am Zaun wucherte so groß, dass ihre Ranken bis über das kleine Holztor reichten. Wenn Heckenrosen hundert Jahre so wuchsen, dachte Elias, dann konnte man sich schon vorstellen, dass man ein Schwert brauchte, um sich den Weg zum Schloss freizuschlagen. Aber das hier war kein Schloss. Es war wenig mehr als ein anderthalbstöckiges Häuschen.
»Da steht ein Auto.« Vera wies auf den Wagen, der vor dem Zaun parkte. »Vielleicht ist sie drinnen oder im Garten.«
Sie suchten nach einer Klingel. Es gab keine. Vera schob das Törchen am Zaun auf, und sie gingen zur Haustür. Sie war verschlossen, und auch dort gab es keine Klingel.
»Ich geh mal außenrum«, sagte Elias.
»Ich warte hier«, sagte Vera und versuchte, durch eines der Fenster zu sehen.
Der Garten war groß. Links und rechts führte jeweils ein schmaler Weg aus Backsteinen um das Haus herum. Auch der war, wie es aussah, lange nicht benutzt worden, und zwischen den Ziegeln spitzte das erste Grün hervor. Er bückte sich unter den Zweigen eines Holunders hindurch und stolperte, als er um die Hausecke bog, weil da unvermittelt die hölzerne Veranda begann, die zwanzig Zentimeter höher lag.
Clara hatte mit halbem Ohr Stimmen vor dem Haus gehört, aber nicht damit gerechnet, dass es schon die Interessenten sein würden. Es konnte noch nicht so spät sein, sie hatte das Handy im Auto gelassen und nicht auf die Glocken geachtet. Sie war ein weiteres Mal durch das Haus gegangen – es sollte außer den Möbeln nichts Privates mehr vorhanden sein. Obwohl alles privat war. Die Farbe an den Wänden, die Fliesen, die abgebeizten und geölten Türstöcke … was man so machte, wenn man sich eine Ruine kaufte, dachte sie mit einem kleinen Lächeln. Wenn man keine Ahnung hatte, wie viel Arbeit das in Wirklichkeit war. Ganz früher hatte sie manchmal von großen Herrenhäusern gesponnen … gut, dass sie nie in die Verlegenheit gekommen war, Geld aus dem Fenster werfen zu müssen. Selbst dieses Häuschen war ein Loch gewesen, aus dem man nicht mal ein Echo hörte, wenn man Geld hineinwarf.
Im Haus war es eiskalt. Man musste ein wenig warme Luft hereinlassen. Sie öffnete die Glastüren und sah, wie ein Mann auf die Veranda stolperte, kurz in die Knie ging, aber sofort wieder hochkam.
»Das hatte ich schon lange nicht mehr«, sagte Clara.
Elias rieb sich kurz über das Knie, aber er war nicht schwergefallen. Die Frau lehnte sich an den Türrahmen. Sie trug ein Kostüm; es sah ungewohnt modisch aus und passte gar nicht zu diesem kleinen Haus. Ob sie die Maklerin war? Vera hatte nichts davon gesagt.
»Was?«, fragte er.
Clara sah ihn kurz an. Man konnte schwer sagen, ob er Mitte dreißig oder doch schon über vierzig war. Auf jeden Fall jünger als sie. Er hatte etwas Jungenhaftes an sich, aber es gab auch ein paar feine Linien um seinen Mund, die … na, man wusste es nicht.
»Dass ein Mann vor mir auf die Knie geht, bevor er sich vorstellt«, sagte Clara trocken. »Das hatte ich lange nicht mehr.«
»Ich finde es so herum viel passender. Außerdem brauche ich mich dann nicht zu entschuldigen, dass ich einfach in Ihren Garten gekommen bin. Soll ich mich jetzt noch vorstellen, oder reicht Ihnen erst mal der Kniefall?«
Elias gefiel ihre Antwort, und deshalb war er frech. Manchmal gab es Leute, die anders reagierten als die meisten. Ganz selten. Solche, die nicht vorgaben, zu erschrecken, und dann fragten: Haben Sie sich wehgetan?, wenn es doch offensichtlich war, und weil man es eben so machte.
»Ich war eigentlich mit einer Dame verabredet«, sagte Clara jetzt. »Gehören Sie dazu, oder sind Sie zufällig auf meine Veranda gefallen?«
»Die Dame ist vorn und wartet auf Sie. Ich bin nur zur Unterhaltung dabei. Ist es wirklich Ihre Veranda, oder sind Sie die Maklerin?«
Clara musste lachen.
»Die Maklerin? Ich? Sehe ich so aus?«
Elias warf einen Blick in den Garten. Alte Obstbäume und dazwischen ein paar junge. Ein schiefer, uralter Schuppen. Ein völlig verwildertes Frühbeet, von dem man gerade noch den Betonrahmen erkennen konnte. Eine der Scheiben der hölzernen Abdeckung war gesprungen. Dann sah er wieder zu Clara.
»Im Vergleich zum Garten schon.«
Es gefiel ihr, dass sie nicht gleich wusste, was er ernst meinte und was nicht. Sie sah an sich hinunter. Wie lange war es her, dass sie so ein Gespräch geführt hatte? So leicht. Es ging um nichts, nur um das Vergnügen, sich geschickt Bälle zuzuspielen.
»Ich hatte die Wahl«, sagte sie, »entweder einen Gärtner oder eine Schneiderin.«
Elias lächelte.
»Wenn Sie sich eine Schneiderin leisten können, warum verkaufen Sie dann das Haus?«
Sein Ball hatte das Netz berührt.
»Denken Sie mal nach«, antwortete sie spöttisch, »oder schauen Sie sich mein Kostüm an.« Er musste lachen. Glück gehabt, dachte sie. Sie hätte die Frage nicht im Ernst beantworten wollen.
»Kommen Sie, wir öffnen Ihrer Frau.«
Sie stieß die Verandatür ganz auf. Elias trat ins Haus. Es war sehr kalt.
»Wir sind nicht verheiratet.«
»Ist das gut oder schlecht?«, fragte Clara und schüttelte schon unwillig den Kopf, bevor sie die Frage ganz gestellt hatte. Es ging sie nichts an. Es war eigentlich bloß eine Revanche für die Frage, warum sie das Haus verkaufte, und für die Frage konnte er nichts. Er hatte sie in ihrem kurzen Spiel gestellt und nicht, um sie zu verletzen.
»Sehr hübsches Haus. Ich mag es, wenn es nicht kaputtrenoviert ist. Wenn man die Ahnen nicht aus den Mauern vertreibt.«
Er sagt tatsächlich Ahnen, dachte Clara. Und konnte es nicht lassen zu bemerken: »Und Sie mögen es nicht, dumme Fragen zu beantworten.«
Sie waren an der Haustür.
»So wie Sie«, gab Elias schnell zurück, »so wie Sie.«
Clara öffnete die Tür.
»Hallo«, sagte sie und streckte die Hand aus, »Clara Wagenbach.«
»Vera Steiner«, sagte Vera unbekümmert und frisch; und mit Blick auf Elias: »Haben Sie sich schon kennengelernt?«
Fotogen, dachte Clara, sehr hübsch, und ärgerte sich im selben Augenblick. Wieso war das ihr erster Gedanke? Sie war doch keine zwanzig oder dreißig mehr, und außerdem hatte sie diesen Selbstvergleich nie leiden können. Und trotzdem. Manchmal waren ihr andere Frauen wie ein Spiegel und warfen ein Bild zurück, das nicht so war, wie sie sich selbst sah.
Elias war nicht schnell genug. Clara sagte leicht: »Ihr Mann ist schon vor mir auf die Knie gefallen. Ich fürchte, ich kann trotzdem nicht mit dem Preis runtergehen. Kommen Sie rein.«
Vera sah fragend zu Elias.
»Ich bin ihr auf der Veranda vor die Füße gestolpert. Nicht sehr elegant.«
Vera lachte.
»Typisch. Zu ungeduldig.«
Es stimmte nicht, dachte er, er war nicht so ungeduldig. Klar stolperte er manchmal oder flog sogar hin, aber das lag daran, dass er nicht gerne langsam ging. Er rannte immer. Nicht aus Ungeduld, sondern weil er es gerne tat. Zum ersten Mal fiel ihm auf, dass Vera sich nie schnell bewegte. Er hatte sie noch nie schnell laufen sehen. Er dagegen … er konnte keine Treppe langsam nehmen. Wie seine Mutter. Die rannte auch heute noch.
Clara ging in das kleine Wohnzimmer voran. Die Luft von draußen hatte es endlich etwas wärmer und freundlicher gemacht. Vielleicht war es gerade deshalb ein komisches Gefühl, dieses Paar hineinzuführen. Weil es mehr an den Ort erinnerte, den sie damals hatten. Kalt wäre einfacher und entfernter gewesen. Sie drehte sich um. Die Frau war stehen geblieben.
»Das ist sehr hübsch hier«, sagte sie, »toller Geschmack. Haben Sie das alles selbst gemacht?«
Clara nickte.
»Es hat ein paar Jahre gedauert.«
Es hatte wirklich lange gedauert, und manchmal hatte sie das Gefühl gehabt, dass nur noch diese gemeinsame Arbeit sie zusammenhielt. Aber dann war es ganz anders gekommen.
Elias sah Vera zu, wie sie vor dem Ofen in die Knie ging und die Klappe öffnete. Ein Zug stieß in den Raum und brachte den kalten Geruch von erloschenem Holzfeuer mit sich.
»Verkaufen Sie das Haus mit der Einrichtung?«, fragte Elias. Es interessierte ihn auf einmal wirklich.
»Das hängt davon ab«, sagte Clara. »Ich kann sie jedenfalls nicht mitnehmen. Meine Wohnung ist zu … sie ist schon ausgestattet. Ich kann das Haus natürlich räumen, wenn Sie es leer haben wollen.«
»Manches gefällt mir sehr gut«, sagte Vera schnell. »Darüber kann man ja immer noch sprechen, wenn wir uns dafür entscheiden.«
Wenn wir uns dafür entscheiden! Wieso sagte sie das? Spielte sie gerade Verliebt, verlobt, verheiratet?
»Keiner von uns beiden kann sich dieses Haus leisten«, sagte er knapp.
Das kam unerwartet. Clara sah die ungeduldige, ärgerliche Bewegung, die Vera Steiner mit dem Kopf machte. Und dann, wie sie gleich wieder gewinnend lächelte.
»Wir denken noch über die Finanzierung nach.«
Elias wollte gerade sagen, dass er sich ganz sicher keine Gedanken darüber machte, mit Vera ein Haus zu kaufen, aber Clara sagte nur: »Wenn es bei großen Entscheidungen keinen Streit gibt, sind Sie kein richtiges Paar. Harmonie bedeutet meistens Desinteresse.«
Elias musste lachen. Und da war sie wieder, diese überraschende Leichtigkeit. Eigenartige Frau. Vera lächelte. Clara ging in die kleine Küche voran. Die Solnhofener Platten auf dem Boden waren noch da. Elias betrachtete die leichten Kuhlen, die hundert Jahre immer gleiche Wege in den Stein geschliffen hatten. Die Kacheln an den Wänden waren in starken Farben gehalten; leuchtend und wie ein Akzent aus der Gegenwart in diesem alten Haus. Es sah frisch aus, fand er. Vera sah sich die Küchenhexe an.
»Gibt es nur diesen Herd? Sie kochen auf Holzfeuer?«
»Damit wird das ganze Häuschen geheizt. Der Ofen ist wasserführend. Sozusagen die Zentralheizung. Das hier war nicht dafür gemacht, für immer hier zu leben.«
Nein, war es nicht, dachte sie, aber das hatte sie damals noch nicht gewusst.
»Schick«, sagte Elias. »Und das Holz ist im Garten? Romantisch.«
»Wenn Sie im Winter morgens um sechs anschüren müssen, damit es warmes Wasser gibt, finden Sie das nicht mehr schick«, entgegnete Clara trocken.
»Ah, sehen Sie«, gab Elias zurück, »jetzt weiß ich, warum Sie das Haus verkaufen wollen. Sie sind keine Frühaufsteherin.«
Er hatte den Ball wieder aufgenommen. Zweiter Satz. Egal, ob die beiden das Haus kaufen wollten oder nicht – der Mann hatte Witz.
»Ich will das Haus gar nicht verkaufen«, sagte Clara in gespieltem Ernst. Dieses schnelle Hin und Her fühlte sich überraschend leicht und schön an. »Ich bin Sozialpsychologin und arbeite seit drei Jahren an einer Studie über Entscheidungsfindung in Paarbeziehungen. Das Haus gehört der Universität.«
Vera sah verunsichert zwischen Clara und Elias hin und her und verstand nicht sofort.
»Lassen Sie«, klärte Clara sie heiter auf, »es ist nicht wahr. Ich bin Fotografin. Aber anscheinend spielt Ihr Mann gerne. Wollen Sie das obere Stockwerk noch sehen?«
Vera nickte.
»Er ist Schauspieler. Deshalb. Ja, gerne. Wenn es oben genauso hübsch ist wie hier unten, bleiben wir gleich hier.«