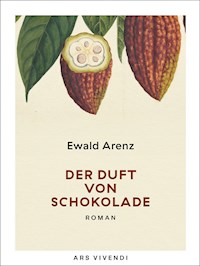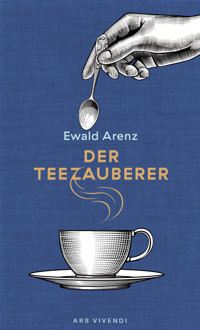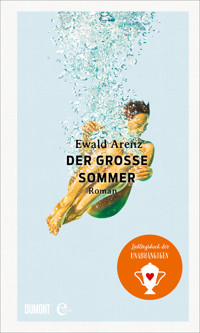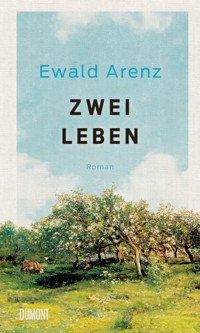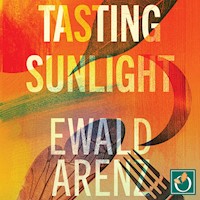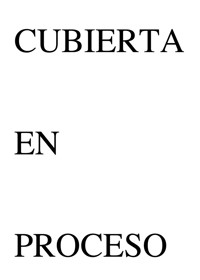10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sally und Liss: zwei Frauen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sally, kurz vor dem Abitur, will einfach in Ruhe gelassen werden. Sie hasst so ziemlich alles: Angebote, Vorschriften, Regeln, Erwachsene. Fragen hasst sie am meisten, vor allem die nach ihrem Aussehen. Liss ist eine starke, verschlossene Frau, die die Arbeit, die auf dem Hof anfällt, problemlos zu meistern scheint. Schon beim ersten Gespräch der beiden stellt Sally fest, dass Liss anders ist als andere Erwachsene. Kein heimliches Mustern, kein voreiliges Urteilen, keine misstrauischen Fragen. Liss bietet ihr an, auf dem Hof zu übernachten. Aus einer Nacht werden Wochen. Für Sally ist die ältere Frau ein Rätsel. Was ist das für Eine, die nie über sich spricht, die das Haus, in dem die frühere Anwesenheit anderer noch deutlich zu spüren ist, allein bewohnt? Während sie gemeinsam Bäume auszeichnen, Kartoffeln ernten und Liss die alten Birnensorten in ihrem Obstgarten beschreibt, deren Geschmack Sally so liebt, kommen sich die beiden Frauen näher. Und erfahren nach und nach von den Verletzungen, die ihnen zugefügt wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Auf der Suche nach der eigenen Welt
In einem Weinberg begegnen sich Sally und Liss. Sally, jung und wütend, ist auf der Flucht vor allem und jedem. Liss, ebenfalls eine Einzelgängerin, bewirtschaftet allein einen Hof. Von Anfang an spüren sie eine seltsame Verbundenheit. Bei der gemeinsamen Arbeit auf den herbstlichen Feldern, im Birnengarten und beim Versorgen der Bienen beginnen sie zaghaft, über das zu sprechen, was sie von anderen Menschen trennt. Als Sally ungewollt eine existenzielle Krise auslöst, entdecken sie die stille Kraft der Freundschaft.
Wann entsteht wirkliche Nähe? ›Alte Sorten‹ ist ein Roman, der entschleunigt und den Blick auf das Wesentliche lenkt.
© lowarig
Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, hat englische und amerikanische Literatur und Geschichte studiert. Er arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Fürth.
Ewald Arenz
Alte Sorten
Roman
E-Book 2019
© 2019 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildungen:Birne: © Charles Frederic/Buch der welt/akg-images
Biene: © denPotisev/istockimages
Papier: © imaginando/Fotolia.com
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-8448-3
www.dumont-buchverlag.de
1.September
Auf der Kuppe der schmalen Straße durch die Felder und Weinberge flimmerte die Luft über dem Asphalt. Als Liss mit dem alten offenen Traktor langsam hügelan fuhr, sah diese aus wie Wasser, das flüssiger war als normales Wasser; leichter und beweglicher. Sommerwasser. Man konnte es nur mit den Augen trinken.
Auf den abgeernteten, von Stoppeln glänzenden Feldern stand der Weizen noch als überwältigender Geruch nach Stroh; staubig, gelb, satt. Der Mais begann, trocken zu werden, und sein Rascheln im leichten Sommerwind klang nicht mehr grün, sondern wurde an den Rändern heiser und wisperig.
Der Nachmittag war heiß und der Himmel hoch, aber wenn man den Traktor abstellte, dann hörte man plötzlich, dass die Vogelstimmen schon weniger geworden waren und das Zirpen der Grillen schon lauter. Liss sah und roch und hörte, dass der Sommer zu Ende ging.
Es war ein gutes Gefühl.
Niemand lief ihr hinterher. Niemand verfolgte sie. Niemand war in ein Auto gestiegen, um langsam die Feldwege abzufahren, auf denen sie seit zwei Stunden unterwegs war; seit einer Dreiviertelstunde stetig bergauf. Ehrlich gesagt – warum auch? War ja nicht so, als müsse sie sich jede Stunde irgendwo melden. Obwohl – das hatte sie auch schon gehabt.
Sally blieb stehen und drehte sich um. Unter ihr lag die Scheißlandschaft in der Sonne. Zehntausend Felder mit irgendwas drauf und ganz weit am Horizont, nur noch in einem diesigen Sommerdunst, die Stadt, an deren Rand die Klinik lag. Schön im Grünen. Mit einer Allee. Mit so einer richtigen Allee bis zum Tor. Die Allee war für Mama irgendwie wichtig gewesen. Als ob die Bäume so was wie eine Garantie für eine besonders gute Behandlung wären.
Sie setzte sich ins Gras am Rand des Wirtschaftswegs. Keine richtige Straße, sondern Betonplatten, die immer genau achteinhalb Schritte lang waren. Sie hatte die Schritte gezählt, weil es wichtig war, nicht auf die Fugen zu treten. Und jetzt saß sie am Wegrand, zog die Knie an und umschlang sie mit den Armen. Es war heiß. Ein paar Kilometer hatte sie gestoppt, aber der Typ, der sie mitgenommen hatte, war ein blödes Arschloch gewesen. Er hatte sie die ganze Zeit zugetextet. Eine Frage nach der anderen, und die, die er nicht gestellt hatte, konnte man dazwischen raushören. Wo kommst du her? Wie heißt du? Was machst du so? Fährst du nach Hause? Habt ihr schon Ferien? Bin ich ein bescheuertes, blödes Arschloch? Nehme ich Mädchen mit, weil ich mich für supersozial halte, aber in Wirklichkeit will ich doch bloß irgendwo ranfahren, um sie zu vögeln? Wie heißt du denn? Sag doch.
Irgendwann hatte sie einfach nach der Handbremse gegriffen und sie hochgerissen. Und war ausgestiegen. So was brauchte sie gar nicht. Nicht heute. Eigentlich nie. Und außerdem war es sowieso besser zu laufen. Den Berg hochzusteigen, obwohl es so scheißheiß war.
Scheißheiß. Scheißheiß. Sally wiederholte das Wort für sich, nur, um ihre eigene Stimme zu hören, die von der heißen Luft trocken geworden war. Sie holte die Wasserflasche aus dem Rucksack. Sie war fast leer. Auf dem Abhang neben ihr standen verstreut ein paar Apfelbäume mit Massen an Äpfeln, die vielleicht auch den Durst gestillt hätten, aber darauf fiel sie nicht rein. Essen war heute nicht. Heute mal gar nicht. Sie hasste es, dass man essen musste, wenn die anderen das sagten oder weil man es immer so tat. Essen, weil es Morgen war. Oder Mittag. Oder Abend. Oder, weil man Hunger hatte. Sie wollte dann essen, wenn sie essen wollte. Sie wollte dann trinken, wenn sie trinken wollte. Das verstand niemand.
Sie nahm die letzten zwei Schlucke des lauwarmen Wassers und schraubte die leere Flasche wieder zu. Auf der Hügelkuppe war ein Dorf. Da konnte man sie sicher irgendwo auffüllen. Und wenn nicht, dann eben nicht.
Sie stand auf, um weiter den Hang hinaufzusteigen. Es war noch nicht spät. Sobald das Dorf hinter ihr liegen würde, könnte sie sich ja nach einem Schlafplatz umsehen. Es war noch warm, und sie hatte … Sally fiel jetzt erst auf, dass sie noch nie richtig draußen geschlafen hatte. In einem Zelt, klar, damals, Jahr für Jahr auf demselben Campingplatz in Italien. Mit zehntausend anderen Familien, die auch alle an Pfingsten nach Italien fuhren. Was für großartige Eltern sie doch hatte! Und wie einfallsreich. Andererseits … draußen schlafen war wahrscheinlich bloß so eine romantische Idee. Wahrscheinlich krochen einem Ameisen ins Ohr und in die Nase. Und Zecken gab es auch. Aber vielleicht würde sie ja eine Scheune oder so was finden.
Der Feldweg mündete auf die Dorfstraße ein, die viel steiler als erwartet anstieg und an ein paar Bauernhäusern vorbei nach etwa hundert, zweihundert Metern auf die Hauptstraße stieß. Nach zehn Minuten war sie endlich oben und blieb kurz stehen, um sich zu orientieren. Das Dorf war nicht sehr groß; von dort, wo sie stand, waren es nur ein paar Schritte bis zum Ortsausgang. Sie konnte weit über das Land sehen. Windräder standen in lockerer Reihe in den Feldern; ihre Flügel drehten sich gemächlich in einem Spätsommerwind, den sie hier unten kaum spürte. Zum Glück gab es die Windräder. Es war alles so verfickt idyllisch, dass sie es kaum aushielt, nicht zu schreien. Am liebsten hätte sie sich mitten auf die Straße hingehockt und gepisst. Bloß, um irgendwas dreckig zu machen.
Sie hätte in die Stadt zurückfahren sollen. Nur dass da immer und überall Polizei war. Außerdem hatte sie keine Lust auf irgendwen, den sie kannte. Sie hatte schon lange keine Lust mehr auf Leute, die sie kannte.
Kurz vor dem Ortsschild kam sie an einem Vorgarten vorbei, in dem ein Rasensprenger müde Wasserstrahlen auf die Beete warf. Sally stieg über den Zaun, ohne sich umzusehen, trennte den Schlauch vom Sprenger und füllte ihre Flasche. Als sie voll war, trank sie noch ein paar Schlucke direkt aus dem Schlauch, warf ihn auf den Rasen und sprang über den Zaun zurück auf die Straße.
Liss hatte den Wagen abgehängt, weil man auf dem schmalen Weg zwischen den Reben nicht mit Traktor und Hänger wenden konnte. Es war praktischer, ihn abzukuppeln und von Hand zu rangieren. Beim Drehen war ein Vorderrad in die Abzugsrinne zwischen Weg und Acker geraten, und nun stand die Deichsel so ungünstig zwischen den Weinstöcken, dass sie mit dem Traktor nicht nahe genug rankam, um anzukuppeln und den Hänger freizuziehen. Das Rad saß in der Rinne wie in einem Schlitz, und dadurch ließ sich auch die Deichsel nicht mehr drehen. Der Wagen war zwar nicht zu groß, um ihn auf einer ebenen Straße bewegen zu können, aber aus der Rinne bekam sie ihn mit Körperkraft alleine nicht heraus. Plötzlich, sie wusste nicht, wieso, musste sie an Sonny denken. An den jungen Sonny von damals, nicht den anderen. Solche Dinge hatten ihm gefallen, weil er so eine Freude an seiner eigenen Kraft hatte. Wenn so etwas passiert war, mit dem Bus vielleicht, dann war er in den Graben gesprungen, hatte sich gegen den Wagen gestemmt, und sie hatte sanft Gas gegeben, bis er, von Sonny mit aller Kraft angeschoben, wieder freigekommen war.
Frei.
Liss hörte das Wort in ihrem Kopf nachklingen und richtete sich auf, musste blinzeln und sah nach unten. Die scharf und klar umrissenen Schatten der Weinblätter auf dem hellen Beton des Weges waren an den Rändern blau. Als sie wieder aufblickte, musste sie die Augen gegen die schon schräg stehende Sonne beschatten. Das Land war weit. Der Fluss lag wie ein glitzernder Gürtel, so weit man sehen konnte. Sie war frei, sagte sie sich. Sie konnte hingehen, wohin sie wollte. Noch einmal ruckte sie mit aller Kraft an dem feststeckenden Hänger. Dann sah sie das Mädchen, das den Wirtschaftsweg entlangkam.
Sally bemerkte die Frau erst, als sie sich aufrichtete. Groß. Schlank. In einem blauen … was war das? Ein Arbeitskleid? Es sah ein bisschen aus wie so ein Overall … wie hießen die? Wie ein Blaumann. Ein Blaukleid. Und ein Kopftuch trug sie außerdem. Sie war auf dem Land. Super fashionable.
Eigentlich wäre sie lieber quer durch die Weinstöcke ausgewichen, aber die Frau hatte sie schon gesehen, und das wäre irgendwie komisch gekommen. Sally ging ein bisschen schneller, als sie registrierte, dass die Frau sie ansah. Auf so eine seltsame Art. Nicht neugierig. Einfach … wie man vielleicht ein Tier betrachtete? Wie einen Käfer, der über die Straße lief. Einer von denen, die so wunderschön grüngold schillerten und in Wirklichkeit Mistkäfer waren. Weil alles so war. Was nach Gold aussah, lebte von Scheiße. Sie drückte sich an dem Wagen vorbei, der schräg auf dem Weg stand, und senkte dann, obwohl sie es eigentlich nicht wollte, den Kopf ein wenig, als sie an der Frau vorbeiging.
»Kannst du eben mit anfassen?«
Die Frage war so unvermittelt gekommen, dass Sally zusammenschrak. Dabei war sie völlig ruhig gestellt worden, wie eine echte Frage, ohne eine Aufforderung. Keine Frage, in der – so wie eigentlich immer – schon ein Befehl steckte. »Magst du mir nicht ein bisschen helfen?« »Magst du nicht ein bisschen essen?« »Magst du mir mal das Wasser reichen?« Das waren die Scheißfragen, auf die man jedes Mal antworten musste: Nein. Mag ich nicht. Ich tu es, weil ihr stärker seid als ich. Weil ihr bestimmen könnt. Weil ihr aus irgendeinem Grund machen könnt, dass ich für euch irgendwas tun muss. Aber: Nein! Ich mag nicht! Fragt mich doch gar nicht erst! Tut doch nicht so, als könnte ich entscheiden! Befehlt mir einfach. Sagt: Sally, du Scheißmädchen, hilf mir. Sally, ich kann dich nicht leiden, ich hasse dich und deine Eltern, weil ich in dieser Drecksklinik nur die Hälfte von dem kriege, was dein Vater verdient, aber ich kann bestimmen, dass du isst. Sally, Sally, Sally, Sally, Sally, reich mir das verdammte Wasser, du Fotze. Aber das traut ihr euch nicht.
»Kannst du eben mit anfassen?«
Es war eine echte Frage. Eine Frage, auf die man mit »Ja« oder »Nein« antworten konnte. Sie war stehen geblieben, aber jetzt drehte sie sich um und sah die große Frau an. Und den Wagen, der mit einem Rad im Abzugsgraben stak.
»Ja«, sagte sie. »Soll ich schieben?«
Die Frau musterte sie kurz, aber sie sagte nicht, dass Sally zu dünn sei oder zu schmal. Sie benutzte nicht eines der Wörter, die die anderen benutzten, um nicht zu sagen, was sie sagen wollten.
»Bist du stark?«, wollte sie ruhig wissen.
Wieder so eine Frage, die Sally nicht erwartet hatte. Das hatte sie überhaupt noch nie jemand gefragt. In ihrem ganzen superkrass schönen Superleben. Was war die für eine?
»Geht so.«
»Dann dreh du die Deichsel immer ein Stück weiter nach links. Ich versuche, ihn rauszuschaukeln.«
Die Frau war schon hinter den Wagen gegangen und hatte sich mit dem Rücken gegen die Bordwand des Hängers gelehnt, als sie merkte, dass vorne nichts geschah. Sie drehte sich zu ihr um, und nach einem kurzen Moment, in dem sie Sally wieder so komisch angesehen hatte, wies sie auf das gegabelte Metallstück mit dem Loch vorne.
»Das ist die Deichsel.«
Dann drehte sie sich wieder weg, stemmte den Rücken gegen den Wagen und fing an, ihn zu schaukeln. Sally hob die Deichsel auf. Irgendwann spürte sie den Rhythmus und fing an mitzuziehen, wenn die Frau schob, mitzudrücken, wenn sie nachließ. Das Rad schaukelte immer stärker die Ränder des Grabens auf und ab, und dann war der Wagen auf einmal frei, und Sally stolperte nach vorn, um nicht zu fallen.
Die Frau hatte die Hände fest auf der Bordwand und hielt den Hänger auf der Straße. Sie lächelte fast unmerklich.
»Danke.«
Sally nickte.
»Kannst du Traktor fahren?«, fragte die Frau sie dann. Sally, sofort wütend über die bescheuerte Frage, drehte sich zu ihr um.
»Seh ich so aus?«, schnappte sie. »Sehe ich so aus, als hätte ich einen Führerschein? Sehe ich aus wie verfickte achtzehn oder was?«
Die Frau hatte aufgehört zu lächeln und sah sie wieder so an, als käme ihr Blick aus dem Meer oder über die Berge; auf jeden Fall von irgendwo wirklich weit weg.
»Das habe ich nicht gefragt«, antwortete sie sachlich wie auf eine richtige Frage; und ruhig, ohne Vorwurf, »aber es ist auch nicht wichtig. Kannst du mir zwei Steine holen und sie unter die Vorderräder legen? Nicht zu klein, bitte.«
Sally zögerte. Diese Frau strahlte nicht diese Sozialpädagogenruhe aus, wie sie die alle in der Klinik hatten. Sie trug nicht dieses Macht-mir-alles-nichts-aus-Gesicht, das sie alle aufsetzten, wenn man sie anschrie oder beleidigte oder auch nur schwieg. Dieses Gesicht, in das man immer am liebsten reingespuckt hätte.
Sie ging zum Graben und sah sich um. Da waren überall Steinbrocken, als hätte sie einer dort am Rand angehäuft. Okay, hatte man wahrscheinlich wirklich. Aus dem Weinberg geklaubt, damit sie dort nicht störten. Sie suchte einen heraus; dreieckig wie ein Keil, weiß staubig, warm von der Sonne. Die Bruchkanten fühlten sich gut an, fast scharf. Sie schob den Stein unter das erste Rad, während die Frau immer noch geduldig den Hänger hielt und ihr zusah. Sally beeilte sich mit dem nächsten Stein.
»So?«, fragte sie kurz.
Die große Frau nahm die Hände von der Bordwand.
»So«, antwortete sie. »Danke.«
Sie ging zu ihrem Traktor, fasste in den Motor und drückte irgendetwas hinunter. Sally hörte, wie die Maschine unglaublich langsam ansprang. Wie ein alter Mann, der nach dem Aufstehen die ersten paar Schritte noch so zögernd geht, als würde er gleich umfallen. Es hörte sich an, als müsste man dem Traktor erst mal auf den Rücken klopfen. Aber dann nahm die Maschine Fahrt auf und tuckerte plötzlich ganz gleichmäßig. Die Frau saß auf, fuhr am Hänger vorbei und setzte den Traktor dann geschickt so zurück, dass die Deichsel fast die Kupplung berührte. Sally griff unwillkürlich nach der Stange und hob sie an.
»Ein Stück noch!«, schrie sie über den Lärm des Dieselmotors. Die Frau ließ den Traktor zehn Zentimeter zurückrollen, und die Deichsel saß in der Kupplung. Sally sah die kleine Eisenstange, die an einer schmalen Kette an der Kupplung hing, nahm sie und steckte sie durch die Ösen. Sie sah zu der Frau auf dem Traktor auf, die sich in ihrem Sitz zu ihr umgedreht hatte und den Daumen hob.
»Den Sicherungsstift noch«, rief sie.
Sally bückte sich und sah den kleinen Stift, der durch ein kleines Loch in der Stange geschoben werden musste, damit sie nicht aus der Kupplung rutschen konnte. Er sah ein bisschen aus wie eine grobe Haarspange. Sie steckte ihn durch und trat dann zwischen Hänger und Traktor zurück auf den Weg. Der Traktor ruckte an, die Frau hob die Hand wie zum Gruß, und Sally nahm ihren Rucksack wieder auf. Ein bisschen Staub wirbelte hoch, als der Traktor den Weg zwischen den Weinreben weiter hügelan tuckerte. Sally folgte langsam. An den Weinstöcken hingen die Trauben. Viel kleiner als die, die sie von zu Hause kannte. Dunkelblau mit einem weißen Überzug. Sie zupfte eine ab und steckte sie in den Mund. Eine war okay, aber gar nicht … sie war nicht richtig süß. Man schmeckte, dass sie noch unreif war, aber nicht so wie unreife Äpfel. Der Geschmack war schon drin. Sie spuckte die Schale aus und ging weiter. Erst nach einer Weile merkte sie, dass der Traktor ein paar Hundert Meter vor ihr wieder stehen geblieben war. Sie hörte den Motor laufen und sah die Frau auf dem Sitz. Was wollte die? Sie ging ein bisschen schneller und überlegte wieder, ob sie durch den Weinberg gehen sollte, einfach querfeldein, aber dann ärgerte sie sich über sich selbst. Was sollte das? Die kannte sie ja nicht. Als sie an dem laufenden Traktor vorbeiging, sah sie, dass die Frau sich eine Zigarette gedreht hatte. Sie drehte sich halb zu Sally und sagte eben laut genug, um den Motor zu übertönen:
»Wenn du willst, kannst du auf meinem Hof schlafen.«
Sallys erster Impuls war, so zu tun, als hätte sie das nicht gehört. Wieso wusste die, dass sie nicht heim ging? Der zweite war wegzulaufen. Sie sah hoch zum Traktor. Die Frau hatte ein Streichholz angerissen und steckte die Zigarette an. Erst danach sah sie wieder zu ihr herunter.
Scheiß drauf, dachte Sally. Scheiß drauf. Sie warf ihren Rucksack auf den Hänger, stieg auf einen der Reifen und schwang sich über die Ladebordwand. Sie setzte sich nicht zu der auf den Traktor. Von hier konnte sie immer runterspringen.
Die Frau atmete Rauch aus und gab Gas. Der Traktor hustete Rauch. Sally setzte sich mit dem Rücken zu beiden auf die Ladefläche, zog die Beine an und sah, wie das Dorf hinter ihr in der flimmernden Luft unscharf wurde, im gleißenden Spätnachmittagslicht verschwamm und schließlich verschwand. So sollte man sich auflösen können, dachte sie, in heißer Luft und in Licht.
2.September
Es war kurz vor halb elf, als Sally aus dem Zimmer, das ihr Liss gegeben hatte, in die Küche kam. Kein besonderer Raum. Spüle, Geschirrschränke, Kühlschrank – die Einrichtung war so, dass man sie sofort vergaß, wenn man die Küche verließ, dachte Sally. Aber wo einmal ein Fenster auf den Hof gewesen war, da gab es jetzt eine Terrassentür aus Glas. Sie stand halb offen. Ein breiter Sonnenstreifen lief schräg über den Dielenboden. Auf dem Tisch standen ein Teller, eine Tasse und eine abgedeckte Schüssel. Eine Teekanne daneben. Es sah alles sauber und aufgeräumt aus. Sally setzte sich auf die Bank, die an der Wand entlanglief und von der aus man durch die Tür auf den Hof sehen konnte. Sie nahm den Teller von der Schüssel. Klein geschnittenes Obst. Apfel. Birne. Kiwi. Ein paar Nüsse dazwischen. Und Honig. Man konnte ihn riechen. Zögernd deckte sie die Schüssel wieder ab und berührte mit dem Handrücken die Kanne. Sie war lauwarm. Sally goss sich ein. Es war schwarzer Tee, wofür sie dankbar war. Warum war es eigentlich ein Grundgesetz jeder verdammten Klinik auf der Welt, immer nur irgendwelche Kräutertees zu haben? Alles roch immer nach Kamille und Pfefferminze. Selbst, wenn man sich irgendwo andere Teebeutel organisierte, schmeckte der Tee trotzdem danach. Wahrscheinlich fraß sich der Geschmack überall hinein. Oder er war schon drin im Klinikgeschirr, und alles, was man darin kochte, wurde automatisch zu Pfefferminz- oder Kamillentee.
Sie musste lachen, als sie das dachte, und erschrak fast ein wenig, weil es sich so fremd anhörte.
Sie nahm wieder den Teller von der Schüssel, klaubte mit den Fingern ein Stück Birne heraus und steckte es in den Mund. Sie schmeckte süß und nach einem sanften Gewürz, das Sally nicht kannte. Sie fragte sich, ob es in der Birne war oder ob Liss den Obstsalat gewürzt hatte. Sie nahm ein Stück Apfel. Der schmeckte ganz anders, und sie probierte die Birne noch einmal. Vielleicht lag es auch daran, dass sie seit gestern Morgen nichts gegessen hatte, aber die Birne schmeckte besonders. Sie pickte sich eine Walnuss heraus. Die schmeckte einfach nach Walnuss und Honig. Sally trank einen Schluck lauwarmen Tee. Sie mochte, wie die Bitterkeit sich erst mit dem Honiggeschmack vermischte und es danach einfach klar und herb in ihrem Mund wurde. Hastig deckte sie die Schüssel wieder ab und stand auf. Die Tasse nahm sie mit, als sie durch die Terrassentür auf den Hof trat. Der Traktor war fort, aber der Ladewagen stand halb in der Scheuneneinfahrt; dort, wo sie ihn gestern abgehängt hatten. Sally schlenderte über den Hof. Gestern hatte sie sich nicht umsehen können. Liss hatte ihr das Zimmer gezeigt, wo sie schlafen konnte – erst, als sie in dem nüchternen Raum standen, hatte sie Sally gesagt, wie sie hieß. Sally hatte zunächst gar nicht geantwortet und erst später, als sie noch einmal in die Küche hinuntergekommen war, Liss auch ihren Namen gesagt. Liss hatte genickt, aber ohne die Befriedigung, mit der die anderen Erwachsenen das so oft taten, dass man genau wusste: Sie hatten bloß darauf gewartet, dass sie endlich zur Vernunft kommen würde, endlich einsehen würde, dass sie unrecht getan gehandelt gehabt hatte, dass sie einknickte nachgab zu Kreuze kroch. Dieses Nicken, das immer wie das Hissen einer Fahne war, wie eine Trompete, die Sieg verkündete. Dieses Nicken, das verständnisvoll aussehen sollte und in dem sich immer ein ganz langsamer Peitschenhieb verbarg.
Sally setzte einen Fuß auf die Deichsel und trank einen Schluck Tee. Liss war komisch. Sie hatte so jemanden noch nie kennengelernt. Was war das für eine Frau? Das Haus war viel zu groß für sie, aber Sally hatte sofort gespürt, dass sie dort allein lebte. Man spürte einem Haus an, ob es belebt war. Und dieses Haus war groß und leer. Das Zimmer, in dem sie geschlafen hatte, war lange nicht benutzt worden.
Sally drehte eine Runde durch die Scheune. Sie war so schön dunkel an diesem hellen Septembervormittag. Eine Reihe von Landmaschinen stand da im Dämmerlicht, von denen sie nur die wenigsten erkannte. Was arbeitete Liss? War sie Bäuerin? Was machte sie allein auf einem so großen Hof? Sally sah nach oben. Über ihr schimmerte durch die Ritzen des Bretterbodens Licht durch. Es gab keine Treppe zum Heuboden, nur eine Leiter. Sie stellte die Tasse auf einer der Maschinen ab und kletterte hoch. Als sie durch die Luke stieg, sah sie überrascht, um wie viel heller es hier oben war. Im Dach gab es in regelmäßigen Abständen Stellen, die mit Glasziegeln gedeckt waren. Nur die Giebelwände hatten richtige Fenster. Vielleicht lag es allein an dem klaren Septembertag und der hochstehenden Sonne, aber der riesige Boden wirkte freundlich und still. Durch die Sonnenbalken fiel der Staub so langsam, dass er fast zu stehen schien. Man musste genau hinsehen, um zu merken, dass er fiel, unablässig fiel. Im hinteren Drittel des Bodens lag ein großer Haufen Heu. Von den Balken hingen Stricke und über der Luke ein großes hölzernes Laufrad, über das ein Seil lief, dessen langes Ende in weiten Schlaufen neben der Luke lag. Es war ein guter Ort. In Sally wurde es das erste Mal seit langer Zeit für einen Augenblick ganz still, und sie bewegte sich nicht, um diese Stille nicht gleich wieder zu verlieren. Sie betrachtete den Staub im Licht und fühlte sich eben so: als fiele sie ganz langsam; so langsam, dass man das Auftreffen nicht fürchten musste.
Eine Zeit lang später stieg sie wieder nach unten, nahm ihre Tasse und streifte über den Hof, am leeren Stall vorbei, auf dem Weg in den Garten an einem Hühnerstall entlang, an rund aufgeschichteten Holzstößen, zwischen denen die Hühner pickten, an einem uralten Klohäuschen, das sich schief an einen Kaninchenstall lehnte, der leer war. Der Garten selbst war eher eine lang gestreckte Wiese – groß wie ein Feld. Ein Stück davon war als Gemüsegarten abgeteilt und eingezäunt. Sally wunderte sich erst, warum man im eigenen Garten einen Zaun ziehen sollte, aber dann fielen ihr die Hühner ein. Dem Gemüsegarten gegenüber befand sich ein flaches, fensterloses Gebäude mit breiten Schiebetüren. Sally zog eine auf und sah, dass es eine Maschinenhalle war. Ein zweiter uralter Traktor stand da, ein Pflug und noch ein paar Geräte, von denen sie nicht wusste, wozu sie dienten; es gab einen Stapel Säcke, und dann stand da ein Motorrad. Neugierig ging sie hin. Sie war schon einmal Motorrad gefahren, schwarz natürlich. Sally schwang sich auf den Sitz und probierte den Kickstarter. Die Maschine sprang nicht an. Sie probierte es noch einmal, verbiss sich darin und trat den Starter wieder durch. Nichts passierte. Sie kickte jetzt, bis ihr ein Krampf in die Waden schoss und sie abspringen musste, um das Bein durchstrecken zu können. Wütend trat sie gegen das Motorrad,es fiel um. Was machte sie hier eigentlich? Was war das für ein bescheuertes Spiel?
Sie lief aus der Halle, den Weg aus dem Garten hinunter auf den Hof, rannte durch die Küche ins Haus, die Treppe hoch in das Zimmer, in dem sie geschlafen hatte. Sie riss den Rucksack vom Stuhl, tastete automatisch nach ihrem Handy und erinnerte sich fast gleichzeitig daran, wo sie es gelassen hatte: eingeklemmt hinter der Rückwand ihres Schranks in der Klinik. Angeschaltet. Wenn es nach ihrem Handy ging, war sie immer noch dort. Sie verzog den Mund. Sie war frei. Keiner wusste, wo sie war. Sie konnte gehen, wohin sie wollte. Sie warf sich den Rucksack über und lief die Treppe hinunter. In der Küche blieb sie stehen. Wunderbar. Die Frage war jetzt allerdings, wohin sie denn eigentlich wollte.
»Weg ist keine Richtung, oder?«, fragte sie laut. Die Tür stand offen. Die Küche war leer. Der Sonnenstreifen war um den Tisch gewandert und lag jetzt eben noch so im Türrahmen. Die Sonne stand mittagshoch, und ihr Licht verließ den Raum. Für die Sonne war es einfach.
»Im Osten geht die Sonne auf nach Süden nimmt sie ihren Lauf im Westen wird sie untergehen im Norden ist sie nie zu sehen«, sang Sally tonlos den Reim aus Kindergartenzeiten. Den Kindergarten hatte sie auch gehasst.
Im Grunde war es egal, wohin sie ging. Es ging ja nicht darum, irgendwohin zu kommen. Es ging darum, von allem wegzugehen.
Als sie die Terrassentür von außen zuzog, fiel ihr die Tasse ein. Sie hatte sie beim Motorrad in der Gerätehalle stehen lassen. Irgendwie fühlte es sich falsch an wegzugehen, ohne die Tasse zurück in die Küche zu stellen. Sie ging noch einmal den Weg an den Holzstößen vorbei. Die Hühner liefen ihr zwischen den Beinen herum, als wäre sie keine Fremde. In der Maschinenhalle sah sie sich nach der Tasse um. Sie hatte sie unsicher auf den grünstaubigen Kotflügel des Traktors gestellt. Aber bevor sie nach ihr griff, machte sie ein paar schnelle Schritte zu dem umgestoßenen Motorrad und hob es auf. Dann nahm sie hastig die Tasse und rannte aus der Halle den Weg hinunter. Liss bog eben auf dem Traktor in den Hof, als Sally ihn erreichte, sprang leicht vom Sitz und griff in den Motor, um ihn abzustellen. Der Diesel tuckerte aus. Lächelnd sah Liss sie an.
»Du gehst?«, fragte sie mit Blick auf den Rucksack.
Sally schüttelte den Kopf und hob die Tasse.
»Ich war nur im Garten«, murmelte sie und ging in die Küche.
3.September
Es regnete. Das erste Mal seit Wochen. Gut für den Wein. Die Luft strömte kühl und grau in die immer noch sommerwarme, fast ein wenig stickige Küche, als Liss in der Morgendämmerung die Tür zum Hof aufstieß. Sie trank den Tee stehend, an den Rahmen gelehnt. Gleichmäßig strömte der Regen. Im Hof standen Pfützen. Die Hühner rannten vom Stall zur Scheune und zurück. Das war auch ein Leben, und wer hätte sagen wollen, dass es falsch war, bloß weil es aus ihrer Warte sinnlos aussah?
Das Mädchen schlief noch. Es schlief in dem Zimmer, das sie ihm gegeben hatte, als wäre es das Seine. Liss ging zum Herd und goss sich Tee nach. Dann lehnte sie sich wieder in den Türrahmen und sah in den Regen. Ein Tag, an dem man die Welt einfach trinken lassen und sie dabei nicht stören sollte. An dem man die Hühner rennen lassen sollte, ohne den Kopf zu schütteln. Ein Tag, an dem man ein Mädchen schlafen lassen sollte, wenn es schlief. Es gab für alles einen Grund, sie sah ihn nur nicht.
Liss trat zurück in die Küche, deckte den Tisch und holte dann ihr Regenzeug. Als sie gehen wollte, sah sie noch einmal auf den Tisch und zögerte kurz, bevor sie dann doch ein Stück von dem dunklen Brot aus der Speisekammer holte, um es neben die Obstschüssel zu legen. Dann ging sie in den Regen hinaus und atmete tief auf, als die ersten Tropfen kühl ihr Gesicht trafen.
Damals regnete es nicht. Aber es hörte sich so an. Es taute. Diese Tage im Februar waren das Traurigste, was es gab. An den Regenrinnen schmolzen die Eiszapfen und tropften unablässig auf die Blechdächer der Hühnerhäuser, der Kaninchenställe, der Holzschuppen. Der Himmel war wie ohne jeden Geschmack. Auf dem ungepflasterten Hof standen die Pfützen knöchelhoch. Die schmutzigen, harten Schneehaufen eines ganzen Winters begruben noch immer meterhoch den Hofzaun zur Straße hin, und man konnte sich nicht vorstellen, dass es jemals wieder Sommer werden würde. Sie hatte die Schularbeiten erledigt und dabei sehnsüchtig aus dem Fenster gesehen. Jetzt war sie draußen in diesem stillen Samstagnachmittag, und es fühlte sich an, als sei sie ganz allein im Dorf. Alle anderen hätten tot sein können oder plötzlich verschwunden. Sie hörte nichts anderes als das stete Tropfen und ab und zu das schwere Rauschen, wenn eine Ladung Schnee von einem der Dächer ins Rutschen kam, und danach das Prasseln auf dem Hofpflaster. Sie stellte sich vor, wirklich ganz allein zu sein. Das Dorf war so ausgestorben wie nach einem dieser Atomkriege in einem ihrer Zukunftsromane, die sie sich aus der Gemeindebibliothek auslieh, wenn der Vater nicht daheim war. Er mochte es nicht, wenn sie las. Sie verließ den Hof und ging die Haselau hinunter, die Heldin einer Science-Fiction-Geschichte. Das Dorf wirkte im verbrauchten Schnee schwarz-weiß wie in einem alten Film. In der Bäckerei stand die Anni und räumte die Auslagen auf. Die schenkte ihr jeden Morgen eine Brezel, wenn sie mit den anderen vor dem Schaufenster auf den Bus wartete. Jetzt winkte sie ihr hereinzukommen, aber das ging nicht, denn sie war ja gerade auf einer Mission und die Anni war nur ein flackerndes Bild auf einem letzten Fernseher, der in einer entvölkerten Stadt in einem geplünderten Geschäft mit dem letzten Strom lief. Sie ging weiter die schmale Straße hinab, am Bergerhof vorbei, an der Mauer des Pfarrgartens entlang, auf der sie im Sommer manchmal auf dem Bauch lag und mit dem ganzen Leib die Hitze der sonnensatten Steine aufsog. Das waren die besonderen Nachmittage, die nur ganz selten vorkamen. Wenn sie sich fortgestohlen hatte, mit einem Buch, das sie dann doch nicht lesen konnte, weil die Bilder beim Lesen immer mächtiger wurden und die flimmernde Luft über dem Dach des Pfarrhauses, wenn sie die Augen ein wenig zusammenkniff, ganz allmählich zum Blau eines südlichen Meeres wurde. Wenn sie sich mit der Mauer, auf der sie lag, fortbewegt hatte, unbemerkt, in die kleine heiße Stadt am Meer, und sie war nicht mehr Elisabeth, sondern Zora und hatte keine Eltern mehr, sondern war frei hinzugehen, wohin immer sie wollte. Und über den Dächern leuchtete das Meer.
Sie zog die Schultern zusammen. An so einem Februartag war es nicht nur sicher, dass sie das Meer nie sehen würde, es war auch nicht sicher, ob jemals wieder ein Sommertag kommen würde, an dem sie wenigstens anderthalb Stunden davon träumen konnte, eine andere zu sein.
Hey, Elisabeth!
Thomas.
Ich heiße nicht mehr Thomas. Ich heiße jetzt Sonny. Kommst du mit?
Thomas war seltsam. Alle im Dorf wussten, dass seinem Vater schnell die Hand ausrutschte. Trotzdem lachte er immer nur.
Was machst du?
Komm mit. Ich zeig’s dir.
Er lief voran, schnell, drehte sich immer wieder um, ob sie ihm auch folgte. Beim letzten Hof, den sie eigentlich überhaupt nicht kannte, weil kein Kind da je hinging, nicht mal zum Abdanken an Karneval, wenn man in jedem Haus eine Mark bekam oder manchmal sogar zwei, lief Thomas hintenherum in den Garten.
Schau.
Stolz, als ob er es selbst gebaut hätte: ein sehr großes Betonbecken. Sie dachte zuerst, es sei für Gülle, aber als sie sich über die Mauer beugte, sah sie, dass es ganz sauber war. Unten stand Wasser, vielleicht ein Meter hoch, und darauf schwammen richtig dicke Eisschollen, groß wie Tischplatten. Thomas schwang sich schon über die Mauer, einen Stecken in der Hand, den er von einem der Holzstapel genommen hatte.
Komm!
Sie zögerte nur kurz. Dann nahm sie sich ebenfalls einen Stock, legte sich bäuchlings auf die Mauer und ließ sich aufs Eis hinab. Und war überrascht, dass die Scholle sie trug. Vorsichtig stieß sie sich mit dem Stock von der Betonwand ab und trieb langsam auf die Gegenseite. Thomas lachte. Sie wurden mutiger. Ihr Lachen hallte im Betonbecken. Sie schwankten und sprangen von einer Scholle auf die andere, schoben sich gegenseitig weg. Und dann versuchte Thomas, sie mit seinem Stecken von der Scholle zu stoßen.
Lass das!
Mach doch auch. Wer stärker ist.
Lass! Ich darf nicht nass heimkommen.
Thomas stieß mit dem Stecken nach ihr. Sie musste sich an der Wand abstützen und schob sich in die Mitte, schwankend zwischen Lachen und Ärger.
Dein Vater hat den größten Hof im Dorf! Der kann dir neue Kleider kaufen.
Sie stieß seine Scholle fort. Er schwankte, musste in die Knie gehen, um nicht zu fallen.
Gar nicht wahr.
Sie wusste gar nicht, ob sie den größten Hof hatten. Sie hatte nie darüber nachgedacht.
Thomas war hochgekommen und trat mit Wucht auf den Rand ihrer Scholle. Sie verlor das Gleichgewicht, rutschte, und dann stand sie bis zu den Hüften im eiskalten Wasser. Überrascht fühlte sie, wie das eiskalte Wasser mit Verzögerung in ihre Stiefel lief. Thomas schien viel erschrockener als sie.
Das wollte ich nicht.
Er flüsterte.
Hilf mir hoch!
Sie war wütend.
Erst jetzt merkten sie, dass sie auf dem Eis stehen mussten, um die Mauer wieder erreichen zu können. Auf einmal war die Angst da.
Hilf mir!
Aber Thomas hüpfte schon hoch, versuchte, die Mauerkrone zu fassen. Sie kämpfte mit dem Eis. Immer kippten die Schollen hoch, brachen, weil sie beide sich so wild und voller Angst bewegten, und wurden dabei immer kleiner.
Hilf mir!
Thomas hatte die Krone erreicht und zog sich hoch.
Ich hol einen Stock.
Weg war er. Vor lauter Wut und Angst warf sie sich mit einem wütenden Sprung auf eine Scholle, lag dort, bis sie sich beruhigt hatte, und stand dann vorsichtig auf. Ihre Knie zitterten. Sie schob sich an die Wand und sprang mit zitternden Knien, fasste den Rand, zog sich hoch. Ihre Hosen waren schwer vom Wasser, aber sie schaffte es. Sie sah Thomas am Holzstapel stehen. Er hatte noch keinen langen Stecken gefunden, aber er lachte schon wieder.
War doch lustig, oder?
Arschloch!
5.September
Es war Freitag, und immer noch hatte niemand Sally gefunden und lange sanft mit ihr geredet und ihr keine Vorwürfe gemacht, voller Mitleid und voller verstecktem Hass hinter jedem sanften Wort. Hass auf sie, weil sie sich nicht fügen wollte, weil sie immer wieder weglief und weil sie nicht auf die weichen, mitleidigen, einfühlsamen Stimmen hörte, sondern ihnen immer in die Augen sah, so lange, bis die falsche Mauer aus professioneller Nettigkeit und Wärme und Verständnis bröckelte und sie dahinter die Langeweile und die Interesselosigkeit und den Hass durchscheinen sah.
Es war Freitag, und noch immer hatte sie keiner gefunden.
Sie lag im Bett in dem kargen Zimmer, dem alles fehlte, was sie dort immer zu brauchen glaubten, damit sie sich wohlfühlen sollten: Es gab keine Pastellfarben und keine geschmackvollen Bilder an der Wand, keine freundlichen Tapeten und keinen kuscheligen Teppich, auf den man am liebsten immer schon beim ersten Reingehen gekotzt hätte. Es war nur ein Zimmer mit weiß gekalkten Wänden, es gab keinen Teppich, es gab nur einen schon ein bisschen wackligen Stuhl, und es gab keine Vorhänge am Fenster. Es war ein Raum wie klares Wasser, und es fühlte sich gut an, darin zu liegen. Gestern hatte es geregnet, und sie war fast den ganzen Tag im Haus geblieben. Morgens hatte sie auf die Geräusche gehört, die Liss in der Küche und im Bad machte. Sie war nach unten gegangen, als es still geworden war, und hatte wieder Tee gefunden und die abgedeckte Schüssel mit Obst. Auch Brot stand auf dem Tisch und eine Untertasse mit Butter. Keine Aufforderung. Nur ein Angebot, das aussah, als hätte Liss am Tag zuvor die Schüssel mit dem unberührten Obst gesehen und sich gedacht, dass Sally lieber Brot äße. Sally räumte die Butter in den Kühlschrank, der nicht in der Küche stand, sondern in der kleinen Speisekammer, deren Decke schräg war, weil sie der Treppe über dem Raum folgte. Sie hatte in die Schüssel gesehen, ob wieder Birne darin war, und sie hatte alle Stücke gegessen und zwei oder drei Walnüsse. Sie hatte den Tee mit nach oben genommen und sich ans Fenster gesetzt und den ganzen Tag auf den Hof gesehen; auf die Straße vor dem Hof und die Bäckerei auf dem kleinen Dorfplatz über der Straße. Sie hatte die Leute beobachtet, die Brot kauften. Manche unterhielten sich trotz des Regens vor dem Laden. Sie hatte die Hühner beobachtet, die im Lauf des Vormittags vom Garten in den Hof hinunterkamen und dort auf dem schmalen ungepflasterten Streifen vor dem Zaun zur Straße hin nach Regenwürmern suchten. Sie hatte Liss beobachtet, die in gelbem Regenzeug auf ihrem Traktor mittags in den Hof fuhr und dann für Stunden in der Scheune verschwand und mit sehr schmutzigen Händen wieder herauskam, ohne auch nur für einen Augenblick zu ihr hochzusehen. Sie hatte mit Liss Kaffee getrunken, als sie vor ihrer Zimmertür gerufen hatte, dass es Kaffee gab. Sie hatten nicht geredet. Dann war Liss wieder aufgestanden und nach draußen gegangen, und Sally hatte die Kaffeekanne auf den Herd gestellt und die Tassen abgespült. Später war sie wieder oben gewesen, hatte auf dem Bett in einem gefundenen Buch gelesen, und dann musste sie eingeschlafen sein, obwohl es noch nicht dunkel gewesen war, denn jetzt war es Freitag.
Es war Freitag, und keiner hatte sie gefunden.
Sie stand auf und trat ans offene Fenster. Es war noch sehr früh, aber es würde sonnig werden. Durch den Regen gestern hing ein feiner Dunst über dem Hof.
Der Hof. Warum lebte die eigentlich allein und ließ dann trotzdem einfach Leute bei sich wohnen? Kurz flackerten Bilder von Psychofilmen durch ihren Kopf. Einsamer Hof. Nebel. Wald. Ein Garten voller junger toter Mädchen. Sie grinste die Bilder weg. Wo sie herkam, war das Haus voller toter Mädchen, bloß wussten die das nicht und bewegten sich einfach weiter. Zombies.
Außerdem war die nicht so. Aber wie war die dann? War irgendwie nicht so supereinfach … man konnte vielleicht leichter sagen, was sie nicht war: Hexe. Psychokiller. Sozialpsychopädagogen-Vertrau-mir-Schlampe. Es gab ja nicht so viele Leute, die einem wirklich vertrauten. Ohne dass sie es immer sagen mussten, damit sie es selber glaubten. Aber strange. Das war sie auf alle Fälle. Strange. Auf eine coole Art vielleicht, aber strange. Trotzdem. Sie überlegte, aber sie kannte eigentlich niemanden, der wirklich allein lebte. Noch dazu in einem so großen Haus.
Es klopfte an der Tür. Sally drehte sich um, erwartete, dass die Tür sich öffnen würde, bevor sie »Herein« gesagt hatte, weil das ja immer so war. Aber tatsächlich wartete Liss. Sally ging zur Tür und öffnete.
»Guten Morgen«, sagte Liss. Sie hatte ein blaues Kopftuch aus Leinen um, das ihr Gesicht auf seltsame Art umrahmte. Sally wehrte sich dagegen, es schön zu finden.
»Ich muss heute Kartoffeln ernten. Kannst du mir helfen?«
»Gleich?«, fragte sie.
»Ich kann gut warten, bis du fertig bist. Es gibt auf dem Hof noch genug zu tun«, antwortete Liss mit diesem kleinen Lächeln, das Sally nun schon kannte.
»Ich komme«, sagte sie.
Diesmal saß sie mit auf dem Traktor. Es gab zwei Sitze über den großen Hinterrädern; auf dem einen war eine längst glatt und glänzend gewetzte Sitzfläche aus Holzleisten angebracht, der andere war das blanke Metall des Kotflügels. Um beide Sitze lief ein Stahlrohr, das Rückenlehne und Haltegriff in einem war. Sally spürte jede Erschütterung. Sie fuhren durch das Dorf hinaus auf die Landstraße. Nach rechts fielen die Weingärten ab. Sie konnte weit über das Tal sehen, in dem der Morgendunst noch immer über den fernen Dörfern hing, während es hier oben schon ganz sonnig war. Links lagen Felder bis hin zum Wald, der vielleicht anderthalb Kilometer entfernt war. Sie bogen in einen Feldweg ein. Hinter ihnen holperte und klirrte die Maschine, die Liss angehängt hatte. Ein Schleuderroder, hatte sie erklärt, als sie ihn aus der Maschinenhalle im Garten gezogen hatten. Was natürlich überhaupt keine Erklärung war. Der Weg führte in einem leichten Bogen an einer Hecke entlang, und dann hielten sie unvermittelt an. Rechts neben ihnen lag ein Feld. Liss nahm einen Jutesack von dem Haufen, der unter ihrem Sitz lag, und warf ihn an den Feldrand. Sie gab Sally einen eisernen Korb. Dann stieg sie über die Deichsel ab und löste einen Hebel. Der Roder senkte sich. Er sah eigentlich aus wie eine Art Pflug, aber dahinter war ein Rad angebracht, von dem in regelmäßigen Abständen leicht gebogene Zinken ausgingen – das sah ein bisschen aus wie die runden Besen der Straßenkehrwagen.
»Woher weißt du, wann die Kartoffeln reif sind?«, fragte Sally.
Liss sprang von der Deichsel und wies auf den Damm.
»Grab mal eine aus.«
Sally hockte sich in die Furche und grub ihre Finger in die Erde unter dem Kartoffelkraut. Sie war warm und vom gestrigen Regen noch ein wenig feucht. Wann hatte sie das letzte Mal in der Erde gegraben? Wann hatte sie das letzte Mal die Hände in der Erde gehabt? Sie konnte sich nicht erinnern.
»Hier«, sagte sie, als sie auf die Kartoffeln stieß und sie freigelegt hatte. Es waren acht oder neun unterschiedlich große Knollen. Sie bröckelte die Erde ab und sah sie an. Hell waren sie; in der Septembersonne leuchteten sie fast.
»Reib sie mal kräftig«, forderte Liss sie auf.
»Und?«, fragte Sally, nachdem sie eine Kartoffel vollkommen sauber gerieben hatte.
»Wenn die Haut nicht mehr abgeht, sind sie reif. Man kann auch welche ausgraben und kochen, um zu probieren, ob sie passen, aber das dauert mir jetzt zu lang.«
Sally sah überrascht auf. Es war das erste Mal, dass Liss gescherzt hatte.
»Sammle die Kartoffeln erst in den Korb und dann in die Säcke«, sagte Liss, die schon wieder auf dem Sitz saß. »Schlepp sie nicht weiter mit, wenn sie schwer werden, ich werfe dir in Abständen welche runter. Und lass dir Zeit.«
Dann gab sie Gas, und das Rad fing an, sich zu drehen. Jetzt sah Sally, wozu der Pflug da war. Er hob die Erde aus dem Damm, der Besen schleuderte sie zur Seite, und dazwischen flogen die Kartoffeln mit. Es sah ein bisschen lächerlich aus, unprofessionell, fast unbeholfen. Aber als sie langsam hinter dem Traktor die Furchen entlangging, sah sie, dass es funktionierte. Man brauchte die Kartoffeln nur aufzuheben.