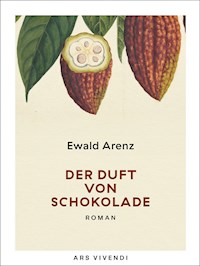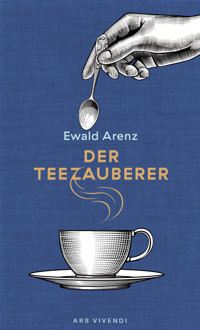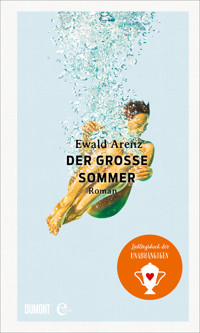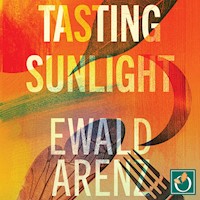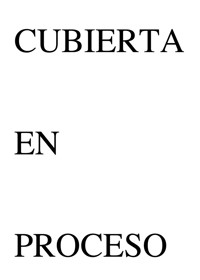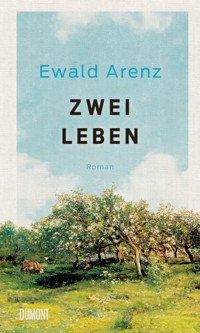
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dorf, die Welt – und die Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben 1971 in einem Dorf in Süddeutschland. Nach einer Art Schneiderlehre in der Stadt kehrt die 20-jährige Roberta auf den Hof ihrer Eltern zurück. Sie ist das einzige Kind und wird irgendwann einmal die Bäuerin sein. Hier auf dem Land sind Vergangenheitsbewältigung, Kriegsdienstverweigerung, Feminismus, Popkultur und Miniröcke nichts, womit man sich beschäftigt. Hier zählen Arbeit, Gehorsam und moralisches Verhalten. Roberta träumt davon, eigene Kleider zu entwerfen, aber sie weiß genau, dass das Träume bleiben werden. Zugleich liebt sie ihren Hof und die körperliche Arbeit in der Natur, wo sie sich ganz und gar spürt. Und sie liebt Wilhelm, den Pfarrerssohn. Wilhelm ist nicht nur für Roberta der Grund, im Dorf zu bleiben. Auch seine Mutter Gertrud bleibt wegen ihres Sohnes. Im Gegensatz zu Roberta hasst sie das Landleben und wünscht sich nichts mehr, als weggehen zu können, hinaus in die Welt. Beide Frauen werden schwanger und müssen eine Entscheidung treffen. Doch ein tragisches Unglück gibt ihrer beider Leben eine komplett neue Richtung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
1971 in einem Dorf in Süddeutschland.
Als einziges Kind ihrer Eltern gibt es für Roberta keine andere Zukunft als die, einmal die Bäuerin auf dem Hof zu sein. Hier auf dem Land sind Vergangenheitsbewältigung, Kriegsdienstverweigerung, Feminismus, Popkultur und Miniröcke nichts, womit man sich beschäftigt. Hier zählen Arbeit, Gehorsam und moralisches Verhalten. Doch Roberta träumt davon, eigene Kleider zu entwerfen, auch wenn sie genau weiß, dass das ein Traum bleiben wird. Zugleich liebt sie ihren Hof und die körperliche Arbeit in der Natur, in der sie sich zu Hause fühlt. Und dann gibt es da noch den Pfarrerssohn Wilhelm, ihren Freund aus Kindertagen. Die beiden verlieben sich ineinander.
Wilhelm ist nicht nur für Roberta der Grund, im Dorf zu bleiben. Auch seine Mutter Gertrud bleibt wegen ihres Sohnes. Im Gegensatz zu Roberta hasst sie das Landleben und wünscht sich nichts mehr, als weggehen zu können, hinaus in die Welt.
Bald sind beide Frauen gezwungen, ihr Leben zu überdenken und Entscheidungen zu fällen, die nicht nur für sie alles verändern.
© Ilka Birkefeld
Ewald Arenz, 1965 in Nürnberg geboren, hat englische und amerikanische Literatur und Geschichte studiert. Er arbeitet als Lehrer an einem Gymnasium in Nürnberg. Seine Romane und Theaterstücke sind mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden. Mit ›Alte Sorten‹ (DuMont 2019) stand er auf der Liste »Lieblingsbuch der Unabhängigen« 2019 und sowohl als Hardcover wie als Taschenbuch auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Sein Roman ›Der große Sommer‹ (DuMont 2021), ebenfalls als Hardcover und als Taschenbuch erschienen, erhielt 2021 die Auszeichnung »Lieblingsbuch der Unabhängigen«. Der Roman ›Die Liebe an miesen Tagen‹ (DuMont 2023) stand auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Der Autor lebt mit seiner Familie in der Nähe von Fürth.
Ewald Arenz
Zwei Leben
Roman
Von Ewald Arenz sind bei DuMont außerdem erschienen:
Alte Sorten
Der große Sommer
Das Diamantenmädchen
Ein Lied über der Stadt
Die Liebe an miesen Tagen
Der Duft von Schokolade
E-Book 2024
© 2024 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Apple Blossoms – by Charles-François Daubigny, 1873 © FineArt/Alamy Stock Photo
Satz: Angelika Kudella, Köln
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1061-2
www.dumont-buchverlag.de
1
Sie hätte auf den Bus warten können, aber der Nachmittag war sonnig, und außerdem war es gut, Zeit fürs Ankommen zu haben. Besser nach Hause gehen, auch wenn sie daheim den Kopf schütteln würden über den doppelten Weg. Den Koffer konnte sie ins Schließfach geben und morgen holen. Sie hatte nichts darin, was sie an diesem Tag noch brauchen würde.
Es hing eine schläfrige, heiße Stille über den Straßen der Stadt, der April war ungewöhnlich warm. Ein alter Herr, der im Eiscafé saß, hatte seinen Stuhl dicht an die Mauer der Stadtkirche in den Schatten gerückt, las Zeitung und rauchte seine Zigarre. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass man bei dieser Hitze rauchen mochte. Ein, zwei Autos fuhren über den Platz; die meisten standen hitzeflirrend am Straßenrand und warteten auf gar nichts. Ein paar Kinder am Schweppermannsbrunnen hatten die Sandalen ausgezogen und saßen auf dem steinernen Rand, die Füße im Wasser. So etwas hatte sie als Kind nie gemacht. Bei ihnen im Dorf gab es keinen Brunnen, der noch benutzt wurde. Es sah aus, als würde es Spaß machen.
Sie war froh, dass sie heute Morgen die Hosen doch in den Koffer getan und das Kleid angezogen hatte, obwohl es noch so frisch gewesen war. Jetzt war das Kleid genau richtig, und wenn sie erst aus der Stadt heraußen war, würde sicher ein Wind gehen.
Die Häuser wurden weniger und die Gärten größer. Ein letztes Mietshaus stand verloren auf einer Wiese. Dann war die Stadt auf einmal zu Ende. Auf der kleinen Brücke über die Umgehungsstraße blieb sie einen Augenblick stehen. Die Apfelbäume entlang der einsamen Landstraße. In der Ferne, auf dem Berg, die Festung. Der Bach, der wenig mehr war als ein Abzugsgraben. Wieder daheim. Sie hatte fast vergessen, wie es war, wenn man auf viele Kilometer keinen einzigen Menschen sah.
Sie nahm den langen Weg durch das Tal. Zwei Gehstunden, aber ein Stück des Weges verlief durch den Wald an der Quelle vorbei. Schöner als der kurze mit dem steilen Anstieg an der Hauptstraße entlang; sie hatte ja Zeit. Daheim erwarteten sie sie erst morgen, und ihre Leute waren sowieso auf dem Feld.
Das Laufen nach der langen Zugfahrt tat wohl. Überhaupt war es gut, eine lange Strecke gehen zu können. Die letzten drei Jahre hatte sie so viel gesessen. An der Nähmaschine oder in der Berufsschule. Sie war immer dankbar gewesen, wenn sie am Zuschneidetisch stehen konnte oder im Lager bei den Stoffen helfen musste. Im Winter ging es noch. Da kam man daheim auch manchmal nur morgens und abends aus dem Haus, um beim Melken oder beim Ausmisten zu helfen. Aber im Frühling, im Sommer, im Herbst … da hatte sie sich immer danach gesehnt, draußen sein zu können. Die Schneiderwerkstatt in einer kleinen Textilfabrik am Rande der Großstadt zwischen Brauerei und Spedition; die hohen Fenster vom ewigen Stoffstaub immer so trüb, dass die Sonne in den Räumen nie ihre wirkliche Farbe hatte. Wie hätte sie da die Kleider nähen können, die nach und nach in ihrem Kopf entstanden waren, wenn sie an die satten Farben im Dorf dachte? Das Zimmer bei der Tante wiederum hatte nur ein Dachfenster gehabt. Keine hellen Jahre. Aber im Nachhinein gab sie dem Vater recht. Es war gut, einen Beruf zu lernen. Man wusste nie. Aber genauso gut war es, zurückzukommen.
Als sie Mühldorf erreichte, blieb sie einen Augenblick stehen. Der Wind kam vom Hügel herab und brachte den Duft von Gras mit. In der Stadt, wenn sie die Rasen mähten, roch es manchmal so ähnlich, aber es war nur wie eine müde Erinnerung an diesen kraftvollen und zugleich lichten Geruch, der Frühling hieß. Man sollte ein Kleid aus diesem Duft machen können. Es müsste, natürlich, grün sein, aber durchsetzt von farbigen Flecken wie Blüten und schmalen, hellen Streifen wie letztjährige Weizenhalme.
Egal. Sie hatten sowieso fast immer nur hässliche Kleider gemacht. Die Zeit in der Schneiderei war endlich vorbei.
Sie passierte die Mosterei, die um diese Jahreszeit verlassen dalag. Ansonsten war es hier in dem Dorf lebhafter als in der Stadt. Vom vorbeifahrenden Traktor herab grüßte sie einer. Sie nickte, obwohl sie sich nicht an ihn erinnern konnte. Mühldorf lag für sie aus Salach jenseits des Bühls, da kam man im Jahr nur einmal zum Mosten her.
Allmählich wurde ihr heiß. Der schmale Weg vom Dorf zum Wald hin stieg leicht an. Auf dem Feld rechts von ihr hatten sie Kartoffeln gesetzt, und es wurde schon Zeit, sie anzuhäufeln. Wo der Vater wohl dieses Jahr Kartoffeln anbaute? Im Eichental vielleicht. Nein, da hatten sie geerntet, bevor sie die Lehre angefangen hatte. Dann am Steinbruch womöglich.
Der Steinbruch. Am Steinbruch hatten sie immer gespielt, früher. Manchmal hatte sie wach gelegen, in ihrem Zimmer bei der Tante, und hatte durch das Dachfenster in den Himmel geschaut. Mit etwas Glück war der Mond darüber hinweggezogen, dann war etwas zum Anschauen da gewesen. An den Winterabenden, wenn sie zum Rodeln am Steinbruch gewesen waren und die Zeit vergessen hatten, da hatte der Mond auch manchmal schon am Himmel gestanden, und sie hatten gewusst, sie würden es kriegen, weil sie zu spät für den Stall zurückgekommen waren. Hatte sich trotzdem immer gelohnt.
Sie war am Waldrand angelangt. Dort, wo früher der Bach unter dem Weg durch einfach in die Wiese geflossen war, hatten sie jetzt ein Becken gebaut. Sie wusste erst nicht, was es sein sollte. Für ein Bewässerungsbecken war es zu klein. Dann sah sie die Tafel. Die beiden Holzpfähle, an die sie geschraubt war, glänzten hell wie frisch entrindet und rochen auch noch nach Fichte. Ein Kneippbecken, hieß es. Anscheinend sollte man an dem Geländer in der Mitte entlang durchs kalte Wasser laufen. Sie musste lächeln. Der Bach hätte es auch getan, oder? Am Waldrand hatten sie sogar geschottert. Ein Parkplatz. Na ja, hier hatten sie jetzt anscheinend einen Fremdenverkehrsverein.
Aber die Tafel hatte sie auf einen Gedanken gebracht: An der Einmündung zum Waldweg blieb sie stehen und streifte die Schuhe ab. Als Kind war sie im Sommer immer barfuß gelaufen. Jetzt spürte sie Aststücke oder Steine sehr deutlich. Stadtkind geworden, dachte sie fast verächtlich.
In der Ferne ein Kuckuck. Sein eintöniges Rufen hatte immer schon Frühjahr geheißen. Sonst war es sehr still im Wald. Kein Wind. Nur das klare Wasser in seinem Bett aus Tuffstein hörte sich eilig an. War die steinerne Rinne höher geworden? Es kam ihr fast so vor. Aber was konnte in drei Jahren schon gewachsen sein? Ihre Lehrerin hatte einmal gesagt, dass es hundert Jahre gedauert hatte, bis sich der Bach sein Bett aus Kalk hatte bauen können. Weil der Bach sich aus dem Berg, aus dem er kam, den Stein mitnahm. Weil man bei jedem Wasser sagen konnte, wo es herkam. So war sie wohl auch. Etwas vom Dorf war immer in ihr, wie der gelöste Stein im Wasser war.
Oben, wo die Quelle aus dem Felsen sickerte, hatte sie noch kein Bett. Da war nur eine flache Kuhle, wo sich das Wasser sammelte, bevor es weiterfloss. Roberta kniete sich hin, schöpfte es mit beiden Händen und trank lange, bevor sie wieder aufstand und den Rest bergan stieg.
Sie trat ein paar Dutzend Meter unterhalb der Kuppe aus dem Wald. Das Sträßchen lag fast leuchtend in der Sonne, und sie zog die Schuhe wieder an, froh, dass sie an der Quelle getrunken hatte. Rechts und links wichen die Fichten zurück, und das Land wurde weit. An der Gabelung zögerte sie kurz. Über Pfraunfeld war es ein kleines Stück weiter, aber die Straße schattiger, weil es noch einmal durch den Wald ging. Andererseits war es schön, die Hitze auf den Schultern zu spüren. Sie ging gleichmäßig, es war gut, ausschreiten zu können. Von hier oben sah sie weiter im Norden die Landstraße liegen, auf der ab und an ein Auto fuhr, ohne dass sie es hätte hören können. Der Wind kam von Südwesten. Hoch über ihr surrte ein Flugzeug durch den leeren Aprilhimmel. Sie blieb stehen und sah ihm nach. Fliegen. Wie sich das wohl anfühlte?
Am Friedhof schloss der alte Satzinger gerade das Tor, als sie das Dorf erreichte. Den gab es immer noch. Eigentlich war sie nicht einmal ganze drei Jahre fort und an Weihnachten und die zwei Urlaubswochen im Sommer zum Helfen daheim gewesen, aber in diesem Moment kam es ihr so vor, als wäre sie ihm als Kind das letzte Mal begegnet. Seltsam.
»Sel, die Strasser Roberta«, sagte er in dem schweren Salacher Zungenschlag, »bist wieder daheim?«
Sie hätte fast gelacht. Nichts sagte ihr mehr, dass sie wieder daheim war, als dieses lang gezogene, bedächtige »sel«, das in der Stadt niemand verstand und das alles heißen konnte, »aha« und »wohl« und »soso« und »schau an«.
Sie nickte. Der Satzinger drehte den Schlüssel im schwarz geschmiedeten Schloss des Friedhofstors. Sie kannte es nicht anders, als dass er nach der Kapelle schaute, die alten Kränze auf den Mist warf und das Gras zwischen den Gräbern schnitt. Hier war schon immer alles gewesen wie immer.
»Den Vater wird’s freuen«, nickte auch er wie zur Bestätigung. »Es ist Arbeit genug am Hof.«
Ja, dachte sie, als sie weiterging. Aber auch das war immer so gewesen: Arbeit genug.
2
Gertrud hängte Wäsche auf, als sie Roberta über den Dorfplatz auf den Hof der Eltern zugehen sah. Sie hasste Wäscheaufhängen, aber besser im Pfarrgarten als auf dem Dachboden wie im Winter. Und sie hasste es eigentlich auch, dass sie wusste, dass es Roberta war, die da nach ihrer Lehre in der Stadt – was war es gewesen? Verkäuferin? – wieder nach Hause zurückkehrte.
Fünf Jahre, hatte es damals geheißen, hatte Hermann damals gesagt, als er hierher versetzt worden war. Fünf Jahre, und dann bewerbe ich mich in die Stadt. Das ist meine erste Gemeinde, ich kann keine Ansprüche stellen, und überhaupt muss man überall wirken können als Pfarrer. Zwanzig Jahre waren daraus geworden. Wilhelm war anderthalb gewesen, als sie in dieser Eisburg angekommen waren. Schüröfen im Wohnzimmer und im Esszimmer. Keine Heizung im Kinderzimmer oder im Gästezimmer oder im Schlafzimmer. Im Winter Frostblumen an den Scheiben, und wenn man abends den Tee auf dem Fensterbrett hatte stehen lassen, dann war morgens eine dünne Eisschicht in der Tasse. Wie sie um die Ölöfen hatte kämpfen müssen! Der Kirchenvorstand … alles Bauern. Bei uns heizt auch keiner die Schlafstube. Die Gemeinde hat kein Geld. Die Orgel gehört überholt. Das Ziffernblatt der Kirchturmuhr wollen wir schon lange austauschen. Und warum sie kein Gemüse anbaue im Pfarrgarten wie alle anderen. Dann wäre nämlich Geld genug da für einen Ofen, den dann die Gemeinde nicht bezahlen müsste.
Nein. Natürlich heizte keiner die Schlafstube. Die war bei denen neben dem Stall, da war es warm genug.
Es war nicht nur wegen ihr. Wilhelm hätte sie gewünscht, dass er nicht nur hier aufgewachsen wäre. Nicht zehn Kilometer mit dem Rad fahren müssen, wenn man ins Kino wollte. Oder jeden Tag so früh aufstehen müssen, weil er den Bus zur Oberschule nahm. Ein einziger Junge aus dem Nachbardorf war auch aufs Gymnasium gegangen, und wie es so war – er und Wilhelm hatten sich nie leiden können. Wilhelm war ein Stiller, aber er wusste, wen er mochte und wen nicht. Vielleicht kam er zu sehr nach seinem Vater.
Wenn sie seine Freunde nicht manchmal mit in die Stadt ins Bad mitgenommen hätte, dann könnte hier im Dorf immer noch keiner schwimmen. Roberta auch, erinnerte sie sich. Die war auch immer unter denen gewesen, mit denen Wilhelm gespielt hatte. Vielleicht hatte sie die Lehre in der Stadt auch deshalb gemacht. Weil sie schon mal was anderes gesehen hatte als immer nur das Dorf.
Sie schlug das schwere, nasse Laken aus und klammerte es an die Leine. Immerhin war Frühling.
3
Der Hof war leer, die Eltern auf dem Feld. Sie ging durch den Stall ins Haus; die hintere Tür war nie zu. In der Stadt schlossen sie immer alle Türen ab, das hatte sie am Anfang gewundert. Aber dann auch wieder nicht. Die waren sich ja alle fremd. Hier schlossen sie immer nur die Haustür zu, wenn sie weggingen. Das Wertvolle war ja nicht im Haus, sondern in den Ställen und Scheunen, und die konnte man eh nicht alle zusperren.
In der Küche war es fast wärmer als draußen. Sie befühlte das Wasserschaff – es war noch heiß. Also hatte die Mutter gekocht, und das hieß, dass sie auf keinem der weiter entfernt liegenden Felder waren, wenn sie zu Mittag hatten heimkommen können. Der Geruch nach Holzfeuer – das hatte ihr gefehlt in der Stadt. Die ewige Hitze in der Küche nicht. Aber die Mutter würde niemals einen elektrischen Herd wollen. Nicht, weil sie gegen das Neue war. Schließlich hatten sie jetzt auch eine Melkmaschine. Aber das Holz kostete sie nichts. Der Strom schon.
Sie ging kurz nach oben auf ihre Stube. Alles wie immer. Das Bett frisch bezogen. Hier war es gleich kühler, weil die Mutter das Fenster musste aufgetan haben, bevor sie aufs Feld gegangen war. Sie nahm ein Buch aus dem Regal, das ihr der Vater gezimmert hatte, als es immer mehr geworden waren. Sturmhöhe. Das hatte sie immer gemocht. So voller Kraft. Und darin auch eine, die auf einem Hof groß geworden war. Sie wog das Buch in der Hand, ohne es aufzuschlagen. Alte Geschichten.
Sie trat ans Fenster. Über dem hohen Scheunendach der Kirchturm. Nie war der Blick anders gewesen. Der weiche Glockenschlag hatte von Anfang an die Tage ihrer Kindheit gezählt und ihre Mädchenjahre. Das Abendläuten im Winter um sechs, im Sommer um acht. Der Vater im Stall nahm dann die Mütze ab und betete ein schnelles Vaterunser, obwohl er vom Pfarrer nicht viel hielt. Ob er an etwas glaubte? Wahrscheinlich tat er es nur, weil alle es taten. Weil es Herkommen war, und wenn man einmal anfing, das Hergekommene zu lassen, dann flog alles auseinander. Sie lächelte. Ja. Wahrscheinlich war es hier so. Wenn man das Hergekommene ließ, dann flog alles auseinander.
Sie sah noch einmal auf das Buch. Da war es auch so, dass alles auseinandergeflogen war. Sie stellte es zurück ins Regal zu den anderen. Obwohl das Buch schon so alt war: Diese Geschichte hatte sie immer berührt.
Es hielt sie nicht im Haus. Das Dorf war nachmittagsstill und die Gassen fast so leer wie an einem Sonntag. Sie holte sich das Fahrrad der Mutter aus der Scheune. Als sie auf die Hauptstraße abbiegen wollte, musste sie warten. Der Postbus kam und fuhr die Haltestelle an. Es war trotz der Jahre in der Stadt immer noch genug Dorf in ihr, dass sie nicht gleich weiterfuhr, als der Bus an ihr vorbei war, sondern dass sie wartete, bis alle ausgestiegen waren. Diese selbstverständliche Neugier, die es hier gab. Vielleicht konnte man es gar nicht Neugier nennen. Vielleicht war es ein selbstverständliches Wissenwollen. Wer kam und wer ging? In der Stadt gab es viel zu viele Menschen, da interessierte es niemanden, aber hier? Hier war es wichtig.
Sie hatte die Unterarme auf den Lenker gestützt und sah den Schmied Walter aussteigen und die Betty vom Hörnleinshof. Die war wohl beim Arzt gewesen, so wie sie sich aufgeputzt hatte, obwohl sie doch schon über fünfzig war. Es hieß, dass sie gerne zum Arzt ging und öfter als eigentlich nötig.
Ich habe das alles noch im Kopf, dachte sie ärgerlich. Wozu? Was geht’s mich an, wenn die Hörnleins Betty gern zum Arzt geht. Ihr Mann … na, jeder wusste, dass der nicht gegen sie aufkam. Gerade, dass er nicht kleiner war als sie, aber ganz sicher nicht so stark. Wenn die aufs Feld fuhren, dann saß er hinten auf dem Traktor.
Sie schüttelte unwillig den Kopf über sich. Jetzt dachte sie doch weiter und wollte das gar nicht. Sie hob sich aus dem Sattel und wollte los, als der Wilhelm hinter dem anfahrenden Bus auftauchte. Er sah sie und hob nach einem kurzen Zögern die Hand als Zeichen des Wiedererkennens.
»Roberta. Bist du wieder da oder nur auf Urlaub?«
Er sah nicht mehr so sehr wie der Junge aus, den sie in Erinnerung hatte.
»Die Lehre ist vorbei. Ich bin jetzt wieder auf dem Hof. Die Eltern brauchen mich da. Und du? Studierst du jetzt?«
Er schüttelte den Kopf.
»Noch nicht. Meine Mutter hat es eigentlich gewollt, weil ich dann nicht zum Militär hätte müssen, aber ich hab gedacht …« Er zögerte einen Augenblick, als ob er nachdächte, dann machte er sich gerade. »Ich mache gerade Zivildienst. Im Krankenhaus.«
»Du hast verweigert?«
Sie kannte niemanden im Dorf, der verweigert hätte. Man schloss die Schule ab, man machte seine Lehre, und dann ging man zum Bund. Wenn sie ein Junge gewesen wäre … sie überlegte einen Augenblick. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie hatte sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Es betraf sie nicht.
»War es schwer?«
Wilhelm schüttelte den Kopf.
»Der Papa hat mir geholfen. Allein hätte ich es nicht schreiben können. Die Anhörung war streng, aber sie haben mich dann doch durchgelassen.«
Wie selbstverständlich er »Papa« sagte. Sie hatte den Vater niemals anders als »Vater« genannt. Sie musste lächeln und sah für einen Augenblick nach unten, weil er es nicht sehen sollte. Aber er hatte es schon bemerkt.
»Was denn?«, fragte er höflich.
»Nichts. Ich fahre zum Steinbruch«, sagte sie schnell, weil sie nicht wusste, wie sie hätte erklären sollen, dass es … so seltsam zärtlich klang, wie er vom Herrn Pfarrer sprach.
»Ah.« Er wandte sich zum Gehen. »Na, es ist schön, dass du wieder da bist, Roberta.«
Er ging, die Hände in den Hosentaschen, mitten auf der Gasse in Richtung Pfarrhaus. Er war immer ein bisschen komisch gewesen, zwischen scheu und wild, der Wilhelm.
Sie stieg endgültig auf und trat in die Pedale; auf einmal in Eile, aus dem Dorf herauszukommen, bevor sie mit noch jemandem reden musste.
In der Kastanie am Ortsausgang bildeten sich allmählich die Blütenkerzen. Noch kein Nektar, deswegen schwärmten die Bienen woanders. Sie war lange nicht mehr mit dem Rad gefahren. In der Stadt hatte sie keins gehabt und zur Schneiderei sowieso immer die Tram nehmen müssen. Der Fahrtwind war schon sommerlich weich und der Himmel immer noch hoch, obwohl es bald auf den Abend zugehen würde. Auf dem Feld neben ihr waren die Rüben bereits aufgelaufen und würden bald gehackt werden müssen. Wenn der Vater welche angebaut hatte. Auf dem Feld draußen an der Teufelsmauer sicher nicht, da war der Boden sandig.
Sie schüttelte den Kopf, ärgerlich über sich selbst. Morgen war Zeit genug für diese Gedanken, heute war sie noch frei.
Auf dem Feldweg, der von der Landstraße abbog, standen Pfützen in den Schlaglöchern, die immer wiederkamen, auch wenn man sie noch so oft mit Ziegelschutt auffüllte. Es musste geregnet haben. Sie wich den größten Lachen aus, aber ab und zu rollte sie doch spritzend durch und hob dann rasch die Füße von den Pedalen. Hier waren sie oft gewesen. Wilhelm auch manchmal. Dieses eine Mal war er auf jeden Fall dabei gewesen. Komisch, dass es sie trotzdem immer wieder hierherzog. Alle paar Monate, wenn es daheim zu viel wurde, eine Zeit lang sogar fast jede Woche. Vom Dorf kam keiner hierher, außer vielleicht die Jäger, aber die waren nachts da oder in der Frühe.
Es war schön, dass alles blühte. Blühen versprach die Frucht, sah schön aus und bedeutete noch keine Arbeit. Die war noch weit weg. Das Äpfelauflesen und die Kartoffelernte und das Rübenhacken und … und schon wieder waren ihre Gedanken bei der Arbeit, dabei rollte sie eben an den Holunderhecken vorbei, die so dunkelsüß dufteten. Zum Steinbruch ging es leicht hügelan. Er lag unterhalb des Waldes, der über die Jahre immer näher an seine Kante herangewachsen war, seit der Steinbruch aufgelassen wurde. Kurz davor gabelte sich der Weg, und sie entschied sich für den breiteren, der steil bergab ging; da, wo früher die Fuhrwerke direkt in den Bruch gefahren sein mussten, um die Steine aufzuladen. Dort unten hatten sie immer gespielt, wenn sie es ungesehen aus dem Hof geschafft hatte. Räuber und Schander. Indianer. Krieg. Die Amis hielten im Herbst immer ihre Manöver im Wald ab, und manchmal hatten sie Patronenhülsen gefunden, aus denen sie sich dann Cowboygürtel bastelten. Und einmal eine Handgranate, aber die hatten sie versteckt, weil der Wolfgang gesagt hatte, dass sie zu gefährlich war. Cowboy hatte sie nie sein dürfen. Indianerin eben. Aber Räuber schon. Dagegen konnten sie nichts sagen.
Sie lehnte das Rad an einen der riesigen Blöcke, die hier immer noch herumlagen. Wenn sie den Steinbruch heute so ansah, dann kam es ihr vor, als hätten sie von einem Tag auf den anderen mit der Arbeit aufgehört. Nach der letzten Sprengung vielleicht. Ein paar der Brocken waren schon rechteckig zugerichtet, aber sie waren nicht mehr abgeholt worden.
Von den Steinen ging eine Hitze aus, die gar nicht zum späten April passen wollte. Viel wuchs nicht hier unten. Ein paar Disteln. Steinbrech natürlich. Und da, wo sich im Laufe der Zeit angewehtes Laub gesammelt hatte, ein paar Brennnesselinseln.
Sie hatten ihnen den Steinbruch immer verboten, streng sogar. Wegen der losen Steine und der Abbruchkante, hatten die Eltern gemeint. Der alte Satzinger wiederum hatte behauptet, da läge noch Munition aus dem Krieg. Und der Bürgermeister hatte irgendwann ein Schild am Zaun anbringen lassen: Betreten verboten. Einsturzgefahr. Was genau hätte einstürzen sollen, war ihnen nie klar gewesen. Aber vor dem Sommerkeller am Rand des Bruchs hatten sie von sich aus schon Angst gehabt. Keiner von ihnen hatte sich jemals tief in die Höhlen getraut. Der Wolfgang hatte behauptet, es gäbe einen Gang bis hinein ins Dorf, in den Keller vom Pfarrhaus, noch von irgendeinem Krieg von ganz früher. Sie musste lächeln, wenn sie daran zurückdachte. Ihre Fackeln hatten nie gebrannt. Gerade, dass sie noch glommen, wenn man ein paar Meter hineingegangen war. Der Wilhelm hatte einmal Kistenspäne mitgebracht, die er vorher mit Kerzen abgerieben hatte. Die leuchteten wenigstens ein wenig, aber sobald das Wachs weggebrannt war, gingen die auch aus.
Sie suchte den Weg zum Eingang des Sommerkellers. Früher hatten sie das Bier da gelagert und das Eis. Es gab im Umkreis von fünfzehn Kilometern keinen See und keinen Fluss, deshalb hatten sie im Winter das Eis von weit her holen müssen, aus einem Weiher bei der Anlauter vielleicht oder noch weiter im Süden. Das hölzerne Gatter hing schief in den Angeln. Im Eingang des Kellers wuchsen ebenfalls Brennnesseln und ein wenig Gras, so weit das Licht reichte. Sie legte den Kopf zurück und sah nach oben. Das frühere Wirtshaus war direkt über den gemauerten Eingang gebaut worden, und es hatte denselben Namen gehabt: Zum Sommerkeller.
Warum kam sie immer wieder her? Sie konnte es nicht sagen. Nur, dass es sie immer wieder hierherzog. Wie eine seltsame Lust war es, ein kleiner Schmerz, den man immer wieder fühlen musste. Sie hatte als Kind ihre Wunden nie in Ruhe lassen können. Aber das allein war es nicht. Es war auch das immerwährende Rätsel, zu dem man immer wieder zurückkehren musste.
Das Haus war noch verfallener als damals. Einen der hölzernen Läden hatte es wohl bei einem Sturm heruntergehauen. Er lag auf der völlig überwachsenen Außentreppe zum Wirtshausgarten hinauf und verrottete da. Die anderen hingen schief in den Angeln. In ein paar Fenstern fehlte das Glas. Vielleicht war der Kitt so alt geworden, dass sie einfach herausgefallen waren – sie sah keine Scherben. Am Ende war das damals auch schon so gewesen; sie erinnerte sich nicht. Aber die kleine Birke, die aus dem Mauervorsprung vor den Fenstern im ersten Stock wuchs, die hatte es noch nicht gegeben, da war sie sich sicher.
Sie stand im völlig verwilderten Biergarten vor dem Eingang. Die verrosteten, nackten Metallgestelle der Stühle lagen im hohen Gras herum, kaum noch sichtbar, die hölzernen Sitzflächen längst herausgewittert. Die Kastanie in der Mitte wölbte sich über den gesamten Garten. Es musste ein schönes Wirtshaus gewesen sein. Der Vater hatte erzählt, dass seine Eltern vor dem Krieg hierher zum Tanz gekommen waren, am Samstagabend oder manchmal, wenn Kirchweih war, auch an den Sonntagnachmittagen im Sommer. Das lag schon lange zurück, dachte sie, als sie zu den Gastzimmern hochsah, sie war noch ein Kind gewesen. Dann trat sie in den Gang. Wie damals.
Wilhelm, Wolfgang und sie. Sie wussten, es war verboten. Ende Februar musste es gewesen sein. Die Nächte noch frostig, und Schnee war auch noch gelegen. Aus dem Grund waren sie überhaupt hergekommen. Noch einmal rodeln, bevor der Winter ganz vorbei war. Aber auf dem Feld unterhalb vom Wald hatte es schon angefangen zu tauen; der Schnee war schwer und schmutzig gewesen, und der Schlitten hatte nicht mehr rutschen wollen. Dann waren sie zum Steinbruch gelaufen und hatten das Wirtshaus entdeckt. Der Wolfgang hatte eigentlich nicht mitkommen wollen, der Schisser. War er heute noch, dachte sie.
Der Vater haut mich recht her, hatte er gesagt. Immer wieder. Bis der Wilhelm stehen geblieben war und gesagt hatte: Du kannst auch heimlaufen. Roberta und ich gehen auf jeden Fall.
Dabei hatte er sie angesehen, als wollte er wissen, ob das stimmte. Es hatte gestimmt. Obwohl sie wusste, obwohl das ganze Dorf wusste, dass der Vater vom Wolfgang wirklich so war. Schellen gab es bei allen. Aber der Vater vom Wolfgang nahm den Gürtel oder auch Haselgerten, und die zündeten so, dass einem die Haut aufplatzte. Wolfgang hatte es ihnen einmal vorgemacht, nach der Schule auf dem Kirchhof, und alle hatten es sich geben lassen. Weil keiner feig sein wollte, aber Wolfgang hatte so zugehauen, dass Wilhelm an der Schulter wirklich geblutet hatte.
Neun oder zehn mussten sie gewesen sein. Sie wusste es nicht mehr genau. Zusammen hatten sie die Tür aufgezogen. Sie hatte sich nur schwer drehen lassen; das Holz aufgequollen von der Winternässe und die Angeln rostig von der Zeit. Der Gang dunkel, aber im alten Gastraum war es hell und eisig gewesen. Auf einem der Tische am zerbrochenen Fenster sogar ein angewehter Haufen Schnee, aus dem es gleichmäßig auf den Boden tropfte. Wolfgang hatte aus Spaß den Lichtschalter gedreht, aber natürlich gab es hier schon lange keinen Strom mehr. An den Zapfhähnen hatten sie gespielt, und dann hatte Wilhelm angefangen, die Biergläser aus den Regalen in den Raum zu schmeißen. Hatte er einfach so gemacht. Schließlich sie und sogar Wolfgang. Lachend und schreiend. Jedes einzelne Glas hatten sie an die Wände gefeuert und auf den Boden, bis keins mehr übrig war und der Boden unter ihren Sohlen knirschte, weil alles voller Scherben war.
Dann waren sie nach oben gegangen; fiebrig und aufgeregt und immer noch lachend. In jedes Zimmer hatten sie geschaut. In einem hatte sogar noch ein Bett gestanden; immer noch bezogen, voller Mäuseschiss und Taubenfedern. Und im Zimmer gegenüber hing der schöne Bernd an einem Strick von der Decke, ganz still. Zu dritt in der Tür stehend, waren sie auch ganz still geworden.
Sie stand da, wo sie damals gestanden hatte. Im Türrahmen. Durch das glaslose Fenster ragten die Zweige der jungen Birke, die außen auf dem Vorsprung im Mauerwerk wuchs. Die Blätter bewegten sich leicht in der aufkommenden Abendbrise. Die Luft war leicht und warm. Es überlief sie, aber es war kein unangenehmes Gefühl. Eher wie die Erinnerung an eine längst überwundene Angst. Noch ein Grund vielleicht, neben dem ewigen Rätsel, weshalb sie immer wieder herkam.
Ganz still hatte er gehangen, der schöne Bernd aus Raitenbühl. Sie kannten ihn alle drei. Er hatte die Fußballer trainiert, und im Kirchenchor hatte er gesungen. Für die Kirchenjugend waren sie alle drei noch zu klein gewesen und daher lange neidisch auf die Großen, weil die einmal im Jahr mit dem Bernd ins Zeltlager fahren durften; hinunter an die Donau.
Der Vater schlägt mich tot, hatte Wolfgang mit ganz kleiner Stimme gesagt. Der schlägt mich tot.
Unter dem schönen Bernd lag ein umgestürzter Wirtshausstuhl. Daneben ein Schuh. Den anderen hatte er noch an, aber einer lag am Boden. Daran erinnerte sie sich immer wieder. An den Schuh. Heute wusste sie: Er musste mit den Beinen im Todeskampf gestrampelt und dabei den Schuh verloren haben. Damals hatte sie das Bedürfnis gehabt, hinzugehen und ihm den Schuh wieder anzuziehen. Als ob sie dadurch alles wieder hätte gutmachen können.
So hatten sie dagestanden und ihn angeschaut.
Wir müssen es sagen.
Aber Wolfgang schüttelte wild den Kopf. Seine Stimme war so voller Angst, wie sie sie noch nie gehört hatte.
Wir haben doch alles kaputt geschlagen unten. Und sie haben es doch verboten. Wir hätten nie herkommen dürfen. Der Vater schlägt mich tot, wenn wir es sagen. Wirklich. Der schlägt mich tot.
Ja, sie hatten es ihnen verboten. Jedes Kind im Dorf wusste, dass der Steinbruch verboten war.
Wir dürfens nicht sagen. Ihr müsst schwören. Wir sagen nichts.
Der Abend kam. Draußen färbte der Himmel sich allmählich in sanften Farben. Manchmal hatte sie an solchen frühen Abenden aus dem Fenster der Schneiderei geschaut und sich gedacht, dass man den Himmel zuschneiden sollte, wenn er so gefärbt war. Weil Kleider aus solchem Stoff einen sicher glücklich machen konnten.
Sie sah aus dem Fenster, und gleichzeitig erinnerte sie sich, wie sie damals Wilhelm angesehen hatte.
Alle drei hatten sie noch einmal zum schönen Bernd geschaut. So gern wäre sie hingegangen und hätte ihm den Schuh wieder angezogen. Auf dem Tisch neben dem Fenster lag ein Zettel. Ein wenig Schnee war auch darauf geweht, aber man konnte ihn noch sehen. Warum sie ihn einsteckte, wusste sie nicht. Vielleicht, weil sie irgendwas tun wollte, wenn es schon nicht der Schuh sein konnte und irgendwie ein wenig Ordnung gemacht werden musste. Die beiden Buben sahen sie an.
Sie finden ihn eh, hatte Wilhelm schließlich unsicher gesagt und sie dazu nur genickt. Die Erwachsenen wussten wirklich fast immer alles, auch wenn man dachte, es wäre geheim. Sie gingen aus dem Zimmer und lehnten die Tür dann wieder so an, wie sie meinten, dass sie sie vorgefunden hatten.
Sie waren aus dem Haus gestürzt, waren mit dem Schlitten nach Hause gerannt, atemlos. Ihr habt geschworen, hatte Wolfgang am Dorfplatz gesagt, drohend fast, und war weitergelaufen zu sich nach Hause. Dabei hatten sie gar nicht geschworen, dachte sie damals. Sie jedenfalls hatte nichts gesagt.
Sie stieg wieder nach unten. Vorsichtig, manche Stufen waren schon morsch, und das Geländer war wacklig. Als sie aus dem alten Wirtshaus in die späte Sonne trat und langsam zu ihrem Rad hinunterstieg, atmete sie so schnell, als wäre sie gelaufen.
Ja, dachte sie, als sie aus dem Steinbruch fuhr, ich bin wieder daheim. Im Guten wie im Schlechten.
4
Gertrud hatte die Fenster weit geöffnet, um die laue Luft hereinzulassen. Sie hätte gerne auf der Terrasse gedeckt und dort Abendbrot gegessen, aber dazu war es noch zu kühl. Außerdem lag die Terrasse nach Nordwesten. Weil der Pfarrgarten natürlich nach Süden liegen musste. Das Haus war über zweihundert Jahre alt, aber so war alles. So dachte man auf dem Dorf: Das Gemüse brauchte Sonne. Die Gäste des Pfarrers nicht. Nur im Hochsommer war es nicht schlecht. Dann war es dort angenehm. Die großen Steinplatten waren wunderbar kühl, und man brauchte keinen Sonnenschirm. Aber Hochsommer war es noch nicht.
Sie warf das Leintuch über den Tisch. Hermann machte sich nichts daraus, ob es ein Tischtuch gab oder nicht. Er würde es wahrscheinlich nicht bemerken, wenn er mit seinem Buch zum Essen kam, es neben seinen Teller legte und nebenbei aß. Er las nicht nebenbei, sondern aß neben dem Lesen. Das hatte sie am Anfang an ihm gemocht. Diese Verlorenheit in geistigen Dingen. Einer, den die Trümmer um ihn herum, der Hunger, das ganze Nachkriegselend nichts angingen. Ein Student, der lesend, traumverloren in einem leeren Park auf einer halb kaputten Bank sitzen konnte. Um sich herum kaum noch Bäume, weil die alle zum Heizen gefällt worden oder bei den letzten Angriffen verbrannt waren. Georg hatte ihn ihr vorgestellt. Lachend: Das ist Hermann. Der studiert richtig. Ihr Bruder war auch manchmal in anderen Sphären, aber nie so vergeistigt wie Hermann. Georg liebte auch die praktischen Dinge, hatte immer gerne Sachen auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Wollte wissen, wie die Dinge im Innersten funktionierten. Vielleicht hatte er deshalb von Theologie zu Jura gewechselt. Hermann war bei Theologie geblieben.
Ja. Das war schön an ihm gewesen. Und, seltsam, die Bauern machten sich nichts daraus, dass er völlig unpraktisch war. Dass er dem alltäglichen Dorfleben so fremd war, wie man nur sein konnte. Vielleicht musste ein Pfarrer für sie so sein. Eine Art Telefon zum lieben Gott. Sie verstanden nicht, wie er lebte, aber sie hatten einen Respekt vor ihm, den Gertrud sich nicht erklären konnte; einen Respekt, der nicht nur von seinem Amt kam. Auf sie erstreckte er sich nicht. Vielleicht war sie zu hochmütig. Sie wollte es nicht sein, aber dieser ganz leicht abfällige Ton, mit der in ihrer Hamburger Kaufmannsfamilie von Bauern gesprochen worden war, früher … ganz verschwand der vermutlich nie, und wie sollte er auch, hier in diesem Kaff? Wo sie keine Terrassen gewohnt waren, die nach Süden gingen. Wo man kein Telefon im Haus hatte und dann eben zum Pfarrer oder zum Bürgermeister ging, wenn man einen Anruf zu machen hatte. Ihre Eltern hatten bereits vor dem Krieg Telefon gehabt. Ja, das war es wohl. Und sie war immer nur die Frau Pfarrer. Mit ihrem Namen war sie hier im Dorf noch nie angesprochen worden. Noch nie.
Sie holte die Gläser aus dem Schrank. Wasser für ihn und Wilhelm. Wein für sich. Es hatte ihr schon als kleines Mädchen gefallen, dieses Glas Wein der Eltern am Abend. In Hermanns Familie hatte es das nie gegeben, obwohl er aus der Weingegend kam und sie aus dem Norden. Pietisten.
Unten ging die Tür, und sie hörte Schritte. Wilhelm. Hermann ging ganz anders, viel schwerer, obwohl er so dünn war. Wilhelms Gang hörte sich jung an.
»Mama?«, hörte sie ihn rufen.
»Hier oben. Ich decke gerade. Abendbrot ist in fünf Minuten.«
Er nahm immer zwei Stufen, so wie sie, lehnte dann am Geländer und hob in dieser halb schüchternen, halb unbeschwerten Art die Hand. Wie frisch er aussah, auch am Ende eines Arbeitstags.
»Roberta ist wieder da«, sagte er ohne Übergang. Als Kind war er immer so gewesen. Sagte, was ihm durch den Kopf ging. Das war selten geworden. Umso schöner sein Lächeln jetzt.
Gertrud nickte.
»Ich habe sie gesehen, vorhin. Wie lange war sie weg? Verkäuferin hat sie gelernt, oder?«
»Schneiderin«, antwortete Wilhelm und sah für einen kleinen Augenblick aus dem Fenster hinüber zur Kirche. »Drei Jahre. Als ich in die elfte Klasse gekommen bin, ist sie weg in die Stadt.«
Sie hob die Schultern.
»So ist das. Irgendwann geht es ins Leben. Sie kann froh sein, dass sie schon was gesehen hat von der Welt. Bei den meisten Dorfkindern … na ja.«
Er sagte nichts. Nahm seine Tasche auf und ging in Richtung Bad.
»Ich komme gleich. Hände waschen.«
Gertrud nahm die Treppe nach unten, um den Wein zu holen. Sie spürte das kleine Lächeln in ihren Mundwinkeln. Es war so, als käme mit Wilhelm das Leben ins Haus zurück.
5
»Gut, dass du wieder da bist. Wir müssen zum Lindenhain heute, Rüben hacken«, sagte der Vater.
Sie saß am Tisch, als wäre sie nie weg gewesen. Auf der roten Bank, unter dem kleinen Kreuz, das über ihr im Eck hing und das die Mutter beim Reinemachen immer vergaß. Als Kind hatte sie sich immer vor den Spinnweben gegraust, die dem Herrn Jesus übers Gesicht hingen. Heute lächelte sie, wenn sie zufällig hochsah. Es passte gut. Ob der Herrgott zusah oder nicht, hier unten in der Küche geschah doch immer das Gleiche, seit zwanzig Jahren. Dünner Kaffee am Morgen. Selbst eingekochte Marmelade auf der ebenso dünnen Schicht Butter. Als hätten sie keine fünfzehn Kühe im Stall stehen. Früher hatten sie die Butter selbst gemacht, erzählte die Mutter manchmal. Das war lange her. Heute kam sie von der Genossenschaftsmolkerei und ging vom Milchgeld ab. Der Vater war nicht geizig, aber wenn er die Zahlen sah, schwarz auf weiß, dann fing er das Rechnen an, und dann gab es weniger Butter.
So. Bist du auch wieder da?
Die Begrüßung gestern Abend, als die Eltern vom Feld kamen. Ohne Überraschung und ohne Freude. Als wäre sie nur beim Arzt gewesen oder in der Schule, nicht drei Jahre fort in der Stadt.
So. Bist du auch wieder da.
Ja, so war es hier. Nicht wie beim Herrn Pfarrer, der vom Wilhelm »Papa« genannt wurde. Bei ihnen gab man sich die Hand beim Abschied, aber nicht beim Wiederkommen. Man gab sich die Hand, wenn einer gestorben war, am Grab, und man gab sich die Hand, wenn man zur Hochzeit gratulierte oder zur Geburt. In der Stadt küssten sie sich sogar auf der Straße. Und einmal hatte sie ein altes Paar gesehen, die waren Hand in Hand gegangen. Sie hatte lachen müssen, als sie sich den Vater und die Mutter so vorstellte. Hand in Hand.
Gut, dass du wieder da bist. Zum Rübenhacken.
Vielleicht war das so ähnlich, wie wenn man sich die Hand gab. Willkommen daheim.
Der Morgen war kühl und der Himmel weißlich überzogen. Vielleicht würde es später sonnig werden, aber jetzt spürte man noch die Feuchte in der Luft. Kein schlechtes Wetter, um auf dem Feld zu sein. Sie waren schon am Lagerhaus auf den Weg nach Bühl abgebogen, und die Hacken tanzten auf dem Ladewagen, wann immer es über ein Schlagloch ging. Die hätten auch längst verfüllt gehört, dachte sie. Steine am Feldrand hatte es genug. In jedem Frühjahr pflügte man sie hoch, und es war, als würden sie über den Winter immer wieder nachwachsen. Der Boden hier war nicht schlecht, aber wenn die Steine größer waren, fuhr man sich manchmal die Egge kaputt, und beim Vollernter lagen auf dem Sortierband oft mehr Kalkbrocken als Kartoffeln.
Sie musste sich mit einer Hand festhalten, denn es rüttelte sie auf dem Bulldog ordentlich durch. Es war trotzdem gut, wieder hier zu sein. Das hatte ihr gefehlt. Morgens schon draußen sein zu können, nicht erst nach einem langen Tag in der Arbeit. Vor allem im Frühjahr, so wie jetzt. Durch das Tuckern des Motors hörte sie die Lerchen. Sie sangen noch! Immer waren es die Lerchen, die, eher noch als der Kuckuck, den Frühling versprachen. Und ihr Verstummen, das man manchmal erst nach ein paar Tagen bemerkte, markierte immer den Anfang des Sommers. War es nicht komisch, dass man das Fehlen oft erst nach einer Weile bemerkte, aber etwas Neues immer sofort? Ob sie den anderen im Dorf gefehlt hatte? Dem Wilhelm? Na ja. Musste wohl. Gestern hatte er sie zumindest gleich angesprochen.
Der Weg war so holprig, dass es den Vater im Sitz immer wieder plötzlich hob. Es sah lustig aus – der große Mann wie eine Puppe. Aber das Lenkrad hielt er trotzdem fest, auch wenn nur mit einer Hand, während er mit dem schwieligen Daumen der anderen den Tabak in der Pfeife nachdrückte. Und blau ausatmete. Der Duft wehte an ihr vorbei. Ja. Das war auch eines der Dinge, die sie vermisst hatte, ohne es zu merken. In der Stadt rauchten sie alle Zigaretten und manchmal ein alter Mann Zigarre. Aber Pfeife rauchte keiner. Dabei roch das so viel besser. Und komisch – das fiel ihr jetzt erst auf –, im Winter rauchte der Vater nur ab und zu einmal, am Abend vielleicht. Aber im Frühjahr und im Sommer, da hatte er die Pfeife manchmal schon am Morgen zwischen den Zähnen. Dann wusste man: Er war gut gelaunt.
Sie waren am Feld angelangt.
»Wirst es noch können?«, fragte der Vater mit einem halben Lächeln, als er ihr die Hacke vom Ladewagen herunterreichte. Die Mutter stand schon in der ersten Furche.
»Es wird schon noch gehen.«
Sie arbeiteten sich nebeneinander das Feld hinunter. Es war noch früh im Jahr für die Rüben, und so waren die Schosser noch klein, aber sie hatte das schon tausendmal gemacht und wusste, wo sie hinlangen musste. Aber sie wusste nicht, warum. Seltsam. Seit sie klein war, hatte sie das gemacht. Jahr für Jahr. Und wusste nicht, wieso sie das taten.
»Vater?«
Er war ein Stück vor ihr und drehte sich nicht um, als er antwortete.
»Ja?«
»Wenn wir die Schosser nicht ziehen, was dann? Warum muss das sein?«
Er bückte sich. Stieß beim Ausatmen ein Wölkchen Tabakrauch aus, und sie hätte fast gelacht. Wie eine kleine Lokomotive sah er aus, der große Mann da vorn.
Er zog einen Schosser heraus und drehte sich zu ihr um.
»Fünftausend Samen oder zehntausend, ich weiß nicht mehr. Wenn wir sie stehen und blühen täten lassen, dann hätte man zehntausend Samen im Acker. Die können über fünfzehn Jahre noch keimen, aber dann hast du nur noch Unkrautrüben. Zu klein, kein Zucker … deswegen.«
Er ließ den Trieb fallen und drehte sich wieder um. Genug erklärt.
Komisch war es schon, dachte sie, als sie ihm in der Nachbarfurche folgte. Eigentlich wäre sie lieber stehen geblieben, um den Gedanken in Ruhe zu Ende denken zu können. Sie taten es einfach. Manchmal, ganz selten, sagten sie einem, warum. Aber oft wussten sie es selbst nicht. Man tat es so, weil es immer so getan worden war. Wenn man taufeuchtes Gras gemäht hatte, durfte es nicht auf einem Haufen liegen.
Brennholz wurde im Kreis geschichtet.
Am Samstag wurde die Straße gekehrt.
Es war anscheinend nicht falsch. Es funktionierte. Beim Gras wusste sie sogar, warum. Einmal war sie am Morgen vom Mähen heimgekommen, und die Mutter hatte schon im Hof auf sie gewartet, dass sie zum Dennerlein laufen sollte, dem Tierarzt. Eine der Kühe sollte kalben, und das Kalb wollte nicht heraus. Als alles getan war, der Dennerlein tief hineingelangt hatte, mit dem Strick in der Hand, und dem Kalb im Mutterleib die Beine gefesselt hatte, damit sie es herausziehen konnten, da war es Mittag geworden. Als sie schließlich zurück zu dem Wagen gekommen war, hatte das nasse Gras schon zu rauchen angefangen. Sie hatte es erst nicht glauben wollen, hatte gedacht, es sei Dampf, die Hand hineingesteckt und sich verbrannt. Der Dennerlein hatte gelacht und es ihr dann im Weggehen erklärt. Nicht der Vater.
»Das sind Bakterien. Die sind im Gras, fressen, und dabei entsteht Wärme. Im Heu ist das noch viel schlimmer. Wenn das zu feucht ist, kann es wirklich brennen. Das Gras …«, er griff hinein und warf es in die Luft, »… das Gras verkohlt nur. Zieh’s auseinander, bevor dein Vater es sieht.«
Sie war auf den Ladewagen geklettert und hatte das Gras verteilt. Voller Vergnügen. Weil es wie Zauberei war. Nasses Gras. Feuer. Das passte eigentlich nicht zusammen, konnte aber doch geschehen. Ja, ein Zauber, der in den Dingen steckte. Aber man konnte ihn nicht sehen, wenn einem keiner sagte, wo er war.
Selbst in der Schneiderei war es so gewesen. Obwohl sie einem in der Berufsschule schon manchmal etwas erklärten. Aber viel war es nicht.
Schosser ziehen. Unkrautrüben hacken. Den Boden lockern. Nach den ersten Metern hing der dunkle Geruch der frischen Erde überall zwischen den Blättern. Einmal, da war sie noch klein gewesen, hatte sie gesehen, wie der Vater eine Handvoll Erde aufgenommen und sie probiert hatte. Mit Lippen und Zunge. Sie hatte erstaunt zugeschaut. Aber jetzt gerade verstand sie, warum man so etwas machen wollte. Sie bückte sich und griff ein paar feuchte, schwere Krumen. Schmeckte mit der Zungenspitze. Rau fühlte sich die Erde an und war eher fad und wenig salzig. Sie roch besser, als sie schmeckte. Trotzdem kein schlechter Geschmack. Wie beim Kaffee: Der Duft war schöner als der Geschmack. Oder bei Lindenblüten oder der Kamille am Wegrand im August oder den Fichten beim Holzeinschlagen im Winter. Schade, dass man Düfte nicht essen konnte. Es war wie mit den Farben am Abendhimmel oder, wie an diesem Morgen, über den Feldern und dem Wald in der Ferne: Wenn sie zu Stoffen wurden, zu Kleidern, dann verloren sie das Durchsichtige und das Leuchten. Dann waren sie nur noch bunt. Man sollte Stoffe auch aus Farben weben können, dachte sie, nicht nur aus Flachs oder Wolle.
Sie war stehen geblieben, auf den Hackenstiel gestützt. Als Kind schon hatte die Mutter sie so oft Schlafliese geschimpft. Dabei war sie doch immer wach gewesen. Musste sie auch. Im Schlaf hatte man solche Gedanken nicht.
Trotzdem beeilte sie sich, zur Mutter aufzuschließen. Sie hätte sich nicht sagen lassen wollen, dass sie in der Stadt das Arbeiten verlernt hatte.
Es war Mittag, als sie fertig waren, und sie spürte ihren Rücken und ihre Waden. Es war das eine, arbeiten zu wollen, und das andere, nach drei Jahren Sitzen und Stehen tatsächlich wieder auf dem Feld zu sein. Sie hatte sich zusammengenommen. Durchbeißen. Aber froh war sie doch gewesen, als die letzte Furche geschafft war. Die Mutter sah auf den Acker, bevor sie die Hacke wieder auf den Ladewagen warf. Die herausgezogenen Schosser und das andere Unkraut lagen zum Verwelken zwischen den jungen, frisch grünen Blättern der Rüben.
»Dass es nie aufhört!«, sagte sie leise, aber hörbar. Roberta sah überrascht zu ihr hinüber, aber die Mutter stieg schon wieder auf den Bulldog. Manchmal hatte sie so etwas. Weil sie eigentlich eine Bessere gewesen war. Einen Bauern zu heiraten, hätte die Mutter nicht nötig gehabt. Aus dem Reuther Sägewerk stammte sie, und es hätte für sie auch anders gehen können. Vielleicht. Man wusste es nicht. Darüber wurde nicht geredet, und was Roberta wusste, das hatte sie vom Opa.
Auf dem Rückweg, kurz bevor sie in den Hof einfuhren, kamen sie am Pfarrhaus vorbei. Wilhelm war mit seiner Mutter im Garten. Richtig, es war Samstag, und er hatte keinen Dienst. Sie hatten das Kanapee hinausgetragen und klopften es aus. Staub stieg bei jedem Schlag auf, und das dunstige Mittagslicht ließ ihn grau leuchten. Als er sie erkannte, ließ er den Teppichklopfer für einen Augenblick sinken und winkte mit einem plötzlichen Lächeln zu ihr herüber. Sie hob die Hand zum Gruß. Es war auch schön, wieder daheim zu sein.
6
Samstagnachmittag, und es war bereits so, als wäre sie nie weg gewesen. Nur der Korb Kleider war neu, der in ihrer Stube stand.
Du hast es doch jetzt gelernt. Die sind alle zum Ausbessern. Aufgehoben, damit sie ordentlich gemacht werden.
Es war ja vernünftig. Aber heute würde sie das auf keinen Fall mehr schaffen. Es hatte aufgeklart, und das Fenster stand weit offen. Wenn sie sich vorbeugte, konnte sie die Straße sehen und das Dach vom Pfarrhaus über dem niedrigen First der Bäckerei. Einerseits war es, als wäre sie nie weg gewesen. Andererseits war da so etwas wie ein neues Gefühl. So, als fühlte sich alles anders an. Die Türklinken. Die Teller unten in der Küche. Das Holz des Hackenstiels. Alles fühlte sich … alt an. Manches auf gute Art, manches so, als gehörte es weggeworfen. So wie die Kleider im Korb. Bei manchen lohnte das Flicken nicht mehr, manche waren nur noch zu Lumpen gut.
Sie setzte sich aufs Bett und zog die flache Kiste mit den Zeitschriften vor. Ein paar waren alte Ausgaben, die sie vom Bader in Raitenbühl bekommen hatte. Andere, vor allem die französischen und amerikanischen, hatte sie sich von der Bahnhofsbuchhandlung geholt. Die konnte sie ein paar Wochen später für weniger Geld kaufen, wenn die neuen Ausgaben eintrafen. Sonst hätte sie sich die nie leisten können. Constanze. Burda. Brigitte, alle aus den letzten Jahren. Und eine Vogue von 1928. Das war ihr Schatz. Die hatte sie irgendwann in der Gemeindebibliothek entdeckt … und gestohlen. Die vermisste niemand. Sie hatte in einem Schuber mit anderen uralten Magazinen gesteckt, der irgendwie alles überstanden hatte: den Krieg, Renovierungen und das Ausmisten, wenn neue Bücher kamen. Die Bibliothek war schon immer im Pfarrhaus gewesen. Sie war jetzt auch in der Stadt in der Bücherei gewesen und wusste: Die hier war ganz klein; nur ein Stübchen eigentlich. Die Regale waren sicher auch aus den Zwanzigern. Jedes Fach einzeln mit einer Glaslade verschlossen. Wenn man ein Buch gefunden hatte, klappte man sie nach oben auf und sie glitt ins Regal hinein. Solche Schränke hatte es nirgendwo anders. Als ob die Bücher alle ein sicheres Zuhause hätten. Das hatte ihr schon immer gefallen. Als sie mit anderen Kindern aus dem Dorf Flötenunterricht hatte bei der Frau Pfarrer, da hatte sie die Schränke das erste Mal gesehen. Und die Bücher.
Sie blätterte durch die Zeitschriften. Das Papier war so anders als das für Bücher. Glatt und viel kühler. So wie die Frauen. Schlank und kühl und elegant. Manche trugen feine weiße Handschuhe. Sie sah auf ihre eigenen Hände. In den Rillen noch wie ein dunkler, feiner Schatten die Erde von heute Morgen. Erst in ein, zwei Tagen würde er ganz verschwunden sein. Wenn man nicht gleich wieder aufs Feld musste oder in die Scheune oder in den Stall. Handschuhe! Wer sollte so was tragen? Aber es sah trotzdem schön aus.
Sie klappte die Zeitschriften zu und legte die Vogue auf ihr Bett. Das Titelbild hatte sie damals so angezogen, dass sie das Heft unter dem Pullover versteckt hatte. Es war nicht schwer. Man konnte nur am Sonntag nach dem Gottesdienst ausleihen. Und die Mesnerin, die auch den Büchereidienst machte, war damit beschäftigt, das Geld aus der Kollekte zu zählen. Kleine Stapel von Einpfennigmünzen; immer zehn davon. Fünfertürmchen von den Zweipfennigstücken. Von den Fünfern wieder zehn; genauso wie von den Zehnerlens. Man durfte ihr nicht helfen. Die Mesnerin traute niemandem, obwohl Roberta auch gerne mal die Münzen in das Papier gerollt hätte. Kleine, schwere Stangen entstanden dabei. Rosa und Blau und Grün, je nachdem, ob es Pfennige, Groschen oder Markstücke waren. Auf jeden Fall war die alte Sorgenfrei so mit dem Einrollen beschäftigt gewesen, dass sie nicht bemerkt hatte, wie sie mit der Vogue unter dem Pullover weggegangen war. Trotzdem hatte sie sich danach vier Wochen nicht mehr in die Bücherei getraut.
Sie hatte das Bild schon so oft angesehen, dass es sich manchmal anfühlte, als käme sie heim. Anders als auf den neuen Magazinen war das hier gemalt. Die Dame im schwarzen Kleid und leichtem schwarzen Mantel an ein Balkongeländer gelehnt. Es war Herbst, und sie hatte auch Handschuhe an. Aber es sah bei ihr nicht verkleidet aus. Sie trug sie einfach so. Der Schal war das Farbigste am ganzen Bild, dabei waren es bloß blaue und rote geometrische Figuren auf weißem Grund. Dass etwas so einfach war und trotzdem so elegant. Wobei … die Frau war nicht einmal so schön wie die Modelle auf der Brigitte oder der Burda. Sie war einfach hübsch. Frisch wie der Herbsttag. Und sie lächelte ein bisschen. Vielleicht mochte sie dieses Bild deswegen so sehr. Weil sie auch so hätte aussehen können, wenn sie nicht hier geboren worden wäre, sondern in Amerika oder Frankreich oder in Kanada.
Denn das Beste war der Ausblick hinter der Frau. Ein See in einem herbstlichen Park. Die Bäume schon ein bisschen licht. Und am Horizont eine angedeutete Stadt; Hochhäuser, die im diesigen Herbstlicht ein wenig unscharf an den Rändern waren. Dort wäre sie gerne. Nur wegen dieser Frau hatte sie Schneiderin werden wollen, als der Vater gemeint hatte, dass sie eine Lehre machen sollte. Dort auf diesem Balkon stehen, so angezogen, mit dieser Stadt im Rücken. Reisen. Reisen … und ihr fiel siedend heiß der Koffer ein.
Jesus Christus! Sie hatte den Koffer im Schließfach vergessen.
7
Gertrud las, als die Klingel an der Haustür ging. Hermann war in seinem Arbeitszimmer und schrieb an seiner Predigt. Am Samstagnachmittag ging er nie an die Tür. Sie lauschte einen Augenblick, ob sie Wilhelm hörte, aber der war anscheinend nicht im Haus. Sie klappte das Buch zu und stand auf. Als sie die Tür zum Gang öffnete, wehte es sie kühl an. Sogar jetzt, mitten im warmen Frühling, atmeten die Wände Kälte. Ein offenes Treppenhaus! Selbst nach zwanzig Jahren ärgerte sie das immer noch. Ein offenes Treppenhaus, das ein Drittel der Grundfläche des Hauses einnahm. Als ob die Pfarrer in diesem Flecken früher Fürsten gewesen wären und hätten repräsentieren müssen, so groß war es.
Natürlich war die Treppe schön. Sie erinnerte sich, als sie das erste Mal in das Haus gekommen war. Die Stufen so breit, dass man zu viert nebeneinander hochgehen konnte. Das geschnitzte Geländer. Dunkles Holz. Ein von zweieinhalb Jahrhunderten schimmernd glatt gearbeiteter Handlauf. Keine einzige raue Stelle. Die fein gedrechselten Säulen mit ihren Altersrissen, die sie jetzt schon so lange kannte. An Weihnachten sah das großartig aus, wenn sie überall Kerzen aufstellte. Aber es war eben auch kalt. Den ganzen Winter hindurch war das Treppenhaus ein einziger Brunnen der Kälte; da konnte sie die Zimmer noch so sehr heizen.
Es klingelte kein zweites Mal, obwohl sie nicht sehr schnell hinunterstieg. Daran erkannte man, dass es niemand von außerhalb war. Die aus dem Dorf klingelten nie zweimal. Die warteten.
Als sie im unteren Flur im Vorbeigehen einen Blick in den Spiegel warf, kam sie sich selbst fremd vor. Immer sah sie ein wenig anders aus, als sie es erwartete. War sie noch schön? Sie ging einen halben Schritt zurück und betrachtete sich genau. Nein. Wenn sie ehrlich war, ganz ehrlich, dann sah sie, wie das Alter von hinten ganz langsam in die Wangen kriechen wollte, in die Mundwinkel und von der Stirn herab in die Augenwinkel. Es war noch nicht da, aber es saß schon irgendwo im Haar, hinter den Ohren, im Nacken. Dort, wo man es nicht sah. Es versteckte sich noch. Aber es würde herauskriechen; irgendwann, nachts, wenn sie nicht achtsam sein konnte. Sie straffte sich. Aber heute nicht.
Sie öffnete die schwere Tür. Es war Roberta vom Strasserhof gegenüber. Da war sie, die ganze Jugend. Nicht so schön, wie sie selbst gewesen war. Aber hübsch genug. Kein Mädchen mehr. Ein ernstes Gesicht, doch mit einem Mund, der zum Lächeln gemacht war. Sie hatte sie immer gern gemocht, damals, als sie noch häufig ins Haus gekommen war, um mit Wilhelm zu spielen.
»Roberta.«
»Frau Pfarrer. Grüß Gott. Ob der Wilhelm da ist, wollte ich fragen.«
Sie war immer schön gewesen, die Frau Pfarrer. Wenn sie sich die Mutter vorstellte, in so einem Kleid … niemals wäre das gegangen. Verkleidet würde sie aussehen. Und schön? Vielleicht war die Mutter einmal schön anzuschauen gewesen. Aber inzwischen oft nur noch müde, und Roberta konnte nicht sagen, wann das angefangen hatte. Sie konnte sich nicht erinnern, dass es einmal anders gewesen war. Aber so war das. Es gab nicht viele Frauen im Dorf, die man hätte schön nennen können.
An der Frau Pfarrer vorbei blickte sie in den dämmerigen Gang. Da war es immer so angenehm kühl gewesen, wenn sie im Sommer zum Flötenunterricht gekommen war oder in die Bibliothek.
»Im Haus ist er nicht«, sagte Gertrud, die Robertas Blick gefolgt war. »Schau doch mal in den Garten, da vielleicht. Wenn er da nicht ist, weiß ich es nicht.«
»Danke.«
Gertrud wollte die Tür schon wieder schließen, da fiel ihr ein, dass sie – wieder einmal – sehr unhöflich war.
»Du bist wieder da? Du hast Schneiderin gelernt, hat Wilhelm gesagt. Hat es dir gefallen?«
Roberta sah an der Frau Pfarrer herunter. Ein Sommerkleid trug sie, viel zu elegant für einen gewöhnlichen Samstag. Und es war so kurz, wie es von den erwachsenen Frauen hier keine getragen hätte. Hausarbeit in so einem Kleid? Fast musste sie lachen. Sie deutete darauf.
»So etwas hätte ich mir vorstellen können, dass wir wirklich das Schneidern lernen. Aber eigentlich war es nur eine Fabrik. Gefallen?« Sie hob die Schultern und dachte kurz nach. »Wir haben halt gelernt, wie man zuschneidet. Die richtigen Nähte, wie man Taschen einsetzt und Reißverschlüsse. Aber ich …« sie zögerte kurz, und Gertrud sah auf einmal das kleine neugierige Mädchen wieder, das sie vor zehn Jahren ins Freibad mitgenommen hatte und das unbedingt vom Dreimeterbrett hatte springen wollte, noch bevor es richtig schwimmen konnte.
»Ja?«, fragte sie, plötzlich wirklich interessiert.
»Wir haben nie etwas Schönes gemacht«, sagte Roberta langsam. Sie deutete auf Gertruds Kleid. »So etwas. Oder richtige Mode. Es war eben eine Fabrik. Wir … na ja. Es ist eh vorbei.«
Tatsächlich hatten sie nur graue Kleider aus grauen Stoffen genäht. Selbst wenn sie blau oder rot oder weiß gewesen waren – am Ende sahen sie doch immer so aus, als hätte man sie falsch gewaschen, und es lag ein Grauschleier im Gewebe so wie auf den Fenstern der ewige Textilstaub. Strahlen konnten solche Kleider nie.
»Ich schau mal nach dem Wilhelm«, sagte sie.
Gertrud nickte und schloss die Tür.
Roberta ging rechts um das Haus herum. Dort, wo der Gemüsegarten war. Oder sein sollte. Sie lächelte, als sie zwischen den verwilderten Beeten durchging. Man konnte sehen, dass die Frau Pfarrer lieber las, als im Garten zu arbeiten. Sie schaute zu den offenen Fenstern im ersten Stock hoch. Sie hatte ein offenes Buch in der Hand gehalten, als sie ihr die Tür geöffnet hatte. Jetzt saß sie wahrscheinlich wieder da oben und las. Einen Moment stieg es in ihr hoch wie etwas zwischen Neid und Sehnsucht. Ja, der war es einfach egal, was die anderen dachten. Die konnte an einem Werktagnachmittag daheimsitzen und nichts anderes tun als lesen.
Es war kühler geworden seit dem Vormittag, und ein Wind war aufgekommen. Die Wolken am Himmel, als hätten sie es eilig, irgendwo hinzukommen. So wie sie … hoffentlich war Wilhelm da.
Der Garten war weitläufig, wie alle Gärten hier. Nur dass es noch eine Terrasse gab, auf die gleich zwei Glastüren führten. Auf dieser Seite sah das Pfarrhaus fast aus wie ein kleines Schloss. Aber hier war Wilhelm auch nicht. Blieb die Scheune. Sie ging durch das kniehohe Gras hinüber. Hier mähte keiner, aber es gab auch kein Vieh zu versorgen.
Das Tor war angelehnt, sie zog es auf. Da stand er an der Werkbank.
»Hallo, Wilhelm«, sagte sie, »komme ich ungelegen?«
Er hatte ein Brillengestell in den Schraubstock geklemmt und war anscheinend dabei, es zu löten. Er drehte sich zu ihr und breitete etwas hilflos die Hände aus. Lächelte.
»Ich versuche, Papas Brille zu löten. Funktioniert aber nicht. Der Bügel fällt immer wieder ab.«
Sie kam näher und warf einen Blick auf die Bruchstelle. Sah die erstarrten Zinntropfen daneben.
»Hast du Lötfett genommen?«, fragte sie.
So fragend, wie er sie ansah, wusste sie die Antwort schon, bevor er den Kopf schüttelte, und musste lachen.