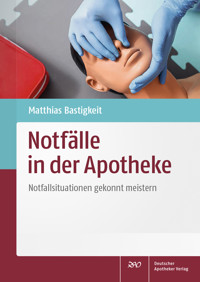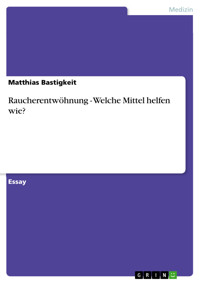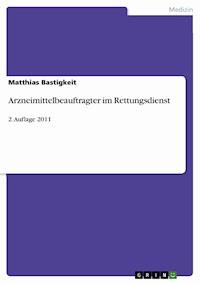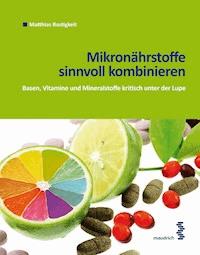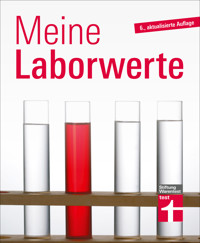
Meine Laborwerte - Ratgeber zu Blutuntersuchung, Blutbild und Laborbericht E-Book
Matthias Bastigkeit
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ergebnisse aus der Laboruntersuchung leicht verständlich erklärt Nach einer Blutuntersuchung folgt der Laborbericht. Ein positives Ergebnis bedeutet aber leider nicht immer etwas Gutes, denn es heißt nur: Das, wonach gesucht wurde, wurde wirklich gefunden und kann daher für den Patienten auch eine negative Nachricht sein. Mit dieser mittlerweile sechsten aktualisierten Auflage unseres beliebten Leitfadens sind Sie für den nächsten Laborbefund bestens gewappnet. Was steckt hinter den zahlreichen Abkürzungen und Fachbegriffen? Was bedeuten die Werte für Ihre Gesundheit? Der Ratgeber erklärt alle wichtigen Blutwerte im Detail, wie die Laborwerte im Vergleich zu den Normalwerten einzuordnen sind, gibt Referenzbereiche und Krankheitsbezüge an und ist eine verlässliche Grundlage für Ihr Gespräch mit dem Arzt. Sie erfahren, was ein kleines von einem großen Blutbild unterscheidet, was Blutdruckwerte aussagen und was hinter dem Begriff Biomarker steckt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Laborwerten, die für die Behandlung von Stoffwechselerkrankungen entscheidend sind, wie zum Beispiel Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Gicht. Ausführlich wird in diesem Handbuch über Blutfettwerte, Leberwerte, Nierenwerte und die wichtigsten Tumorwerte informiert. Zusätzlich erhalten Sie Tipps, was Sie therapiebegleitend tun können. Dieses Buch richtet sich an alle, die sich nicht nur für ihre Gesundheit interessieren, sondern auch ihre Laborergebnisse verstehen möchten. - Über Werte und Normen: Messgrößen, Normal- und Referenzwerte, Blutdruck und BMI - Das kleine und große Blutbild: Tests, Ergebnisse und Auswertungen - Biomarker: Tumormarker und Endzündungswerte - Werte bei verschiedenen Krankheiten: z.B. Schilddrüsen-, Leber-, Herz- und Nierenerkrankungen - Laborwerte von A-Z, Vitamine und Spurenelemente: Zahlen und Werte schnell nachschlagen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MeineLaborwerte
Matthias Bastigkeit
unter Mitarbeit von Prof. Dr. Peter B. Luppa
Inhaltsverzeichnis
Werte und Normen
Laborwerte und andere Messgrößen
Normal- und Referenzwerte
Blutdruck
BMI (Body-Mass-Index)
Kleines und großes Blutbild
Kleines Blutbild
Rote Blutkörperchen (Erythrozyten)
Thrombozyten (Blutplättchen)
Großes Blutbild
Gerinnungsparameter
So stoppt eine Blutung
Das Blut „verdünnen“
Biomarker
Tumormarker
Entzündungswerte
Werte bei verschiedenen Krankheiten
Glukosestoffwechsel
Blutfette
Leberwerte
Herz
Nieren
Harnsäure
Prostata
Schilddrüse
Weitere Laborwerte von A–Z
ACE / Angiotensin Converting Enzyme
ACTH/Kortikotropin
ADH/Vasopressin
Adrenalin
Albumin
Aldosteron
Alpha-1-Antitrypsin
Amylase
Blutgas-Analyse
Blutgruppen
Diaminoxidase
FSH
LH
Lipase
Von Vitamin bis Spurenelement
Vitamine
Vitamin A
Folsäure
Vitamin B12
Vitamin D
Mineralstoffe und Spurenelemente
Kalzium
Eisen
Kalium
Magnesium
Natrium und Chlorid
Hilfe
Stichwortverzeichnis
Liebe Leserin,lieber Leser,
Sie halten die mittlerweile sechste und aktualisierte Auflage unseres Buches über Laborwerte in den Händen. Es richtet sich an alle, die sich nicht nur für ihre Gesundheit interessieren, sondern auch ihren Laborbefund verstehen möchten. Wir informieren verständlich über verschiedenste Blutwerte – ergänzend zu dem, was Ihr Hausarzt oder Ihre Internistin Ihnen erklärt hat.
Im ersten Teil des Buches werden allgemeine Fragen beantwortet wie „Was unterscheidet eigentlich ein kleines von einem großen Blutbild?“, „Was sagen meine Blutdruckwerte aus?“ und „Was sind Biomarker?“. Außerdem werden Laborwerte erklärt, die bei verschiedenen Krankheiten verändert sein können. Dabei nehmen wir die einzelnen Organe in den Blick und geben Tipps, was Sie therapiebegleitend tun können, wenn Sie krank sind.
Was dieses Buch so besonders macht: Wir erklären, wie die Laborwerte im Vergleich zu den Normalwerten einzuordnen sind. Dabei ist es aber ganz wichtig, sich nicht „verrückt“ zu machen. Denn:
„Der Mensch ist mehr als die Sammlung von Organen, und eine Erkrankung ist mehr als die Sammlung von Laborwerten. Laborparameter sind wichtige Puzzlestücke bei der Diagnose. Für die Prognose einer Erkrankung sind aber noch viele andere Aspekte von Bedeutung.“
Matthias Bastigkeit
Im zweiten Teil werden fürs schnelle Nachschlagen Laborwerte – beispielsweise Vitamine, Hormone und Mineralstoffe – alphabetisch geordnet vorgestellt. Wir nennen auch hier nicht nur Zahlen, sondern ermöglichen den Blick über den Tellerrand, erläutern, was es bedeutet, wenn Werte zu niedrig oder zu hoch sind, und führen auf, was die Ursache dafür sein könnte.
Viel Erkenntnisgewinn beim Lesen und einen gesunden Blick auf Ihre Gesundheit wünscht Ihnen
Ihre Stiftung Warentest
Werte und Normen
Laborwerte und andere Messgrößen
Wenn ein Labortest ein positives Ergebnis liefert, bedeutet es: Das, wonach gesucht wurde, wurde wirklich gefunden. Ein solches positives Ergebnis kann für den Patienten also durchaus eine leider negative Nachricht bedeuten.
Die Einheiten
Jeder gemessene Wert wird mit einer passenden Einheit angegeben. In der Medizin galten über die Jahrhunderte ihrer Geschichte sehr unterschiedliche Normsysteme, die sich an verschiedenen historisch gewachsenen Messsystemen orientierten. Das Système international d’unité (kurz SI) regelt seit 1960 die Verwendung von Einheiten in den Naturwissenschaften, wobei das Regelwerk in Abständen überarbeitet wird. Diese Einheiten müssen sich auf die Grundeinheiten und deren dezimale Teiler bzw. Vielfache beziehen. Die Umsetzung wurde jedoch in der Medizin bis heute aus verschiedenen Gründen nicht durchgängig vollzogen.
Die international gebräuchlichen SI-Einheiten bestehen aus sieben Basiseinheiten: Meter, Sekunde, Kilogramm, Mol, Ampere, Kelvin und Candela sowie davon abgeleiteten Untereinheiten. Die Verwendung der SI-Einheiten ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. In bestimmten Gebieten sind jedoch aus praktischen oder historischen Gründen auch andere Einheiten zugelassen, beispielsweise wird der Blutdruck weiterhin in Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) angegeben.
Normal- und Referenzwerte
Den einen Normalwert gibt es nicht, sondern einen Schwankungsbereich, innerhalb dessen Werte als unauffällig gelten. Dieser Bereich heißt Referenz- oder Normalbereich. Aber auch ein solcher Bereich ist nicht unumstößlich. Bei gemessenen Werten sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. So verschieben Alter, biologisches Geschlecht, Regionen oder unterschiedliche Messmethoden den Bereich, der als „normal“ gilt.
Erklärung der Einheiten
g/dl - (Gramm pro Deziliter): 1 Gramm pro 100 ml
mg/dl - (Milligramm pro Deziliter): 1 Tausendstel Gramm pro 100 ml
μg/dl - (Mikrogramm pro Deziliter): 1 Millionstel Gramm pro 100 ml
ng/ml - (Nanogramm pro Milliliter): 1 Milliardstel Gramm pro ml
mval/l (Milligrammäquivalent pro Liter): 1 Tausendstel der Stoffmenge, die einem Referenzatom (Wasserstoff) gleichgesetzt ist
Was vor der Analyse passiert
Bevor etwas im Labor untersucht wird, steht die Präanalytik an. Darunter versteht man alle Arbeitsschritte der klinisch-chemischen Bestimmung, die vor der eigentlichen Laboranalyse liegen. Fehler bei diesen Arbeitsschritten führen zu einer Abweichung, die erheblich größer ist als die fehlende Genauigkeit der nachfolgenden Labormethoden. Auf diese Arbeitsschritte haben Sie ebensowenig Einfluss wie auf die Laboruntersuchung. Aber zu verstehen, was abläuft, wird Ihnen einiges des „Laborpapierkrams“ verständlicher machen.
Zur Präanalytik zählen unter anderem:
1Wo wurde das Blut entnommen? Entnahmeort (venöses oder arterielles Blut)
2Wie lange wurde der Blutfluss vor der Entnahme gestaut?
3In welcher Position (sitzend oder liegend) wurde das Blut entnommen?
4Welche körperliche Aktivität gab es vor der Blutentnahme?
5War die Person bei der Blutentnahme nüchtern? Was hat sie eventuell zu sich genommen?
6Welche Medikamente werden regelmäßig oder momentan eingenommen?
7Welches Probenmaterial wurde verwendet?
8Welche Lagerung und Aufbereitung der Probe erfolgte vor der Untersuchung?
9Wie wurde die Probe transportiert?
10 Ist die Probe lesbar und sicher beschriftet?
Laborwerte aus der Apotheke
Viele Apotheken bieten seit Langem auch Blutuntersuchungen an. Damit die Qualität dieser Werte hoch ist und bleibt, empfiehlt die Bundesapothekerkammer (BAK) den einzelnen Apotheken, neben geeigneten, regelmäßigen Maßnahmen zur eigenen internen Qualitätskontrolle einmal jährlich an einem Ringversuch teilzunehmen, bei dem Externe diese Dienstleistung testen. Fragen Sie in der Apotheke, wer von den Beschäftigten sich auf die Interpretation von Laborwerten spezialisiert hat.
Was misst man warum?
Parameter
Anwendung/Risiko
Glukose (Heimtest)
Diabetes mellitus
HbA1c-Wert
Diabetes mellitus
INR/Quick
Antikoagulans-Therapie
Lipidwerte: HDL-, LDL-Cholesterol, Triglyzeride
Gefäßerkrankungen
C-reaktives Protein (CRP)
Infektionen, Entzündungen
Kreatinin
Nephropathie
Hämoglobin
Anämie
Harnsäure
Gicht
Leberenzyme (γ-GT, ALT, AST)
Hepatitis
Mikroalbumin
Nephropathie
HCG
Schwangerschaft
okkultes Blut
Darmpolypen
PSA
Prostata
Wozu dienen die Werte?
Vielleicht fragen Sie sich manchmal, wozu das ganze Messen gut ist? Die moderne Labormedizin ist inzwischen eine wichtige Säule in der ärztlichen Diagnostik geworden. Meist sendet Ihr Arzt als Untersuchungsmaterial Körperflüssigkeiten wie Blut oder Urin oder auch Kot an ein medizinisches Labor. Nach seinen Vorgaben werden dort die Laborparameter erhoben und in einem Laborbericht festgehalten. Dies nutzt er, um später entweder eine Erkrankung festzustellen, auszuschließen oder aber ihren Verlauf zu kontrollieren.
Wenn Ihr Arzt Sie „nüchtern“ in die Sprechstunde bestellt, dürfen Sie 8–12 Stunden vor der Blutabnahme weder essen noch trinken. Lediglich Wasser ist erlaubt.
Blutdruck
Der Blutdruck ist sicherlich kein „Laborwert“ im klassischen Sinne, aber er ist von großer Bedeutung in der Diagnostik und wird in Arztpraxen, Apotheken und zu Hause häufig überprüft. Bei der Messung können allerdings recht viele Fehler passieren.
Warum dieser Druck?
In allen Blutgefäßen muss ein gewisser Druck vorhanden sein, damit das Blut durch die Gefäße fließen kann. Dieser „Blutdruck“ wird unterteilt in Diastole und Systole. Wenn das Herz sich mit Blut füllt, spricht man von der Diastole, wenn es sich zusammenzieht und das Blut in den Körperkreislauf pumpt, von der Systole. Da das Herz kräftiger pumpen als sich füllen kann, ist der Druck in der Systole größer.
Systolischer Blutdruck (gesunder Erwachsener) 110–130 mmHg
Diastolischer Blutdruck (gesunder Erwachsener) 70 bis 85 mmHg
Ist der Blutdruck dauerhaft zu hoch, spricht man von Hypertonie. Die Einheit für den Blutdruck ist Millimeter Quecksilbersäule, während der Druck im Autoreifen oder der Luftdruck in Einheiten wie Bar oder Pascal angegeben wird. Früher hat man den Blutdruck mithilfe einer langen Quecksilbersäule gemessen. Durch den Druck wurde das flüssige Metall (Elementsymbol Hg) nach oben gepumpt und der Arzt konnte den Wert in Millimetern ablesen. Deshalb ist in Deutschland auch heute noch die Maßeinheit für den Blutdruck mmHg, also Millimeter Quecksilbersäule.
Wie hoch?
Blutdruckwerte
Einteilung
systolisch
diastolisch
Normalbereich
optimal
< 120
< 80
normal
< 130
< 85
hoch-normal
130–139
85–89
Bluthochdruckbereich
Grad 1 (leicht)
140–159
90–99
Grad 2 (mäßig)
160–179
100–109
Grad 3 (schwer)
> 180
> 110
Messmethoden
Es gibt drei Arten von Messgeräten: solche mit einem Stethoskop, bei dem der Messende die „klopfenden“ Geräusche der Pulswelle hört, automatische Geräte mit Stethoskop und Geräte, die mit der oszillometrischen Methode arbeiten. Je nach Bauart wird die Manschette des Gerätes um den Oberarm oder um das Handgelenk gelegt.
Messung mithilfe eines Stethoskops
Die indirekte Blutdruckmessung mit einer aufblasbaren Oberarmmanschette und einem Manometer hat der italienische Arzt Scipione Riva-Rocci (1863–1937) erfunden. Daher auch die Abkürzung „RR“ für Blutdruck. Durch Aufpumpen der Manschette wird die Armarterie zusammengedrückt. Danach lässt man die Luft so lange langsam ab, bis wieder ein Puls am Handgelenk tastbar ist. Jetzt überwindet der arterielle Druck den Manschettendruck. Dieser Luftdruck in der Manschette entspricht dem systolischen Blutdruck. Später kombinierte man die Methode mit dem Abhören der Arterie mithilfe eines Stethoskops auf der Ellenbeuge. Dabei sind Strömungsgeräusche zu hören. Diese werden als Korotkoff-Töne (nach Nikolai S. Korotkoff, 1874–1920) bezeichnet. Beim Ablassen des Manschettendrucks entspricht der Druck beim ersten Entstehen des Strömungsgeräuschs dem systolischen Blutdruck, der Druck beim vollständigen Verschwinden des Geräuschs dem diastolischen Blutdruck.
INFO
DIE RICHTIGE GRÖSSE
Damit Sie den Blutdruck korrekt messen können, muss das Gerät nicht nur funktionstüchtig sein, sondern auch zu Ihrem individuellen Oberarmumfang passen. Denn das Verhältnis von Armumfang und Manschettengröße beeinflusst die Messgenauigkeit.
< 24 cm Oberarmumfang: 10 cm Breite
24–32 cm: 12–13 cm
33–41 cm: 15 cm
> 41 cm: 18 cm
Tipps für richtiges Blutdruckmessen:
1Achten Sie darauf, dass die Blutdruckmanschette korrekt angelegt ist, je nach Gerät am Oberarm oder am Handgelenk. Eine falsch angelegte Blutdruckmanschette führt zu Fehlmessungen.
2Messen Sie immer am unbekleideten Arm; Kleidungsstücke können die Messung stören.
3Bei einem Oberarmmessgerät muss die Blutdruckmanschette so positioniert sein, dass sich der Messpunkt in Herzhöhe befindet.
4Legen Sie bei der Blutdruckmessung mit einem Unterarmmessgerät die Hand mit der Manschette nicht auf den Tisch, sondern halten Sie den Unterarm bei der Messung in Herzhöhe. Je weiter die Manschette von der Herzhöhe entfernt ist umso größer der Messfehler. Alle Faktoren, die den Blutdruck beeinflussen können, finden Sie auf S. 16.
Oszillometrische Messung
Bei dieser Methode werden statt akustischer Signale beim allmählichen Ablassen des Manschettendrucks Oszillationen des Manschettendrucks erfasst. Diese Messgeräte sind nicht für alle Personen geeignet. Bei Herzrhythmusstörungen kann es beispielsweise zu fehlerhaften Werten kommen.
Einflussgröße bei der Blutdruckmessung
Einfluss auf den systolischen Wert*
Einfluss auf den diastolischen Wert*
Technische Faktoren
Manschette zu schmal
bis 8 mmHg niedriger
bis 8 mmHg höher
Messung liegend versus sitzend
liegend bis 3 mmHg niedriger
liegend 2 bis 5 mmHg niedriger
Armhaltung
8 mmHg höher oder niedriger je 10 cm über bzw. unter Herzhöhe
8 mmHg höher oder niedriger je 10 cm über bzw. unter Herzhöhe
Personenbezogene Faktoren
Erwartungshaltung des Messenden
Aufrundung um 5–10 mmHg
Aufrundung um 5–10 mmHg
Unterhaltung bei der Messung
17 mmHg höher
13 mmHg höher
veränderte Temperatur durch Frieren
11 mmHg höher
8 mmHg höher
Rauchen
10 mmHg höher (für mind. 30 Minuten nach dem Konsum)
8 mmHg höher (für mind. 30 Minuten nach dem Konsum)
Kaffee
10 mmHg höher (für bis zu 2 Stunden nach dem Konsum)
7 mmHg höher (für bis zu 2 Stunden nach dem Konsum)
Alkohol
8 mmHg höher (bis zu 3 Stunden nach dem Konsum)
7 mmHg höher (bis zu 3 Stunden nach dem Konsum)
Dehnung von Harnblase oder Darm
27 mmHg höher
22 mmHg höher
körperliche Aktivität
5–11 mmHg niedriger (für mind. 1 Stunde)
4–8 mmHh niedriger (für mind. 1 Stunde)
(*verglichen mit dem tatsächlichen Wert; mod. nach: Evidenzbasierte Leitlinie zur Diagnostik und Therapie, entwickelt durch das medizinische Wissensnetzwerk „evidence.de“ der Universität Witten/Herdecke; www.evidence.de)
Bei der Wahl eines Messgerätes für zu Hause sollten Sie sich vorher gut beraten lassen. Die Deutsche Hochdruckliga (DHL) versieht Geräte mit einem Prüfsiegel. Dem gehen aufwendige Tests nach einer europäischen Norm mit standardisierten Voraussetzungen voraus. Die Messwertabweichungen vom Referenzverfahren dürfen enge Grenzen nicht überschreiten. Die Geräte mit Prüfsiegel sind auf der Internetseite der DHL veröffentlicht (www.hochdruckliga.de). Empfehlenswert sind gerade für ältere Menschen Geräte mit gut ablesbaren Displays, gegebenenfalls ergänzt durch Farbskalierungen (rot, gelb, grün) für gute oder schlechte Druckwerte.
Ergebnisse aus Prüfungen von Blutdruckmessgeräten finden Sie auch unter www.test.de.
Blutdruckamplitude
In den vergangenen Jahren wurde erkannt, dass ein erhöhter systolischer Blutdruckwert gerade bei älteren Personen mit Bluthochdruck (Hypertonie) ein eigenständiger Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.
Die Betrachtung der Blutdruckamplitude, auch als Pulse Pressure oder auch Pulsdruck bezeichnet, würde eine Risikoabschätzung bei Bluthochdruck-Betroffenen genauer machen. Der Pulsdruck erlaubt eindeutigere Hinweise auf das Risiko, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erleiden und gegebenenfalls daran zu sterben, als eine isolierte Betrachtung des diastolischen oder des systolischen Blutdrucks.
Rein rechnerisch ist der Pulsdruck die Differenz zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck. Er sollte 50–60 mmHg nicht überschreiten. Somit ist ein vermeidlich harmloser Blutdruck von 140/70 mmHg absolut behandlungsbedürftig.
Ein Anstieg des Pulsdrucks um 10 mmHg kann das Risiko für das Auftreten von Herz-Kreislauf-Komplikationen um 13 von 100 Vorfällen erhöhen, für Todesfälle infolge von Herz- und Gefäßkomplikationen um 22 je 100 Vorfälle.
INFO
Der systolische Blutdruckwert drückt aus, wie hoch die Druckwelle ist, die beim Pumpen des Bluts aus dem Herz in den Körperkreislauf auf der Aorta und den großen Arterien lastet. Der Pulsdruck hingegen charakterisiert den Wechsel zwischen Systole und Diastole. Er wird durch die Elastizität der Blutgefäße bestimmt.
Was zeigt der Pulsdruck?
Je elastischer ein Gefäß, umso besser kann es diesen Wechsel bewältigen und umso kleiner ist der Pulsdruck. Ein hoher Pulsdruck deutet somit auf ein verhärtetes und unelastisches Gefäßsystem mit einer nur geringen Compliance (Dehnbarkeit) hin. Das ist ein gesundheitliches Risiko, denn unter unflexiblen Gefäßen leidet das Herz-Kreislauf-System, die Herzarbeit nimmt zu, der Sauerstoffverbrauch des Herzens steigt und die Durchblutung der Herzgefäße reduziert sich. Somit ist der Pulsdruck ein wichtiger diagnostischer Faktor und vor allem ein Kriterium für die Voraussage der Krankheitsentwicklung.
Hoher Pulsdruck: über 65 mmHg
Erhöhter Pulsdruck: 55 bis 65 mmHg
Normaler Pulsdruck: unter 50 mmHg
Steigt der Pulsdruck zum Beispiel von 60 auf 70, so bedeutet das ein drei- bis vierfach erhöhtes Herzinfarkt- und Todesrisiko innerhalb der kommenden zehn Jahre. Werte von 170/110 mmHg sind im hohen Alter also besser als 170/90 mmHg.
Hypertonie ist eine weitverbreitete, schleichende Krankheit. Sie wird als „silent killer“, als „leiser Mörder“ bezeichnet, weil viele Betroffene gar nicht wissen, dass sie erkrankt sind. Es tut nicht weh, an Bluthochdruck zu leiden. Sieben von zehn Patienten mit krankhaft erhöhtem Blutdruck werden unzureichend oder gar nicht behandelt. Etwa 15 von 100 Erwachsenen haben bei Gelegenheitsmessungen leicht erhöhte Blutdruckwerte im Bereich Schweregrad I. Bei etwa der Hälfte dieser Personen (also 7–8 von 100) normalisiert sich der Blutdruck während weiterer Beobachtungen. Bei zwei oder drei dieser Menschen entwickelt sich allerdings innerhalb von drei bis fünf Jahren ein mittelschwerer oder schwerer Bluthochdruck.
Tipps bei zu hohem Blutdruck
1Versuchen Sie ggf., Ihr Gewicht zu reduzieren, wenn Sie an Übergewicht leiden. Jedes Kilogramm Körpergewicht weniger kann den Blutdruck um 1–2 mmHg senken.
2Beschränken Sie den Kochsalzkonsum auf weniger als 6 g/Tag (etwa 1 Teelöffel).
3Beschränken Sie den Alkoholkonsum auf weniger als 30 g/Tag (z. B. etwa 250 ml Wein oder 600 ml Bier).
4Seien Sie regelmäßig körperlich aktiv. Ein dreimaliges Ausdauertraining von je 30 bis 45 Minuten pro Woche kann den Blutdruck bis zu 15 mmHg senken.
5Bauen Sie Stress frühzeitig ab (mit ausreichend Schlaf, Pausen, Entspannung).
6Achten Sie auf Ihre Medikamente. Mittel gegen Rheuma und andere Schmerzen, Glukokortikoide („Kortison“) oder die „Antibabypille“ können den Blutdruck steigern. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob eine Anpassung der Behandlung hier sinnvoll und notwendig ist.
Kochsalz hat einen Einfluss auf den Blutdruck. Zwar ist dieser geringer als früher angenommen, aber eine Reduzierung der Salzzufuhr kann nicht schaden.
Auch einige Nahrungsmittel können den Blutdruck steigern. Bekannt ist dies unter anderem für Lakritz. In der schwarzen Süßigkeit ist eine Substanz, Glycyrrhizin, enthalten, die Natrium und Wasser im Körper zurückhält und damit den Blutdruck erhöht. Das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin warnt daher vor Produkten, die mehr als 0,2 Prozent Glycyrrhizin enthalten.
Die EU hat eine Richtlinie erlassen, nach der seit Mai 2006 auf der Verpackung von Lakritzerzeugnissen ihr Glycyrrhizinsäuregehalt und der von Ammoniumsalz angegeben werden muss. Der Warnhinweis lautet „Enthält Lakritz – bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden“.
BMI
(Body-Mass-Index)
Der Body-Mass-Index (BMI) erlaubt eine grobe Einschätzung, ob ein Unter-, Normal- oder Übergewicht vorliegt.
INFO
BMI-FORMEL
Körpergewicht (in kg)
geteilt durch
Größe (in m) zum Quadrat
Das Körpergewicht spielt bei vielen Erkrankungen eine Rolle. Meist geht es allerdings nicht um das reine Gewicht, sondern um das Verhältnis von Muskel- zu Fettgewebe oder um die Fettverteilung im Körper.
Was sagt der BMI aus?
Normalgewicht
19–24,9 kg/m2
Übergewicht
25–29,9 kg/m2
Adipositas/Fettsucht Grad I
30–34,9 kg/m2
Adipositas/Fettsucht Grad II
35–39,9 kg/m2
Adipositas/Fettsucht Grad III
≥ 40 kg/m2
Der BMI ist daher ein umstrittener Wert, denn wer viel Muskelmasse besitzt, kann trotz eines hohen BMI normalgewichtig sein. Dieses Problem führt zu Diskussionen über die Aussagekraft des Wertes. Der BMI trifft außerdem auch keine Aussage über die Verteilung des Körperfetts, die als Risikofaktor aber relevant ist.
Eine weitere Größe zur Beurteilung des Körpergewichts ist die Waist-to-Height-Ratio (WtHR).
Taillenumfang geteilt durch Körpergröße.
Hier gilt ein Wert unter 0,5 als erstrebenswert.
Kleines und großes Blutbild
Kleines Blutbild
Blut ist nicht nur flüssig
Guckt man sich eine Blutprobe einmal genau an, sieht man, dass feste Teilchen in einer Flüssigkeit verteilt sind, es ist also eine Suspension.
Die Milliarden fester Bestandteile in dieser Suspension werden als Blutzellen bezeichnet. Die zellulären Bestandteile machen bei Männern etwa 43 bis 50 Prozent und bei Frauen 37 bis 45 Prozent des Gesamtvolumens aus. Dazu gehören die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutzellen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten). Der prozentuale Anteil dieser zellulären Bestandteile wird in der Fachsprache als Hämatokrit bezeichnet.
Die Flüssigkeit, in der die festen Bestandteile „schwimmen“, nennt sich Blutplasma. Weitere Blutbestandteile sind Plasmaproteine, Gerinnungsfaktoren und Elektrolyte.
Das Plasma ohne Gerinnungsfaktoren und Fibrinogen heißt Blutserum. Für das Blutbild werden die zellulären Bestandteile mikroskopisch oder maschinell mit einem Zählgerät (Coulter-Zähler) analysiert. Beim kleinen Blutbild wird die Zahl der Erythrozyten, Thrombozyten und die Gesamtzahl der Leukozyten bestimmt. Beim Differenzialblutbild werden die weißen Blutkörperchen zusätzlich in ihre Subtypen, in Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten, aufgeteilt.
Von besonderer Bedeutung sind die roten Blutkörperchen (siehe S. 25) sowie die Blutplättchen (siehe S. 30).
Weitere Werte
Die weiteren Werte des kleinen Blutbilds geben genauere Informationen über die Beschaffenheit der roten Blutkörperchen: Hb (Hämoglobin) und Hkt (Hämatokrit).
Der Hb-Wert kennzeichnet die Menge des roten Blutfarbstoffes. An diesen bindet sich Sauerstoff, der über das Blut zu den Zellen transportiert wird. Der Wert sinkt, wenn die Anzahl der roten Blutkörperchen zurückgeht. Die Ursache kann eine Magen-Darm- oder Nierenerkrankung sein. Erhöhte Werte können durch Tabakkonsum oder einen längeren Aufenthalt in großer Höhe entstehen.
Der Hämatokritwert gibt Auskunft über den Volumenanteil der roten Blutkörperchen. Je höher er ist, desto leichter entstehen Blutgerinnsel. Je leichter ein Gerinnsel entsteht, umso höher ist das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden.
Das kleine und das Differenzialblutbild zusammen ergeben das große Blutbild.
Differenzialblutbild
Das kleine Blutbild liefert schon eine Menge an Werten; daraus lassen sich zahlreiche Rückschlüsse auf Gesundheitsstörungen ziehen. Manchmal muss es aber noch genauer sein. Das Differenzialblutbild beurteilt alle zellulären Bestandteile des Blutes. Grundsätzlich unterscheidet man ein maschinelles und ein manuelles Blutbild. Das maschinelle Differenzialblutbild wird von einem Hämatologieautomaten erstellt. Dagegen werden die Blutzellen beim manuellen Differenzialblutbild unter dem Mikroskop von einer Fachkraft gezählt und beurteilt. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile.
Rote Blutkörperchen
Erythrozyten
Die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, transportieren Sauerstoff durch den Körper. In einem Liter Blut befinden sich etwa 5 000 Milliarden „Erys“. Diese haben keinen Zellkern und sehen aus wie eine eingedellte Scheibe, wie ein Drops.
Die Lebensdauer der roten Blutkörperchen beträgt etwa 120 Tage. Das Knochenmark bildet jeden Tag rund 200 Milliarden rote Blutkörperchen neu. In mehreren Stadien reifen sie zur endgültigen Stufe heran. So ein Entwicklungszyklus im Knochenmark dauert fünf bis neun Tage.
Im Zentrum der Erythrozyten befindet sich der rote Blutfarbstoff Hämoglobin. Als Zentralatom enthält er ein Eisenion. An dieses binden die Sauerstoffmoleküle, die zur Lunge und den Geweben hintransportiert werden. Die Anzahl der Erythrozyten bestimmt somit maßgeblich die Sauerstoffversorgung im Körper.
Bei einem Sauerstoffmangel bildet unser Körper vermehrt das Hormon Erythropoetin (EPO), das die Neubildung der roten Blutkörperchen anregt. Daher deutet eine zu hohe Anzahl an Erythrozyten (Polyglobulie) auf einen Sauerstoffmangel hin. Dieser Zustand kann durch Erkrankungen oder aber auch bei einem Aufenthalt im Hochgebirge aufgrund des verminderten Luftdrucks entstehen. Nicht nur die Anzahl der roten Blutkörperchen spielt bei der Beurteilung einer Erkrankung eine Rolle, sondern folgende weitere Faktoren:
1Größe
2Form
3Färbbarkeit
4Hämoglobingehalt
Worauf kann die Untersuchung der Erythrozyten hinweisen?
Erschöpfung
Eisenmangel
Ursachenklärung bei Anämie (Blutarmut)
Ursachen für eine zu hohe Anzahl an Erythrozyten (Polyglobulie)
verminderter Sauerstoffgehalt im Blut (infolge von Herz- oder Lungenerkrankungen, Aufenthalt im Hochgebirge)
starker Tabakkonsum