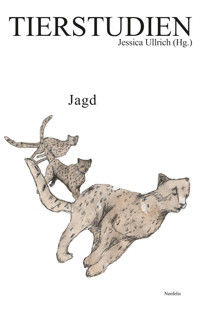8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: édition el!es
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bücher sind absolut nicht Micks erste Wahl, wenn es um Freizeitbeschäftigungen geht. Als Polizistin hat sie mit der konkreten Wirklichkeit zu tun, nicht mit irgendwelchen romantischen Träumen. Beispielsweise mit einer Einbruchserie, die nicht aufzuklären ist. Und da stolpert Bibliothekarin Melina in Micks Dienststelle und behauptet, sie hätte genau diese Einbrüche im Traum gesehen, bevor sie passierten. Das erweckt sofort Micks Misstrauen. Hat Melina mit diesen Einbrüchen zu tun? Ganz im Gegensatz zu Mick lebt Melina lieber in Büchern als in der realen Welt. Sie flüchtet sich in erfundene Geschichten und verbringt ihr Leben als Bibliothekarin gern zwischen Bücherregalen. Doch auch sie kann sich vor der Realität nicht ganz verschließen, als diese Einbrüche sie mit Mick zusammenbringen. Soll sie sich tatsächlich mit dieser Polizistin einlassen? Und was ist das mit ihren Träumen? Schließlich steckt dahinter ein Geheimnis, das sie Mick niemals anvertrauen kann . . .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Laura Beck
MEINE TRAUMHAFTE BIBLIOTHEKARIN
Roman
© 2024édition el!es
www.elles.de [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-95609-381-4
Coverillustration:
1
Ich muss es tun. Ich muss es einfach tun.
Unentschlossen biss Melina sich auf die Lippe.
Wahrscheinlich muss ich es tun.
Gleichzeitig spürte sie, wie alles in ihr sich dagegen sträubte. Und doch . . .
Es ist das dritte Mal, dass das passiert ist. Das geht so nicht weiter.
Sie starrte auf den Bildschirm vor sich, auf dem die heutige Ausgabe der lokalen Zeitung prangte.
Aber es war noch nicht einmal die Schlagzeile, die sie anzog und laut verkündete: Es geht auf die Zielgerade! Denn da ging es nur um die Wahl des Bürgermeisters. Oder der Bürgermeisterin. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Direkt daneben jedoch stand ein kleinerer Artikel in weniger großen Buchstaben. Einbruch in der Villa Wolters. Wertvolle Gemälde gestohlen.
Es gab ein Bild der Villa von außen und auch eines, in dem eine Wand eines Raumes darin gezeigt wurde. Die Wand war leer, aber ein leichter Staubrahmen deutete an, dass dort wohl einmal ein ziemlich großes Bild gehangen haben musste.
Der Raum war nicht sehr gut zu erkennen, und doch erkannte Melina ihn wieder. Obwohl sie noch nie dort gewesen war.
Am Rande des Bildes war eine beinah schemenhafte Gestalt mit aufgenommen worden, die einen Arm hob, um ihr Gesicht zu verdecken. In der Hand, die sie nicht gehoben hatte, hielt sie ein Tablet. Darauf war so etwas wie ein Polizei-Logo zu sehen. Vermutlich war das die Polizistin, die den Einbruch untersuchte.
Eine Polizistin . . . Melina starrte das Bild an, als wollte sie sich jede Einzelheit einprägen. Doch dabei gingen ihr ganz andere Bilder durch den Kopf. Bilder von damals . . .
»Du willst dich wohl Liebkind bei Herrn Krämer machen«, riss sie auf einmal eine Stimme aus ihren Gedanken. »Indem du immer früher als ich da bist.« Das Gesicht ihrer älteren Kollegin Evelyn verzog sich gespielt bedauernd. »Das wird dir nicht gelingen.«
»Evelyn . . .« Melina atmete tief durch. »Erst einmal einen schönen guten Morgen.«
»Das wird sich noch zeigen«, erwiderte Evelyn säuerlich. »Ob irgendetwas an diesem Morgen gut oder schön wäre.«
Kurz warf Melina noch einmal einen Blick auf den Bildschirm des Bibliothekscomputers, an dem sie saß. »Ich will nur morgens vor dem Dienst die Nachrichten anschauen«, erklärte sie geduldig, obwohl sie das nicht zum ersten Mal erklärte. »Du weißt, dass ich zu Hause weder einen Computer noch einen Fernseher habe.«
»Aber du hast ein Handy.« Sofort wies Evelyn mit ihrer ausgestreckten Hand auf das kleine Gerät hin, das neben Melina lag.
»Das ich nur widerwillig benutze«, gab Melina seufzend zurück. »Sehr widerwillig. Jetzt zum Beispiel ist es noch nicht einmal an. Ich habe es gestern nach Feierabend ausgemacht und seither nicht mehr angestellt.«
Anklagend wies Evelyn auf den Bildschirm vor Melina. »Und das hat nichts mit deiner Bibliotheksarbeit hier zu tun.«
Schnell warf Melina einen Blick auf die große Uhr an der Wand, die jedem hier in der Bibliothek die Stunde schlug. »Ich bin ja auch noch nicht im Dienst. Wir öffnen erst in einer Minute.«
»Eben.« Evelyn presste die Lippen zusammen. »In einer Minute. Und dann solltest du mit deinem Privatkram fertig sein. Du wirst hier für deine Arbeit als Bibliothekarin bezahlt.«
Mit hoch erhobenem Kinn dampfte sie zur Tür, um sie aufzuschließen.
»Ja, natürlich«, seufzte Melina.
Evelyn war mindestens doppelt so alt wie sie selbst und immer schlecht gelaunt. Ihre Mundwinkel wiesen meistens nach unten. Wahrscheinlich betrachtete sie Melina, die erst seit Kurzem hier in der Bibliothek arbeitete, als Konkurrenz.
Dabei wollte Melina das gar nicht sein. Sie akzeptierte Evelyn als ältere und erfahrene Kollegin voll und ganz. Sie wollte sich in keinem Fall vordrängen und schon gar nicht Liebkind machen, wie Evelyn behauptet hatte.
Gerade so etwas lag Melina absolut fern. Und wenn Evelyn nicht so missgünstig gewesen wäre, hätte sie gesehen, dass das auch nicht in Melinas Natur lag. Sie wollte einfach nur ihre Ruhe haben, sich ihren Büchern widmen . . .
Bücher waren das Einzige, worauf man sich verlassen konnte. Ihr Inhalt war festgelegt. Egal, wie oft man ein Buch las, jedes Wort blieb gleich und begrüßte die Leserin wie ein alter Freund, den man gern wiedersieht.
Das Leben war leider nicht so zuverlässig. Deshalb interessierte Melina die Realität, das, was täglich in der Welt vor sich ging, auch nur wenig. Warum sie dennoch die Nachrichten anschaute . . . Das hatte andere Gründe.
Nun war aber Schluss damit, denn nachdem Evelyn die Tür geöffnet hatte, kamen auch bereits die ersten Besucher. Es gab einige, die nur darauf warteten. Nicht allein deshalb, weil es in der Bibliothek Bücher gab, sondern auch, weil es hier freies Internet gab. So sparten sie sich den Anschluss zu Hause.
In einem kleinen Ort wie diesem war jeder öffentliche Platz, an dem man sich aufhielt, oft jedoch auch eine Gelegenheit, soziale Kontakte zu pflegen. Evelyn unterband zu laute Gespräche regelmäßig mit einem missbilligenden »Schhhh!«, aber es nützte nichts.
Obwohl überall in der Bibliothek Schilder angebracht waren, dass man hier leise sprechen sollte – oder am besten überhaupt nicht –, war das für einige mehr ein Vorschlag als eine Regel.
Darüber regte Melina sich jedoch nicht auf. Es war für sie mehr wie ein weißes Rauschen im Hintergrund, das ihr half, ihre eigenen Gedanken für einen Moment zu vergessen. Wenn es ihr auch niemals ganz gelang.
So wie dieser Gedanke jetzt wieder. Sie warf noch einmal einen schnellen Blick auf den Bildschirm, schaltete dann jedoch auf den Bibliotheksbildschirm um. Die Schlagzeile hatte sie jetzt lange genug angestarrt. Und den Artikel daneben auch.
Sie musste etwas unternehmen. Das verschwommene Bild der Polizistin mit dem Tablet in der Hand erschien wieder vor ihrem inneren Auge. Das konnte sie nicht einfach abschalten wie den Computerbildschirm. Umschalten auf ein anderes Programm.
Mit dieser Polizistin würde sie wahrscheinlich reden müssen, wenn sie . . . wenn sie ihr sagen wollte, was sie ihr sagen musste.
Aber musste sie wirklich? Niemand wusste, was Melina wusste. Niemand vermutete etwas. Und glauben . . . ja, glauben würden sie ihr wahrscheinlich sowieso nicht. Sie würden sie für eine durchgeknallte alte Jungfer halten wie Evelyn.
Zwar war sie noch nicht so alt, aber Bibliothekarin. Das reichte vermutlich schon, um diese Polizistin und ihre Kollegen zu Lachanfällen zu reizen.
Und dann noch alles Übrige . . .
2
Als sie am Abend nach Hause kam, war Melina völlig erschöpft. Noch immer hatte sie sich zu keiner Entscheidung durchgerungen.
Das war aber auch schwer. Entscheidungen waren noch nie ihr Spezialgebiet gewesen, und solche schon gar nicht. Im Grunde genommen wusste sie, was sie tun musste, und doch konnte sie es nicht tun. Es war einfach alles zu verwirrend.
Schon ihre ganze Kindheit war verwirrend gewesen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Man konnte auch sagen, sie hatte gar keine Kindheit gehabt. Oder jedenfalls keine, die irgendjemand als normal bezeichnet hätte.
Und das setzte sich im Erwachsenenleben fort. Einem Erwachsenenleben, das sie sich so auch nicht vorgestellt hatte. Dennoch war sie zufrieden damit, denn Bücher hatte sie immer geliebt. Bücher waren ihre Fluchtburgen gewesen, in denen sie sich vor der Realität verstecken konnte. Einer Realität, die sie oft überforderte.
Bücher aus der Stadtbücherei zuerst einmal, denn Bücher zu kaufen hatte sie sich als Kind nicht leisten können. Deshalb hatte sie schon von frühester Jugend an ein spezielles Verhältnis zu Bibliotheken und Büchereien entwickelt.
Der Geruch der Bücher, die Ruhe, die Möglichkeit, sich zwischen den Regalen zu verstecken und nicht gefunden zu werden, das alles hatte ihr damals ein positives Gefühl vermittelt, ein Geborgenheitsgefühl, das sie auch jetzt noch empfand und das sie beruhigte.
Weshalb sie gern in einer Stadtbibliothek arbeitete, auch wenn sie sich mit Kolleginnen wie Evelyn herumschlagen musste, die ihr das nicht gerade erleichterten.
Damit die Außenwelt nach Feierabend nicht mehr in ihre eigene kleine Welt eindringen konnte, stellte sie ihr Handy ab, sobald sie nach Hause kam. Das wollte sie auch heute gerade tun, als es klingelte.
Sie sah aufs Display und nahm ab. »Hallo Sibylle.«
»Hallo Melina«, kam die freundliche Stimme einer älteren Frau aus dem Lautsprecher zurück. »Wie geht es dir? Ich wollte mich mal wieder nach dir erkundigen. Und dich zum Sonntagsessen einladen. Wie wär’s? Du warst schon lange nicht mehr da.«
»Ja, ich weiß.« Sofort ergriffen Schuldgefühle von Melina Besitz. »Tut mir leid. Ich bin immer so müde, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Am Wochenende versuche ich mich dann zu erholen.«
»Und stellst dein Handy ab, das kenne ich ja schon von dir.« Sibylle lachte. »Ich habe schon mehrmals versucht, dich zu erreichen, aber ich wurde immer auf die Mailbox verwiesen. Da spreche ich nicht drauf. Hört sowieso niemand ab.«
»Ich auch nicht«, gab Melina zu. »Ich weiß nur nicht, wie man die deaktiviert, sonst hätte ich das längst getan.«
»Ich wollte dich nicht bei der Arbeit stören«, sagte Sibylle. »Manchmal sind da Privatgespräche ja nicht gern gesehen.«
»Allerdings.« Melina seufzte. »Wenn du meine Kollegin Evelyn am Telefon erwischt hättest, die hätte dir was erzählt. Und mir erst.«
»So etwas habe ich mir schon gedacht. Das wollte ich dir ersparen«, erklärte Sibylle fürsorglich. »Aber wenn man dich nicht mal auf der Arbeit anrufen kann, bist du wirklich schwer zu erreichen, so ganz ohne Internet und alles.«
Melina wand sich ein bisschen. »Ich habe gern meine Ruhe, lese, sitze auf dem Sofa und trinke Tee. Die sozialen Medien sind nichts für mich. Oder irgendwelche Apps auf dem Handy, um sich Nachrichten zu schicken. Das macht mich nur nervös.«
»Ich weiß«, erwiderte Sibylle verständnisvoll. »Aber die anderen würden dich am Sonntag gern mal wieder sehen. Willst du sie gar nicht sehen?«
»Doch, doch.« Melina begann zu lächeln. »Ich habe schon öfter daran gedacht. Aber dann . . . kam immer etwas dazwischen.«
Sibylle sagte für einen Moment nichts mehr, doch Melina konnte regelrecht spüren, wie sich eine Frage in ihr aufbaute. Und da kam sie auch schon. »Marvin vielleicht?«
Durch diese Frage wurde das Lächeln gleich wieder aus Melinas Gesicht gewischt.
Das sah Sibylle zwar nicht, aber sie konnte es sich vermutlich denken. »Ich habe recht, nicht wahr?«
»Es geht ihm nicht gut«, antwortete Melina. »Und er hat doch nur mich.«
»Das stimmt nicht. Er hätte auch mich. Und andere«, widersprach Sibylle. »Wenn er wollte. Aber er will nicht.«
»Er nimmt nicht gern Hilfe an.« Melina atmete tief durch. »Er will es allein schaffen.«
»Das ist dumm«, stellte Sibylle kurz und bündig fest. »Du solltest ihn nicht noch dabei unterstützen, sich so zu verhalten. Du weißt, wohin das führt.«
Ein gequältes Seufzen entrang sich Melinas Brust. »Er ist mein Bruder. Er ist alles, was ich habe.«
»Wirklich?« Sibylle äußerte nur dieses eine kurze Wort, dann wartete sie.
»Es tut mir leid«, wand Melina sich. Sie fühlte sich furchtbar. »Ich habe es nicht so gemeint. Ich weiß, dass du immer für mich da bist. Aber du bist nicht –«
»Ich bin nicht deine Mutter. Wir sind keine biologische Familie«, bestätigte Sibylle ruhig. »Aber du hast lange genug in meinem Haus gelebt, um zu wissen, dass man nicht blutsverwandt sein muss, um sich umeinander zu kümmern.«
Wie so oft, wenn es um Marvin ging, versuchte Melina auszuweichen. »Marvin war nicht so lange da.«
»Er hat das selbst entschieden«, sagte Sibylle. »Niemand hat ihn weggeschickt. Er hätte genauso lange in unserem Haus bleiben können wie du.«
»Ich weiß.« Immer mehr machte sich die Erschöpfung in Melina breit. Sie wusste, dass ihre Pflegemutter es gut meinte, aber es war im Moment einfach alles zu viel für sie.
»Ich will nicht mehr länger in dich dringen«, bemerkte Sibylle versöhnlich, die ein untrügliches Gespür dafür hatte, wann es zu viel war. »Ich weiß, dass das keinen Sinn hat. Ich will nur, dass du weißt, dass ich für dich da bin und dass du immer zu mir kommen kannst. Und denk dran: Du bist nicht für Marvin verantwortlich. Abgesehen davon, dass er dein älterer Bruder ist, nicht dein jüngerer.« Sie machte eine kurze Pause. »Ich würde mich nur sehr, sehr freuen, wenn du am Sonntag zum Essen kommst. Und die anderen auch. Sie haben schon nach dir gefragt.«
Melina bekam ein schlechtes Gewissen. Auch wenn Sibylle nicht ihre Mutter war, liebte sie sie doch wie eine Mutter, denn sie war fast die einzige, die sie je gekannt hatte.
An ihre tatsächliche Mutter, ihre und Marvins, konnte sie sich kaum mehr erinnern. Sie und ihr Vater waren fast nur wie ein Schemen aus ihrer Vergangenheit, denn sie waren schon gestorben, als Marvin und Melina noch Kinder gewesen waren.
»Ich komme am Sonntag zum Essen«, versprach sie und begann nun doch wieder zu lächeln. »Und . . . danke, Sibylle.«
»Gern geschehen.« Es war, als käme auch von Sibylle ein Lächeln durchs Telefon. »Ich freue mich auf Sonntag. Und jetzt mach dir einen schönen Tee und erhol dich. Ich wollte dir nicht deinen Feierabend rauben.«
»Das hast du nicht.« Ein warmes Gefühl durchzog Melina. Sibylle hatte die Fähigkeit, jedem Menschen diese Wärme zu vermitteln. Auch bei Marvin hatte sie das getan, doch er – »Wir sehen uns am Sonntag. Tschüss.«
»Tschüss.«
Die Verbindung löste sich auf wie ein Tau, das gekappt wurde.
Endgültig stellte Melina ihr Handy ab und war froh, dass es nun nicht mehr klingeln konnte.
3
Geht es Ihnen nicht gut?« Der Leiter der Stadtbibliothek, Herr Krämer, sah Melina ein wenig besorgt an.
»Nein, nein.« In solchen Situationen lief Melina gern einmal rot an, aber glücklicherweise bemerkte Herr Krämer das nicht. Er hielt das einfach für eine gesunde ländliche Wangenfarbe. »Alles in Ordnung. Ich habe nur nicht so gut geschlafen.«
»Sie werden mir wohl doch nicht krank?« Jovial klopfte Herr Krämer Melina auf die Schulter. »Ich bin froh, dass wir endlich mal eine zweite Kraft hier haben.«
Melina schüttelte den Kopf. »Ich bin nur noch nicht . . . Die neue Wohnung. Und da draußen kläffen nachts so viele Hunde. Das bin ich nicht gewöhnt.«
»Ach so.« Er schien mit der Auskunft zufrieden zu sein. »Aber wenn Sie krank werden, sagen Sie bitte rechtzeitig Bescheid. Es hat keinen Sinn, wenn Sie uns alle anstecken. Und die Bibliotheksbesucher dazu.« Jetzt wieder ein bisschen misstrauischer musterte er sie. »Lieber ein paar Tage zu Hause bleiben, hören Sie? Das ist vernünftiger.«
»Ja, das mache ich.« Melina nickte. »Danke, Herr Krämer.«
»Tu ich doch gern.« Und mit seiner ganzen Jovialität machte er sich davon.
»Ihr seid ja schon ein richtiges Liebespaar.« Die vor Neid grün gefärbte Stimme von Evelyn schnitt durch die Luft.
»So ist es nicht, Evelyn.« Melina seufzte. Das Leben könnte so schön sein . . . ohne Evelyn. Allerdings schoss ihr gleich noch der Gedanke durch den Sinn, dass das eventuell auch für Marvin zutraf. Evelyn war nicht die Einzige, die ihr das Leben schwer machte. Was sie etwas versöhnlicher gegenüber Evelyn stimmte, sodass sie sie freundlich ansah. »Kann ich irgendetwas für dich tun?«
»Du kannst mir mal helfen, die Bücher einzuräumen«, schnappte Evelyn. »Wenn du neben deinen . . . Unterhaltungen mit Herrn Krämer Zeit dafür hast.«
»Herr Krämer hat sich nur danach erkundigt, ob ich krank bin«, erklärte Melina. »Er will nicht, dass ich euch dann alle anstecke.«
»Und? Bist du?« Evelyn wich sofort ein paar Schritte zurück.
»Nein, bin ich nicht.« Melina lächelte müde. »Ich habe nur schlecht geschlafen. Wahrscheinlich sehe ich deshalb etwas mitgenommen aus.«
»Schlecht geschlafen.« Evelyns Mundwinkel zuckten. »Oder vielleicht einfach zu wenig? Oder überhaupt nicht?« Jetzt hatten sogar ihre Augen einen grünen Schimmer, obwohl sie braun waren.
Zuerst wusste Melina nicht, was sie meinte, doch dann fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. »Ich war allein«, entgegnete sie an der Oberfläche kühl, auch wenn sie merkte, dass sie sich lieber in ein Mauseloch verkrochen hätte. »Ich kenne hier doch noch überhaupt niemanden.«
»Doch. Herrn Krämer«, behauptete Evelyn und dampfte zu den Bücherkarren ab.
Melina klappte die Kinnlade herunter. Unterstellte Evelyn ihr etwa tatsächlich, dass sie etwas mit Herrn Krämer haben könnte? Er war weit über fünfzig. Und verheiratet. Seine beiden erwachsenen Töchter waren auch schon auf dem Weg dazu.
Außerdem, das wusste Melina genau, sah sie nun wirklich nicht nach einem Vamp aus. Dafür sorgte sie schon. Sie kleidete sich so unauffällig, dass man sie für eine kleine graue Maus hätte halten können.
Sibylle hatte immer versucht, sie von etwas mehr Farbe zu überzeugen, aber Melina wollte einfach nicht auffallen. Hätte sie ihre Arbeit in der Bibliothek hier tatsächlich aus einem Mauseloch heraus machen können, wäre ihr das sehr recht gewesen. Der Umgang mit Menschen war für sie immer sehr anstrengend.
Sie hörte Evelyn verärgert am Bücherkarren rappeln. Sie wollte ganz klar deutlich machen, dass sie hier die älteren Rechte hatte. Melina war in ihren Augen nur so etwas wie ein Lehrling, obwohl sie genauso wie Evelyn die Ausbildung zur Bibliothekarin abgeschlossen hatte.
Viel später als Evelyn natürlich, die schon zwanzig Jahre in der Bibliothek arbeitete. Deshalb hätte Melina – so kurz, wie sie sie kannte – auch normalerweise Sie zu ihr gesagt und sie mit ihrem Nachnamen angesprochen, aber Herr Krämer hatte von Anfang an deutlich gemacht, dass er wünschte, dass seine Angestellten ein freundschaftliches Verhältnis hatten und sich duzten.
Der Einzige, der hier gesiezt wurde, war er. Vielleicht gab ihm das ein Gefühl von Überlegenheit. Er war eben der Chef, und das wollte er auch zeigen. Seine Jovialität war nur eine Art Zuckerüberzug.
Aber sie konnte Evelyn jetzt nicht mit der Arbeit alleinlassen. Es waren eine Menge Bücher zurückgegeben worden, und die mussten alle wieder in die Regale geräumt werden. So früh am Morgen gab es meist nicht so viel anderes zu tun, also stand sie hinter der Ausleihtheke auf und ging zu Evelyn hinüber.
Dort vorn an der Ausleihtheke zu sitzen, die auch gleichzeitig für die Anmeldung und als Anlaufstelle für Fragen der Bibliotheksbenutzer diente, war sowieso nicht ihr Lieblingsplatz. Da kam wirklich jeder vorbei und sprach sie an. Auch wenn sie am Computer arbeitete und Bücher katalogisierte, war sie nie allein oder ungestört.
Das überließ sie deshalb lieber Evelyn, die zwar Haare auf den Zähnen hatte, sich aber trotzdem gern mit Menschen abgab. Lieber jedenfalls als Melina. Auch wenn die meisten Menschen sich umgekehrt lieber mit Melina unterhielten als mit Evelyn.
»Lass mich das machen«, schlug sie vor, als sie bei Evelyn ankam, die die Bücher auf dem Karren so sortierte, dass sie zu den entsprechenden Abteilungen in der Bücherei passten, damit man sie gleich in einem zurückstellen konnte. »Geh du lieber nach vorn.«
»Ach, bist du jetzt schon die Chefin hier?«, fauchte Evelyn sie an. »Hat Herr Krämer dich schon dazu gemacht?«
»Bitte . . . Evelyn.« Melina fuhr sich mit einer Hand müde übers Gesicht. »Du kannst das da vorn doch viel besser als ich. Du hast viel mehr Erfahrung. Das hier, das kann doch jeder machen, auch ich. Dazu muss man nicht viel können.« Treuherzig blinzelte sie Evelyn an, um ihr das Gefühl zu vermitteln, Melina hielte sich selbst für eine dumme kleine Idiotin und Evelyn für den großen Zampano.
Das besänftigte Evelyn tatsächlich. Sie war ohnehin der Meinung, dass Melina nicht halb so viel konnte wie sie, da konnte sie eine Ausbildung haben, wie sie wollte. Dabei hatte Melina in ihrer Ausbildung jetzt sicherlich sehr viel mehr gelernt als Evelyn vor zwanzig Jahren, aber dieses Gefühl wollte sie ihr auf keinen Fall vermitteln.
Sie hatte in ihrem wenn auch noch jungen Leben die Erfahrung gemacht, dass man am besten durchkam, wenn einen keiner bemerkte, wenn sie nicht auffiel, nicht herausragte, sich nicht in irgendeiner Weise hervortat. Unter dem Radar fliegen nannten das manche. Und das konnte Melina gut.
»Das stimmt, dazu muss man nicht viel können«, wiederholte Evelyn selbstgefällig. »Dann mach du das mal.«
Mit großen Schritten ging sie zur Anmeldung zurück, als hätte sie nun eindeutig bewiesen, dass sie die Chefin war, nicht Melina.
Melina war jedoch erleichtert, dass sie den Bücherkarren nach hinten zwischen die Regale schieben konnte, wo sie allein war.
4
»Auf wen wartet die denn?« Polizeioberkommissarin Michaela Mrozek, von ihren Kollegen und vielen anderen Mick genannt, wies mit dem Kinn auf die zusammengesunkene Gestalt auf der Bank an der Wand des Polizeireviers, an der sie nun schon zum dritten Mal vorbeigelaufen war.
»Keine Ahnung.« Polizeihauptwachtmeister Paul Wilke zuckte die Schultern. »Sitzt schon eine Weile da.«
»Will sie Anzeige erstatten?« Mick runzelte die Stirn.
»Kann sein«, meinte Paul. »War so viel los. Hab sie nicht gefragt.«
»Kennst du sie?« Mit einem Schritt trat Mick auf den Tresen der Polizeistation zu. »Ist sie öfter hier?«
Das war manchmal der Grund, warum die Diensthabenden im Revier Leute ignorierten. Wenn sie jeden Tag herkamen und die absurdesten Dinge anzeigten. Einfach, weil sie nichts anderes zu tun hatten. Dann hoffte man, sie würden es sich anders überlegen und vielleicht doch wieder gehen.
»Nö.« Paul schüttelte den Kopf. »Noch nie gesehen.«
Mick hob die Augenbrauen.
»Ich sag doch, es war so viel zu tun.« Paul reagierte gereizt auf den unausgesprochenen Vorwurf. »Sie kann ja herkommen, wenn sie was will.«
»Schon gut.« Mick wusste, dass er recht hatte. Noch vor ein paar Minuten war hier der Teufel los gewesen. Ebenso wie draußen auf der Straße. Weshalb vier Streifen ständig im Außeneinsatz unterwegs waren und das Revier deshalb unterbesetzt war.
Sie nickte Paul besänftigend zu und ging hinüber zu der Bank, die viel zu groß für die kleine Gestalt erschien, die darauf saß. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Ein furchtsames Gesicht zuckte hoch. Die ungeschminkten Lippen schienen fast zu zittern.
Das hat mir gerade noch gefehlt, dachte Mick. Hätte ich sie bloß in Ruhe gelassen.
Die Augen, die sie ansahen, wirkten dunkler, als es die helle Haarfarbe vermuten ließ. Aber vielleicht war das auch nur eine Folge der Angst, die darin lag.
»Ist irgendetwas passiert?«, fragte Mick.
Schnell huschte ihr Blick über die Kleidung der Sitzenden. Sie trug eine Art Blusenhängerchen, das ihre Figur nur ahnen ließ, in einer undefinierbaren Farbe, einer Mischung zwischen Grau und Braun. Sehr unauffällig. An einer Kette um ihren Hals baumelte eine alte Brosche. Ihre langen Haare waren an der Seite zu einem Zopf geflochten.
Nichts an ihrer Kleidung schien zerrissen oder sonst wie beschädigt. Keine Blut- oder Kratzspuren. Aber es musste ja auch nicht das sein, was Mick zuerst vermutet hatte.
Auf einmal räusperte die unscheinbare Gestalt sich und begann zu sprechen. »Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Ich werde gehen.« Sie stand auf.
Das war eine merkwürdige Reaktion, fand Mick. Warum hatte sie dann die ganze Zeit hier herumgesessen, wenn sie nun unverrichteter Dinge wieder gehen wollte?
»Es tut mir leid, dass Sie warten mussten«, erklärte Mick darum. »Unsere Streifenbesatzungen sind heute im Dauereinsatz und kommen gar nicht mehr von ihren Außeneinsätzen zurück. Deshalb ist die Dienststelle hier nur knapp besetzt. Manchmal ist plötzlich einfach die Hölle los.«
Die Frau nickte. »Ich verstehe. Ich komme ein andermal wieder, wenn weniger los ist.« Sie lächelte wie um Verzeihung bittend mit einem schief verzogenen Mundwinkel. »Es ist auch gar nicht so wichtig.«
»Dafür, dass es nicht wichtig ist, haben Sie ziemlich lange hier gewartet«, stellte Mick mit professioneller Einsicht fest.
Wieder nickte die Frau. »Ich musste mir erst darüber klar werden, ob . . . ob es . . . ob ich überhaupt –« Sie brach ab.
Wieder ärgerte Mick sich darüber, dass sie die Frau angesprochen hatte. Das konnte langwierig werden. Und eigentlich hatte sie gar keine Zeit. Immer dieses verdammte Pflichtbewusstsein . . .
Aber nun hatte sie sich schon einmal in die Bredouille gebracht. »Wie wäre es, wenn wir damit anfingen, dass Sie mir zuerst einmal Ihren Namen sagen?«, schlug sie vor. »Ich heiße Michaela Mrozek.« Sie streckte der Frau die Hand hin.
»Melina Keilbach«, antwortete die sofort, betrachtete Micks Hand jedoch fast misstrauisch, berührte sie dann nur kurz und zog sich sofort wieder in ihr Schneckenhaus zurück.
Unwillkürlich musste Mick grinsen. »Sehen Sie, da haben wir doch schon etwas gemeinsam«, stellte sie fest. »Michaela und Melina. Unsere Vornamen beginnen mit demselben Buchstaben.«
Anscheinend brauchte Frau Keilbach eine Weile, um den Witz zu verstehen. Dann verzogen auch ihre Mundwinkel sich. Doch es wirkte fast gezwungen. »Tatsächlich«, sagte sie leise. »Ist mir gar nicht aufgefallen.«
Mick zuckte die Schultern. »Berufskrankheit«, gab sie zu. »Deshalb bin ich Polizistin und Sie sind . . .?« Sie ließ die Frage im Raum stehen und sah Melina Keilbach mit hochgezogenen Augenbrauen auffordernd an.
»Bibliothekarin«, antwortete Melina.
Auch das noch! Mick stöhnte innerlich auf. Aber was hatte sie denn erwartet? Der Beruf passte genau zu diesem Hängerchen, zu der Brosche, der Strickjacke und dem dunkelbraunen Faltenrock, der aus der Großmutterabteilung eines Kaufhauses stammen musste.
Dabei war die Frau noch gar nicht so alt. Wahrscheinlich sogar jünger als Mick. Doch auch ihre Brille schien aus dem vergangenen Jahrhundert übriggeblieben zu sein. Eine typische Bibliothekarin eben, die zu vergeistigt war, um sich um ihr Äußeres zu kümmern. Typische alte Jungfer.
War sie das? fragte Mick sich und legte unwillkürlich leicht den Kopf schief, als sie die Frau, die etwas kleiner war als sie selbst, jetzt betrachtete. Ehrlich gesagt konnte sie sich wirklich nicht vorstellen, dass diese Frau je schon einmal Sex gehabt hatte.
Was für Gedanken. Wie kam sie denn auf so was? Hatte sie es schon so nötig?
Deshalb riss sie sich zusammen und konzentrierte sich wieder auf ihre Arbeit. »Wenn Sie wollen, können Sie mit mir mitkommen in mein Büro«, bot sie an. »Da ist es nicht so öffentlich wie hier.«
Das schien der Frau eine Entscheidung abzuverlangen, die sie nicht treffen konnte. Sie bewegte sich keinen Zentimeter.
»Kommen Sie«, entschied Mick deshalb für sie und griff leicht an ihren Arm, als wollte sie sie abführen. »Auf dem Weg finden wir bestimmt auch einen Kaffee.«
»Ich trinke keinen Kaffee.« Es war nur ein Murmeln. Wie das leise Flüstern eines Baches, der sich nicht in den Vordergrund drängen wollte, sich in der Landschaft verlor.
»Tee?«, fragte Mick. Denn irgendwie hatte sie das Gefühl, das passte zu dieser Frau.
Was die auch nickend bestätigte. »Aber nur Kräutertee. Ich ziehe meine Kräuter selbst.«
Wie die Faust aufs Auge . . . Mick hätte fast gelacht, wie klischeehaft das alles war. Jetzt fehlte nur noch Veganerin und ein langgezogenes Ooommm . . ., dann war das Bild komplett.
»Damit kann ich leider nicht dienen«, erklärte sie bedauernd. »Aber wenn Sie mir jetzt bitte folgen würden . . .«
Da sie die Frau nicht hinter sich herzerren wollte, ließ sie ihren Arm los und ging auf den Tresen zu, hob die Klappe an und trat hindurch.
Diesmal funktionierte die Aufforderung. Fast zu Micks Verwunderung folgte die Frau ihr tatsächlich. Mick ließ hinter ihr die Klappe wieder sinken, ging an ihr vorbei in den Gang hinein und betrat ein paar Meter weiter ihr Büro.
»Bitte, setzen Sie sich«, forderte sie die Frau auf, als die zögernd an der Tür stehenblieb. Mick hatte das Gefühl, sie könnte gleich wieder umdrehen.
»Ich weiß wirklich nicht . . .« Nur den rechten Fuß vor den linken setzend, ohne den linken nachzuziehen, schaute die Frau sie etwas hilflos an.
»Was wissen Sie nicht?« Mick zog sich ihren Stuhl hinter dem Schreibtisch heran und ließ sich hineinsinken.
Endlich gab Melina Keilbach sich einen Ruck und kam auf Micks Schreibtisch zu. »Ich habe lange mit mir gerungen«, sagte sie, wobei ihre Stimme nun etwas fester wurde. »Aber ich muss es Ihnen doch sagen.«
Wenn sie jetzt Was müssen Sie mir sagen? fragte, würde Mick sich wie ein Echo vorkommen. Deshalb unterließ sie es und sah die Frau nur fragend an.
»Natürlich hätte ich es Ihnen vorher sagen sollen«, fuhr Melina fort, war nun endgültig an dem Besucherstuhl vor Micks Schreibtisch angekommen und ließ sich nicht hineinsinken, sondern schwebte fast hinein. Es machte kein Geräusch. »Vor dem Einbruch.«
»Einbruch?« Das ließ Mick aufhorchen. »Welcher Einbruch?«
»Der, der heute Morgen in der Zeitung stand«, erklärte Melina beinah schuldbewusst. »Der in der Villa Wolters.«
Diese Aussage ließ Micks Augenbrauen nach oben wandern. »Sie wissen etwas darüber?«
Melina schluckte. »Wissen . . . ist vielleicht zu viel gesagt.«
Was denn nun, Mädel . . . Mick seufzte innerlich ziemlich ungeduldig auf. Kannst du dich mal entscheiden?
Langsam hatte sie das Gefühl, sie hatte einen Fehler gemacht. Diese Frau sah zwar nicht so aus, wie diese Leute normalerweise aussahen, aber sie wollte sich anscheinend nur wichtig machen. Ihr Leben als Bibliothekarin war wohl nicht aufregend genug.
»Haben Sie irgendwelche Informationen, die den Einbruch betreffen?«, formulierte sie ihre Frage anders. »Haben Sie etwas gesehen? Wohnen Sie da in der Nähe?«
Fast wie in Zeitlupe schüttelte Melina den Kopf. »Nein, ich wohne nicht im Villenviertel.« Ihr Blick richtete sich auf einmal sehr klar auf Mick. »Sie waren in der Villa. Sie haben den Einbruch aufgenommen.«
»Woher wissen Sie das?« Diese Frau erstaunte Mick immer wieder. Viel schien sie nicht zu wissen, aber wenn, dann waren es die unerwartetsten Dinge.
»Von dem Foto. Dem Foto in der Zeitung. Das war zwar ziemlich verschwommen, aber ich glaube, das waren Sie da am Rand.« Melina blickte in die Luft, als versuchte sie, sich an das Foto zu erinnern.
»Ach ja, richtig«, bestätigte Mick nickend. »Das war ich.«
»Das heißt, Sie bearbeiten den Fall?«, fragte Melina.
Mick nickte erneut. »Den und andere. Ich bin im Einbruchsdezernat.«
Fast überrascht lachte Melina auf. »Dann bin ich bei Ihnen ja genau richtig.«
»Das frage ich mich«, erwiderte Mick, lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und trommelte mit den Fingern auf die Lehne. »Denn bisher haben Sie mir noch überhaupt nichts gesagt.«
»Bitte entschuldigen Sie.« Auf einmal wirkte Melina Keilbach sehr betroffen. Auf eine andere Art als bisher. »Ich hätte nicht herkommen sollen.«
Sie erhob sich halb vom Stuhl, wurde jedoch durch Micks Stimme aufgehalten. »Warum nicht?«, fragte sie ganz direkt. »Haben Sie etwas mit dem Einbruch zu tun? Waren Sie daran beteiligt?«
Obwohl sie sich das in keiner Weise vorstellen konnte, versuchte sie, Frau Keilbach zu provozieren, damit sie ihr endlich ein paar klarere Angaben machte.
»Daran beteiligt?« Entsetzt riss Melina die Augen auf. »Nein, natürlich nicht.«
Mick beugte sich ein wenig vor. »Was haben Sie dann damit zu tun?«
»Ich . . .« Melina schluckte, räusperte sich, schluckte wieder. »Ich habe . . .« Schließlich gab sie sich einen Ruck. »Ich habe davon geträumt.«
Nur mit Mühe konnte Mick sich von einem Lachanfall zurückhalten. »Bitte was?«
Betrübt nickte Melina und schaute sie sehr verzagt an. »Genauso habe ich mir das vorgestellt. Dass Sie so reagieren würden.«
»Wie soll man da denn sonst reagieren?« Konsterniert drehte Mick ihre Hand in der Luft. »Ein Einbruch geschieht, es steht etwas darüber in der Zeitung, und dann kommen Sie hier an und behaupten, Sie hätten davon geträumt.« Noch mehr beugte sie sich vor und starrte Melina ziemlich gereizt an. »Sie haben es einfach gelesen. Stand doch alles da.«
»Nicht alles.« Wieder flüsterte Melina nur. Diesmal in ihren Schoß hinein, weil sie zudem auch noch ihren Blick gesenkt hatte. »Und es war nicht der erste Fall, von dem ich geträumt habe.« Entschlossen hob sie auf einmal den Blick und sah Mick ganz gerade in die Augen. »Es war der dritte.«
5
Endlich war es raus. In gewisser Weise atmete Melina innerlich auf. Gleichzeitig sah sie aber auch das Unverständnis im Blick der Polizistin. Mit dem sie zwar gerechnet hatte, aber gegen alle Vernunft hatte sie doch auf etwas anderes gehofft.
Sie beobachtete, wie es im Kopf von Oberkommissarin Mrozek ratterte. Melina hatte ihren Dienstgrad auf dem Schild neben der Tür gelesen, die in das Büro führte, in dem sie jetzt saßen. Sie hatte auch Abzeichen an ihrer Uniform, die wahrscheinlich das gleiche bedeuteten, aber damit kannte Melina sich nicht aus.
Jetzt überlegte diese Frau Oberkommissarin wahrscheinlich, ob sie Melina noch eine Chance geben sollte, ihre Aussage zurückzunehmen, oder ob sie sie gleich in eine Zwangsjacke stecken lassen sollte.
»Sie haben dreimal von einem Einbruch geträumt?«, erkundigte sie sich endlich. Sie wirkte ziemlich genervt.
Melina nickte. »Und zwar nicht erst, nachdem es in der Zeitung gestanden hatte.« Ein Seufzen, das sie nicht unterdrücken konnte, entfuhr ihren Lippen. »Es war immer davor. Diesmal zum Beispiel hat es eine Woche davor angefangen.« Sie schloss kurz die Augen, öffnete sie dann wieder und fügte hinzu: »Das ist jedes Mal unterschiedlich.«
»Jedes Mal?« Die Polizistin runzelte die Stirn. »Alle drei Male?«
Einen Augenblick überlegte Melina. »Ja, alle drei Male«, bestätigte sie dann.
Michaela Mrozek hob die Hände. »Und was soll ich jetzt damit anfangen? Außer Sie haben in Ihrem Traum auch die Täter gesehen.« Sie hob fragend die Augenbrauen.
Traurig schüttelte Melina den Kopf. »Leider nein. Ich habe die Häuser gesehen, die Räume, die Bilder. Aber keine Menschen.«
»Hm.« Die Polizistin, die ihr gegenübersaß, überlegte angestrengt. Oder vielleicht tat sie auch nur so, weil sie nicht wusste, was sie sagen sollte. »Das heißt, Sie haben alle Häuser schon einmal besucht? Sie gekannt? Und dann davon geträumt?«
Damit habe ich gerechnet. Melina seufzte innerlich. Aber wie sollte sie das auch erklären? Sie hatte sich da vielleicht doch in etwas hineingeritten, dem sie nicht gewachsen war. Das hätte sie sich vorher überlegen sollen. Aber nun war es zu spät.
»Nein«, sagte sie. »Ich bin in keinem der Häuser je gewesen.«
Das warf die Polizistin ein wenig aus der Bahn, wie Melina ihr deutlich ansah. Sie wirkte tatsächlich verwirrt, obwohl sie ansonsten den Eindruck machte, dass das nicht zu ihrem Grundrepertoire gehörte.
»Das Bild zum Beispiel . . .«, setzte Melina neu an. »Das Foto von dem Einbruch gestern, das heute in der Zeitung war. Auf dem Sie am Rand drauf waren.«
Sie versuchte, Augenkontakt zu Kommissarin Mrozek herzustellen – das Ober ließ sie in Gedanken weg, warum waren diese Dienstgrade auch immer so lang? –, aber Frau Mrozek schien noch immer ziemlich in sich und ihre Gedanken versunken.
»Auf dem Foto waren in der Mitte an der Wand Spuren von einem Rahmen zu sehen«, fuhr sie tapfer fort, weil sie unterschwellig das Gefühl hatte, die Kommissarin wälzte verschiedene Alternativen, wie sie Melina rauswerfen konnte. »Da hatte ein Rubens gehangen.«
Der Kopf von Michaela Mrozek ruckte hoch. »Woher wissen Sie das? Dann müssen Sie doch schon mal in dem Haus gewesen sein.«
»Nein, war ich nicht«, bestätigte Melina noch einmal kopfschüttelnd. »Nur in meinen Träumen. Aber die waren sehr konkret. Als ich heute das Foto sah, war es, als würde ich das alles schon kennen. Ich hätte Ihnen auch genau sagen können, dass ein Stück weiter eine Tür ist, die ins Nebenzimmer führt. Da hängt ein Landschaftsbild an der Wand, und es gibt zwei Sessel und ein Sofa. Außerdem einen Schreibtisch und ein Regal mit . . .«, sie kniff die Augen zusammen, »vier Regalbrettern. In dreien davon stehen Bücher, in einem Regal steht eine Uhr.« Sie seufzte. »Die gar nicht dahin passt. Sie hat eine Digitalanzeige.«
»Hing«, sagte die Polizistin. »Das Landschaftsbild von Vermeulen ist auch weg.« Nun betrachtete sie Melina sehr misstrauisch. »Wie eine ganze Menge anderes.«
Da Melina ihr nun etwas beschrieben hatte, das nicht auf den Zeitungsfotos gewesen war, hatte das natürlich ihren kriminalistischen Argwohn geweckt. Das war unvermeidlich.
Vielleicht hätte ich nicht herkommen sollen. Es hat ja doch keinen Sinn, dachte Melina ziemlich niedergeschlagen. Doch obwohl sie sich müde fühlte, schlug ihr Herz bis zum Hals.
Sie hätte das nicht tun sollen, das wurde ihr immer mehr klar. Das war alles nicht das, was sie wollte.
Aber nun war sie schon einmal hier und konnte es nicht mehr ändern. Jetzt musste sie da durch.
»Was wissen Sie über den Schmuck?«, fragte die Kommissarin da plötzlich. »Wenn Sie das Regal gesehen haben, wissen Sie doch sicher auch, dass dahinter ein Safe ist.«
Melina schüttelte den Kopf. »Von einem Safe weiß ich nichts. Ich kann nicht durch Wände oder hinter Türen sehen.«
»Sie können . . . was?« Kommissarin Mrozek blieb fast die Kinnlade hängen.
»Ich meine, ich träume nur von Dingen, die . . . die direkt vor mir sind.« Am Ende wurde Melinas Stimme immer leiser.
Sie wusste ja selbst, dass sie sich verrückt anhörte. Und wenn sie das selbst schon so empfand, wie sollte es dann diese Polizistin empfinden? Die garantiert nicht wegen ihrer Begabung für Fantasie hier eingestellt worden war. Dann hätte sie nicht einen so brutalen, der Realität verhafteten Beruf gewählt.
Melina hätte sich niemals vorstellen können, so einen Beruf auszuüben. Es schauderte sie allein bei der Vorstellung. Und doch hatte sie damals –
Schnell versuchte sie, ihre Gedanken auf ein anderes Thema zu lenken. »Haben Sie denn irgendeine Spur?«, fragte sie.
»Außer Ihnen?«, fragte die Kommissarin etwas bissig.
Melinas Augen öffneten sich weit. »Außer mir?«, fragte sie völlig verdattert zurück.
»Na ja, außer Ihnen ist bis jetzt niemand vorbeigekommen und hat uns freiwillig Informationen angeboten«, erweiterte die Kommissarin ihre Aussage. Sie blickte Melina strafend an. »Was auch immer die wert sind.«