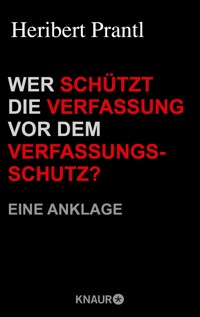19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Heribert Prantl legt eine Autobiografie vor, mit der er seinen Ruf als großer Journalist und Zeitzeuge eindrucksvoll bestätigt. In seinem »autobiografischen Kalendarium« greift er zwölf Themen auf, die ihm wichtig sind, von Frieden und Demokratie über Gleichberechtigung und Pressefreiheit bis zu Heimat und Religion. Prantl plaudert aus dem Nähkästchen des politischen Journalismus und beschreibt mit leichter Hand sein ereignisreiches Leben als Oberpfälzer, Jurist im Staatsdienst und vor allem als engagierter, streitbarer Journalist. Ein Buch voller interessanter Anekdoten über die »Großen« und »Kleinen« der Gesellschaft, aber auch voll ganz privater Dinge und nicht zuletzt Prantls ureigenstes Bekenntnis zu seiner Profession und seinen Werten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
»Das können die schon vertragen!«
Januar
Frieden in unfriedlichen Zeiten
Weltfriedenstag, 1. Januar
Februar
Die Wehen der Demokratie
In Weimar tritt die Nationalversammlung zusammen, 6. Februar 1919
März
Männer und Frauen sind gleichberechtigt
Weltfrauentag, 8. März
April
Ein Glück, wenn man daran glauben kann
Ostern
Mai
Die Würde des Menschen ist unantastbar
Grundgesetzverkündung, 23. Mai 1949
Juni
Handeln, als wenn wir Flüchtlinge wären
Weltflüchtlingstag, 20. Juni
Juli
Der große und der kleine Widerstand
Gescheiterte Erhebung gegen Hitler, 20. Juli 1944
August
Pressefreiheit ist wie ein großer Strom
Leiturteil des Bundesverfassungsgerichts, 5. August 1966
September
Heimat ist, worüber ich schreibe
Tag der Heimat, Erster Sonntag im September
Oktober
Vollzogen, aber nicht vollendet
Wiedervereinigung, 3. Oktober 1990
November
Traumtag und Trauertage
9. November und Totenmonat
Dezember
Eine Ahnung vom Sinn der Dinge
Advent und Weihnachten
Nachwort
Zukunft entsteht in jedem Augenblick
Vorwort
»Das können die schon vertragen!«
Als der sozialistische Theoretiker Eduard Bernstein in den frühen Jahren der Sozialdemokratie wieder einmal über »soziale Gerechtigkeit« philosophierte, belehrte ihn sein Freund, der SPD-Reichstagsabgeordnete Ignaz Auer, geboren in Dommelstadel bei Passau, so: »Mein lieber Ede, so etwas sagt man nicht, so etwas tut man.«
Dieser Satz ist mir eingefallen, als ich als junger Journalist zu meinem ersten Interview mit dem CDU-Politiker Heiner Geißler ins Dorf Gleisweiler fuhr, seinen Wohnort an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Geißlers zwölf Jahre als programmatischer Generalsekretär der CDU waren da schon vorbei, und er war auf dem Weg zur Legende: Christdemokrat und Kapitalismuskritiker, bekennender Katholik, ehemaliger Jesuit und aktives Attac-Mitglied, Weinbauer, Bergsteiger, Skifahrer und Bestseller-Autor. Er war, hundert Jahre später, Ignaz Auer und Eduard Bernstein in einem – sowohl ein Theoretiker als auch ein Praktiker der sozialen Gerechtigkeit; für ihn war »Die neue soziale Frage« die Kernpolitik einer guten Demokratie.
Freunde, Freundschaft, Journalismus
Das ging mir also durch den Kopf, als ich an Geißlers Haustür im Dorf Gleisweiler an der Weinstraße klingelte. Ich begrüßte ihn mit einem »Grüß Gott, Herr Generalsekretär«, obwohl er das schon längst nicht mehr war. Aber der Titel war und ist ihm, wie ein zweiter Vorname, bis zu seinem Tod im Jahr 2017 geblieben. Aus dem mittäglichen Interviewtermin von eineinhalb Stunden wurde dann ein sehr langer Nachmittag und ein spannender Abend. Das bahnte sich an, als Geißler, trotz des Gipskorsetts, das er damals nach einem Absturz mit dem Drachenflieger trug, in seinen Keller hinunterstieg, um ein paar Flaschen seiner »Gleisweiler Hölle« zu holen; er baute diese Hölle selber an, auf dem kleinen Weinberg hinter seinem Haus.
Es gibt Menschen, bei denen man schon bei der ersten Begegnung ahnt und spürt, dass man sich verstehen wird. Geißler, der ein begnadeter Zuspitzer und ein begnadeter Schlichter war, gehörte zu ihnen. Unser Interview zu aktuellen tagespolitischen Fragen ging über in ein Gespräch über Gott, die Welt und die Zukunft der CDU, die er in seinen zwölf Generalsekretär-Jahren zu reformieren versucht hatte, um aus einem Kanzlerwahlverein eine Programmpartei zu machen, eine Partei der »ökologisch sozialen Marktwirtschaft«, wie er das nannte. Es war dies das erste von vielen langen Gesprächen, die im Lauf der Jahre in Bonn, in Berlin und in München folgten – über Grundfragen der Politik, über Agitation und Polemik, über Taktik und Strategie, über Macht und Machtkämpfe und darüber, was man in der Politik bewegen kann und was Politik mit denen anrichtet, die sie machen.
Zu meinem fünfundfünfzigsten Geburtstag schenkte Geißler mir dann die Neuausgabe eines Buches des Jesuiten und Barockdichters Friedrich Spee aus dem Jahr 1631, aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges; es heißt »Cautio Criminalis« und ist eine Kampfschrift gegen Folter und Hexenwahn. Er schrieb folgende Widmung hinein: »Zwischen Politikern und Journalisten gibt es keine Freundschaft. Wenn es sie gäbe, wären wir Freunde.« Wir sind immer per Sie geblieben, obwohl wir viel miteinander gelacht, gegessen, getrunken und gegrübelt haben.
Ein Stein, den man ins Wasser wirft
»Heribert Prantl schreibt spitz«, hat Winfried Hassemer, Strafrechtsprofessor und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, einmal gesagt. Das stimmt: Ich liebe, wie Geißler das getan hat, die pointierte Zuspitzung, ich liebe den bildhaften Vergleich, ich bin mit Leib und Seele ein Leitartikler und Kolumnist. Ein Kommentar ist ein Diskussionsbeitrag; dessen Kraft hängt sicher auch von der Auflage oder der Reichweite des Mediums ab, in dem er erscheint. Aber das allein ist es nicht. Ein lahmer Kommentar bleibt ein lahmer Kommentar, ob er nun im Sechsämterboten, in den Tagesthemen oder in der Süddeutschen Zeitung publiziert wird. Ein Kommentar soll nicht kaltlassen; er soll anregen oder aufregen; er soll überzeugen oder zum Widerspruch herausfordern.
Natürlich muss ein Kommentator Partei ergreifen – nicht für eine politische Partei, sondern für eine Sache, manchmal auch für eine Person; für die Grundrechte vor allem und im Zweifel: für die Schwachen, für die, die Unterstützung brauchen, die sonst niemand hört. Kommentieren heißt nicht irgendetwas meinen. Der Kommentar ist nicht irgendein Geblubber, der Kommentator schreibt nicht aus dem Bauch, sondern aus dem Kopf und manchmal aus ganzem Herzen. Ein Kommentar ist nicht erst dann gut, wenn er in der morgendlichen Lagebesprechung des Ministeriums zualleroberst liegt. Wenn ein Kommentar Parteigremien beschäftigt, schön. Wenn er beim Frühstück zur Diskussion reizt, ist es besser. Wenn es gar Spaß macht, daraus vorzulesen, ist es am besten. Ob der Leser zustimmt oder ob sich die Leserin am Kommentar reibt, ob der Kommentar also kitzelt oder kratzt – das ist vielleicht gar nicht so entscheidend.
Und im Übrigen: Wenn man als Kommentator gegen den Strom schwimmt, kann man nicht erwarten, dass der Strom deswegen seine Richtung ändert. Ein Leitartikel ist nicht dann demokratisch, wenn er danach trachtet, die Mehrheitsmeinung abzubilden; nichts wäre langweiliger; dann könnte man die Kommentare abwechselnd von Forsa, Civey, der Forschungsgruppe Wahlen oder der KI (ChatGPT) schreiben lassen. Ein Kommentar ist dann demokratisch, wenn er zum Gespräch verhilft. Ein Leitartikel ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Er verändert die Qualität des Wassers nicht, zieht aber Kreise.
Fachmännisch einschenken
Und es soll bitte so sein, dass man nach dem Lesen verstanden hat, worum es geht und warum dieses Thema wichtig ist. Wenn ich zwei-, dreimal im Jahr an Journalistenschulen und Presseakademien ein paar Tage lang Unterricht über die Theorie und vor allem die Praxis des Kommentars abhalte, wenn ich dort mit den Seminarteilnehmern den Kommentar übe, Kommentare schreiben lasse und dann ausführlich bespreche, dann erkläre ich das so: »Die Standlfrau vom Viktualienmarkt soll sagen: Jetzt habe ich endlich verstanden, worum es geht. Das ist ja gar nicht so kompliziert, wie ich dachte. Und der Universitätsprofessor soll sagen: Der Prantl hat das sehr komplexe Problem schon sehr vereinfacht, aber es ist erfasst.«
Als Personifikation des Professors kommt mir dann einer wie der kreativ-kauzige Wilhelm Steinmüller in den Sinn, bei dem ich einst Rechtsphilosophie studierte; der Ordinarius war eigentlich Kirchenrechtler, wurde dann Rechtsinformatiker, entwickelte das Konzept der informationellen Selbstbestimmung und war damit ein Pionier des Datenschutzes; später, nach seiner Emeritierung, wandte er sich dann einem ganz anderen Gebiet zu: Er wurde Psychotherapeut und Traumaforscher.
Wenn es mir gelingt, auch von so eigenwilligen Menschen gelesen und goutiert zu werden, sodass sie mir von einer Forschungsreise eine Ansichtskarte schreiben – dann bin ich glücklich und esse vor Freude eine Tafel Schokolade. Und wenn mir ein Leser bei einer persönlichen Begegnung nach einem Vortrag, einer Lesung oder einer Diskussion sagt, dass er zwar eher selten meiner Meinung sei, mich aber immer gern lese – dann ist das ein gutes Weißbier wert. Als der verstorbene Fernseh-Kollege Thomas Leif mich einmal in seine Talksendung nach Berlin zum Streitgespräch eingeladen hatte, durfte ich mir schon vorab ein bestimmtes Getränk wünschen. Ich wählte mein Lieblingsweißbier von der Brauerei Jakob in Bodenwöhr, also aus meiner Heimat. Der Redaktion gelang es tatsächlich, eine Kiste davon nach Berlin zu schaffen, Thomas Leif schaffte es aber nicht, das Weißbier ordentlich einzuschenken, sodass ich live und vor laufender Kamera Gelegenheit hatte, diese Kunst fachmännisch zu zelebrieren. »Fachmännisch einschenken« – das ist, so dachte ich mir da, auch kein schlechtes Motto für den guten Meinungsjournalismus.
Trotz alledem
Aber das Kommentieren allein macht mein Glück im Journalismus nicht aus. Es ist die Begegnung mit Menschen – mit Gelehrten und Ganoven, mit Künstlern und Kanzlern, mit Mächtigen und mit Mutigen, mit starken Frauen und mit ihren Widersachern, mit Widerständlern und Whistleblowern, mit Intriganten und Informanten, mit bekannten und unbekannten Menschen, die etwas angepackt haben, die in ihrer jeweiligen Welt, ob sie groß oder klein war oder ist, Wegweiser gesetzt haben; bisweilen auch falsche. Ich habe sie interviewt, manche, wie Wolfgang Schäuble, immer und immer wieder und in allen Etappen ihres Berufslebens. Ich habe sie porträtiert – ganz junge wie Greta Thunberg; ganz alte wie Hans-Jochen Vogel; und ganz viele meines Alters wie Angela Merkel.
Nicht immer war der Weg zu ihnen so kurz, aber verschlungen wie zum ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel. Es war so: Man fuhr östlich aus München hinaus, Richtung Eichenried und Moosinning, ließ den Flughafen »Franz-Josef-Strauß« links liegen, brauste vorbei an Langengeisling und Wolferding, an Vilsbiburg und Binabiburg, an Frauenhaselbach und Scherzthambach, fuhr bei Eggenfelden nicht Richtung Wurmannsquick, sondern nach Pfarrkirchen, Brambach und Hirschbach und kam dann nach Bad Birnbach. Dort angelangt war man immer noch nicht so weit, bei ihm am großen Holztisch Platz zu nehmen. Dann verließ einen nämlich das Navigationssystem und man war darauf angewiesen, einen Einheimischen zu finden, den man nach dem Weg zu Herrn Doktor Vogel fragen konnte.
Ein paar Kilometer rumpelte man dann durch Wiesen und Auen und auf einmal stand man dann vor einem Obstgarten und einem gepflegten alten Bauernhaus, in dem er jahrzehntelang seine Freizeit verbrachte. Hierher hatte einst, in den Jahren des RAF-Terrors, der Personenschutz den Bundesjustizminister Vogel begleitet, hier hatte er sich von seinen Niederlagen erholt, und das waren nicht wenige. Die Kopie eines Zettels, den ihm einst Herbert Wehner nach seiner Wahlniederlage gegen Richard von Weizsäcker in Berlin geschrieben hatte, klebte ein paar Jahre lang an meiner Bürotür: »Trotz alledem: Weiterarbeiten und nicht verzweifeln.«
Hier, in Vogels Toskana, arbeiteten wir einige Wochenenden lang an einem Gesprächsbuch, das dann unter dem Titel »Politik und Anstand« auf den Markt kam. Seine häusliche Stimme bei diesen Gesprächen für das Interview-Buch klang ganz anders, als die Stimme des Parteichefs Vogel geklungen hatte, wenn sie zur politischen Rede ansetzte. Da nämlich funktionierte Vogel so ähnlich wie eine Orgel, da war es, als ob sich erst der Blasebalg mit Luft füllte, und dann strömte es in satten, vollen Tönen aus ihm heraus, dann dröhnte und brauste es, dann konnte er auch schneidend, warnend und klagend sein. In der niederbayerischen Toskana am Holztisch rief er zärtlich: »Liserl, bringst uns bitte noch einen Kaffee?« Liserl war seine Frau – und er ging mit ihr so liebreizend um, dass jeder, was die eigene Gefährtin betrifft, auf der Stelle ein schlechtes Gewissen bekam.
Anstoß und Ansporn
Aus solchen großen und kleinen Begegnungen sind journalistische Porträts geworden: Vom Philosophen Jürgen Habermas, von Rita Süßmuth, von Oskar Lafontaine, von Joseph Ratzinger oder von Hans Traxler, dem freundlich unerbittlichen Cartoonisten des alltäglichen Schwachsinns. Auf die Idee, dass der Untergang der Titanic etwas damit zu tun hatte, dass Gott »Schiffe versenken« spielte, muss man erst einmal kommen. Hans Traxler, dem Maler und Kinderbuchautor, war so etwas eingefallen. Gleich bei unserer ersten Begegnung stellten wir fest, dass jeder von uns, wenn auch um Jahrzehnte versetzt, eine Regensburger Geschichte hat, die von der Auseinandersetzung mit den kirchlichen Autoritäten handelt.
Traxler erinnerte sich an die Nachkriegszeit mit seiner Mutter in Regensburg, wohin es die beiden nach dem Krieg aus ihrer randböhmischen Heimat verschlagen hatte. Er erinnerte sich daran, dass es der Mutter eines Abends gesundheitlich sehr schlecht ging, es ging ans Sterben. Ein christkatholischer junger Mensch aus Böhmen wie der Hans dachte da natürlich an den Pfarrer und die Sterbesakramente. Und so rannte der Hans nach Sankt Emmeram, wo der Geistliche gerade beim Abendessen saß und sich dabei vom atemlosen Hans und seiner sterbenskranken Mutter nicht stören lassen wollte. Der Pfarrer blickte vom Essen auf und schickte den Hans trotz Bitten und Betteln ungerührt wieder weiter mit den Worten: »Mein Sohn, dann wollen wir doch den guten Willen für die Tat nehmen.« Hans Traxler packte, weil er schon als junger Mann ein Herr war, den Pfarrer nicht am Schlawittl und schüttelte ihn auch nicht. Er trat stattdessen aus der Kirche aus. Sehr viel später zeichnete er Helmut Kohl als »Birne« und prägte mit dieser Symbolik zwei Jahrzehnte Politik.
Über hundert solcher in der SZ und anderswo publizierter Porträts habe ich in zwei Büchern versammelt, deren Titel einen Hinweis darauf geben, worum es mir bei diesen Begegnungen und publizistischen Psychogrammen geht: Das eine Buch heißt »Was ein Einzelner vermag«, das andere Buch »Außer man tut es«. Sie handeln von kleinen und großen Vorbildern. Wann ist jemand und warum ein Vorbild? Es geht nicht um Tugendboldigkeit und auch nicht um andauernde Heldenhaftigkeit, nicht um napoleonisches Gehabe und auch nicht darum, dass dem Vorbild die Güte aus den Knopflöchern springt. Habituelle Heiligkeit hält ohnehin, wie man weiß, nicht lange vor. Es geht mir darum, dass ein Mensch im gegebenen Augenblick etwas getan hat, das uns guten Anstoß und guten Ansporn gibt.
Die gedeckte Tafel
Einmal habe ich mir mit einem solchen Porträt viel Ärger eingehandelt: Ich porträtierte Andreas Voßkuhle, den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, auf der Seite 3 der SZ. Nie hatten die Karlsruher Richter nämlich so viel Politik gemacht wie unter seiner Ägide – deutsche Politik, europäische Politik, Weltpolitik. Eine der großen Fragen war: Erlaubt das Grundgesetz die Euro-Rettung? Ich beschrieb daher im Jahr 2012, kurz vor einem weichenstellenden Urteil, Voßkuhle als den »Prototypen eines Mediators«, als einen »Künstler des Ausgleichens« – und schilderte zur Illustration eine Szene am Küchentisch des Ehepaars Voßkuhle, »wie er ein großes Essen vorbereitet«.
Dieser Absatz hat dann zu einer aufgeregten Presseerklärung des Bundesverfassungsgerichts und einer Richtigstellung in meiner Zeitung geführt, weil der Eindruck entstanden war, dass ich bei dem geschilderten Essen selbst dabei war. Ich hatte mir die Essensszene von einem früheren Bundesverfassungsrichter erzählen lassen, das aber nicht ausdrücklich erwähnt – sodass sich daran allerlei Phantasien entzündeten.
Dabei war die Szene ganz harmlos: »Bei Voßkuhles setzt man sich nicht an die gedeckte Tafel und wartet, was aufgetragen wird … Der eine Gast putzt die Pilze, der andere die Bohnen, der dritte wäscht den Salat. Und dazu gibt es ein Arbeitsweinchen. Natürlich hat der Gastgeber alles sorgfältig vorbereitet, natürlich steht die Menüfolge fest; aber es entsteht alles gemeinsam.« Es hat sich bei meinem Text gezeigt, dass nicht nur ein Essen, sondern schon die kurze Schilderung eines Essens Politik sein kann und die Reaktion darauf auch.
Journalismus und Politik
Ein andermal habe ich mit einem Interview dazu beigetragen, dass ein Bundespräsidentenkandidat der CDU nicht Kandidat geblieben und also nicht Bundespräsident geworden ist. Es war im Jahr 1993, es war Steffen Heitmann, der damalige sächsische Justizminister, den ich gut kannte.
In dem Interview, das ich mit ihm führte, begründete er ausführlich seine damals schon im Umlauf befindlichen und heftig kritisierten Äußerungen über Ausländer in Deutschland, über die Rolle der Frauen in der Gesellschaft und über die Nazivergangenheit. Die CDU zog ihn als Präsidentschaftskandidaten zurück, Bundespräsident wurde Roman Herzog – davon werde ich noch mehr im Kapitel »August« erzählen, das sich der Pressefreiheit widmet.
Gibt es eine Pflicht des Journalisten, einen Politiker vor sich selbst zu schützen? Nicht jeden vielleicht, aber einen, den man näher kennt? Gewiss: Der Interviewer hat dem Interviewten gegenüber nicht die Pflichten, wie sie der Anwalt gegenüber dem Mandanten oder der Arzt gegenüber dem Patienten hat. Aber womöglich gibt es auch abseits von solchen ganz speziellen Vertrauens- und Pflichtverhältnissen Obliegenheiten, die daraus erwachsen, dass der Interviewte sich als recht arglos präsentiert.
Solche Fragen zum Verhältnis von Journalismus und Politik beschäftigen mich noch heute. Die eingangs genannte Buchwidmung von Heiner Geißler fällt mir dazu noch einmal ein: »Zwischen Politikern und Journalisten gibt es keine Freundschaft!«
Kostbarkeiten eines Journalistenlebens
Oder vielleicht doch? Vielleicht dann, wenn der Politiker ganz woanders arbeitet, in Italien zum Beispiel? Oder wenn er gar kein richtiger Politiker, sondern ein Chefkriminalist, ein Präsident des Bundeskriminalamts und schon im Ruhestand ist? Der eine, den ich einen Freund nenne, war bis 2022 Oberbürgermeister von Palermo – Leoluca Orlando, der Kämpfer gegen die Mafia; mit ihm bin ich durch sein Sizilien gefahren, mit ihm ist mir Palermo vertraut geworden. Der andere, Horst Herold, war der Präsident des Bundeskriminalamts in der RAF-Zeit gewesen, von 1971 bis 1981; wenn er mir schrieb, wenn wir telefonierten, wenn er zum Essen einlud, wenn wir über den Terrorismus diskutierten – dann nannte er mich »junger Löwe«; er war dreißig Jahre älter als ich.
Und wenn ich aus diesen Jahren mit ihm etwas herzlich bereue, dann dies: Er hatte vorgeschlagen, zusammen mit mir ein Buch über den Terrorismus zu schreiben – und ich bin dem nicht gefolgt, weil ich meinte, da sei er ganz allein der ganz große Experte und so ein Buch wolle man von ihm lesen, nicht von einem, der, wie ich, in der RAF-Zeit noch Gymnasiast war. Das Buch blieb ungeschrieben, Herolds Skizzen finden sich in seinen privaten Aufzeichnungen, die er »Lehren aus dem Terror« überschrieb, und die er auszugsweise in der SZ publizierte.
Dreißig Jahre, bevor Google auf den Markt kam, hatte Horst Herold sein Computer-Such-System für die Polizei schon installiert. Es hieß Inpol. Dort fasste er alle im Bundesgebiet anfallenden kriminalistischen Erkenntnisse zusammen. So war ihm 1972 die Verhaftung von Ulrike Meinhof und Andreas Baader gelungen, so hatte er den Kern der ersten Generation der RAF zerschlagen, so hatte er die Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden Peter Lorenz aufgeklärt, so konnte er nach der Ermordung seines Freundes, des Generalbundesanwalts Siegfried Buback, etliche Täter fassen, so erwarb er sich den Ruf eines Daten-Junkies, eines rasterfahndenden Doktor Mabuse. Doch nach der Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer erkannte man Fahndungspannen, die zum Vorwand genommen wurden: Gerhart Baum, damaliger FDP-Bundesinnenminister, entließ Horst Herold. Herold ging in die innere Emigration und dort traf ich ihn dann. Die ausgefallensten Geburtstags-Glückwünsche, die ich je erhalten habe, stammen von ihm. Als schon sehr alter Herr saß er am Wohnzimmertisch und bastelte darauf virtuos wie ein junger Digital-Native schöne Fake-Fotos, auf denen der US-Präsident und sonstige Berühmtheiten sich zum Geburtstags-Defilee bei mir aufreihten.
So wahr mir Gott helfe
Solche Bilder gehören zu den Kostbarkeiten meines Journalistenlebens. Und dazu kommen keine gefälschten, sondern ganz echte Fotos aus dem Kanzleramt in Berlin, auf denen Vater und Mutter am Kabinettstisch sitzen und mit der Glocke läuten. Die Besichtigung des Bundeskanzleramts war ein Geburtstagsgeschenk für sie zur Zeit des Kanzlers Gerhard Schröder, das er und seine damalige Frau, die Journalistenkollegin Doris Köpf, ermöglicht hatten – auch wenn dabei für die SPD, wie Schröder räsonierte, nichts zu gewinnen war; denn »der Prantl senior« sei ja schwarz wie die Nacht.
In der Tat: Mein Vater, von dem ich den Vornamen Heribert geerbt habe, war CSU-Mitglied. Aber immer dann, wenn ich mich mit seiner Partei und ihren Protagonisten journalistisch anlegte, rief er mich im Büro an und sagte: »Jetzt hast es denen wieder so richtig gesagt. Das hat’s braucht, das können die schon vertragen.« Das war, das ist auch kein schlechtes Motto für den politischen Journalismus. Und so mag ich das auch weiterhin halten– das Leben und die Politik mit Lust und mit Kraft kommentieren. So wahr mir Gott helfe.
Dieses Buch ist keine klassische Autobiographie. Ich habe eine auf den ersten Blick etwas simple Gliederung gewählt: die zwölf Monate; diesen Monaten habe ich Ereignisse und Erlebnisse zugeordnet. Das führt weg von der klassischen Autobiographie – Kindheit, Studium, Beruf etc. – die ich für mich als peinlich empfände.
Das Buch verbindet Themen, die mir wichtig waren und sind, mit bestimmten Monaten: Das Thema Gleichberechtigung und Emanzipation beispielsweise mit dem März, weil am 8. März der Weltfrauentag ist. Die Welt meiner Kindheit war eine sehr katholisch geprägte Welt. Mein Verhältnis zur Religion, zum christlichen Glauben und zu den Kirchen schildere ich im Kapitel April, weil Ostern, das Fest der Auferstehung, meist in diesen Monat fällt. Meine Liebe zum Grundgesetz erkläre ich im Kapitel Mai, weil es am 23. Mai 1949 in Kraft getreten ist. Die Probleme der Wiedervereinigung und der Deutschen Einheit handele ich in den Kapiteln Oktober und November ab.
Und weil die Analyse und die Diskussion dieser Themen mit persönlichen Erfahrungen, mit eigenen Erlebnissen, mit Abenteuern und Schnurren verwoben sind, habe ich das Buch im Untertitel »Ein autobiographisches Kalendarium« genannt. So ist die Politik, die mich und mein Berufsleben ausmacht, in diesem Buch durchsetzt mit Erlebnissen und Erinnerungen. Die Durchmischung von Person und Politik macht dieses Buch aus: Plaudereien, Launiges, Ernsthaftes – Dinge, die mich geprägt haben.
Januar
Dieses Kapitel handelt vom Frieden in unfriedlichen Zeiten und davon, warum mir die Silvesterböllerei und die Silvestergaudi seit meiner Kindheit zuwider sind. Das Kapitel handelt davon, warum es gut ist, das Jahr mit einem Weltfriedenstag am ersten Januar zu eröffnen: Die Welt braucht die Hoffnung, dass »ein Fried’ kommt in die Welt und ein Fried‘ bleibt in der Welt«, wie meine Großmutter das formulierte. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Selig also die, die Frieden stiften; und selbst ein Reden gegen die Wand kann ein Gespräch eröffnen.
Frieden in unfriedlichen Zeiten
Weltfriedenstag 1. Januar
Bisweilen beschleicht mich das Gefühl, dass die Weltgeschichte einen gigantischen Staubsauger eingeschaltet hat, der alle bisherigen Sicherheiten wegsaugt: Der Corona-Pandemie folgt der Ukraine-Krieg; die Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen steigt. Und über all dem schwelt die Klimakatastrophe. Die Welt ist so unsicher wie schon lange nicht mehr. Eine Weltgeschichte, die alle Sicherheiten einsaugt, frage ich mich dann freilich – wie soll das gehen? Die Geschichte ist kein handelndes Subjekt, sondern das Produkt der Aktionen von Subjekten. Und wenn man schon das Bild vom Staubsauger aufruft: An den Reglern für die Saugleistung sitzen Autokraten und Diktatoren.
Angesichts des Zustands der Welt ist es gut, das Jahr mit einem Weltfriedenstag zu eröffnen. Die römisch-katholische Kirche feiert am 1. Januar den »Weltfriedenstag«; in Deutschland wird am 1. September der »Antikriegstag« begangen. Die Vereinten Nationen haben den 21. September zum »Internationalen Tag des Friedens« ausgerufen. Mir gefällt der 1. Januar als Weltfriedenstag. Es gibt nichts Wichtigeres als den Frieden; es ist hoffnungsvoll, wenn damit das Jahr beginnt. Die Welt braucht Hoffnung.
Der Mensch kann menschlich werden
Die Nähe zu Weihnachten und seiner Botschaft »Friede den Menschen auf Erden« ist hilfreich. Indes: Kann es sein, dass dieses Versprechen eine Lüge ist, eine barmherzige Lüge, um die Hoffnung am Leben zu erhalten? Wo ist der Friede, zweitausend Jahre nach seiner Verheißung? Weihnachten ist das Fest, an dem Gott sich klein, sich zu einem Kind macht, auf dass die Menschen verstehen, dass sie das Überwinden der von ihnen angerichteten Katastrophen nicht Gott dem allmächtigen Herrn im Himmel überlassen können, der alles so herrlich regiert. So gesehen ist Weihnachten gar nicht so possierlich. Es verlangt ziemlich viel: orare et laborare, beten und arbeiten an einer besseren Welt.
Es stimmt nicht, dass nichts zu machen ist; es stimmt nicht, dass Widerstand gegen den Unfrieden keinen Sinn hat. Es gibt kein historisches Gesetz, wonach Unmenschlichkeit exponentiell mit der Weltbevölkerung wächst, keine Zwangsläufigkeit, wonach Kontinente verhungern, der Meeresspiegel steigt, Regenwälder verschwinden oder ein Völkermord dem anderen folgt. Für all das gibt es Ursachen, und es gibt die Verantwortung, dagegen etwas zu tun. Es ist nicht sinnlos, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Weihnachten könnte also heißen: Wenn Gott Mensch werden konnte, dann kann auch der Mensch menschlich werden.
Als der Philosoph Immanuel Kant schon ein alter Herr war, schrieb er eine Schrift, die »Zum ewigen Frieden« heißt. Je nach aktueller Befindlichkeit stöhnt man da heute, schmunzelt man verlegen, ist melancholisch oder vielleicht auch hoffnungsvoll. Kant lehrt in dieser Schrift aus dem Jahr 1795 etwas sehr Wichtiges: dass der Frieden kein natürlicher Zustand ist, sondern dass er gestiftet werden muss. Frieden stiften – genau das ist, genau das wäre die Aufgabe von heute, eine Aufgabe, die nie erledigt und erfüllt ist. Wer stiftet? Wo sind die Mutigen? Wie geht das Friedenstiften? Friedenstiften ist keine laute, keine lärmende Angelegenheit.
Wenn dem Lärm, dem Feuerwerk und dem Krachzauber an Silvester ein 1. Januar als Friedenswunschtag folgt, finde ich das wunderbar. Ich habe es nie besonders leiden können, wenn der Jahresschluss so gefeiert wird, als handele es sich um die Generalprobe für den Rosenmontag, wenn also in die Weihnachtszeit auf einmal der Fasching hereinbricht. Ich habe das schon in der Kindheit als Störung des Festlichen und Feierlichen empfunden. Aber die Gaudi zum Jahreswechsel ist keine Erfindung der Moderne oder der Postmoderne, sondern gehört zum Brauchtum. Im Voralpenland heißen die lärmenden Gestalten, wenn sie maskiert sind und wie wild Glocken schwingen, »Perchten«. Wenn sie unmaskiert, aber gleichwohl laut sind, heißen sie CSU und treffen sich zur Jahresauftakt-Klausur. Und wenn sie sich nicht in Oberbayern – früher in Wildbad Kreuth, heute in Seeon – treffen, sondern in Stuttgart, und ihre Veranstaltung dort »Dreikönigstreffen« nennen, dann handelt es sich um die FDP.
Der Hass sei verbannt
Die Klausurtagung der CSU zum Jahresauftakt und das Dreikönigstreffen der FDP erinnern mich an ein Ritual, das meine Großmutter liebte: Zwischen den Jahren, in den ruhigen Tagen zwischen Weihnachten und Dreikönig, kam die Blaskapelle zum »Neujahranblasen« vors alte Bauernhaus. Die Großmutter und drei ledige Tanten lebten dort im Erdgeschoss, meine Eltern und wir Kinder oben im ersten Stock und unterm Dach. Nach den ersten Tönen der Neujahranbläser trat die Großmutter dick eingemummt vor die Tür und wünschte sich »den Schneewalzer, bittschön«. Der zog sich dann der Kälte wegen ein wenig schräg dahin, Großmutter war beschwingt, sie summte mit; es war Weihnachten im Dreivierteltakt. Die Musikanten erhielten fünf Mark, die Großmutter eine musikalische Zugabe, meist das Lied »Tief drin im Böhmerwald«.
Davon wurde die alte Frau ein wenig melancholisch; aber das gehört ja zum Jahreswechsel. Sie philosophierte dann beim Kaffee darüber, »wer worn is und wer gschtorbn is«. Das Werden und das Sterben waren Hauptthemen für die Frau, die 15 Kinder geboren hatte. Und die Hauptsache, setzte sie dann fort, sei, »dass a Fried’ wird, a Fried’ is und a Fried’ bleibt«. Die Großmutter, Jahrgang 1886, hatte zwei Weltkriege erlebt und zweimal das, was sie die »teure Zeit« nannte, die Inflation. Sie mochte es, wenn wir dann als Sternsinger, als Caspar, Melchior und Balthasar samt einem Sternträger, von Haus zu Haus zogen und lange gereimte Verse aufsagten: »Die Liebe sei mächtig, der Hass sei verbannt, das wünschen die Weisen aus dem Morgenland.« Der Sog solcher Reime ist mächtig; ich kann sie noch immer auswendig, von der ersten bis zur letzten Zeile.
Aber die Realität ist die, die mich mein Journalistenleben lang begleitet hat: dass der Hass mächtig ist; er befeuert Terror und Attentate. Hass ist eine furchtbare Kraft, die schlimmste, die es gibt; er macht blind. Der Hasser sieht den Menschen nicht mehr, er sieht die Menschen nicht mehr. Er sieht nicht mehr, dass die Menschen, die er jetzt totfährt, gerade Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder einkaufen. Der Hasser sieht nicht, dass die Menschen, die er mordet, Menschen mit Sorgen sind wie er. Der Hass macht aus anderen Menschen Objekte, die der Befriedigung des eigenen Hasses dienen müssen. Der Hass entmenschlicht. Er ist ein niedriger Beweggrund, der sich mit Geltungssucht selbst erhöht. Hassen heißt, unablässig morden. Solcher Hass ist nicht nur hässlich, er ist entsetzlich und unendlich traurig.
Das Gefährliche am Hass ist, dass er das Morden für eine tapfere Tat hält. Und das besonders Gefährliche am Hass ist, dass er ansteckend ist. Hass hat Verführungskraft. Wer vom Hass getroffen wird, kann von ihm infiziert werden. Die vom Hass Getroffenen hassen dann zurück: Sie hassen den Täter, sie hassen auch die Gruppe von Menschen, zu denen man den Täter rechnet. So entsteht die monströse Dynamik des Hasses. Wenn diese Dynamik funktioniert, ist das ein Erfolg der Hasser, der Mörder, der Terroristen.
»Das kommt darauf an«
Ich erinnere mich an eine Frage, die ich in meinen frühen Journalistenjahren dem damaligen Außenminister Klaus Kinkel forsch gestellt habe. »Wie viel Blut darf eigentlich«, so fragte ich, »an den Händen eines Diktators kleben, dass Sie ihm noch die Hand geben?« Er antwortete: »Das kommt darauf an.« Ich reagierte damals auf diese Antwort des Mannes, der seine politische Karriere als Büroleiter des legendären Hans-Dietrich Genscher begonnen hatte, mit zornigem Protest: »Politik ohne Moral«, sagte ich, »ist unmoralische Politik.«
Ich hielt das für einen sehr gelungenen Satz; aber ich frage mich heute, ob so ein Satz nicht vor allem der Selbstbefriedigung und der Selbstberuhigung dient. »Das kommt darauf an«, sagte Kinkel damals. Worauf kommt es zu Zeiten des Ukraine-Kriegs an? Es kommt darauf an, ob man und wie man einen Krieg verkürzen, ob man und wie man das Leiden der Menschen beenden kann. Wenn das gelingt, dann ist realpolitischer Pragmatismus ein pragmatischer Humanismus. »Selig, die Frieden stiften« – der Satz stammt aus den Seligpreisungen des Matthäus-Evangeliums. Er hängt auf Plakaten und Transparenten an vielen Kirchen.
Das Stiften beginnt mit Reden; und es darf nicht sein, dass Reden als von vornherein sinnlos erachtet wird. Im Anfang war das Wort, nicht der Streitwagen und nicht die Panzerhaubitze. Das heißt: Man muss auch dann das Gespräch suchen, man muss auch dann verhandeln, wenn man das Gefühl hat, gegen Wände zu reden. Selbst das Reden gegen Wände kann ein Gespräch öffnen. Für das Ende des Tötens muss man es versuchen.
Der kleine Pazifismus
Das Grundgesetz ist keine pazifistische Verfassung. Sie ist aber eine sehr friedliebende Verfassung. Sie enthält nämlich ein Friedensgebot, sie enthält die Verpflichtung, »dem Frieden der Welt zu dienen«. Diese »Friedenswillen-Erklärung« steht schon in der Präambel und sie wird dann an verschiedenen Stellen im Grundgesetz wiederholt. Es ist freilich versäumt worden, dieses Friedensgebot auszuarbeiten, zu substantiieren, zu spezifizieren und zu konkretisieren, wie das mit dem Rechtsstaatsgebot und dem Sozialstaatsgebot sehr wohl geschehen ist. Das Friedensgebot ist eine schöne, aber leere Formel geblieben; sie ziert das Grundgesetz, wurde und wird aber behandelt wie eine Verzierung. Das war und ist falsch; und das rächt sich jetzt, in der öffentlichen Diskussion über den Ukraine-Krieg. Sie ist eine haltlose Diskussion, sie hat keinen Halt in der Verfassung – weil der Gehalt des Friedensgebots unklar ist. Das Prinzip Frieden muss noch umfassend entfaltet werden.
Ich bin kein Pazifist. Aber ich bewundere die Pazifisten; sie sind gute Begleiter in eine gute europäische Zukunft. Ich bewundere, wie die Pazifisten es schaffen, ihre Ohnmacht auszuhalten. Ich bewundere sie dafür, dass sie der Gewalt die Gegengewalt verweigern. Pazifisten gelten als die Narren der Nationen. Sie ziehen Gespött auf sich, ihre Rufe nach Abrüstung werden als weltfremd und geschichtsvergessen bezeichnet – auch deshalb, weil, wie es heißt, Pazifismus wohl eine individuelle Entscheidung, aber keine Grundlage für das Handeln des Staates sein könne.
Friedensnobelpreise haben nichts daran geändert, dass Pazifisten Außenseiter sind; aber so randständig wie heute angesichts der akuten Gefährlichkeit von Putins Brutal-Imperialismus waren sie schon lange nicht mehr. Nicht mit Gebeten, sondern mit Waffen wurden die Nazis besiegt. Aber wer hat sie groß gemacht? Die Pazifisten etwa? Sie haben dem aufgeblasenen Militarismus die Luft abgelassen. Trotz aller Härte gegenüber Putin müssen wir die Zivilgesellschaft in Russland achten. Es wäre zum Beispiel gut gewesen, die deutsch-russischen Städtepartnerschaften nicht auszusetzen, sondern erst recht den Kontakt mit Russland zu suchen. Man kann den Gedanken der Völkerverständigung auf kommunaler Ebene pflegen; man kann ihn auch in Kinos und Konzerthäusern pflegen. Das ist der kleine Pazifismus. Er ist der Pazifismus des Grundgesetzes.
Dem Frieden dienen
Das Wort Frieden kam 1949 erst auf Vorschlag von Hans Christoph Seebohm in die Entwürfe der Präambel; Seebohm gehörte damals der rechtsgerichteten Deutschen Partei DP an, trat später in die CDU ein und war von 1949 bis 1966 Bundesminister; es ist pikant, dass er dabei vom KPD-Abgeordneten Heinz Renner unterstützt wurde, der auf die Friedensformel im Entwurf der DDR-Verfassung hinwies.
Das Grundgesetz wurde dann im Parlamentarischen Rat mit 53 Ja-Stimmen gegen 12 Nein-Stimmen angenommen – die Nein-Stimmen kamen von der CSU, der KPD und der DP. »Von dem Willen beseelt … als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen.« So heißt es in der Präambel des Grundgesetzes. In der Debatte über das Für und Wider von deutschen Waffenlieferungen zu Beginn des Ukrainekrieges spielten das Grundgesetz und sein Friedensgebot kaum eine Rolle. Vielleicht deshalb gilt die Warnung vor einer »Eskalation« des Krieges als ein Ausdruck der Verzagtheit, vielleicht deshalb werden in dieser Debatte Wörter wie »Kompromiss« und »Waffenstillstand« häufig so ausgesprochen, als wären sie vergiftet, vielleicht deshalb gilt derzeit Kriegsrhetorik als Ausdruck von Realismus. Das ist aber nicht ganz neu. Der Militärhistoriker Wolfram Wette hat schon lange vor dem Ukraine-Krieg einen »beängstigenden bellizistischen Diskurs in Teilen der Meinungseliten« festgestellt. Dieser Dis-Kurs hat 1999 die deutsche Beteiligung am völkerrechtswidrigen Kosovo-Krieg getragen.
Wie dient man, wie es das Grundgesetz verlangt, dem Frieden in Zeiten des Ukraine-Kriegs? Mit Haubitzen oder mit Vermittlungsversuchen? Mit Diplomatie oder mit Drohnen? Womöglich mit beidem? Nothilfe gegen einen Aggressor gehört, das ist im Völkerrecht unumstritten, zur aktiven Friedenspolitik. Aber: Wo endet die Nothilfe, wo beginnt der Nothilfeexzess? Die Grundgesetzformulierung beinhaltet zunächst die Absage an Gewaltpolitik jedweder Form. Wie hat diese Absage auszusehen? Das Wort »dienen« verlangt gewiss mehr als Indifferenz, es verlangt mehr, sehr viel mehr als einfach nur den Frieden nicht zu stören und zu gefährden; das Grundgesetz verlangt eine aktive Friedenspolitik.
Frieden ist der Ernstfall
Zu diesem Zweck muss man erst einmal wissen, was Frieden ist und was Krieg. So klar ist das nämlich nicht. Es wird fast immer so getan, als seien Krieg und Frieden feste Aggregatzustände der Geschichte. Aber das stimmt nicht. Die Übergänge sind fließend, auch wenn die Formalien und Formalitäten des Völkerrechts anderes nahelegen. Kriege warten nicht darauf, dass sie erklärt oder so genannt werden; und der Frieden ist nicht dann da, wenn er ausgerufen wird. Kriegserklärungen, Waffenstillstände und Friedensschlüsse sind »oftmals nur Symboldaten in einem Prozess dynamischer Gewaltverdichtung beziehungsweise -entflechtung«, sagt der Hamburger Historiker Bernd Wegner.
Das tragende Prinzip der Verfassung
»Entweder, es ist Krieg, oder es ist Frieden, und dazwischen ist nichts Mittleres.« So hat es einst Cicero, der römische Politiker und Philosoph, gesagt; und so lehrt es das klassische Völkerrecht; womöglich sind einst auch die Mütter und Väter des Grundgesetzes noch von dieser Antinomie ausgegangen. Aber das wird der Realität nicht gerecht, schon deswegen nicht, weil Frieden sehr viel mehr ist als die Abwesenheit von Krieg oder auch nur eine bestimmte geographische Distanz zum Krieg; das Mittlere ist umfassend, die Grauzone ist also groß.
Es war die Anstrengung in der Grauzone, die seinerzeit Gustav Heinemann 1969 in seiner Antrittsrede nach seiner Vereidigung als Bundespräsident gefordert hat. Er sagte: »Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken unterwiesen wurde, sondern heute ist der Frieden der Ernstfall. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr.«
Es fehlt eine Verfassungstheorie zu einer Kultur des Friedens, die dann die Verfassungspraxis, also die Politik befruchtet und beflügelt. Der große Staatsrechtler Peter Häberle hat das vor fünf Jahren richtig konstatiert: Er hat darauf hingewiesen, dass die sogenannten Grundrechte der zweiten Generation, also die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Freiheiten, die ja die klassischen Grundrechte ergänzen, um des Friedens willen entstanden sind. Und das gesamte Umweltrecht ist entstanden nicht nur um Frieden mit der Natur, sondern auch um Frieden mit den künftigen Generationen zu erreichen.
Der Frieden ist also aus der Ecke des Grundgesetzes herauszuholen: Er ist nämlich keine Leerformel, kein Füllwort und keine Schmuckvokabel. Er ist das tragende Prinzip der Verfassung, das als tragendes Prinzip aber noch nicht entwickelt worden ist. Das ist noch zu leisten, da steht Gustav Heinemanns Mahnung aus dem Jahr 1969 noch im Raum. Das Bundesverfassungsgericht muss Substantielles dazu beitragen – mehr jedenfalls, als es in seinen schwiemeligen Entscheidungen zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr gesagt hat.
Und es gilt der Imperativ und das Friedenspostulat von Immanuel Kant: »Das Recht muss nie der Politik, aber die Politik dem Recht angepasst werden.« Es war und ist deshalb fatal und unendlich töricht, wenn schon Wörter wie »Friedensappell« und »Frieden« dann als anrüchig gelten, wenn sie im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gebraucht werden. Es ist fatal, wenn das Werben für diplomatische Offensiven fast schon als Beihilfe zum Verbrechen bewertet wird.
»Schreib was, Bub«
Eines der vielen Kinder der Großmutter, meine Tante Babett, war nach einem Bombenangriff im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs schwerbehindert und wurde von den beiden anderen Tanten gepflegt. Gleich neben dem Hauseingang war ihr Zimmer; dort lag sie jahrelang im Bett: blass, dünn und klug, mit großen, gütigen Augen, stets bereit, den Buben eine Geschichte zu erzählen. Ich habe sie bis zu ihrem Tod, da war ich neun Jahre alt, nie anders erlebt. Bei einem Ereignis wie dem Neujahranblasen zog sie sich, um die Dinge besser mitzukriegen, an einem weißen Strick hoch, der am Fußende ihres Bettes befestigt war. Und sie erinnerte sich mit gefasster Wehmut daran, dass sie einst tanzen konnte. Wenn es heißt, jemand sei »ans Bett gefesselt«, fällt mir dieses Bild ein.
Großmutters wichtigste Erinnerungen waren in einer großen Holzkiste verwahrt, die in diesem Zimmer der Tante Babett einen besonderen Platz hatte; auf der Kiste stand in Sütterlin-Schrift »Der Krieg«. Darin befanden sich Briefe, die ihre Söhne und Schwiegersöhne von allen Fronten des Zweiten Weltkriegs nach Hause geschrieben hatten. Einer der vielen Briefschreiber war Soldat in der deutschen 11. Armee unter General Erich von Manstein, die 1941/42 versuchte, Sewastopol auf der Krim zu erobern.
Diese Kiste ist mir immer wieder eingefallen in den Monaten des Ukraine-Kriegs. Großmutter hätte sich wohl auf diese Kiste gesetzt, hätte erst geschimpft über Putin und auf »d’Russn«, aber dann vor allem über den Krieg als solchen, der eine Schande sei und für Jeden, aber auch wirklich für Jeden eine Teufelei. Was würde Großmutter sagen, wenn sie noch lebte? »Schreib was, Bub«, würde sie sagen, »schreib was gegen den Krieg.« Sie würde mir dann, wie so oft, nicht nur vom Zweiten, sondern auch vom Ersten Weltkrieg erzählen: wie der Krieg auf einmal da war, vor hundert Jahren, mitten im schönsten August – und dass das nie, nie, nie wieder so sein dürfe. Und dann würde sie vom großen »Wunder« reden, das sie kaum glauben könne, wenn sie in die alte Kiste schaue. Man müsse dies’ Wunder hüten wie ein rohes Ei – das Wunder Europa.
Lust auf Europa
Dieses Europa ist das Beste, was den Deutschen, den Franzosen und den Italienern, den Österreichern und den Dänen, den Polen und Spaniern, den Tschechen und den Ungarn, den Flamen und Wallonen, den Schotten und den Iren, den Basken, den Balten und Bayern und vielen anderen in ihrer langen Geschichte passiert ist. Dieses Europa wurde gebaut aus überwundenen Erbfeindschaften. Es ist die späte Verwirklichung so vieler alter Friedensschlüsse, die den Frieden dann doch nicht gebracht haben. Die Europäischen Verträge sind die Ehe- und Erbverträge ehemaliger Feinde. Dieses Europa ist ein welthistorisches Friedensprojekt. Es ist mehr, es ist viel mehr als die Summe seiner Fehler. Europa ist ein Wunder, trotz seiner Fehler.