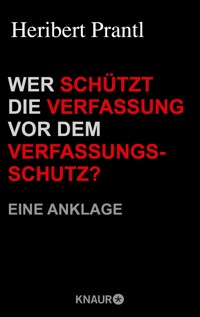16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Weltzuversicht vieler Menschen zerbricht. Die Populisten, die Nationalisten und die Terroristen sind nicht nur Ursache, sondern auch Symptom des erschütterten Vertrauens in eine gesicherte Zukunft. Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtstaatlichkeit sich, und sei es langsam, weiterentwickeln, geht verloren. Heribert Prantl schreibt an gegen das Ohnmachtsgefühl und gegen den vermeintlichen Sog der Fremdbestimmung. Er vertraut der Kraft der Hoffnung; diese Kraft steckt nicht im billigen Optimismus; sie verweigert vielmehr dem Unheil den totalen Zugriff. Prantl glaubt daran, dass die Zukunft positiv gestaltbar ist. Und er sagt wie. Die Frage ist nicht, welche Zukunft man hat oder erduldet, die Frage ist, welche Zukunft man haben will und wie man darauf hinarbeitet. Die Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt, in jedem Augenblick der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Die Kraft der Hoffnung
Welche Zukunft hat die Zukunft?
Da hilft nur beten
Das Vertrauen in die Utopie
Die verletzlichen Boten der Menschlichkeit
Reiß die Himmel auf2
Die Verzeihung des Unverzeihlichen
Rache rettet nichts
Das Anti-Verzweiflungsfest
Das Wir-Gefühl
Ab nach Kassel
Auf Wiedersehen
Letzte Ehre
Die Wahrheit soll ans Licht, aber: Was ist Wahrheit?
In den Dunkelkammern der Zeiten
Gesichter des Bösen
Der Palast des Unrechts
Eine Zeit für Rechtsanwälte
Lasst alle Hoffnung fahren
Wenn 1914 nicht vergeht
Lügner, Heuchler, Kriegsverbrecher
Der Rat der Alten
Hier ist die Ukraine. Hier ist Europa.
Einmauern oder teilen
Eine Welt der Hoffnung
Hoffen auf Europa
Hoffen auf Zuflucht
Hoffen auf Heimat
Hoffen auf Wertschätzung
Hoffen auf Heilung
Hoffen auf produktive Unruhe 233
Hoffen auf Politik
Hoffen auf innere Weisung
Hoffen auf Widerstand 2
Der Autor
Vorwort
Die Kraft der Hoffnung
Ihr Wert misst sich nicht daran, wie realistisch sie ist.
Bisweilen beschleicht einen das Gefühl, dass die Weltgeschichte einen gigantischen Staubsauger eingeschaltet hat, der alle Sicherheiten wegsaugt: Der Corona-Pandemie folgen der Ukraine-Krieg, der Terror der Hamas, die Gewalt in Gaza. Die Angst vor einem Einsatz von Atomwaffen steigt. Und über all dem schwelt die Klimakatastrophe. Die Welt ist so unsicher wie schon lange nicht mehr. Eine Weltgeschichte, die alle Sicherheiten einsaugt, frage ich mich dann freilich – wie soll das gehen? Die Geschichte ist kein handelndes Subjekt, sondern das Produkt der Aktionen von Subjekten. Und wenn man schon das Bild vom Staubsauger aufruft: An den Reglern für die Saugleistung sitzen Autokraten und Diktatoren.
Als der Philosoph Immanuel Kant bereits ein alter Herr war, schrieb er eine Schrift, die »Zum ewigen Frieden« heißt. Je nach aktueller Befindlichkeit stöhnt man da heute, man schmunzelt verlegen, ist melancholisch oder vielleicht auch hoffnungsvoll. Kant lehrt in dieser Schrift aus dem Jahr 1795 etwas sehr Wichtiges: Dass der Frieden kein natürlicher Zustand ist, sondern dass er gestiftet werden muss. Frieden stiften – genau das ist, genau das wäre die Aufgabe von heute. Wer stiftet? Wo sind die Mutigen?
Wir leben in einer Zeit, in der an die Stelle des Glaubens an den Fortschritt der Aufklärung das Gefühl fortschreitender existenzieller Unsicherheit tritt. Seit der Erstauflage dieses Buches im Jahr 2017 hat sich dieses Gefühl noch verstärkt. In solchen Zeiten hat man die Wahl: Man kann sich einbunkern in der kläglichen Erwartung, dass man stirbt, bevor die Katastrophe final hereinbricht. Man kann sich in Zynismus flüchten; man kann, so man betucht ist und Platz hat, im Keller seines Hauses fünf Ster Holz stapeln und viele Säcke Pellets, dazu ein paar Kisten Rotwein. Und ein jeder, ob betucht oder nicht, kann sich die Ohren zuhalten, damit er nichts mehr hört von der Gewalt in der Ukraine, von Atomkriegsszenarien oder von Long-Covid.
Hoffnung lässt die Welt nicht zum Teufel gehen
Man kann den Kopf hängen lassen und resignieren. Man kann aber auch mutig sein und hoffen; man kann an eine erträgliche Zukunft glauben und darauf hinarbeiten, und sei es auch bloß durch offene, ringende Diskussion, die andere Meinungen nicht verachtet, sondern achtet. Das Ziel: Frieden stiften, auch inneren Frieden. Eine Utopie? Utopie besteht in der konkreten Verneinung der als unerträglich empfundenen gegenwärtigen Verhältnisse – mit der Perspektive und der Entschlossenheit, das Gegebene zum Besseren zu wenden. Der Soziologe Oskar Negt hat das einmal so formuliert. Er hat recht. Es gibt daher eine Pflicht zur Hoffnung. Warum? In der Hoffnung steckt Kraft zum Handeln. Das ist aber nun kein Plädoyer dafür, Gefahren schönzureden. Hoffnung sieht die Gefahr; sie verweigert aber Unglück und Unheil den totalen Zugriff.
Es gibt eine Egozentrik der Hoffnungslosigkeit, die Optimismus fast als Beleidigung empfindet. Man kann Zukunftslosigkeit so finster beschreiben, dass die Zukunft vor einem wegläuft. Man kann die Indizien des drohenden Untergangs präsentieren. Man kann die Leiden der Zeit immerzu und in allen Facetten betonen und die Indizien des drohenden Untergangs präsentieren. Aber solches Katastrophalisieren führt zu Depression und Aggression. Selbst wenn es keinen Anlass zum Hoffen gibt, gibt es doch einen Grund dazu: Da, wo man jede Hoffnung fahren lässt, wird die Welt zur Hölle. »Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fahren«, steht, so schreibt Dante in seiner »Göttlichen Komödie«, in dunkler Farbe auf der Pforte zur Hölle. Hoffnung lässt die Welt nicht zum Teufel gehen. Es gilt, dem Unglück und dem Unheil den totalen Zugriff zu verweigern.
Wir alle hatten uns den Ausgang aus der Corona-Pandemie so anders vorgestellt. Zur Pandemie kam und kommt der Ukraine-Krieg, der Hamas-Terror in Israel, der Krieg im Gaza-Streifen. Und über all dem wölbt sich die Klimakatastrophe. In der Corona-Pandemie haben wir weltweite Unordnung erlebt, eine unzeitig-vorzeitige Begegnung mit dem Tod. Das Leben in der Corona-Zeit mit all ihren Beschränkungen war beschwerlich – es war Chaos für die einen, Ödnis für die anderen, bloße Störung der Normalität für die Dritten. Die Impfung brachte Vielen, aber beileibe nicht Allen die Hoffnung zurück, sie brachte viele Menschen wieder aus der Gefahren- und Todeszone, sie brachte aber auch Nebenwirkungen, an denen nicht wenige leiden. Es ist noch viel kreativer Geist vonnöten, um das gestörte Zusammenleben neu zu ordnen.
Die Hilfe kommt aus uns selbst
Wir leben in einer Gefahrengemeinschaft, die spürt, wie sich Bedrohungen zusammenballen und immer größer werden. Man würde sich wünschen, dass es auch eine gute, möglichst nebenwirkungsfreie Impfung gegen die Aggression in der Ukraine gäbe, dass es auch eine Impfung gäbe gegen die Kriegsfolgen, eine Impfung gegen Gewaltherrschaft und für Demokratie, eine Impfung für ein starkes, resilientes Europa – eine Impfung zur Stärkung der Zuversicht und gegen die Hoffnungslosigkeit. Aber so einfach geht es nicht. Die Hilfe kommt nicht von außen, sie kommt nicht aus der Apotheke. Sie kommt aus uns selbst.
Hoffnung – das ist das Wort der Stunde. Nach einer langen Corona-Zeit brauchen die Menschen nicht nur Biontech, Moderna und Astra-Zeneca; sie brauchen auch Hoffnung. Wir leben in einer Mischung aus Müdigkeit, Gereiztheit und Angst. Es gibt, wen wundert es, eine Lust am katastrophischen Denken; sie ist gefährlich, weil sie die Hoffnung zerstört, die nötig ist, um die Krise, die Krisen zu bewältigen. Wir brauchen kreative Kraft, um die Klimakrise zu überleben. Wir brauchen sie, um den Menschen in der Ukraine und im Nahen Osten zu helfen. Wir brauchen diese Kraft, um Frieden zu finden in einer Welt des Unfriedens. Wir brauchen diese Kraft für den Kampf gegen die Kinderarmut, wir brauchen sie für eine gute Bildungspolitik. Wir brauchen sie zumal für die Klimapolitik und für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist keine Frage von gut oder böse, von fair oder unfair. Es ist eine Frage der Selbsterhaltung.
Die Sehnsucht nach dem inneren Frieden
Wir brauchen die Kraft der Hoffnung. Wie geht so ein Hoffen? Muss man sich selber einen Vor-Schuss an Optimismus impfen, bevor man anfängt, etwas zu tun – muss man sich selbst die Gewissheit injizieren, dass es etwas bringen wird? So ist es nicht. Václav Havel, als Dissident immer wieder inhaftiert und später erster Staatspräsident der Tschechischen Republik, hat es so formuliert: »Je ungünstiger die Situation ist, in der wir unsere Hoffnung bewähren, desto tiefer ist diese Hoffnung. Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht. Sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.« Deshalb darf, deshalb muss man auch im Ukraine-Krieg die Hoffnung haben, dass in Verhandlungen ein Weg zum Frieden gefunden werden kann. Es ist ein unheilvoller Defätismus zu sagen, dass das eh nichts bringt, und man das deshalb gar nicht erst versucht. Hoffnung beginnt damit, dass man sich ans Werk macht, einfach weil es wahr ist, einfach weil es ein Muss ist, dem man nicht widerstehen kann, auch wenn man sich auf verlorenem Posten sieht.
Eigenes Tun: Es gibt verstärke Überlegungen, einen sozialen Pflichtdienst einzuführen. Es geht dabei um die nützliche Erfahrung, nützlich zu sein. Eine solche soziale Pflichtzeit passt zu einer Erfahrung, die das Land in der Corona-Zeit gemacht hat: dass man auf Vieles verzichten kann, nicht aber auf den fürsorglichen Umgang miteinander. Etwas Weiteres kommt hinzu: Im Schatten des Ukraine-Kriegs und der militärischen Aufrüstung Deutschlands wächst das Gespür dafür, dass Frieden mehr und anderes verlangt als neue Panzer: Sicherheit entsteht nicht mit dem steilen Anstieg der Aktienkurse der Rüstungskonzerne. In einer Zeit der äußeren Unsicherheit wächst die Sehnsucht nach innerem Frieden, nach sozialer Sicherheit, nach einem guten Miteinander einer viel zu fragmentierten Gesellschaft. Die stark wachsende Zustimmung zu einer sozialen Pflichtzeit ist ein Ausdruck dieser Sehnsucht.
Kaum eine Hoffnung ist je umsonst
Je größer die Probleme, umso wichtiger die Hoffnung – die Kraft, die in der Hoffnung steckt. Das ist nicht nur im Leben einer Gesellschaft, das ist auch im Leben des Einzelnen so. Die größte Hoffnung findet man nicht selten bei denen, die keinen Grund haben zu hoffen. Eine evangelische Pfarrerin, die Sterbende begleitet, erzählt, dass sie Schwerstkranke erlebt hat, die bis zum Schluss hofften. Sie hofften, bis sie starben. Im Lauf der Krankheit änderte sich ihre Hoffnung: Anfangs hofften sie auf Heilung, später auf eine gute Begegnung, auf einen Besuch, auf einen schönen Tag; und dann auf ein seliges Ende. Haben sie sich etwas vorgemacht? Nein, sie machten sich nichts vor, sie hofften. Das sind zweierlei Dinge.
Aber wenn es nicht gut ausgeht? Wenn es kein Happy End gibt? War dann die Hoffnung umsonst? Das Leben ist kein Hollywoodfilm. Es gibt das Scheitern der besten Sache; es gibt den unaufhaltsamen Fortgang einer Krankheit, den Fortgang eines Elends aller Hoffnung zum Trotz. Dennoch: Soll ein Höllenbewohner von Guantanamo aufhören zu hoffen, irgendwann frei zu kommen? Soll ein Bewohner der elenden Flüchtlingslager aufhören zu hoffen, irgendwann ein Zuhause zu finden? Sollte der unheilbar Kranke aufhören zu hoffen, Heilung zu finden? War die Hoffnung dann dummes Zeug, wenn er nicht freikommt, wenn er kein Zuhause findet, seinen Lebtag keinen Frieden sieht, am Ende doch stirbt? Kaum eine Hoffnung ist je umsonst.
Hoffnung macht den Menschen größer
Ein Hoffen, das nicht die Augen verschließt vor der Wirklichkeit, wie sie ist, hat Wert und Würde jenseits des Erfolgs. Manche meinen, ein Scheitern strafe den Hoffenden Lügen. Wer so urteilt, betrachtet die Dinge vom Ende her, vom vermeintlichen Erfolg oder Misserfolg. Man sollte die Dinge aber von der Mitte des Tuns aus betrachten. Inmitten der Arbeit, inmitten des Entschlusses, inmitten der Krankheit und des Leidens macht die Hoffnung den Menschen größer als die Angst. Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, dann liegt es meistens nicht daran, dass die Dinge sind, wie sie sind. Es liegt daran, dass ihm jede Hoffnung fehlt – selbst die Hoffnung, wieder hoffen zu können. Der Suizid ist der Notausgang aus der vollkommenen Hoffnungslosigkeit.
Hoffnung hilft, die Dinge nicht nur zu ertragen, sondern zu tragen, auch die eigentlich unerträglichen. Und wenn man nicht mehr hoffen kann? Was ist, wenn der Hoffnung der Atem ausgeht? Hoffnung ist zwar etwas Tätiges, aber sie ist keine Sportart, die man trainieren kann. Dann ist man darauf angewiesen, dass Andere für einen hoffen. Und man kann sich anstecken lassen von der Hoffnung Anderer.
Die Schwester der Hoffnung ist die Geduld. Geduld ist nichts Passives. Man darf sie nicht verwechseln mit einem »Gib dich zufrieden und sei still«. Geduld ist weit entfernt davon, alles zu dulden. Sie ist weit entfernt von einer Apathie, die das alles hinnimmt und sich in alles schickt. Die Geduld gibt die Erwartung nicht auf. Sie ist kein Aufgeben, sondern ein Festhalten. Der Geduldige hält die Erwartungen fest und die Hoffnung hoch. Er ist nicht wunschlos glücklich. Er lässt sich seine Wünsche nicht abschminken, sie sind ihm weiter ins Gesicht geschrieben. Darum wohnt in der Geduld immer die Spannung, manchmal auch der Schmerz des Noch-nicht.
Zukunft formt sich jeden Augenblick
Es ist bitter, wenn das Wort Zukunft vom Frohwort zum Drohwort wird. Das darf nicht passieren. Auch die bedrohlichen politischen Irrlehren der Gegenwart, der populistische Extremismus und der neue aggressive Nationalismus, sind keine Naturgewalten, sie sind nicht zwangsläufig, sie kommen nicht einfach unausweichlich auf uns zu und über uns. Es gibt keine Zukunft, von der man sagen könnte, dass es sie einfach gibt, dass sie einfach über uns kommt. Zukunft ist nichts Feststehendes, nichts Festgefügtes, Zukunft kommt nicht einfach – es gibt nur eine Zukunft, die sich jeden Augenblick formt: je nachdem, welchen Weg ein Mensch, welchen eine Gesellschaft wählt, welche Entscheidungen die Menschen treffen, welche Richtung die Gesellschaft einschlägt. Die Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt. Die Frage ist nicht, welche Zukunft man hat oder erduldet, die Frage ist, welche Zukunft man haben will und wie man darauf hinlebt und hinarbeitet.
Im Dezember 2023 ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 75 Jahre alt geworden. Alles Rühmende, das über diese Deklaration gesagt wird, ist richtig. Es ist ein Dokument der Hoffnung. Zwar enthält es nicht mehr als ein Postulat; aber darauf baut ein System von Konventionen auf, das verbindliche Rechte und Pflichten in Krieg und Frieden formuliert. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war und ist der Grundstein der Weltordnung; wer fragt, was wertegeleitete Außenpolitik sein soll, der findet hier die Antwort. Es gibt keinen Staat, der nicht wenigstens ein paar Konventionen des universellen Menschenrechtsschutzes ratifiziert hätte. Die Menschenrechte stehen in ganz vielen Verfassungen, sie finden sich in fast jeder staatsmännischen Rede, sie gehören zum Völkergewohnheitsrecht. Die Papierform der Menschenrechte ist also vorzüglich.
Mit kraftvoller Noblesse
Ihre Realität sieht ganz anders aus. Sie war und ist eine Geschichte des Immer-wieder-Scheiterns, eine Geschichte der neokolonialen Bigotterie und der verzweifelten Illusionen. Es gibt ein alljährliches Register dieser Realität: den Jahresbericht von Amnesty International; er wird jedes Jahr länger und düsterer. Und es gibt, seit 9/11, die sich häufenden Tage des Schwankens der Welt – Terroranschläge von der diabolischen Potenz, die sogar die Illusionen und die Visionen zerstören. In der Menschenrechtserklärung wird ein Geist der Brüderlichkeit, der Schwesterlichkeit und der Solidarität beschworen. Dieser Geist hat sich verflüchtigt. Aber in jedem Land der Welt gibt es Menschen, die im Großen und im Kleinen für Versöhnung und Menschenrechte fechten. In Deutschland macht das der uralte FDP-Politiker Gerhard Baum – mit kraftvoller Noblesse und unermüdlich. Die Menschenrechte brauchen diese Unermüdlichkeit.
Die Erklärung der Menschenrechte bleibt ein Dokument der Hoffnung; sie ist ein Leitstern. Nur war dessen Licht selten so matt, war die Hoffnung selten so kleinlaut, waren die Gewissheiten selten so ungewiss wie heute, weil Krise auf Krise folgt und Unheil auf Unheil. In der Präambel der Menschenrechtserklärung heißt es: »Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschen mit Empörung füllen, … verkündet die Generalversammlung diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.« Wir leben wieder in den Zeiten der Präambel.
Hoffnung hilft, nicht verrückt zu werden
Der Wert der Hoffnung misst sich nicht daran, wie realistisch sie ist, und auch nicht daran, ob sie am Ende von Erfolg gekrönt ist. Nelson Mandela hielt die Hoffnung auf ein anderes Südafrika durch, obwohl wenig dafür sprach in all den Jahren, die er im Gefängnis saß, in denen er alt und älter wurde. Nelson Mandela hat recht behalten mit seiner Hoffnung. Was wäre, wenn er nicht recht behalten hätte? Wäre er zuschanden geworden an seiner Hoffnung? Hätte er sich am Ende seines Lebens für sie schämen müssen, weil sie eine Illusion war? Semiya Simsek, die Tochter des Blumenhändlers, den die rechtsextreme NSU-Terrorbande erschossen hat, sagte in einem Interview, sie habe sich all die Jahre gewünscht, »einfach den Tätern gegenübersitzen und in die Augen blicken zu können«. Das schien eine verrückte Hoffnung; aber sie war nicht verrückt, sie hat ihr vielmehr geholfen, nicht verrückt zu werden.
Heribert Prantl, zur Neuauflage des Buchs im Januar 2024
Welche Zukunft hat die Zukunft?
Da hilft nur beten
Ein Gebet gibt der Not eine Sprache, es vermeidet die Sprachlosigkeit. Beten heißt, eine Sprache und eine Geste zu finden für Glück, Unglück und Wünsche.
Manchmal scheint es keinen Ausweg mehr zu geben, manchmal gibt es wirklich keinen mehr. Manchmal scheint alles verloren zu sein, manchmal ist wirklich alles verloren. Manchmal gibt es nichts mehr, was Rettung bringt oder wenigstens Zuversicht: keinen Aufschub, keinen Ausweg, keine Flucht und keine Fristung; es gibt nur das echt oder vermeintlich Unabänderliche: kein Ostern, nirgendwo; keine Auferstehung, kein Halleluja.
Manchmal schlägt diese Erkenntnis ein wie ein Blitz; manchmal schleicht sie sich an wie ein Dieb. Manchmal quält die Schärfe dieser Erkenntnis nur einen einzelnen Menschen, kaum ein anderer kann dessen Ausweglosigkeit nachempfinden. Manchmal ist es kein Einzelner, sondern eine große Gefahrengemeinschaft, die ihr Verlorensein spürt. Krankheiten und Katastrophen können eingebildet sein oder furchtbar real; und je nachdem kann der Spruch »Da hilft nur beten« eine kleine, gar spöttische Ermunterung sein, die ein ironisch trainiertes Bewusstsein kitzelt – oder aber ein schicksalsschwerer und verzweiflungsnaher Satz, der ein Wunder beschwört. »Not lehrt beten«, heißt ein Spruch, in dem sich Geschichte und Welterfahrung spiegeln.
Beten Sie? Mit kaum einer anderen Frage kann man Menschen so irritieren. Die Frage ist peinlich, die Antwort ist peinlich; es offenbart sich in dieser sprachlosen Peinlichkeit so etwas wie eine transzendentale Obdachlosigkeit. Beten gilt als kindlich und kindisch – weil das Gebet meist die erste frühe Begegnung mit dem Glauben war. Und doch sind die frommen Verse, die einen die Oma als Abendgebet gelehrt hat, auf zarte Weise vertraut geblieben. Oft ist Beten daher auch das Letzte, was Menschen in ihrem Leben tun. Alpha und Omega.
Willst du hören von Liebe und Tod
Beten Sie? Die Frage gilt als Zumutung, die gestammelte Antwort ist meist auch eine – weil der Beter weiß, dass Beten ohne einen Rest von kindlichem Urvertrauen nicht funktioniert. Beten ist reden mit Gott, mit einem Wesen also, das nicht antwortet. Das ist naiv, das ist seltsam, das ist suspekt, das gilt als ein Überbleibsel der alten und unaufgeklärten Zeiten in einer säkularisierten Welt. Ist das wirklich so? Ist Beten praktizierte Unvernunft?
»Willst du hören von Liebe und Tod« – so beginnt der mittelalterliche Roman von Tristan und Isolde. Liebe und Tod: In diesen Worten spiegeln sich das Menschenleben, seine Wunder, seine Not, sein Glück und Schmerz. Die Gebete der Menschen kreisen seit je darum: Liebe, Tod, Erbarmen. Beten hat mit Grenzerfahrungen zu tun. Viele Menschen beten – trotzdem sind sie nicht immer gläubig. Für manche ist der Akt eine Art Therapie. Sie schöpfen Kraft aus dem Gebet. Wie weit hat sich das Ritual von seinen Ursprüngen entfernt? Beten, sagen die Religionswissenschaftler, sei schlechthin selbstverständlich. Ist das noch so in Westeuropa? In allen heiligen Büchern sämtlicher Religionen ist das Beten einfach da und immer da gewesen. Beten war und ist also ein Menschheitsbrauch. Geht er zu Ende, oder verändert er sich? Ist das Kreuz, das der Fußballer vor dem Elfmeter schlägt, ein letzter Rest des Brauchtums – und das Händefalten in einer Notlage auch?
In Umfragen bekennen sich erstaunlich viele Menschen zum Beten. Sie tun das oft schamhaft und ungelenk. Aber ist das nicht besser als die Schamlosigkeit, mit der US-Präsident Bush jr. sich vor dem Irak-Angriff öffentlich im Gebet gezeigt hat?
Das Gebet ist lebendiger als die Kirchen, die es lehren. Es ist deswegen lebendiger, weil man weder die kirchlichen Lehren noch ihre Hierarchie dazu unbedingt braucht; andererseits hängen die Rituale auch daran, dass die Institutionen, die diese Rituale tradieren, weiterexistieren.
Das Beten gibt der Not eine Sprache, es vermeidet die Sprachlosigkeit in existenzieller Lage. Beten heißt: eine Sprache und eine Geste finden für Glück, Unglück und Wünsche. Da gibt es nichts, was man nicht sagen dürfte – bis dahin, dass der Beter seinen Gott schüttelt und anklagt: »Warum hast du mich verlassen?« »Warum?«, klagt der Beter. »Wie lange?«, fragt er. Man erlegt sich keine Zensur auf im Gebet. Ist das Glaube? Das ist nicht wichtig. Man kann auch ungläubig beten.
Das Gebet ist lebendiger als die Kirchen, die es lehren
Wichtig ist: Wer Fragen stellt, resigniert nicht. Wer fragt, klagt, bittet, wer aufbegehrt – der hat schon angefangen, etwas zu unternehmen gegen das, was ihm und den anderen angetan wird. Wer es nicht mit dem religiösen Wort »Gebet« benennen will, nenne es therapeutisches Selbstgespräch. Und wenn das, was man Gebet nennt, dabei hilft, der absoluten Sinnlosigkeit standzuhalten, wenn der Tod so nicht das allerletzte Wort hat – dann ist das überhaupt nichts Frömmlerisches, dann hat das Gebet etwas Österliches: Es hilft beim Wieder-Aufstehen.
Was kann ein Gebet denn schon ändern, fragt man sich. Christen glauben an die Macht des Gebetes, daran, dass es sehr viel ändern kann. Sie bestürmen ihren Gott daher mit kleinen und großen Bitten. Es gibt »Weltgebetstage« für bestimmte Anliegen. Und die Wallfahrtsorte hängen voll mit Danksagungen für erfahrene Hilfe. Das alles muss man nicht glauben; und als Nichtchrist mag man das belächeln. Gott, wenn es ihn gibt, ist kein Icon, das man anklickt, um das Programm zu öffnen, das man haben will.
Das Gebet verändert – den Betenden
Wenn ein christlicher Schriftsteller wie der zu Unrecht vergessene Reinhold Schneider 1936 in seinem berühmten Sonett wider die Nazis schreibt »Allein den Betern kann es noch gelingen / Das Schwert ob unseren Häuptern aufzuhalten« – dann denkt man sich, dass ein klarer Widerstand der Kirchen erfolgreicher gewesen wäre als die Beterei. Aber das ist überheblich, weil Beten tatsächlich etwas verändert. Es verändert den Betenden. Dem evangelischen Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, der kurz vor Kriegsende 1945 hingerichtet wurde, war klar, dass man Hitler nicht wegbeten konnte. Aber aus dem Gebet schöpfte er Kraft zum Widerstand. Es ist die Macht des Gebetes, dass es etwas mit dem Menschen macht, der betet.
Beten kann heilen und wieder mit dem Lebenswillen verbinden. Teresa von Avila, die vor rund 500 Jahren geborene Mystikerin, vergleicht die Wirkung des Gebets für die Seele mit dem Regen, der einen Garten bewässert. Das Klage- und Bittgespräch macht ruhiger, geordneter, gewisser. Es macht auch mutiger. Manchmal so, dass man die Welt tatsächlich ein wenig zum Guten verändern kann.
Erschienen in der Süddeutschen Zeitung vom 4., 5. und 6. April 2015, Ostern
Das Vertrauen in die Utopie
Wie und warum man glauben kann. Und warum glauben nicht vom Denken entbindet.
Vielleicht tut man sich leichter mit dem Glauben, wenn man in Regensburg, wenn man im bayerischen Rom aufgewachsen ist. Die Stadt hat einen römischen Zauber, nicht nur für den, der dort, wie ich, groß geworden ist – und nicht nur wegen der unglaublichen Kirchen- und Klosterdichte dort. Die Stadt war der Hauptort von Kaisern und Königen, Sitz des immerwährenden Reichstags, Zentrum des Alten Reiches, Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation; und wenn man auf der Steinernen Brücke steht und in Richtung Dom schaut, dann spürt man das, irgendwie.
Die kleinere Schwester von Rom
Die Stadt war schon Hauptstadt, als Hamburg und Berlin noch nicht einmal Städte waren. Sie ist nicht kleindeutsch; nur kleingeistig, manchmal. Regensburg ist die kleinere Schwester von Rom, sie ist Vorläuferin von Brüssel als europäische Hauptstadt.
Regensburg ist theologisch die Stadt der katholischen Dogmatik. Die katholischen Bischöfe dort waren und sind Dogmatiker. Das Wort Dogma löst nicht unbedingt gute Assoziationen aus. Knopf eins, natürlich: Inquisition, Scheiterhaufen, Rechthaberei. Enge und Denkverbote – das war und das ist die Verirrung des Dogmas. Aber: Dogmatik ist keine Basta-Wissenschaft; sie wird nur zu oft so gehandhabt. Mit Dogma kann man, idealiter, Aufrichtigkeit, gedankliche Klarheit, Glaube und Verstehen verbinden; und die Reflexion der Widersprüche. Dafür ist die Dogmatik eigentlich da.
Den einen wärmt der Mantel, dem anderen wird er zu eng
Eine Klosterschwester, sie hatte wohl keine besonders guten Erfahrungen mit dem Dogma, hat mir einmal gesagt: Wer nicht viel weiß, erlässt Dogmen; wer mehr weiß, fragt; wer viel weiß, betet.
Glaube lernt man nicht, indem man Dogmen und den Katechismus auswendig lernt, sondern wie eine Sprache, in der man aufwächst. Der Glaube wird einem von den Eltern wie ein Mantel um die Schultern gelegt. Die einen wärmt der Mantel, den anderen wird er zu schwer und zu eng. Wenn er einem zu eng wird, kann man ihn wegwerfen; man kann ihn auch in Ehren halten. So mag ich es halten. Und ich mag am Sonntag mit meiner alten Mutter die alten Kirchenlieder singen.
Jungfrauengeburt – das ist ein emanzipatorischer Begriff
Wenn man glaubt, muss man dann alles glauben, was im Glaubensbekenntnis steht, inklusive Hölle und Jungfrauengeburt? Welche Frage. Glauben entbindet nicht vom Denken. Wer meint, die Hölle sei ein Ort, zu dem man gelangen kann, wenn man den Spaten in die Hand nimmt und tief genug gräbt, hat nichts kapiert. Fragen Sie einen Bootsflüchtling, der im lumpigen Schlauchboot über das Mittelmeer nach Europa geflohen ist, fragen Sie ihn, wo die Hölle ist; er wird um die Antwort nicht verlegen sein. Und: Wer meint, die Jungfrauengeburt sei eine Unterabteilung der Sexualkunde und in Marias Vagina zu veri- oder falsifizieren, der ist borniert oder aufklärungsverblödet. Jungfrauengeburt – das ist ein emanzipatorischer Begriff in der Bibel. Er besagt, dass etwas Neues zur Welt kommt, das nicht patriarchaler Macht entspringt.
Die Sprache des Credo ist eine mythische, keine historische oder biologische. Glauben hat nichts zu tun mit unkritischem Fürwahrhalten, es ist ein Vertrauen in eine Utopie.
Der Text basiert auf einem Interview in Die Zeit /Christ und Welt vom 21. Januar 2013
Die verletzlichen Boten der Menschlichkeit
Engel sind keine himmlische Eingreiftruppe. Sie sind die Chiffre für den Wunsch, behütet zu sein.
An Weihnachten, dem Fest also, an dem die Engel in den Tannenzweigen landen und vor und über den Krippen die frohe Botschaft verkünden, könnte man es sich zur Übung machen, den »Engel des Jahres« zu wählen und sich dabei von Bildern inspirieren zu lassen – von Raffael, Rembrandt, Chagall oder Anselm Kiefer. Das wäre eine multikulturelle Übung, denn Engel sind keine christliche und jüdische Spezialität; sie finden sich auch auf Bildern, auf denen man Mohammed in den Himmel reiten sieht.
Auf den Flügeln Spuren von Blut
Vor der Abstimmung über den Engel des Jahres sollte man die Ereignisse des zu Ende gegangenen Jahres rekapitulieren. Wer den Terror und die Grausamkeiten des IS vor Augen hat, das Elend der Flüchtlinge und den Absturz des Germanwings-Flugzeugs in den Meeralpen – der wird für ein Bild des finnischen Malers Hugo Simberg votieren. Es heißt »Der verwundete Engel«, hängt im Ateneum in Helsinki: Man sieht einen jugendlichen Engel, von zwei Jungen auf einer Bahre getragen; er hat eine Binde über den Augen, auf den Flügeln finden sich Spuren von Blut. Es ist ein Gegenbild zu den rauschhaft gloriosen Bildern von der Herrlichkeit des Himmels. Es ist ein trauriges Bild, ein Bild vom Versagen eines Schutzengels. »Fürchtet euch nicht!«, sagt der Weihnachtsengel im Evangelium. Beim Bild des Malers Simberg fürchtet man auch um den Engel.
Man hat sich oft gefürchtet im vergangenen Jahr. Ist Angst aber nicht eine gesunde Regung? Angst erschüttert, sie zwingt Fragen auf: Was ist so kostbar, dass man Angst hat, es zu verlieren? Angst ist eine Unterbrechung, die wichtig ist – auf dass man dann die richtige Entscheidung trifft. Diese Angst ist eine andere als die neuen deutschen Ängste, die gern zu »diffusen Ängsten« kumulieren; diese Pegida-Ängste erweisen sich bei näherer Betrachtung nur als rassistische Ressentiments. Sie sind die Schafspelze, die sich der Hass umhängt, um Wolfsgedanken zu verbreiten. Engel erregen Furcht, keine diffusen Ängste. Sie fordern auf, Furcht zur Besinnung zu nutzen und so zu überwinden.
Throne und Herrschaften
Wer den Kosmos der Engel studiert, so wie ihn Glaube, Wunsch und Vorstellung geschaffen haben, der findet vornehmlich sehr mächtige Exemplare. Die alten Theologen haben den himmlischen Luftraum in neun Chöre gegliedert: die Seraphim und Cherubim, die Throne und Herrschaften, die Mächte und Gewalten, die Fürstentümer, Erzengel und normalen Engel. Sie begleiten und geleiten, schützen, trösten und kämpfen; sie blasen Posaunen, führen Schwerter, besiegen Teufel. Wenn man von den Engeln nichts anderes sieht als einen Kopf und zwei Flügel, heißen sie Putten und zieren als Stimmungsträger die Barockkirchen und Weihnachtskarten.
Die mittelalterlichen Scholastiker sind auf der Spur der Engel zur Hochform aufgelaufen. Die berühmteste scholastische Frage war die, wie viele Engel Platz haben auf der Spitze einer Nadel; daran exemplifizierte sich der Streit über die Körperlichkeit der Engel. Der Kirchenhistoriker Karl August von Hase hat die Engel deshalb zu »metaphysischen Fledermäusen« erklärt. Scholastik und Spott haben aber nichts daran geändert, dass heute mehr Menschen an Engel glauben als an Gott.
Weil die Engel Flügel haben, sind sie aus den heiligen Schriften heraus und hinein in den Alltag geflogen; dort kleben sie bisweilen am Zuckerguss fest. Engel haben ihren Platz im Alltag unabhängig vom Gottglauben gefunden: Es gibt rettende und heilende Engel, Friedensengel, die Schutz- und Todesengel. Viele Menschen glauben an Signale der Transzendenz, daran, dass menschliches Bewusstsein in Verbindung treten kann mit einer Wirklichkeit, die jenseits der Alltagswirklichkeit existiert. Der Engel ist eine Chiffre dafür, er ist der Name für den Wunsch, behütet zu sein. Kein anderer Taufspruch ist daher so beliebt wie der aus Psalm 91: »Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.« Das ist tröstlich; wenn man aber den ganzen Psalm liest, schüttelt es einen; da geht es um die Albträume des Lebens, da ist die Rede von den Pfeilen des Tages, den Seuchen des Mittags, dem Grauen der Nacht.
Erst Krippe, dann Kreuz
Die Engel als himmlische Eingreiftruppe? Das Neue Testament lehrt es anders: erst Krippe, dann Kreuz! Die Lebenserfahrung lehrt es auch anders: Wo waren die Engel, die die Flüchtlinge behüteten auf all ihren Wegen übers Mittelmeer? Wo waren sie beim Germanwings-Flug 4U 9525? Aber schon die biblischen Engel verweigern sich ja, genau besehen, der Leibwächterrolle, die ihnen Mythos und Volksfrömmigkeit verpasst haben.
Die Menschen spüren, dass die Lebensrisiken größer werden und wollen sie abwenden. Statt gegen die Ursachen zu rebellieren, hofft man auf Engel, die es wieder richten. Engel sollen den Lebensplan beschützen, aber nicht durcheinanderbringen. Die biblischen Engel sind aber keine Krisenmanager und keine persönlichen Bodyguards, sie sind keine Verstärkung des eigenen Ego. Sie sind etwas anderes: Sie sind Mahner, Gewissen, Systemkritiker; sie fordern Entscheidungen: Sie wollen, dass der Mensch um den richtigen Weg ringt und dann »englisch« handelt. So ein Engel ist der Engel der Weihnachtsgeschichte, wenn er »Fürchtet euch nicht!« sagt, bevor er Unglaublichkeiten verkündet und den Hirten ansinnt, sie zu glauben und danach zu handeln. Der Weihnachtsengel verkündet, dass nicht Kaiser Augustus der Erlöser ist, sondern ein Kind in der Krippe. Es braucht Mut, so etwas zu glauben, den Mut zur Utopie. Dass es eine Utopie ist, weiß die Weihnachtsgeschichte selbst, denn das ist der tiefere Sinn, wenn sie erzählt, dass es »keinen Ort« (u-topos) in der Herberge gab.
Der Engel mit der blutigen Nase
Einen Ort für Utopien zu schaffen: Das ist Weihnachten. Engel sind Leute, die daran glauben, dass Menschlichkeit und Gewaltlosigkeit möglich sind und die danach handeln. Engel ist jeder, der die Kraft hat, aus dem Ring der Unversöhnlichkeit zu springen; dem Ring, der aus dem Nächsten den Anderen macht, aus dem Nachbarn den Gegner, aus dem Flüchtling den Feind. Allmächtige Engel gibt es womöglich nicht; als Engel holt man sich oft eine blutige Nase, holt man sich Verletzungen wie Simbergs Engel. Aber die verletzlichen Boten der Menschlichkeit sind unverzichtbar, um an der Welt nicht zu verzweifeln.
Erschienen in der Süddeutschen Zeitung vom 24. Dezember 2015
Reiß die Himmel auf
Die Weltzuversicht vieler Menschen ist zerrissen. Es gilt, weder in billigen Trost, noch in Trostlosigkeit zu verfallen.
Es gibt Zeiten der Verzweiflung. In einer solchen Zeit schrieb der Jesuit Friedrich Spee das Lied »O Heiland reiß die Himmel auf«. Das war vor bald 400 Jahren, im Dreißigjährigen Krieg, es war die Zeit der Hexenverfolgung; Spee war ihr leidenschaftlicher Gegner – und er war der Beichtvater ihrer Opfer. Er hat die Folter gesehen, den Hass des Mobs und den Wahn in den Augen der Richter. Er hat die Opfer in Blut und Ekel liegen sehen. Er hat die Urteile gehört, Urteile »im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes«. Er wusste um die Unschuld der Opfer, aber er hat kein Urteil verhindern, er hat nur trösten können. Er hat sich überlegt, ob er sich selbst »den kopff herunter hawen« lässt. Aber dann hat er ihn lieber zum Denken benutzt, hat weitergetröstet und weiterbegleitet zum Scheiterhaufen – und Gott angeschrien in seinem Lied: Reiß auf! Reiß ab! Schlag aus!
Der bittere Ruf nach Gerechtigkeit
Das Lied ist kein Klingeling. Es ist der bittere Ruf nach Gerechtigkeit; es ist die Klage darüber, dass Weihnachten nicht kommt, obwohl es im Kalender steht. Die Klage legt die Enttäuschung frei und bricht der Sehnsucht Bahn. Sie ist der Versuch, sich zu wehren gegen kollektiven Wahn. Spee flieht nicht, auch nicht in simple Antworten. Er konnte den Terror nicht stoppen; aber er konnte tun, was ein Einzelner tun kann: ihn anklagen. Das hat er getan: Er hat es nicht bei Forderungen an den himmlischen Heiland belassen; er wurde zum Widerständler, zum Whistleblower des 17. Jahrhunderts.
Sein Trostschrei-Lied ist heute so erschütternd wahr wie 1622. Die letzten Jahre waren Jahre an der Schwelle vom Zweifel zur Verzweiflung. Es war, als habe die Weltgeschichte den Weltstaubsauger eingeschaltet. Es ist, als säßen an den Reglern der Saugleistung Leute wie Erdoğan und Trump, als säßen dort die Populisten und Nationalisten, diejenigen, von denen man glaubte, dass ihre Zeit vorbei sei – und dazu, immer und immer wieder, die Terroristen. Es ist, als saugten sie die bisherigen Grundgewissheiten weg und den Boden der Gewissheiten gleich mit. Die Welt wird bodenlos.
In der Türkei gibt es neue Hexenjagden. Auf den Philippinen protzt ein Präsident damit, dass er ein Mörder ist. In Deutschland wurde der Weihnachtsmarkt zum Ort des Terrors. Das sicher Geglaubte ist nicht mehr sicher. Der Glaube daran, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich, und sei es langsam, weiterentwickeln, der Glaube an den Fortschritt der Aufklärung ist erschüttert; er hat tiefe Risse.
Wünsche erfüllen sich die Menschen selbst
Das Weihnachtsgefühl ist daher nicht wohlig, sondern bang; es ist das Gefühl existenzieller Unsicherheit; es ist das Gefühl, dass unvermittelt die Barbarei durch diese Risse kriechen könnte. Aleppo, der Südsudan, Jemen, Afghanistan, Mossul – das alles ist Tausende Kilometer weg, aber die eigene Hilflosigkeit ist nahe. Man wünscht sich daher zu Weihnachten kein neues iPhone, das einem dann die schlechten Nachrichten noch schöner präsentiert; man wünscht sich etwas anderes, etwas Großes: dass der Engel, der in der Weihnachtsgeschichte »Friede auf Erden« verheißt, vielleicht doch nicht gelogen hat; dass der finstere Lauf der Dinge angehalten wird und der Himmel zerreißt, wie in der Legende von der Heiligen Nacht.