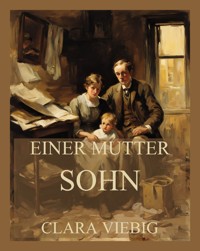Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die uralte Friederike Längnick hütet die ihr aus ihrem Grund und Boden zugeflossenen Millionen als höchstes Gut. Trotz aller Besitzmacht als reiche Schlossherrin kann sie den Verfall ihrer Familie nicht aufhalten. Sohn, Enkel, ja selbst die junge, heißgeliebte Urenkelin Lore, deren Leben sie mit Klugheit zu formen gedachte, entreißt ihr ein unerbittliches Schicksal. Ihr verhärtetes Herz bricht erst beim Verlust des Geldes in der Inflation. Menschen unter Zwang – das sind wir alle. Eine fesselnde Handlung in einer in Verwirrung geratenen Epoche.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clara Viebig
Menschen unter Zwang
Roman
Saga
I
Dass Frau Friederike Längnick-Güldenaue einstmals auf einer bäuerlichen Hofstatt, klappernde Holzpantinen an den nackten Füssen — Strümpfe wurden nicht angezogen, wenn es schmutzig war schonte sie die — durch Dungpfützen und Regenlachen gestapft war, das wusste kein Mensch. Das wusste sie selbst nicht mehr. Dazu war es schon allzu lange her; so lange, dass ein Mensch in der Zeit geboren werden und wieder sterben und doch seine vierzig Jahre gelebt haben kann. Sie hatte vergessen, vieles vergessen; nur einiges nicht. Das, was sie nicht vergessen wollte. Tempelhof, das Dorf bei Berlin, woher sie stammte und Johann Längnick geheiratet hatte, wo sie ihren einzigen Sohn Paul geboren und wieder verloren hatte, wo sie geliebt und gehasst, gearbeitet und gegeizt hatte, wo sie reich geworden war, schwer reich durch den Verkauf ihrer Ländereien an die Stadt Berlin, dieses Tempelhof hatte in ihrem Gedächtnis zu existieren aufgehört. Es existierte ja in Wirklichkeit auch nicht mehr. Fort die alten Dorfhäuschen mit den Lauben davor, die Scheunen mit den Storchnestern, die mächtigen breiten Linden im tiefen Sand, der Pfuhl, aus dem am Sommerabend wie wild die Frösche quakten. Sie dachte nicht mehr daran, sie sprach nicht mehr davon, jenes Leben war aus und vorbei, so, als sei es nicht gewesen; nur zuweilen nachts konnte es vorkommen, dass sie, aus einem Traum aufschreckend, schrie: „Johann, anspannen!“ Aber wenn ihr beim Erwachen die Erinnerung an solchen Traum kam, wischte sie sich über die Stirn und machte mit der Hand eine wegscheuchende Bewegung in die Leere ihres Schlafzimmers hinein, das nicht mehr wie einst den ständig haftenbleibenden bäuerlichen Geruch nach Erde und Stall hatte.
Sie hiess jetzt nicht mehr Rike, sondern Friederike, ging in schwarzer Seide, ein schwarzes Spitzendeckelchen auf dem Kopf, damit man die Kahlheit auf ihrem Scheitel nicht sah, nur darum herum die schütteren schneeweissen Haare. Liess sich ‚gnädige Frau‘ nennen und von Leuten, die etwas von ihr wollten, mit ‚von‘ oder ‚Frau Baronin‘ anreden. Es hatte ihr viel Mühe gekostet, so zu werden, wie sie jetzt war: so zu sprechen, so zu essen, so aufzutreten. Hinter verschlossener Tür, ganz allein mit sich und ihrem Verstand, hatte sie fleissig geübt. Geld allein macht es ja nicht, das wusste sie jetzt. Das, was sie als Tempelhofer Bäuerin in ihren mittleren Jahren noch nicht gewesen war, das stellte sie jetzt vor: eine Dame.
Man sprach mit dem grössten Respekt von der alten Schlossherrin auf Güldenaue. Der Respekt war freilich mit etwas Angst gemischt. Die jungen Dienstmädel im Hause sagten: ‚Die Ale sieht ’m bis in a Magen.‘ Auch die Knechte auf dem Hof sagten das. Wenn die Gnädige am Arm ihres Enkelsohns, des Herrn William Längnick, in die Ställe hineinsah, dann duckte sich der Schweizer hinter die Milchkühe, und der Kutscher, der die Pferde striegelte, striegelte nocheinmal so emsig. Sie sah alles, wenn ihre Augen auch halbversunken hinter Hautfalten unter verknitterten Lidern lagen; schwarz und stechend blickten sie: wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? Wer hat aus dem Obstkorb genascht? „Ich sehe alles, ihr macht mir nichts vor!“ Und dann lachte sie, kicherte in sich hinein, bis sie ihren Husten bekam, an dem sie nachts oftmals fast erstickte. Dann riss sie an der Klingel, heisses Zuckerwasser wollte sie. Aber niemand kam. Man hatte es eben nicht gehört, zu fest geschlafen: mochte sie doch ersticken, das alte Gespenst!
Selbst Berta Rotenbücher, die Gutsmamsell, sagte, sie hätte nichts gehört. Und die hätte doch alle Ursache gehabt, aufmerksam zu sein, denn was wäre wohl aus ihr geworden, wenn die Gnädige sie nicht engagiert hätte, als ihr Bräutigam sie verliess und sie mit einem Kinde dasass? Kein Mensch wollte sie mieten — ‚uneheliches Kind, liederlich!‘ Herrn Pastor Kimmel, dem Seelsorger der Gemeinde Güldenaue, war es etwas beklommen gewesen, als er der Gnädigen den Fall vortrug: wer weiss, wie solche Dame sich dazu stellte? Aber die Herrin von Schloss Güldenaue sagte: „Herr Pastor, ich kümmere mich ’nen Dreck drum, was die Leute sagen. Wenn sie gut kocht, kann sie meinetwegen sechs uneheliche Kinder haben.“ ‚’nen Dreck drum‘ — das verblüffte Herrn Pastor Kimmel etwas — aber doch eine gütige Dame, eine barmherzige Dame! Die gnädige Frau von Schloss Güldenaue nahm die Mamsell mit dem unehelichen Kind in Dienst, sie gab ihr dafür aber auch nur die Hälfte des herkömmlichen Gehaltes; der kleine Balg kam ins Waisenhaus.
Auch die Erzieherin von Lore, der Urenkelin auf Schloss Güldenaue, hörte das nächtliche Klingeln. Fräulein Doris Mittler hatte gute Ohren, aber die wollten nicht hören; sie stand sich nicht mit der alten Gnädigen. Die hatte ihr vorgeworfen, sie spekuliere auf eine Heirat mit ihrem Enkelsohn, dem Besitzer von Güldenaue, dem verwitweten Vater der kleinen Lore. Als ob Doris Mittler, diese noch so frische, tüchtige Dreissigerin, es nötig hätte, diesen tatenlosen Neurastheniker zu heiraten! Und doch hatte sie daran gedacht, dachte noch immer daran.
Aber der Schlossherr von Güldenaue, der statt des deutschen ‚Wilhelm‘ William hiess nach dem Wunsch seiner früh verstorbenen Mutter, die Engländerin gewesen war, scheute vor einer zweiten Heirat ängstlich zurück.
‚Schlummerkopp‘ nannte Friederike Längnick ihn, wenn sie ärgerlich war. Recht hatte sie damit. Nun hatte sie soviel errafft mit der Arbeit eines Lebens, in dem sie sich selber kaum etwas gegönnt, wie eine Magd geschafft hatte, selber mit zum Markt gefahren war, das Geld, das der Verkauf ihrer Tempelhofer Ländereien an die Stadt Berlin ihr eingetragen, dann noch durch glückliche Bau- und Grundstückspekulationen schlau vermehrt — und nun genoss er es nicht! War das nicht zum Ärgern? Ach, sein Vater, ihr Paul, ihr einziger Sohn, der hatte es ja auch nicht genossen! Wenn ihr die Gedanken an den kamen, dann zuckte es über ihr Greisenantlitz, das versteinert schien in seinen eingegrabenen Furchen; alter Schmerz machte es lebendig. In seine Blässe, die graugelblich war, wie allzu lange im Schrank verschlossen gewesenes Leinen, stieg ein Rot. Aus den tiefen Falten der Stirn, aus den Runzeln der Wangen sprangen Gram und verbissene Wut.
Was Friederike Längnick mit ihrem Sohn nicht hatte erreichen können, das hatte sie sich mit Pauls Sohn zu erreichen bemüht. Er sollte lernen, viel lernen; sie schickte ihn aufs Gymnasium, sie hielt ihm noch einen Hauslehrer dazu, er sollte besser schreiben und lesen, mehr wissen als sein Vater. Aber er lernte nicht gut. Sie hatte ihn später dann auf Reisen geschickt. Paris, London, Italien, die halbe Welt hatte er kennengelernt; aber er kam genau so zurück, wie er fortgegangen war. Da kaufte sie ihm das Schloss Güldenaue unweit des Städtchens gleichen Namens am Fuss sanft ansteigender bewaldeter Höhen. Das eigentliche Gebirge lag noch fern, man sah dessen Kamm nur aufsteigen in blauem Duft, wenn die Fernsicht gut war. Sie kaufte Güldenaue billig, denn das Gut war ziemlich heruntergewirtschaftet und das Schloss eigentlich nur ein grösseres Landhaus. Da sollte er sich nun betätigen. Aber er hatte wenig Interesse an der Landwirtschaft. Seine Augen blieben gleichgültig; sie blickten auch nicht lebhafter, als die Grossmutter ihm eine Frau ausgesucht hatte, eine hübsche junge Frau.
Friederike Längnick hatte bei ihrer Wahl weniger auf Geld gesehen, zum erstenmal spielte das keine Rolle. Gesund musste sie sein, sehr gesund; es musste einmal frisches neues Blut in die Familie. Die Tempelhofer hatten immer untereinander geheiratet, sie und ihr Johann waren ja auch Geschwisterkinder, und dass das nicht gut tat, das wusste sie jetzt. „Junges frisches Blut, das wird dich aufmöbeln“, sagte sie mit grimmigem Scherz und stiess dem Enkelsohn mit dem Ellbogen in die Seite. Er sah sie stumm, ohne zu lächeln, an. Da fuhr sie auf: „Zum Donnerwetter noch mal, und da sagst du nichts?!“ Sie hatte ihn mit beiden Händen gefasst und gerüttelt: „Wach auf, wach doch endlich mal auf! Hast du nicht alles, was das Herz begehrt: Gut, Schloss, Saat und Ernte — viel Geld — und nun noch ’ne hübsche junge Frau?!“ — — — —
Wie damals vor Jahren die Grossmutter ihn gerüttelt hatte, so rüttelte heute Doris Mittler den Schlossherrn von Güldenaue. Ohne anzuklopfen war sie bei ihm eingetreten, sie durfte das jederzeit. Mit beiden Händen hielt sie seine Schultern gefasst — sie war von gleicher Grösse mit ihm —, sah ihm so, ganz nah, mit klugen, aufmerksamen Blicken ins Gesicht. Vor den Leuten nannten sie sich selbstverständlich ‚Sie‘, hier aber, allein mit ihm in seinem Zimmer, sagte sie ‚Du‘. „Frau Ingeborg Bade will herkommen — hörst du, William? Ich habe eben einen Brief von ihr bekommen. Sie fragt bei mir an — vorsichtshalber, du würdest ja doch nicht antworten —, ob ihr Besuch nächste Woche passen würde?“
„Was meinst du dazu?“ fragte er.
„Meinetwegen kann sie kommen. Soll ich dir den Brief mal vorlesen?“
„Wozu?“
„Sie schreibt so geheimnisvoll: sie müsste in einer über ihr Wohl und Wehe entscheidenden Angelegenheit deinen Rat einholen.“
„Meinen Rat?“ Er zog fast verlegen die Schultern. „Ich habe gar kein Interesse für ihre Angelegenheiten; wahrscheinlich wieder irgendeine ihrer Liebesgeschichten, mit der sie mich behelligen will.“
Doris Mittler lächelte befriedigt: grossen Anteil an der Schwägerin nahm William wirklich nicht! Dann redete sie ihm zu: „Du kannst sie nicht gut abweisen, Willi, sie ist doch die Schwester deiner verstorbenen Frau!“
„Meinetwegen, dann lass sie kommen. Aber das sage ich dir, ich kann mich nicht um sie kümmern, ich habe keine Zeit. Gar keine.“
„Zeit — du hast keine Zeit?!“ Sie lachte unwillkürlich.
Er fuhr unwillig auf: „Habe ich auch nicht. Ich habe Kopfweh!“ In einer schmerzhaften Regung fasste er sich nach der Stirn; dieser Griff war seiner Hand schon eine gewohnte Bewegung. „Immer Kopfweh!“
„Oh, oh“, machte sie bedauernd. Und sie streichelte ihm Stirn und Wange.
Er hielt still, liess sich streicheln und schloss die Augen dabei; die Berührung ihrer Hand tat ihm wohl. „Es wird mir doch noch einmal so gehen wie meinem Vater“, seufzte er. „Immer dieses Kopfweh. Eines Tages werden sie mich auch ins Irrenhaus bringen.“
„Aber William!“ Sie wurde förmlich böse. „Was sind das für strafbar törichte Gedanken! Nimm dich doch zusammen, lass dich nicht so gehen!“
Er stöhnte auf, nahm ihre beiden Hände und legte sein Gesicht hinein.
Sie sah auf ihn nieder. Ihre Stimme wurde weicher, ihre Augen schimmerten feucht: „Armer Mann, wie quälst du dich!“ Heute war es wieder ganz schlimm mit ihm, er hatte seinen melancholischen Tag, da durfte man ihn nicht schelten, sonst wurde er böse, und es gab eine Szene. So klagte sie denn nur: „Du hast mich doch gar nicht lieb! Sonst würdest du so etwas nicht sagen, du tust mir ja weh damit. Du hast doch auch gar keinen Grund, so zu reden.“
„Keinen Grund —?“ Er hob das Gesicht aus ihren Händen und sah sie verstört an. „Wenn dein Vater — ach, vielleicht hat auch schon dein Grossvater und dein Urgrossvater zu viel gesoffen —, wenn dein Vater so getrunken hätte, dass er das Delirium bekam, bei lebendigem Leibe schon tot war, würdest du dann nicht auch Grund genug haben, um dich zu fürchten? Grund genug, wahrhaftig! Und dazu diese Kopfschmerzen, immer elende Kopfschmerzen. Nicht zum Ertragen“, schrie er aufgeregt, schleuderte ihre Hände von sich und rannte durchs Zimmer.
Sie wartete still, bis seine Schritte sich verlangsamten, bis sein unruhiges Hin und Her ganz aufhörte, bis er am Fenster stand und durch die geschlossene Scheibe hinausstarrte.
Es war Frühling, man hörte, dass laut die Vögel sangen. Gezirp, Gezwitscher von vielen, dazwischen ein süsses, warmtönendes Flötenlied. Unten vorm Fenster, mitten auf dem Rasenplatz, den hochstämmige Rosenstöcke im ersten Trieb einrahmten, ein vollerblühtes rundes Bäumchen; es stand wie ein holdes Wunder in seinem rosa Kleid. Und weiterhin noch andere Bäume, die blühen wollten. Und das Grün so grün, und erste Blumen so bunt, und über der des Frühlings sich freuenden Erde der Himmel, so licht und so blau. Und er sah es nicht. Ach, der Arme, dem das alles gehörte, und der doch nichts davon hatte! Doris Mittler warf einen zornigen Blick hinauf zur Zimmerdecke: gerade oben darüber sass sie in ihrem Zimmer, die Alte! Hätte sie es doch für sich behalten, ihm nicht erzählt, was einstmals war! Freilich, was wusste die, was Nerven waren! Leise trat sie hinter den am Fenster Stehenden und legte den Arm um seine Schultern: „Musste sie dir’s erzählen?“
„Warum denn nicht?“ Es klang gereizt. „Nun weiss ich doch, was mit uns Längnicks los ist. Wenn ich doch nur etwas zu arbeiten hätte! Bei der Arbeit vergisst man. Aber ich habe keine — unintelligent, träge.“ Seine Stimme sank, wurde fast tonlos: „Essen, trinken, schlafen — man sollte mich totschlagen.“
Sie war erschrocken, seine Stimme erschütterte sie. Er machte sich Vorwürfe über sein müssiges Leben — war es denn nicht auch schrecklich, so dahinzuleben?! „So nimm dir doch etwas vor“, bat sie herzlich. „Könntest du nicht vielleicht den Inspektor abschaffen?“
Er schüttelte verneinend.
„Dann doch wenigstens den Vogt. Du hast viel zu viel Leute; was läuft hier alles herum. Güldenaue ist nicht gross, eigentlich nur ein Luxusgut. Du könntest es ganz gut allein schaffen. Es würde dir so viel Freude machen, über die Felder zu gehen. Du könntest ja auch reiten.“ Sie klinkte das Fenster auf, stiess die Flügel weit zurück und atmete tief: „Ah, es ist schön, wunderschön, wenn in der Frühe die Lerchen singen! Oder wenn am Abend die Sonne in Korn und Wiesen versinkt. Versucht’s doch mal, ob es dir nicht möglich wäre, dich selbst etwas mehr zu kümmern. Ich könnte dich gut dabei unterstützen, Willi, die Bücher führen, die Löhne auszahlen, die —“
„Ach was, ach was“, unterbrach er sie heftig. „Alles Unsinn. Ich werde Güldenaue verkaufen und nach der Stadt ziehen. Nach Breslau, nach Dresden, vielleicht nach Berlin. In der Stadt ist immer was los, man hat Zerstreuung.“
„Und Lore?“ fragte sie vorwurfsvoll. Um Gottes willen, nur nicht in die Stadt ziehen, dachte sie. Sie hatte noch genug davon, wie er aus Berlin zurückgekommen war im vorigen Winter — vollständig ausgeplündert, geistig und körperlich. Es hatte lange gedauert, bis er sich erholt hatte. Gut, dass sie Lore zum Vorwand nehmen konnte! Und war es denn nicht auch so, hatte der Arzt nicht gesagt, dass für Lore Landluft das Zuträglichste sei? Ihre Mutter war genau so rosig gewesen, niemand hätte gedacht, dass diese blühende junge Frau einer Grippe so wenig standhalten könnte. Hohes Fieber, wenige Tage nur, dann war’s aus gewesen; das Herz zu schwach, es versagte plötzlich. Vielleicht war Lores Herz auch nicht stark. „Willi, denk an Lore! Ach, in die Stadt eingesperrt, was soll da aus dem armen Kind werden?!“
„Ach so, ja, Lore.“ Es klang enttäuscht. Aber doch war William Längnick im Grunde froh, dass aus seiner plötzlich aufgetauchten Idee, Güldenaue zu verkaufen, nicht Wirklichkeit werden konnte. Ach, alles, was er in Angriff nehmen wollte, zerfloss eben in nichts! Er hatte weder in den Händen noch in den Gedanken die Kraft, etwas festzuhalten, geschweige denn auszuführen. Die Grossmutter würde es ja auch gar nicht erlaubt haben. „Ich bin krank“, seufzte er.
Ja, das war er! Sie sah ihn besorgt an: was war es für eine Krankheit? Doktor Schmieder konnte sie ihr nicht nennen. Ach, war es die Krankheit des Degenerierten? Geschlechter wachsen nicht aufwärts, sie wachsen niederwärts; wie bei den Fürsten so bei den Bauern. Und doch hätte Doris Mittler ihn geheiratet, nicht nur seines Reichtums wegen — als seine Witwe würde sie in bester Lebenslage zurückbleiben —, sie hatte ihn auch wirklich lieb, trotz seiner Schwächen. War er nicht wie ein Knabe, der sich an sie schmiegte, wenn ihm ganz bange war? Und geheiratet um Lores willen. Sie fühlte es wohl, man wollte ihr dieses Kind, das sie gehütet, seitdem es seine Mutter verloren hatte, entwinden. Oh, die, die da oben! Unwillkürlich stellte sie sich fester auf ihre Füsse. Aber musste diese Alte, dieses ‚Gespenst von Güldenaue‘, wie das Dienstpersonal sie nannte, denn ewig leben? ‚Des Menschen Leben währet siebenzig Jahre, und wenn es hoch kommt, so sind es achtzig Jahre‘ — diesen Psalm hatte Lore erst kürzlich gelernt —, die Urgrossmutter war ja nun schon weit über achtzig Jahre! Das gab Beruhigung. Wer weiss auch, ob William sich nicht doch noch mit ihr trauen liess? Dann hätte sie alle Rechte. Doris drückte sich enger an ihn, sie legte ihre Wange an die seine: „Mein Guter, du Lieber!“
Er lächelte und legte den Arm um sie: „Du bist gut, Doris — ach ja, wenn ich dich nicht hätte!“
So standen sie eine Weile. Das viele Licht, das die Sonne und der frischgrüne Rasenplatz von draussen hereinsandten, fiel hell auf die zerwühlte Stirn des kaum Vierzigjährigen, auf sein Haar, das an den Schläfen schon ergraute, mitten in sein Gesicht, das so sympathisch war, wenn es einen freundlicheren Ausdruck zeigte. Auch ihr Gesicht war voll beschienen: ein kluges Gesicht, gesund gebräunt, mit klaren braunen Augen. Es war auch klug, dass sie, scheinbar sich unterordnend, jetzt nochmals fragte: „Und an die Bade soll ich also schreiben, dass es dir recht ist, wenn sie kommt?“
„Nein, es ist mir gar nicht recht.“ Er sagte es förmlich kläglich. Seine Augen blinzelten, es zog wie Angst über sein Gesicht: „Sie will mich heiraten!“
„Dann heirate mich doch schon lieber“, sagte sie lachend. Ihr frischer Mund war ganz nahe dem seinen.
„Nein“, sagte er plötzlich voll ungewohnter Energie, „ich habe dich lieb. Heiraten —?! Ich bin dir viel zu dankbar dazu.“
II
Ingeborg Bade war eine schöne Frau. Und lebenslustig auch — warum auch nicht, sollte sie ewig ihrem verstorbenen Gatten, dem Apothekenbesitzer Bade, nachtrauern? Die böse Welt der Stadt, die nicht so gross war, dass man sich gegenseitig nicht leicht hätte beobachten können, wusste manches über die schöne Witwe zu erzählen. Schon als Bade noch lebte, hatte sie Liebhaber gehabt. Der gute Bade rührte hinten im Laboratorium seine Mixturen, studierte, die Brille vor den kurzsichtigen Augen, sorgsam die Rezepte, und vorn im Verkaufsraum sass Frau Bade, elegant angezogen, an der Kasse und tauschte mit dem Provisor zärtliche Blicke und rasche zärtliche Worte. Wie man behauptete, hatte sie noch viel mehr mit ihm getauscht. Ein hübscher, flotter Mensch, dieser Provisor. Aber bei Ingeborg Bade war es so, sie musste immer Abwechslung haben. Nach dem Provisor war es der Polizeihauptmann, mit dem ritt sie sogar aus. Wenn es dann hernach zu Ende war, fragte sie nicht viel danach, ob die Herren diskret waren oder nicht; wenn man ihr dies und das hinterbrachte, was die gesagt haben sollten, warf sie den Kopf zurück und lachte: „Ist ja gar nicht wahr!“ Sie leugnete nichts, war auch nicht beleidigt, es schmeichelte ihr im Gegenteil, dass man sich so mit ihr beschäftigte; sie kam sich interessant vor. Der reiche Gutsbesitzer Vennhof war auch einer von ihren Anbetern. Er war auch mit dem Ehemann sehr befreundet gewesen; der Verkehr war äusserst rege, allwöchentliche Besuche und Gegenbesuche wechselten sich ab.
Auf Vennhofs Jagd war es auch, dass der gute Bade verunglückte. Die Freunde sassen auf Anstand, einer nicht allzu weit vom anderen entfernt; es war grauender Morgendämmer. Gott weiss, was den Apotheker angekommen sein mochte, dass er auftaumelte, sich geduckt an den Büschen entlang schlich. Der Jagdfreund hatte geglaubt: ha, der Rehbock! Sein Schuss fiel. Aber es war kein Rehbock, der fiel. Trotzdem sollte Vennhofs Verhältnis mit Frau Bade noch fortgedauert haben. Man hatte ihn in Berlin mit ihr zusammen gesehen. In einer Tanzdiele. Aber es konnte ja auch eine Täuschung sein, es gab in Berlin viele Frauen, die sich so schick kleideten wie die Bade; die reine Uniform: Kleid, Hütchen, leicht getönte Wangen und dasselbe Lächeln. Es konnte ebensogut eine andere gewesen sein, die mit einem beleibten Agrarier Sekt trank. Frau Bade behauptete, seit Jahren nicht mehr in Berlin gewesen zu sein. Und Vennhof dachte ja auch gar nicht daran, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. —
Aber jetzt hatte Ingeborg Bade ernste Absichten, sie war es nun müde, in der Leute Mäuler zu sein. Sie lachte nicht mehr darüber, sie weinte sogar, denn die Vierzig nahten. In einer Gesellschaft hatte sie einen Herrn kennengelernt, der ihr sehr gefiel. Es wurden allerlei Spiele gespielt, und da war es ganz merkwürdig, was dieser junge Mann für ein Talent entwickelte; eine seltsame Gabe. Er ging hinaus, ausser Seh- und Hörweite, und es wurde etwas für ihn versteckt. Ihr Taschentuch. Man legte es in den Flügel, ganz hinten auf die besponnenen Saiten, und schloss den Deckel wieder. Als er dann hereingerufen wurde, ersuchte er sie um ihre Hand, fasste die ganz fest mit Daumen und Zeigefinger ums Gelenk, da wo der Puls sitzt, und bat sie, nun ganz intensiv an den versteckten Gegenstand zu denken. Sein kühnes Gesicht verlor das Lächeln, es nahm einen besonderen Ausdruck an, seine Stirn zog sich zusammen wie bei einer Anstrengung, er sagte kein Wort. Sie fühlte ihren Puls unruhig klopfen, er hatte so eiserne Finger, die hielten sie wie in einer Klammer. Nach kurzem Zögern schritt er auf den Flügel zu, rasch, immer rascher, er zog sie förmlich, klappte den Deckel auf, nahm das Tuch von den Saiten und überreichte es ihr mit einer Verbeugung: „Ihr Taschentuch, gnädige Frau!“ War das nicht wunderbar? Wie konnte er es nur so rasch finden und dann gleich wissen, dass es ihr gehörte?!
„Sie sind ein gutes Medium, gnädige Frau!“ Tief senkte er dabei seinen Blick in den ihren. Es überlief sie: was er für zwingende Augen hatte! Wahrhaftig, dem etwas abzuschlagen würde schwer halten!
Den ganzen Abend beschäftigten sie sich miteinander. Er war riesig interessant. Konnte er wirklich Gedanken lesen oder war es nur Humbug? Ob er wohl wusste, dass sie sehr wünschte, ihm zu gefallen? „Was denke ich jetzt?“ fragte sie ihn kokett.
Er lächelte: „Dass ich Ihnen gefalle, gnädige Frau, und dass Sie es wünschen, mir auch zu gefallen.“
Sie war erschrocken. „Hm“, sagte sie nur und nickte.
Als die Gesellschaft aufbrach, bat er, sie nach Hause bringen zu dürfen. Sie hatte sich schon oft nach Hause bringen lassen, aber so wie heute war es doch noch nie gewesen. Mitternacht war vorbei, der Mond schien, langsam gingen sie durch die menschenleeren Strassen. Immer langsamer schleuderten sie. Ah, sie schien ihm doch sehr zu gefallen, und er gefiel ihr auch immer besser! Ingeborg Bade fühlte ihr Blut sich erregen. Er hatte ihr den Arm geboten, sie sei müde, hatte sie gesagt; es war auch so; sehr müde, ganz schlasf. Sie hatte sich bei ihm eingehängt, nun drückte er ihren, unterm Pelzmantel nackten Arm fest an sich. Wie einen Strom fühlte sie es von ihm zu sich hinüberrinnen.
Er fing an, vom Krieg zu sprechen. Natürlich war er mit dabeigewesen — krach, krach, Achtung, Granate! Ein Splitter hatte ihn am Arm schwer verletzt. „Da lag der Fetzen Fleisch, ein Stück von mir! Ich habe mich noch danach bücken wollen, dass man’s wieder anpappen konnte — aber dann fiel ich doch um.“
„Haben Sie einen Mut! Gott, was für einen Mut!“ Es gruselte sie und verschlug ihr fast den Atem.
Er lachte: „Ja, ein klein bisschen Courage muss man schon haben! Aber Sie zittern ja, gnädige Frau? Sie brauchen kein Mitleid mehr mit mir zu haben, ich habe noch Schwereres überstanden.“
„Sie Armer“, sagte sie zärtlich.
Da küsste er sie.
An der Haustür trennten sie sich nicht. Sie hatte ihn mit hineingenommen. — — —
„Also diesmal wollen Sie wirklich heiraten?“ fragte die alte Längnick und sah über den Tisch, auf dem das Abendessen stand, hinüber zur Schwester von ihres Enkels verstorbener Frau.
Es wurde Ingeborg ganz unbehaglich unter dem scharfen Blick der kleinen schwarzen Augen; sie ärgerte sich, dass sie Unbehagen empfand: was brauchte sie sich vor der zu genieren, Rechenschaft war sie der doch nicht schuldig?! Und doch wurde es ihr schwer, die Kecke und Selbstsichere zu spielen. „Warum denn nicht? Ein reizender Mensch! Und er liebt mich! Wenn man so vereinsamt ist wie ich, darf man da treue Liebe von sich weisen?“ Sie warf einen Blick zu ihrem Schwager hinüber: was machte der denn für ein Gesicht dazu? „Nicht wahr, Willi? Was sagst du?“
„Gar nichts.“ William Längnick zuckte die Achseln. „Mich geht das ja gar nichts an.“ Es klang fast grob. Dieses verwünschte Frauenzimmer war ihm nun doch auf den Hals gekommen, obgleich Doris ihr geschrieben hatte, ihr Besuch passe jetzt nicht, sie möchte ihn lieber noch etwas verschieben. Sie war doch gekommen, behauptete, diesen Brief nicht bekommen zu haben!
Ohne vorherige nochmalige Anmeldung war Ingeborg Bade heute erschienen mit einem Koffer und viel Handgepäck. Sie hatte ja solche Sehnsucht, eine nicht mehr zu bezwingende Sehnsucht nach dem lieben Güldenaue und seiner friedlichen Abgeschiedenheit, wo man kaum gewahr wurde, dass draussen Krieg gewesen war und noch immer die Welt so voller Unruhe. Und Sehnsucht nach ihrem guten Schwager, der ihr stets ein Freund gewesen war. Einen Freund, ach, den brauchte sie jetzt doppelt und dreifach, stand sie doch vor einer immerhin schweren Entscheidung: sollte sie ‚ja‘ sagen oder ‚nein‘ auf Herrn Tills Antrag? Sie hatte Kinder, eine Tochter von dreizehn, Brigitte war bald ein Backfisch, und dann ein so junger Stiefvater! So viele Jahre ihr guter Bade älter gewesen war als sie, so viele jünger war Herr Thomas Till. Achtundzwanzig. Ein Vierziger würde freilich besser zu ihr passen, aber, aber — sie zögerte, seufzte und sah wieder nach dem Schwager hin. Wenn William wenigstens sagen würde: „Bei dir spielt das Alter keine Rolle, du bleibst immer jung und schön.“ Aber er sagte nichts.
Die Grossmutter, die sagte etwas. „Also so ’nen Jungen wollen Sie sich zulegen? Na ja!“ Ihre Miene war vielsagend.
Doris Mittler rückte unruhig auf ihrem Stuhl: wollte die Alte taktlos werden? Lore sass doch am Tisch! Sie wendete sich rasch zu dem Kind, das schön und still neben ihr sass: „Lorchen, sei so gut, lauf mal in mein Zimmer hinauf, hol mir ein Taschentuch, ich hab’s vergessen.“
„Gehen Sie doch selber! Lore ist kein Schickedanz.“ Die Gnädige ergriff die Gelegenheit, der Mittler eins auszuwischen: was sich diese Person alles erlaubte! Doris wurde blutrot, aber sie behielt ihre ruhig-freundliche Miene. Doch William Längnick fuhr auf: „Ich werde es holen. Bleib sitzen!“ herrschte er die Tochter an. Rasch war er zur Tür hinaus.
Oh, war der froh, entrinnen zu können! Doris unterdrückte ein Lächeln; sie war nun nicht mehr beleidigt, sie hatte Humor genug für die Situation, und den Pfeil der alten bösen Frau hatte William ritterlich abgewehrt. Das tat ihr wohl.
Eine plötzliche Stille war eingetreten. Die Grossmutter sass ganz erstaunt: William ging selber, stand auf vom Tisch, was erlaubte er sich? Auch die junge Lore sah mit grossen Augen von ihrer Doris zur Urgrossmutter, und von dieser wieder zu jener, und dann auch zu der Tante hin, die so unwillkommen zu Besuch gekommen war. Unwillkommen, das konnte man gut merken. Diese schöne Frau mit den gebrannten Haaren, in dem eleganten Kleid, so ganz anders angezogen als ihre Doris, war ihr nicht gerade sympathisch und hatte ihr etwas Fremdes. Aber es war doch die Schwester ihrer Mutter, und wenn Tante Ingeborg auch keine Ähnlichkeit mit der hatte — Doris sagte, sie hätte gar keine —, so musste sie doch der Mutter wegen, zu deren Grab sie oft mit Doris Blumen brachte, lieb und freundlich zu ihr sein.
„Was macht denn Britta?“ fragte sie mit ihrer fast noch kindlichen Stimme und lächelte die Tante an.
„Ach, Brigitte ist auch schon ein grosses Mädchen, wenn auch lange nicht so hübsch wie du!“ Frau Bade war dankbar für die erlösende Frage aus dieser bedrükkenden Stille. Diese Grossmutter war ja ganz gefährlich, wenn auch in anderer Art gefährlich als die Mittler! Und blöde war es von dem Schwager, aufzuspringen und nach dem Taschentuch zu rennen! Mit Freuden ergriff sie die Gelegenheit, von Brigitte und Theo zu sprechen; sie tat es gern, sie liebte ihre Kinder. „Ein bisschen wild ist Theo leider: Tom sagt zwar, er wird ihn schon zahm kriegen, ich schicke ihn aber doch in eine Erziehungsanstalt, in ein Landheim oder nach der Schweiz, dann lernt er gleich gut Französisch. Es ist nicht angenehm, in einer jungen Ehe so grosse Kinder im Haus zu haben. Und Brigitte — ja, da weiss ich noch nicht. Vorderhand schwärmt sie für Tom. Er mag sie auch sehr gern. Sie ist ja auch wirklich lieb, aber ein komisches Mädchen — ja, was ich mit Brigitte machen soll, das weiss ich wahrhaftig noch nicht!“
„Tante, gib sie doch her zu uns!“ In Lores zartes Weiss stieg eine helle Röte. „Oh, das wäre schön! Mir fehlt gerade jemand, mit dem zusammen ich noch lernen kann und auch mal ’ne Dummheit machen und lustig sein. Doris sagt immer: ‚Eine junge Gefährtin brauchtest du, eine Altersgenossin.‘ Nicht wahr, Fräulein Mittler, ich werde zu altklug immer nur mit Erwachsenen?“ Sie lachte und Fräulein Mittler lächelte auch. Sie strich dem jungen Mädchen mit einer zärtlichen Gebärde über das lockige Haar: „Wenn du über die junge Freundin nicht die Liebe zu deiner alten hintansetzst, dann soll sie nur kommen!“
„Hörst du, Tante, Fräulein Mittler sagt es auch!“ Lebhaft umarmte sie die Erzieherin und drückte ihr einen Kuss auf. „Doris erlaubt’s!“
Die Urgrossmutter sah aus wie ein Geier, der die Federn sträubt: „Fräulein Mittler hat gar nichts zu erlauben. Sitz still, Lore!“ Sich zu Ingeborg wendend, sagte sie dann: „Aber es liesse sich drüber reden. Meinetwegen. Was würden Sie für die Pension hier anlegen?“
Lore wurde blutrot: o wie peinlich! Geld, bezahlen?! So war es doch nicht gemeint. Die Tante sollte doch nicht bezahlen. Um Gottes willen, sie durfte nichts bezahlen! Britta sollte hier als ihre Gefährtin sein, als ihre Freundin, und Freundschaft und Liebe, die haben mit bezahlen doch nichts zu tun. War denn nicht Geld genug hier?! Die Tränen schossen ihr in die Augen, sie fühlte sich tief verletzt. ‚Millionenerbin‘ sagten die Leute. War es so, sollte sie einmal Millionen erben? Ach, sie machte sich gar nichts daraus. Liebe, Liebe, nach der verlangte es sie, ausser Doris hatte ja niemand sie lieb. Der Vater nicht, der war viel zu gleichgültig, die Urma nicht, die konnte ja gar nicht lieben. Aber Britta würde sie lieben, sie sah sich schon mit ihr Hand in Hand. Sie würden zusammen konfirmiert werden — das war ein grosses Ereignis — sie traten zusammen in das Leben ein, von dem sie noch keine Ahnung hatte, und auf das sie doch sehr neugierig war. Lores Augen richteten sich flehend auf die Schwester ihrer Mutter: wenn die doch jetzt sagen möchte, ‚ja, ich schicke dir Britta!‘
Aber Frau Bades Gedanken waren bereits abgeschweift. Dass William mit der Mittler was hatte, das war ja ganz klar! Oh, diese scheinheilige Landpomeranze mit dem glatten Scheitel und der puritanischen Kleidung, Rock und Bluse wie eine Bedienstete. Die auszustechen, konnte ihr doch nicht schwer fallen. Ihm nahm sie weiter das Verhältnis nicht übel, er war ja noch ein Mann in den besten Jahren und hatte hier eben keine Wahl. Ihre Gedanken eilten flüchtig, wie sie stets waren, zu Tom: der war in der Liebe mehr nach ihrem Geschmack, jünger und frischer. Aber freilich, William war reich. Gut aussehend war er eigentlich auch, und dass er nicht viel sprach, war ja gar nicht unangenehm; bei Tom kam man nie zu Wort, der beherrschte immer die Unterhaltung. Er hatte ja auch was zu erzählen. Was der im Krieg sich alles geleistet hatte! Tolle Stückchen: Schleichpatrouillen mitten in die feindlichen Linien — Horchposten — es war stets auf Leben und Tod gegangen. Er war ja auch Offizier geworden, hatte das Kreuz Erster bekommen, immerhin was für einen einfachen Handlungskommis! Aber sie wollte doch auch einmal reden, nicht bloss zuhören.
Die Frau wog Vorzüge und Nachteile beider Männer ab wie der Krämer die Ware. Die Waage senkte sich nach des reichen Schwagers Schwere. Wo William nur so lange blieb? Sie beschloss, gleich heute noch einen Vorstoss zu wagen. „Warum kommt William nicht wieder?“ fragte sie harmlos.
„Da müssen Sie ihn selber drum fragen“, sagte die Alte. Sie lächelte ein wenig, wenn man das Zucken ihres schmallippig gewordenen Mundes Lächeln nennen wollte. Ei, was war diese Frau für eine Pute! Sie war hergekommen, um den reichen Mann zu kapern, und merkte es gar nicht, dass sie ihm auf die Nerven fiel. Friederike Längnick amüsierte sich. „Hm, hat denn Ihr Zukünftiger eine Position?“ fragte sie. „Oder will er Sie nur heiraten wegen des Geldes, das Ihnen Bade hinterlassen hat? Das kann rasch alle werden.“
„Oh, er ist gutsituiert“, sagte rasch Frau Ingeborg. Sie würde hier doch nicht sagen, dass er nichts hatte. Sein Vater, der hatte einmal etwas gehabt — sogar drei Güter — Tom war als Knabe mit der Equipage zur Schule gefahren worden, aber das war schon lange her. Ingeborg Bade war sich bewusst, dass sie log, als sie sagte ‚gutsituiert‘. Konnte sie denn dieser bösen Alten die Wahrheit sagen? Konnte sie sagen, dass er zur Zeit nicht einmal eine Stellung hatte, sondern von dem lebte, was ihm ein älterer Bruder zukommen liess? Diese alte Hexe würde ihr womöglich auf den Kopf zusagen: ‚Sie wollen nur heiraten um jeden Preis.‘ Ja, das wollte sie auch! Wenn Vennhof sich nicht scheiden liess, und William nicht herumzubekommen war, dann musste sie eben Tom heiraten; und tat das auch ganz gern, denn er war ein Liebhaber, wie man sich keinen besseren wünschen konnte. Wo war ein Mädchen, das ihn nicht gern genommen hätte? Alle, Frauen wie Mädchen, bezauberte er. Aber erst würde sie es doch noch einmal beim Schwager versuchen. Ingeborg stand auf und zupfte ihr Kleid zurecht. „Gute Nacht“, sagte sie, „ich bin von der Reise doch recht müde.“
„Na, denn gehn Sie man.“ Die Alte reichte ihr die kühle Greisenhand. „Schlafen Sie gut und träumen Sie süss!“
Wie boshaft das klang! Es durchfuhr Ingeborg: diese Grossmutter war eine böse Zugabe. Aber trotzdem, trotzdem — und wie lange konnte die denn auch noch leben?! Sie machte eine leichte, abschiednehmende Verbeugung und strich Lore über den Kopf: „’nacht, mein Süsses!“
Doris Mittler stand auf: „Ich werde Sie nach oben bringen, gnädige Frau!“
Aber Frau Bade winkte mit Entschiedenheit ab: „Ich bin ja hier ganz zu Haus. Nein, bleiben Sie ruhig sitzen — nein, nein, ich finde schon!“ —
Leichtfüssig war sie die breite Treppe hinaufgehuscht. Da war des Schwagers Zimmer! Sie lauschte und hörte sein Hin- und Hergehen. Aber vorerst schlüpfte sie in ihr Zimmer. Hastig warf sie ihr Kleid ab und hüllte sich in ein Negligé: na, wenn ihm das nicht gefiel! Das weiche, fliessende Gewand von zartem Blau, das den Hals freiliess und den Ansatz des Busens zeigte, stand ihr bezaubernd, der Spiegel bestätigte ihr’s. — — —
An William Längnicks Tür hatte es leise geklopft, und es wurde zugleich auf die Klinke gedrückt. Das war Doris! Niemand sonst würde das wagen, so ohne ‚herein‘. Er war enttäuscht, statt Doris seine Schwägerin vor sich zu sehen.
Mit liebenswürdigem Lächeln hielt sie ihm beide Hände hin: „Du kamst nicht zurück, William, ich muss dir doch noch gute Nacht sagen!“
„Sehr freundlich von dir. Schlaf wohl!“ Seine Hand machte die gewohnte Bewegung nach der Stirn. „Ich bin auch müde.“ Ihre beiden ihm entgegengestreckten Hände sah er nicht.
„Ach, Willi, es bewegt mich so, mal wieder hier im Hause zu sein.“ Sie seufzte auf: „Ach Gott, nun ist die gute Elfriede schon so lange tot, über zwölf Jahre. Aber ich sehe noch ihren Sarg unten im grossen Saal stehen mit all den Blumen und Kerzen. Ihr benutzt jetzt den Saal wohl gar nicht mehr?“
„Wir geben keine Gesellschaften. Ich glaube, es steht jetzt die Wäscherolle drin.“
Da, wo ihre liebe junge Schwester im Sarg gelegen hatte, da stellten sie jetzt eine Wäscherolle hin? Das war selbst dieser Leichtherzigen zuviel. Waren das kalte Menschen! Die Tränen kamen ihr in die Augen und heisses Rot stieg ihr ins Gesicht; sie hielt nicht an sich: „Ich habe Bade nicht geliebt — die Eltern wollten es, dass ich ihn heiratete — aber das muss ich doch sagen, das Zimmer, drin er gelegen hat zuletzt, das ist mir denn doch heilig gewesen!“
„Grossmutter hatte das so bestimmt.“
„Deine Grossmutter ist ein —“ Ingeborg verschluckte ein kräftig bezeichnendes Wort. Aber es hätte William vielleicht beleidigen können, so sagte sie denn nur: „ein herzloser Mensch.“
Der Enkel nickte schwermütig: „Das ist sie oder scheint es wenigstens zu sein. Aber doch, was fingen wir an ohne sie?!“
„Sie regiert euch alle. Das ist ja lächerlich, wie ihr euch regieren lasst!“ Nun fing Ingeborg an, sich auch über den Schwager zu ärgern: war der ein Mann? Ah, da war Tom doch ein ganz anderer! Sie wurde auf einmal kritisch: „Du bist grau geworden, William, seit wir uns nicht gesehen haben.“
Er lächelte müde: „Das glaube ich wohl. Ich bin auch nicht gesund. Alt werde ich nicht, das fühle ich deutlich.“ Er wurde auf einmal mitteilsam; Ingeborg machte ein so mitleidiges Gesicht, sie sagte auch nicht ‚Unsinn‘ und ‚Nimm dich zusammen‘, und das liess ihn gesprächig werden. „Ich habe nicht die Lebenskraft, die Grossmutter noch immer hat. Die hat eine Kraft, eine Kraft! Siehst du, und das macht mich ganz willenlos ihr gegenüber. Es ist schon immer so gewesen, seit ich denken kann. Sie hat an meiner Kindheit Wache gestanden — später auch — du wirst denken: wie ein bissiger Hund; aber gebissen hat sie mich nie. Sie hat mich lieb, auf ihre Weise natürlich. Ich habe sie auch lieb — das wundert dich vielleicht?“ Er sah sie fragend an.
Aber sie nickte nur flüchtig, das hatte ja so wenig Interesse für sie.
„Ich habe mich früher manchmal gegen sie empören wollen. Ich habe sie zuweilen fast gehasst. Das ist längst vorbei; ich tue, was sie will. Deine Schwester hat sie mir zur Frau ausgesucht, nicht ich habe die gesucht und gefunden. Aber es war ja gut so. Wenn ich Elfriede nicht so früh verloren hätte, wäre es jetzt besser mit mir — vielleicht!“ Er stiess einen Seufzer aus und runzelte die Stirn. „Freilich, besonders glücklich ist Elfriede nicht gewesen, und ich“ — er stockte.
Die Schwägerin hatte eine unwillkürliche Bewegung gemacht: wie, die Schwester war nicht glücklich gewesen — eine so reiche Frau?!
„Mit mir kann niemand glücklich werden“, sagte er tonlos und sah so starr-traurig dabei in eine Ecke, als sähe er sich selber da stehen. „Ich habe ja nicht mal den Willen zum Glück.“