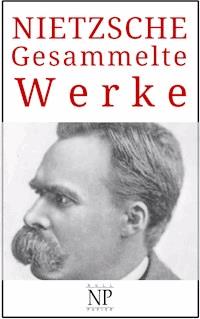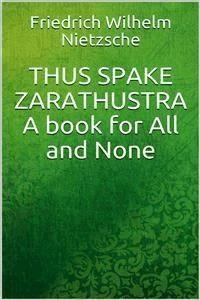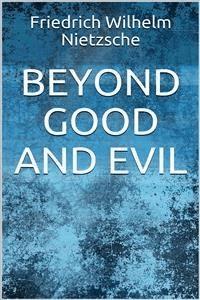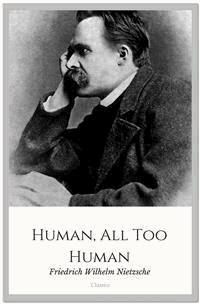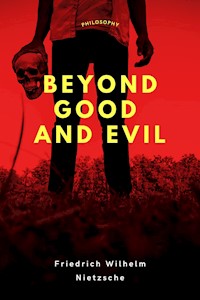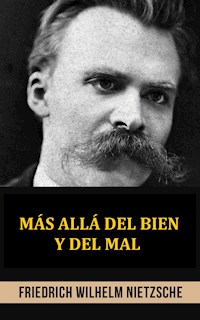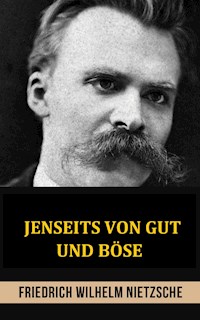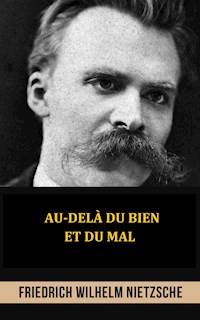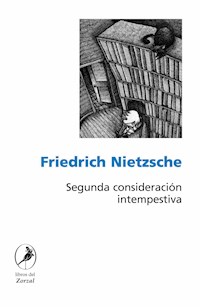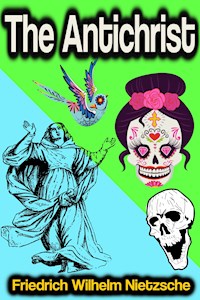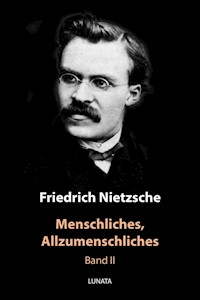
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Menschliches, Allzumenschliches" des Philosophen Friedrich Nietzsche umfasst vermischte Meinungen und Sprüche, die Sammlung "Der Wanderer und sein Schatten", eine Aphorismensammlung, sowie einige Gedichte. Es werden verschiedene Themen behandelt, wie Moral und Erkenntnis, Religion, Künstler und Schriftsteller, Kultur, Frauen und die Stellung der Geschlechter, der Mensch an sich und im Verkehr sowie der Staat. Nietzsche übt hierin heftige Kritik an der Philosophie, vor allem der Metaphysik und hinterfragt etablierte Moralvorstellungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LUNATA
Menschliches, Allzumenschliches
Zweiter Band
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Menschliches, Allzumenschliches
Zweiter Band
© 1880 Friedrich Wilhelm Nietzsche
Überarbeitete Neuauflage
© Lunata Berlin 2020
Inhalt
Einleitung
Vorrede
Erste Abteilung
Zweite Abteilung
Nachbericht
Über den Autor
Einleitung
Die beiden vorliegenden Schriften samt dem letzten Abschnitt aus dem Nachlass sind in den Zwischenzeiten von meines Bruders trübstem Gesundheitszustand geschrieben. Schon im Frühjahr 1878, nach der Vollendung des I. Bandes von Menschliches, Allzumenschliches hatte er den Entschluss gefaßt, seine Professur an der Universität Basel aufzugeben; aber beide Freunde, Erwin Rohde sowohl als Karl von Gersdorff, legten so eifrig direkt und indirekt durch Andere gegen diesen Entschluss Protest ein, daß er sich noch einmal überreden ließ, in seinem Amte zu verbleiben. Auch begann er das Sommersemester 1878, nachdem er sich vier Wochen in Baden-Baden erholt hatte, mit einem recht guten Gesundheitszustand, sodaß er noch einmal frischen Mut faßte, mit Hilfe einer veränderten Lebensweise seine beiden Pflichten, sein Amt und seine eigenste, höhere Aufgabe mit einander durchzuführen. Es hatte sich erwiesen, daß das Klima von Basel besonders ungeeignet für ihn war; so wollte er sich dort nur ein Absteigequartier nehmen, die Woche über seine Kollegien halten und alle Sonnabende in die so leicht zu erreichende Höhenluft der Schweizer Berge entfliehen. Bis Ende November 1878 hat ihm auch diese Lebensweise recht wohlgetan. Während dieser Zeit ist die erste Schrift dieses Bandes »Vermischte Meinungen und Sprüche« zum größten Teil entstanden, welcher er noch eine Nachlese von Aphorismen hinzufügte, die er den Niederschriften aus Sorrent und Rosenlauibad entnahm. Das Manuskript wurde von der trefflichen Freundin Frau Marie Baumgartner in Lörrach für den Druck abgeschrieben und von meinem Bruder geordnet und nachgeprüft. War es nun wiederum die Übermüdung seiner Augen oder hatte er sich sonst überarbeitet – kurzum, gegen Weihnachten wurde er wieder so von Schmerzen der Augen und des Kopfes gequält, daß er von nun an den festen Entschluss faßte, sich von Basel loszulösen. Eine Osterreise mit Aufenthalt in Genf brachte keine Erleichterung; und im Frühjahr 1879, bei Anfang des Sommersemesters, befiel ihn ein solcher Zustand der Schwäche, daß sein Arzt die höchste Besorgnis hatte und Jedermann glaubte, daß es mit seinem Leben bald zu Ende gehen müßte. Ich war damals in Naumburg bei meiner Mutter und wurde schnell zu ihm gerufen. Wir verließen Basel sogleich, um in der Nähe von Bern, Schloß Bremgarten, einen Höhenluftkurort, aufzusuchen. So elend wie damals habe ich meinen teuern Bruder nie gesehen; er entschloß sich auch, sein Abschiedsgesuch bei der Erziehungsbehörde einzureichen:
»Der Zustand meiner Gesundheit, dessentwegen ich mich schon mehrere Male mit einem Gesuch an Sie wenden mußte, läßt mich heute den letzten Schritt tun und die Bitte aussprechen, aus meiner bisherigen Stellung als Lehrer an der Universität ausscheiden zu dürfen. Die inzwischen immer noch gewachsene äußerste Schmerzhaftigkeit meines Kopfes, die immer größer gewordene Einbuße an Zeit, welche ich durch die zwei- bis sechstägigen Anfälle erleide, die von Neuem (durch Herrn Schieß) festgestellte erhebliche Abnahme meines Sehvermögens, welche mir kaum noch zwanzig Minuten erlaubt ohne Schmerzen zu lesen und zu schreiben – dies Alles zusammen drängt mich einzugestehen, daß ich meinen akademischen Pflichten nicht mehr genügen, ja ihnen überhaupt von nun an nicht mehr nachkommen kann, nachdem ich schon in den letzten Jahren mir manche Unregelmäßigkeit in der Erfüllung dieser Pflichten, jedesmal zu meinem großen Leidwesen, nachsehen mußte. Es würde zum Nachtheile unserer Universität und der philologischen Studien an ihr ausschlagen, wenn ich noch länger eine Stellung bekleiden müßte, der ich jetzt nicht mehr gewachsen bin; auch habe ich keine Aussicht mehr in kürzerer Zeit auf eine Besserung in dem chronisch gewordenen Zustande meines Kopfleidens rechnen zu dürfen, da ich nun seit Jahren Versuche über Versuche zu seiner Beseitigung gemacht und mein Leben auf das Strengste danach geregelt habe, unter Entsagungen jeder Art – umsonst, wie ich mir heute eingestehen muß, wo ich den Glauben nicht mehr habe, meinem Leiden noch lange widerstehen zu können. So bleibt mir nur übrig, unter Hinweis auf § 20 des Universitäts-Gesetzes mit tiefem Bedauern den Wunsch meiner Entlassung auszusprechen, zugleich mit dem Dank für die vielen Beweise wohlwollender Nachsicht, welche die hohe Behörde mir vom Tage meiner Berufung an bis heute gegeben hat.« Die Regierung antwortete sehr herzlich bedauernd, doch ist das Schreiben verloren gegangen, sodaß ich nur einem aus Basel mir zugesandten Entwurf das Folgende entnehmen kann:
»Indem wir Ihnen die Urkunde zustellen, womit der Regierungsrat Ihrem Entlassungsgesuche Folge gibt, sprechen wir unsererseits unsern wärmsten Dank aus für die treue Hingebung, womit Sie an unserer Universität und am Pädagogium gewirkt haben, so lange und so weit Ihnen dies nur immer möglich war. Wir geben auch der Hoffnung Raum, daß das Leiden, das zu unserm großen Bedauern Ihrer äußeren Tätigkeit für einstweilen ein Ziel gesetzt hat, in nicht allzu langer Zeit der stillen Wirkung der Zeit und der Ruhe weichen werde. Möge Ihre Geduld nicht auf eine allzu harte Probe gestellt werden!«
Übrigens erholte sich mein Bruder merkwürdig schnell von diesem Zustand äußerster Hinfälligkeit; nach vier Wochen hatte er sich bereits so weit gekräftigt, daß er sich allein nach dem Engadin begeben konnte, während ich nach Basel ging, um den ganzen Haushalt aufzulösen. Dabei muß ich mich noch jetzt verwundern, welches außerordentliche Vertrauen mir mein Bruder in Hinsicht auf seine Manuskripte damals bewiesen hat. Während des einen Tages, den wir noch zusammen in Basel verbrachten, ehe wir nach dem Luftkurort reisten, gab er mir noch Anweisungen, wie ich mit seiner Bibliothek und seinen Büchern verfahren sollte. Einen Teil seiner Bücher hatte er bereits verschenkt und verkauft, aber die Hauptmasse seiner Bibliothek war noch vorhanden und sollte in Kisten eingepackt bei Freunden eingestellt werden, mit Ausnahme von zwei gefüllten Koffern, die er auf die Reise mitnehmen wollte. Ganz schrecklich war mir, was er über seine Manuskripte bestimmte! Er hatte die Gewohnheit die Vorarbeiten zu seinen Schriften in feste Hefte zu schreiben; von diesen hatte er nun zwei Haufen gemacht, der eine sollte eingepackt, der andere verbrannt werden. »Was soll ich noch mit diesen Heften, ich bin nächstens entweder blind oder tot«, meinte er (während der schlimmen Leidenszeit war die Sehkraft sehr herabgesunken). Diese Bücher mit seiner lieben Handschrift verbrennen zu sollen, war mir ein unfaßbarer Gedanke. »Fritz«, sagte ich zögernd, »wie kann man diese festen Hefte verbrennen?« »Mit den Deckeln geht es natürlich nicht,« sagte er, nahm ein Federmesser und schnitt innen die Bänder durch, die das Heft mit dem Deckel verbanden. Zum Glück hatte er eines der Hefte ergriffen, in welchem Etwas stand von dem er zuvor gesagt hatte, daß es aufbewahrt werden sollte. »Siehst Du, Fritz, da wäre nun gleich etwas Falsches verbrannt worden,« meinte ich, »laß mich das Ganze erst noch einmal aussuchen«. Schließlich überließ er Alles, wie er sagte: »meiner Liebe und Klugheit«. Natürlich habe ich keine Zeile verbrannt, sondern alles von ihm zur Vernichtung Bestimmte sorgfältig eingepackt und nach Naumburg geschickt. Um den Vernichtungseifer meines Bruders zu verstehen, muß man sich vorstellen, wie grenzenlos unangenehm es ihm war, wenn Andere außer mir Einsicht in seine Manuskripte nahmen; selbst Prof. Overbeck, der sich damals zur Durchsicht seiner Papiere anbot, und welchem er sonst großes Vertrauen zeigte, wies er ziemlich schroff zurück. Es wäre ihm lieber gewesen Alles zu verbrennen, als diese Niederschriften in Anderer Hände zu wissen.
Von Schloß Bremgarten ging er zunächst nach Wiesen und Ende Juni nach St. Moritz im Engadin. Zum ersten Mal leuchteten der Glanz des Engadiner Himmels, die edeln heroischen Linien seiner Landschaft, die ganze Farbenpracht seiner Seen und seiner blütenübersäten Wiesen und Abhänge in seine Leidenszeit hinein. Wie tief er davon entzückt war, wie er sich dieser Umgebung innigst verwandt fühlte, sagen zwei Aphorismen N. 295 u. 338 aus der zweiten Schrift dieses Bandes, dem »Wanderer und sein Schatten«, die er damals verfaßte und welche die ganze Höhenluft seiner Stimmungen aufgenommen hat. Er schrieb damals: »Vorgestern gegen Abend war ich ganz in Claude Lorrainsche Entzückungen untergetaucht und brach endlich in langes heftiges Weinen aus. Daß ich dies noch erleben durfte! Ich hatte nicht gewußt, daß die Erde dies zeige und meinte, die guten Maler hätten es erfunden. Das Heroisch-Idyllische ist jetzt die Entdeckung meiner Seele: und alles Bukolische der Alten ist mit einem Schlage jetzt vor mir entschleiert und offenbar geworden – bis jetzt begriff ich Nichts davon.« Mein Bruder pflegte später zu sagen: »Das Engadin hat mich dem Leben wiedergegeben«. Jedenfalls fand ich ihn im September, als ich in Chur mit ihm zusammentraf, zu meiner freudigsten Verwunderung außerordentlich erholt. Er war frisch und elastisch, hatte seine gesunde Gesichtsfarbe und stramme stattliche Haltung wiedergewonnen, sodaß ich meinem Erstaunen und Glück gar nicht genug Worte verleihen konnte. Wir wurden von der Zuversicht erfüllt, daß er wieder ganz gesund werden könnte; es waren schöne Tage, die wir in diesem Glauben verlebten!
Zunächst kam freilich im Winter 1879/80, den er von Ende Oktober bis Anfang Februar in Naumburg verlebte, der schlimmste Rückfall seines Leidens, und als »der Wanderer und sein Schatten« am Schluß des Jahres 1879 veröffentlicht wurde, glaubte mein Bruder in der That, daß er nun bald vom Leben scheiden müßte; er nahm fast von allen Freunden in seinen Briefen Abschied. Im Februar 1880 aber raffte er sich mit ungeheurer Energie empor, verließ den düsteren niederdrückenden Norden und eilte dem Süden, der Genesung und den höchsten Werken seiner Schaffenskraft entgegen. Er begann einen hartnäckigen Kampf mit der Krankheit, die ihn zu vernichten drohte – und mit herrlichem Erfolg! Dadurch, daß er seine Kräfte nicht mehr zu zersplittern brauchte und seine Augen nicht mehr bei den Vorbereitungen zu den Kollegien abzumühen hatte, war es ihm möglich seine alte Gesundheit wiederzugewinnen und trotzdem die ungeheuern Vorarbeiten zu seinen Hauptwerken zu bewältigen. Oh wie dankbar müssen wir sein für die folgenden neun Jahre intensiven Schaffens, denn während dieser Zeit war es ihm möglich sein höchstes Ideal aufzustellen und uns zu zeigen, was er wirklich war, nämlich einer der ganz großen Philosophen und Gesetzgeber, die in ihrer Wirkung unermeßlich sind, da sie der Menschheit ein neues Ziel geben. –
Im Jahr 1886 fügte mein Bruder der neuen Ausgabe von den »Vermischten Meinungen und Sprüchen« und dem »Wanderer und sein Schatten«, die vorzügliche Vorrede hinzu, die uns von seiner inneren Entwicklung in jenen Jahren und darüber hinaus ein so deutliches Bild gibt. Auch hier steht gewissermaßen im Mittelpunkt sein Erlebnis mit Richard Wagner, und man könnte mit Leo Berg die Behauptung aufstellen, daß mein Bruder niemals über dieses Erlebnis hinweggekommen ist. Vielleicht könnte ich gerade hier in diesem Bande, wo auch die hinzugefügten Aufzeichnungen des Nachlasses allein dieses Verhältnis behandeln, eine Andeutung geben, warum es in dem Leben meines Bruders von solcher Bedeutung gewesen ist. Von frühester Jugend an war in meinem Bruder jene höchste Sehnsucht vorhanden nach einem vollkommenen Wesen, das er verehren konnte, und wenn er in »Also sprach Zarathustra« über die höchsten Exemplare der Menschheit klagt: »Wahrlich, auch den Größten fand ich – allzumenschlich«, so drückt er darin die tiefe Enttäuschung aus, die er den Verehrtesten gegenüber empfunden haben mag, besonders aber in Hinsicht auf Richard Wagner. Das soll aber kein Vorwurf gegen Richard Wagner sein, denn der Fehler lag auf der Seite meines Bruders, der ihn in einem zu verklärten Lichte sah. Man höre z. B. die ergreifenden Worte, die er im August 1869 an Freiherrn von Gersdorff über Wagner schreibt. »In ihm herrscht eine so unbedingte Idealität, eine solche tiefe und rührende Menschlichkeit, ein solcher erhabner Lebensernst, daß ich mich in seiner Nähe wie in der Nähe des Göttlichen fühle.« Einem solchen Bilde konnte die Wirklichkeit auf die Dauer nicht entsprechen.
Aber gerade diese Enttäuschungen haben ihn veranlaßt, auf das Tiefste über das Problem der höheren Typen der Menschheit nachzudenken. Daran hat er sein ganzes Leben gearbeitet und selbst in den Jahren der Entstehung von »Menschliches, Allzumenschliches«, die man wohl eine Zeit der Skepsis nennen könnte, hat er, wie auf Seite 57 des vorliegenden Bandes steht, versucht an seinem Ideal, dem »schönen Menschenbilde« fortzudichten, um jene Fälle zu suchen und zu finden, »wo mitten in unserer modernen Welt und Wirklichkeit, wo ohne jede künstliche Abwehr und Entziehung von derselben, die schöne große Seele noch möglich ist, dort wo sie sich auch jetzt noch in harmonische, ebenmäßige Zustände einzuverleiben vermag, durch sie Sichtbarkeit, Dauer und Vorbildlichkeit bekommt und also, durch Erregung von Nachahmung und Neid, die Zukunft schaffen hilft«.
Weimar, April 1906
Elisabeth Förster-Nietzsche
Vorrede
1
Man soll nur reden, wo man nicht schweigen darf; und nur von dem reden, was man überwunden hat, – alles andere ist Geschwätz, »Literatur«, Mangel an Zucht. Meine Schriften reden nur von meinen Überwindungen: »ich« bin darin, mit allem, was mir feind ward, ego ipsissimus, ja sogar, wenn ein stolzerer Ausdruck erlaubt wird, ego ipsissimum. Man errät: ich habe schon viel – unter mir... Aber es bedurfte immer erst der Zeit, der Genesung, der Ferne, der Distanz, bis die Lust bei mir sich regte, etwas Erlebtes und Überlebtes, irgendein eigenes Faktum oder Fatum nachträglich für die Erkenntnis abzuhäuten, auszubeuten, bloßzulegen, »darzustellen« (oder wie man's heißen will). Insofern sind alle meine Schriften, mit einer einzigen, allerdings wesentlichen Ausnahme, zurück zu datieren – sie reden immer von einem »Hinter-mir« –: einige sogar, wie die drei ersten Unzeitgemäßen Betrachtungen, noch zurück hinter die Entstehungs- und Erlebniszeit eines vorher herausgegebenen Buches (der »Geburt der Tragödie« im gegebenen Falle: wie es einem feineren Beobachter und Vergleicher nicht verborgen bleiben darf). Jener zornige Ausbruch gegen die Deutschtümelei, Behäbigkeit und Sprach-Verlumpung des alt gewordenen David Strauß, der Inhalt der ersten Unzeitgemäßen, machte Stimmungen Luft, mit denen ich lange vorher, als Student, inmitten deutscher Bildung und Bildungsphilisterei gesessen hatte (ich mache Anspruch auf die Vaterschaft des jetzt viel gebrauchten und mißbrauchten Wortes »Bildungsphilister« –); und was ich gegen die »historische Krankheit« gesagt habe, das sagte ich als einer, der von ihr langsam, mühsam genesen lernte und ganz und gar nicht willens war, fürderhin auf »Historie« zu verzichten, weil er einstmals an ihr gelitten hatte. Als ich sodann, in der dritten Unzeitgemäßen Betrachtung, meine Ehrfurcht vor meinem ersten und einzigen Erzieher, vor dem großen Arthur Schopenhauer zum Ausdruck brachte – ich würde sie jetzt noch viel stärker, auch persönlicher ausdrücken –, war ich für meine eigne Person schon mitten in der moralistischen Skepsis und Auflösung drin, das heißt ebenso sehr in der Kritik als der Vertiefung alles bisherigen Pessimismus –, und glaubte bereits »an gar nichts mehr«, wie das Volk sagt, auch an Schopenhauer nicht: eben in jener Zeit entstand ein geheimgehaltenes Schriftstück »über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne«. Selbst meine Sieges- und Festrede zu Ehren Richard Wagners, bei Gelegenheit seiner Bayreuther Siegesfeier 1876 – Bayreuth bedeutet den größten Sieg, den je ein Künstler errungen hat –, ein Werk, welches den stärksten Anschein der »Aktualität« an sich trägt, war im Hintergrunde eine Huldigung und Dankbarkeit gegen ein Stück Vergangenheit von mir, gegen die schönste, auch gefährlichste Meeresstille meiner Fahrt... und tatsächlich eine Loslösung, ein Abschiednehmen. (Täuschte Richard Wagner sich vielleicht selbst darüber? Ich glaube es nicht. Solange man noch liebt, malt man gewiß keine solchen Bilder; man »betrachtet« noch nicht, man stellt sich nicht dergestalt in die Ferne, wie es der Betrachtende tun muß. »Zum Betrachten gehört schon eine geheimnisvolle Gegnerschaft, die des Entgegenschauens« – heißt es auf Seite 46 der genannten Schrift selbst, mit einer verräterischen und schwermütigen Wendung, welche vielleicht nur für wenige Ohren war.) Die Gelassenheit, um über lange Zwischenjahre innerlichsten Alleinseins und Entbehrens reden zu können, kam mir erst mit dem Buche »Menschliches, Allzumenschliches«, dem auch dies zweite Für- und Vorwort gewidmet sein soll. Auf ihm, als einem Buche »für freie Geister«, liegt etwas von der beinahe heiteren und neugierigen Kälte des Psychologen, welche eine Menge schmerzlicher Dinge, die er unter sich hat, hinter sich hat, nachträglich für sich noch feststellt und gleichsam mit irgendeiner Nadelspitze feststicht: – was Wunders, wenn, bei einer so spitzen und kitzlichen Arbeit, gelegentlich auch etwas Blut fließt, wenn der Psychologe Blut dabei an den Fingern und nicht immer nur – an den Fingern hat?...
2
Die Vermischten Meinungen und Sprüche sind, ebenso wie der Wanderer und sein Schatten, zuerst einzeln als Fortsetzungen und Anhänge jenes ebengenannten menschlich-allzumenschlichen »Buchs für freie Geister« herausgegeben worden: zugleich als Fortsetzung und Verdoppelung einer geistigen Kur, nämlich der antiromantischen Selbstbehandlung, wie sie mir mein gesund gebliebener Instinkt wider eine zeitweilige Erkrankung an der gefährlichsten Form der Romantik selbst erfunden, selbst verordnet hatte. Möge man sich nunmehr, nach sechs Jahren der Genesung, die gleichen Schriften vereinigt gefallen lassen, als zweiten Band von Menschliches, Allzumenschliches: vielleicht lehren sie, zusammen betrachtet, ihre Lehre stärker und deutlicher, – eine Gesundheitslehre, welche den geistigeren Naturen des eben heraufkommenden Geschlechts zur disciplina voluntatis empfohlen sein mag. Aus ihnen redet ein Pessimist, der oft genug aus der Haut gefahren, aber immer wieder in sie hineingefahren ist, ein Pessimist also mit dem guten Willen zum Pessimismus, – somit jedenfalls kein Romantiker mehr: wie? sollte ein Geist, der sich auf diese Schlangenklugheit versteht, die Haut zu wechseln, nicht den heutigen Pessimisten eine Lektion geben dürfen, welche allesamt noch in der Gefahr der Romantik sind? Und ihnen zum mindesten zeigen, wie man das – macht?...
3
– Es war in der Tat damals die höchste Zeit, Abschied zu nehmen: alsbald schon bekam ich den Beweis dafür. Richard Wagner, scheinbar der Siegreichste, in Wahrheit ein morsch gewordener, verzweifelnder Romantiker, sank plötzlich, hilflos und zerbrochen, vor dem christlichen Kreuze nieder... Hat denn kein Deutscher für dieses schauerliche Schauspiel damals Augen im Kopfe, Mitgefühl in seinem Gewissen gehabt? War ich der einzige, der an ihm – litt? Genug, mir selbst gab dies unerwartete Ereignis wie ein Blitz Klarheit über den Ort, den ich verlassen hatte, – und auch jenen nachträglichen Schrecken, wie ihn jeder empfindet, der unbewußt durch eine ungeheure Gefahr gelaufen ist. Als ich allein weiterging, zitterte ich; nicht lange darauf, und ich war krank, mehr als krank, nämlich müde, aus der unaufhaltsamen Enttäuschung über alles, was uns modernen Menschen zur Begeisterung übrigblieb, über die allerorts vergeudete Kraft, Arbeit, Hoffnung, Jugend, Liebe; müde aus Ekel vor dem Femininischen und Schwärmerisch-Zuchtlosen dieser Romantik, vor der ganzen idealistischen Lügnerei und Gewissens-Verweichlichung, die hier wieder einmal den Sieg über einen der Tapfersten davongetragen hatte; müde endlich, und nicht am wenigsten, aus dem Gram eines unerbittlichen Argwohns, – daß ich, nach dieser Enttäuschung, verurteilt sei, tiefer zu mißtrauen, tiefer zu verachten, tiefer allein zu sein als je vorher. Meine Aufgabe – wohin war sie? Wie? schien es jetzt nicht, als ob sich meine Aufgabe von mir zurückziehe, als ob ich nun für lange kein Recht mehr auf sie habe? Was tun, um diese größte Entbehrung auszuhalten? – Ich begann damit, daß ich mir gründlich und grundsätzlich alle romantische Musik verbot, diese zweideutige, großtuerische, schwüle Kunst, welche den Geist um seine Strenge und Lustigkeit bringt und jede Art unklarer Sehnsucht, schwammiger Begehrlichkeit wuchern macht. »Cave musicam« ist auch heute noch mein Rat an alle, die Manns genug sind, um in Dingen des Geistes auf Reinlichkeit zu halten; solche Musik entnervt, er weicht, verweiblicht, ihr »Ewig-Weibliches« zieht uns – hinab!... Gegen die romantische Musik wendete sich damals mein erster Argwohn, meine nächste Vorsicht; und wenn ich überhaupt noch etwas von der Musik hoffte, so war es in der Erwartung, es möchte ein Musiker kommen, kühn, fein, boshaft, südlich, übergesund genug, um an jener Musik auf eine unsterbliche Weise Rache zu nehmen. –
4
Einsam nunmehr und schlimm mißtrauisch gegen mich, nahm ich, nicht ohne Ingrimm, dergestalt Partei gegen mich und für alles, was gerade mir wehe tat und hart fiel: – so fand ich den Weg zu jenem tapferen Pessimismus wieder, der der Gegensatz aller romantischen Verlogenheit ist und auch, wie mir heute scheinen will, den Weg zu »mir« selbst, zu meiner Aufgabe. Jenes verborgene und herrische Etwas, für das wir lange keinen Namen haben, bis es sich endlich als unsre Aufgabe erweist, – dieser Tyrann in uns nimmt eine schreckliche Wiedervergeltung für jeden Versuch, den wir machen, ihm auszuweichen oder zu entschlüpfen, für jede vorzeitige Bescheidung, für jede Gleichsetzung mit solchen, zu denen wir nicht gehören, für jede noch so achtbare Tätigkeit, falls sie uns von unsrer Hauptsache ablenkt, ja für jede Tugend selbst, welche uns gegen die Härte der eigensten Verantwortlichkeit schützen möchte. Krankheit ist jedesmal die Antwort, wenn wir an unsrem Rechte auf unsre Aufgabe zweifeln wollen, – wenn wir anfangen, es uns irgendworin leichter zu machen. Sonderbar und furchtbar zugleich! Unsre Erleichterungen sind es, die wir am härtesten büßen müssen! Und wollen wir hinterdrein zur Gesundheit zurück, so bleibt uns keine Wahl: wir müssen uns schwerer belasten, als wir je vorher belastet waren...
5
– Damals lernte ich erst jenes einsiedlerische Reden, auf welches sich nur die Schweigendsten und Leidendsten verstehen: ich redete, ohne Zeugen oder vielmehr gleichgültig gegen Zeugen, um nicht am Schweigen zu leiden, ich sprach von lauter Dingen, die mich nichts angingen, aber so, als ob sie mich etwas angingen. Damals lernte ich die Kunst, mich heiter, objektiv, neugierig, vor allem gesund und boshaft zu geben, – und bei einem Kranken ist dies, wie mir scheinen will, sein »guter Geschmack«? Einem feineren Auge und Mitgefühl wird es trotzdem nicht entgehen, was vielleicht den Reiz dieser Schriften aus macht, – daß hier ein Leidender und Entbehrender redet, wie als ob er nicht ein Leidender und Entbehrender sei. Hier soll das Gleichgewicht, die Gelassenheit, sogar die Dankbarkeit gegen das Leben aufrecht erhalten werden, hier waltet ein strenger, stolzer, beständig wacher, beständig reizbarer Wille, der sich die Aufgabe gestellt hat, das Leben wider den Schmerz zu verteidigen und alle Schlüsse abzuknicken, welche aus Schmerz, Enttäuschung, Überdruss, Vereinsamung und andrem Moorgrunde gleich giftigen Schwämmen aufzuwachsen pflegen. Dies gibt vielleicht gerade unsern Pessimisten Fingerzeige zur eignen Prüfung? – denn damals war es, wo ich mir den Satz abgewann: »ein Leidender hat auf Pessimismus noch kein Recht!«, damals führte ich mit mir einen langwierig-geduldigen Feldzug gegen den unwissenschaftlichen Grundhang jedes romantischen Pessimismus, einzelne persönliche Erfahrungen zu allgemeinen Urteilen, ja Welt-Verurteilungen aufzubauschen, auszudeuten... kurz, damals drehte ich meinen Blick herum. Optimismus, zum Zweck der Wiederherstellung, um irgendwann einmal wieder Pessimist sein zu dürfen – versteht ihr das? Gleich wie ein Arzt seinen Kranken in eine völlig fremde Umgebung stellt, damit er seinem ganzen »Bisher«, seinen Sorgen, Freunden, Briefen, Pflichten, Dummheiten und Gedächtnismartern entrückt wird und Hände und Sinne nach neuer Nahrung, neuer Sonne, neuer Zukunft ausstrecken lernt, so zwang ich mich, als Arzt und Kranker in einer Person, zu einem umgekehrten, unerprobten Klima der Seele, und namentlich zu einer abziehenden Wanderung in die Fremde, in das Fremde, zu einer Neugierde nach aller Art von Fremdem... Ein langes Herumziehen, Suchen, Wechseln folgte hieraus, ein Widerwille gegen alles Festbleiben, gegen jedes plumpe Bejahen und Verneinen; ebenfalls eine Diätetik und Zucht, welche es dem Geiste so leicht als möglich machen wollte, weit zu laufen, hoch zu fliegen, vor allem immer wieder fort zu fliegen. Tatsächlich ein minimum von Leben, eine Loskettung von allen gröberen Begehrlichkeiten, eine Unabhängigkeit inmitten aller Art äußerer Ungunst, samt dem Stolze, leben zu können unter dieser Ungunst; etwas Zynismus vielleicht, etwas »Tonne«, aber ebenso gewiß viel Grillen-Glück, Grillen-Munterkeit, viel Stille, Licht, feinere Torheit, verborgenes Schwärmen – das alles ergab zuletzt eine große geistige Erstarkung, eine wachsende Lust und Fülle der Gesundheit. Das Leben selbst belohnt uns für unsern zähen Willen zum Leben, für einen solchen langen Krieg wie ich ihn damals mit mir gegen den Pessimismus der Lebensmüdigkeit führte, schon für jeden aufmerksamen Blick unserer Dankbarkeit, der sich die kleinsten, zartesten, flüchtigsten Geschenke des Lebens nicht entgehen läßt. Wir bekommen endlich dafür seine großen Geschenke, vielleicht auch sein größtes, das es zu geben vermag, – wir bekommen unsre Aufgabe wieder zurück. – –
6
– Sollte mein Erlebnis – die Geschichte einer Krankheit und Genesung, denn es lief auf eine Genesung hinaus – nur mein persönliches Erlebnis gewesen sein? Und gerade nur mein »Menschlich-Allzumenschliches«? Ich möchte heute das Umgekehrte glauben; das Zutrauen kommt mir wieder und wieder dafür, daß meine Wanderbücher doch nicht nur für mich aufgezeichnet waren, wie es bisweilen den Anschein hatte –. Darf ich nunmehr, nach sechs Jahren wachsender Zuversicht, sie von neuem zu einem Versuche auf die Reise schicken? Darf ich sie denen sonderlich ans Herz und Ohr legen, welche mit irgendeiner »Vergangenheit« behaftet sind und Geist genug übrig haben, um auch noch am Geiste ihrer Vergangenheit zu leiden? Vor allem aber euch, die ihr es am schwersten habt, ihr Seltenen, Gefährdetsten, Geistigsten, Mutigsten, die ihr das Gewissen der modernen Seele sein müßt und als solche ihr Wissen haben müßt, in denen, was es nur heute von Krankheit, Gift und Gefahr geben kann, zusammenkommt, – deren Los es will, daß ihr kränker sein müßt als irgendein einzelner, weil ihr nicht »nur einzelne« seid..., deren Trost es ist, den Weg zu einer neuen Gesundheit zu wissen, ach! und zu gehen, einer Gesundheit von morgen und übermorgen, ihr Vorherbestimmten, ihr Siegreichen, ihr Zeit-Überwinder, ihr Gesündesten, ihr Stärksten, ihr guten Europäer! – –
7
– Daß ich schließlich meinen Gegensatz gegen den romantischen Pessimismus, das heißt zum Pessimismus der Entbehrenden, Mißglückten, Überwundenen, noch in eine Formel bringe: es gibt einen Willen zum Tragischen und zum Pessimismus, der das Zeichen ebenso sehr der Strenge als der Stärke des Intellekts (Geschmacks, Gefühls, Gewissens) ist. Man fürchtet, mit diesem Willen in der Brust, nicht das Furchtbare und Fragwürdige, das allem Dasein eignet; man sucht es selbst auf. Hinter einem solchen Willen steht der Mut, der Stolz, das Verlangen nach einem großen Feinde. – Dies war meine pessimistische Perspektive von Anbeginn, – eine neue Perspektive, wie mich dünkt? eine solche, die auch heute noch neu und fremd ist? Bis zu diesem Augenblicke halte ich an ihr fest, und, wenn man mir glauben will, ebenso wohl für mich als, gelegentlich wenigstens, gegen mich... Wollt ihr dies erst bewiesen? Aber was sonst wäre mit dieser langen Vorrede – bewiesen?
Sils-Maria, Oberengadin,
im September 1886
Erste Abteilung
Vermischte Meinungen und Sprüche
1
An die Enttäuschten der Philosophie. – Wenn ihr bisher an den höchsten Wert des Lebens geglaubt habt und euch nun enttäuscht seht, müßt ihr es denn jetzt gleich zum niedrigsten Preise losschlagen?
2
Verwöhnt. – Man kann sich auch in Bezug auf die Helligkeit der Begriffe verwöhnen: wie ekelhaft wird da der Verkehr mit den Halbklaren, Dunstigen, Strebenden, Ahnenden! Wie lächerlich und doch nicht erheiternd wirkt ihr ewiges Flattern und Haschen und doch nicht Fliegen- und Fangen-können!
3
Die Freier der Wirklichkeit. – Wer endlich merkt, wie sehr und wie lange er genarrt worden ist, umarmt aus Trotz selbst die häßlichste Wirklichkeit: so daß dieser, den Verlauf der Welt im Ganzen gesehen, zu allen Zeiten die allerbesten Freier zugefallen sind, – denn die Besten sind immer am besten und längsten getäuscht worden.
4
Fortschritt der Freigeisterei. – Man kann den Unterschied der früheren und der gegenwärtigen Freigeisterei nicht besser verdeutlichen, als wenn man jenes Satzes gedenkt, den zu erkennen und auszusprechen die ganze Unerschrockenheit des vorigen Jahrhunderts nötig war und der dennoch, von der jetzigen Einsicht aus bemessen, zu einer unfreiwilligen Naivität herabsinkt, – ich meine den Satz Voltaire's: » croyez-moi, mon ami, l'erreur aussi a son mérite.«
5
Eine Erbsünde der Philosophen. – Die Philosophen haben zu allen Zeiten die Sätze der Menschenprüfer (Moralisten) sich angeeignet und verdorben, dadurch, daß sie dieselben unbedingt nahmen und Das als notwendig beweisen wollten, was von Jenen nur als ungefährer Fingerzeig oder gar als land- oder stadtsässige Wahrheit eines Jahrzehnts gemeint war, – während sie gerade dadurch sich über Jene zu erheben meinten. So wird man als Grundlage der berühmten Lehren Schopenhauer's vom Primat des Willens vor dem Intellekt, von der Unveränderlichkeit des Charakters, von der Negativität der Lust – welche Alle, so wie er sie versteht, Irrtümer sind – populäre Weisheiten finden, welche Moralisten aufgestellt haben. Schon das Wort »Wille«, welches Schopenhauer zur gemeinsamen Bezeichnung vieler menschlichen Zustände umbildete und in eine Lücke der Sprache hineinstellte, zum großen Vorteil für ihn selber, soweit er Moralist war – da es ihm nun freistand, vom »Willen« zu reden, wie Pascal von ihm geredet hatte –, schon der »Wille« Schopenhauer's ist unter den Händen seines Urhebers, durch die Philosophen-Wut der Verallgemeinerung, zum Unheil für die Wissenschaft ausgeschlagen: denn dieser Wille ist zu einer poetischen Metapher gemacht, wenn behauptet wird, alle Dinge in der Natur hätten Willen; endlich ist er, zum Zwecke einer Verwendung bei allerhand mystischem Unfug, zu einer falschen Verdinglichung gemißbraucht worden – und alle Modephilosophen sagen es nach und scheinen es ganz genau zu wissen, daß alle Dinge Einen Willen hätten, ja dieser Eine Wille wären (was, nach der Abschilderung, die man nun diesem All-Eins-Willen macht, so viel bedeutet, als ob man durchaus den dummen Teufel zum Gotte haben wolle).
6
Wider die Phantasten. – Der Phantast verleugnet die Wahrheit vor sich, der Lügner nur vor Andern.
7
Licht-Feindschaft. – Macht man Jemandem klar, daß er, streng verstanden, nie von Wahrheit, sondern immer nur von Wahrscheinlichkeit und deren Graden reden könne, so entdeckt man gewöhnlich an der unverhohlenen Freude des also Belehrten, wie viel lieber den Menschen die Unsicherheit des geistigen Horizontes ist und wie sie die Wahrheit im Grunde ihrer Seele wegen ihrer Bestimmtheit hassen. – Liegt es daran, daß sie Alle insgeheim selber Furcht davor haben, daß man einmal das Licht der Wahrheit zu hell auf sie fallen lasse? Sie wollen Etwas bedeuten, folglich darf man nicht genau wissen, was sie sind? Oder ist es nur die Scheu vor dem allzuhellen Licht, an welches ihre dämmernden, leichtzublendenden Fledermaus-Seelen nicht gewöhnt sind, so daß sie es hassen müssen?
8
Christen-Skepsis. – Pilatus, mit seiner Frage: was ist Wahrheit!, wird jetzt gern als Advokat Christi eingeführt, um alles Erkannte und Erkennbare als Schein zu verdächtigen und auf dem schauerlichen Hintergrunde des Nichts-wissen-könnens das Kreuz aufzurichten.
9
»Naturgesetz« ein Wort des Aberglaubens. – Wenn ihr so entzückt von der Gesetzmäßigkeit in der Natur redet, so müßt ihr doch entweder annehmen, daß aus freiem, sich selbst unterwerfendem Gehorsam alle natürlichen Dinge ihrem Gesetze folgen – in welchem Falle ihr also die Moralität der Natur bewundert –; oder euch entzückt die Vorstellung eines schaffenden Mechanikers, der die kunstvollste Uhr, mit lebenden Wesen als Zierrat daran, gemacht hat. – Die Notwendigkeit in der Natur wird durch den Ausdruck »Gesetzmäßigkeit« menschlicher und ein letzter Zufluchtswinkel der mythologischen Träumerei.
10
Der Historie verfallen. – Die Schleier-Philosophen und Welt-Verdunkler, also alle Metaphysiker feineren und gröberen Korns ergreift Augen-, Ohren- und Zahnschmerz, wenn sie zu argwöhnen beginnen, daß es mit dem Satz: die ganze Philosophie sei von jetzt ab der Historie verfallen, seine Richtigkeit habe. Es ist ihnen, ihrer Schmerzen wegen, zu verzeihen, daß sie nach Jenem, der so spricht, mit Steinen und Unflat werfen: die Lehre selbst kann aber dadurch eine Zeitlang schmutzig und unansehnlich werden und am Wirkung verlieren.
11
Der Pessimist des Intellekts. – Der wahrhaft Freie im Geiste wird auch über den Geist selber frei denken und sich einiges Furchtbare in Hinsicht auf Quelle und Richtung desselben nicht verhehlen. Deshalb werden ihn die Andern vielleicht als den ärgsten Gegner der Freigeisterei bezeichnen und mit dem Schimpf- und Schreckwort »Pessimist des Intellekts« belegen: gewohnt, wie sie sind, Jemanden nicht nach seiner hervorragenden Stärke und Tugend zu nennen, sondern nach Dem, was ihnen am fremdesten an ihm ist.
12
Schnappsack der Metaphysiker. – Allen Denen, welche so großtuerisch von der Wissenschaftlichkeit ihrer Metaphysik reden, soll man gar nicht antworten; es genügt sie an dem Bündel zu zupfen, welches sie, einigermaßen scheu, hinter ihrem Rücken verborgen halten; gelingt es dasselbe zu lüpfen, so kommen die Resultate jener Wissenschaftlichkeit, zu ihrem Erröten, an's Licht: ein kleiner lieber Herrgott, eine artige Unsterblichkeit, vielleicht etwas Spiritismus und jedenfalls ein ganzer verschlungener Haufen von Armen-Sünder-Elend und Pharisäer-Hochmut.
13
Gelegentliche Schädlichkeit der Erkenntnis. – Die Nützlichkeit, welche die unbedingte Erforschung des Wahren mit sich bringt, wird fortwährend so hundertfach neu bewiesen, daß man die feinere und seltnere Schädlichkeit, an der Einzelne ihrethalben zu leiden haben, unbedingt mit in den Kauf nehmen muß. Man kann es nicht verhindern, daß der Chemiker bei seinen Versuchen sich gelegentlich vergiftet und verbrennt. – Was vom Chemiker gilt, gilt von unsrer gesamten Kultur: woraus sich, nebenbei gesagt, deutlich ergibt, wie sehr dieselbe für Heilsalben bei Verbrennungen und für das stete Vorhandensein von Gegengiften zu sorgen hat.
14
Philister-Notdurft. – Der Philister meint einen Purpurfetzen oder Turban von Metaphysik am Nötigsten zu haben und will ihn durchaus nicht schlüpfen lassen: und doch würde man ihn ohne diesen Putz weniger lächerlich finden.
15
Die Schwärmer. – Mit Allem, was Schwärmer zu Gunsten ihres Evangeliums oder ihres Meisters sagen, verteidigen sie sich selbst, so sehr sie sich auch als Richter (und nicht als Angeklagte) gebärden, weil sie unwillkürlich und fast in jedem Augenblicke daran erinnert werden, daß sie Ausnahmen sind, die sich legitimieren müssen.
16
Das Gute verführt zum Leben. – Alle guten Dinge sind starte Reizmittel zum Leben, selbst jedes gute Buch, das gegen das Leben geschrieben ist.
17
Glück des Historikers. – »Wenn wir die spitzfindigen Metaphysiker und Hinterweltler reden hören, fühlen wir Anderen freilich, daß wir die ›Armen am Geist‹ sind, aber auch daß unser das Himmelreich des Wechsels, mit Frühling und Herbst, Winter und Sommer, und Jener die Hinterwelt ist – mit ihren grauen frostigen unendlichen Nebeln und Schatten.« – So sprach Einer zu sich bei einem Gange in der Morgensonne: Einer, dem bei der Historie nicht nur der Geist, sondern auch das Herz sich immer neu verwandelt und der, im Gegensatz zu den Metaphysikern, glücklich darüber ist, nicht »Eine unsterbliche Seele«, sondern viele sterbliche Seelen in sich zu beherbergen.
18
Drei Arten von Denkern. – Es gibt strömende, fließende, tröpfelnde Mineralquellen; und dem entsprechend drei Arten von Denkern. Der Laie schätzt sie nach der Masse des Wassers, der Kenner nach dem Gehalt des Wassers ab, also nach Dem, was eben nicht Wasser in ihnen ist.
19
Das Bild des Lebens. – Die Aufgabe, das Bild des Lebens zu malen, so oft sie auch von Dichtern und Philosophen gestellt wurde, ist trotzdem unsinnig: auch unter den Händen der größten Maler-Denker sind immer nur Bilder und Bildchen aus einem Leben, nämlich aus ihrem Leben, entstanden – und nichts Anderes ist auch nur möglich. Im Werdenden kann sich ein Werdendes nicht als fest und dauernd, nicht als ein »Das« spiegeln.
20
Wahrheit will keine Götter neben sich. – Der Glaube an die Wahrheit beginnt mit dem Zweifel an allen bis dahin geglaubten Wahrheiten.
21
Worüber Schweigen verlangt wird. – Wenn man von der Freigeisterei wie von einer höchst gefährlichen Gletscher- und Eismeer-Wanderung redet, so sind Die, welche den Weg nicht gehen wollen, beleidigt, als ob man ihnen Zaghaftigkeit und schwache Knie zum Vorwurf gemacht hätte. Das Schwere, dem wir uns nicht gewachsen fühlen, soll nicht einmal vor uns genannt werden.
22
Historia in nuce. – Die ernsthafteste Parodie, die ich je hörte, ist diese: »im Anfang war der Unsinn, und der Unsinn war, bei Gott!, und Gott (göttlich) war der Unsinn.«
23
Unheilbar. – Ein Idealist ist unverbesserlich: wirft man ihn aus seinem Himmel, so macht er sich aus der Hölle ein Ideal zurecht. Man enttäusche ihn und siehe! – er wird die Enttäuschung nicht minder brünstig umarmen, als er noch jüngst die Hoffnung umarmt hat. Insofern sein Hang zu den großen unheilbaren Hängen der menschlichen Natur gehört, kann er tragische Schicksale herbeiführen und später Gegenstand von Tragödien werden: als welche es eben mit dem Unheilbaren, Unabwendbaren, Unentfliehbaren in Menschenloos und -Charakter zu tun haben.
24
Der Beifall selber als Fortsetzung des Schauspiels. – Strahlende Augen und ein wohlwollendes Lächeln ist die Art des Beifalls, welcher der ganzen großen Welt- und Daseinskomödie gezollt wird, – aber zugleich eine Komödie in der Komödie, welche die andern Zuschauer zum » plaudite amici« verführen soll.
25
Mut zur Langweiligkeit. – Wer den Mut nicht hat, sich und sein Werk langweilig finden zu lassen, ist gewiß kein Geist ersten Ranges, sei es in Künsten oder Wissenschaften. – Ein Spötter, der ausnahmsweise auch ein Denker wäre, könnte, bei einem Blick auf Welt und Geschichte, hinzufügen: »Gott hatte diesen Mut nicht; er hat die Dinge insgesamt zu interessant machen wollen und gemacht.«
26
Aus der innersten Erfahrung des Denkers. – Nichts wird dem Menschen schwerer als eine Sache unpersönlich zu fassen: ich meine, in ihr eben eine Sache und keine Person zu sehen: ja man kann fragen, ob es ihm überhaupt möglich ist, das Uhrwerk seines personenbildenden, personendichtenden Triebes auch nur einen Augenblick auszuhängen. Verkehrt er doch selbst mit Gedanken, und seien es die abstraktesten, so, als wären es Individuen, mit denen man kämpfen, an die man sich anschließen, welche man behüten, pflegen, aufnähren müsse. Belauern und belauschen wir uns nur selber, in jenen Minuten, wo wir einen uns neuen Satz hören oder finden. Vielleicht mißfällt er uns, weil er so trotzig, so selbstherrlich dasteht: unbewußt fragen wir uns, ob wir ihm nicht einen Gegensatz als Feind zur Seite ordnen, ob wir ihm ein »Vielleicht«, ein »Mitunter« anhängen können; selbst das Wörtchen »wahrscheinlich« gibt uns eine Genugtuung, weil es die persönlich lästige Tyrannei des Unbedingten bricht. Wenn dagegen jener neue Satz in milder Form einherzieht, sein duldsam und demütig und dem Widerspruch gleichsam in die Arme sinkend, so versuchen wir es mit einer andern Probe unserer Selbstherrlichkeit: wie, können wir diesem schwachen Wesen nicht zu Hülfe kommen, es streicheln und nähren, ihm Kraft und Fülle, ja Wahrheit und selbst Unbedingtheit geben? Ist es möglich, uns elternhaft oder ritterlich oder mitleidig gegen dasselbe zu benehmen? – Dann wieder sehen wir hier ein Urteil und dort ein Urteil, entfernt von einander, ohne sich anzusehen, ohne sich auf einander zu zu bewegen: da kitzelt uns der Gedanke, ob hier nicht eine Ehe zu stiften, ein Schluß zu ziehen sei, mit dem Vorgefühle, daß im Falle sich eine Folge aus diesem Schluss ergibt, nicht nur die beiden ehelich verbundenen Urteile, sondern auch die Ehestifter die Ehre davon haben. Kann man aber weder auf dem Wege des Trotzes und Übelwollens, noch auf dem des Wohlwollens jenem Gedanken Etwas anhaben (hält man ihn für wahr –), dann unterwirft man sich und huldigt ihm als einem Führer und Herzog, gibt ihm einen Ehrenstuhl und spricht nicht ohne Gepränge und Stolz von ihm; denn in seinem Glanze glänzt man mit. Wehe Dem, der diesen verdunkeln will; es sei denn, daß er uns selber eines Tages bedenklich wird: – dann stoßen wir, die unermüdlichen »Königsmacher« ( king-makers) der Geschichte des Geistes, ihn vom Throne und heben flugs seinen Gegner hinauf. Dies erwäge man und denke noch ein Stück weiter: gewiß wird Niemand dann von einem »Erkenntnistriebe an und für sich« reden! – Weshalb zieht also der Mensch das Wahre dem Unwahren vor, in diesem heimlichen Kampfe mit Gedanken-Personen, in dieser meist versteckt bleibenden Gedanken-Ehestiftung, Gedanken-Staatenbegründung, Gedanken-Kinderzucht, Gedanken-Armen- und Krankenpflege? Aus dem gleichen Grunde, aus dem er die Gerechtigkeit im Verkehre mit wirklichen Personen übt: jetzt aus Gewohnheit, Vererbung und Anerziehung, ursprünglich, weil das Wahre – wie auch das Billige und Gerechte – nützlicher und ehrbringender ist als das Unwahre. Denn im Reiche des Denkens sind Macht und Ruf schlecht zu behaupten, die sich auf dem Irrtum oder der Lüge aufbauen: das Gefühl, daß ein solcher Bau irgend einmal zusammenbrechen könne, ist demütigend für das Selbstbewusstsein seines Baumeisters; er schämt sich der Zerbrechlichkeit seines Materials und möchte, weil er sich selber wichtiger als die übrige Welt nimmt, Nichts tun, was nicht dauernder als die übrige Welt wäre. Im Verlangen nach der Wahrheit umarmt er den Glauben an die persönliche Unsterblichkeit, das heißt den hochmütigsten und trotzigsten Gedanken, den es gibt, verschwistert wie er ist mit dem Hintergedanken » pereat mundus, dum ego salvus sim! « Sein Werk ist ihm zu seinem ego geworden, er schafft sich selber in's Unvergängliche, Allem Trotz Bietende um. Sein unermeßlicher Stolz ist es, der nur die besten härtesten Steine zum Werke verwenden will, Wahrheiten also oder Das, was er dafür hält. Mit Recht hat man zu allen Zeiten als »das Laster des Wissenden« den Hochmut genannt – doch würde es ohne dieses triebkräftige Laster erbärmlich um die Wahrheit und deren Geltung auf Erden bestellt sein. Darin, daß wir uns vor unsern eigenen Gedanken, Begriffen, Worten fürchten, daß wir aber auch in ihnen uns selber ehren, ihnen unwillkürlich die Kraft zuschreiben, uns belohnen, verachten, loben und tadeln zu können, darin, daß wir also mit ihnen wie mit freien geistigen Personen, mit unabhängigen Mächten verkehren, als Gleiche mit Gleichen – darin hat das seltsame Phänomen seine Wurzel, welches ich »intellektuales Gewissen« genannt habe. – So ist auch hier etwas Moralisches höchster Gattung aus einer Schwarzwurzel herausgeblüht.
27
Die Obskuranten. – Das Wesentliche an der schwarzen Kunst des Obskurantismus ist nicht, daß er die Köpfe verdunkeln will, sondern daß er das Bild der Welt anschwärzen, unsere Vorstellung vom Dasein verdunkeln will. Dazu dient ihm zwar häufig jenes Mittel, die Aufhellung der Geister zu hintertreiben: mitunter aber gebraucht er gerade das entgegengesetzte Mittel und sucht durch die höchste Verfeinerung des Intellekts einen Überdruss an dessen Früchten zu erzeugen. Spitzfindige Metaphysiker, welche die Skepsis vorbereiten und durch ihren übermäßigen Scharfsinn zum Mißtrauen gegen den Scharfsinn auffordern, sind gute Werkzeuge eines feineren Obskurantismus. – Ist es möglich, daß selbst Kant in dieser Absicht verwendet werden kann? ja daß er, nach seiner eignen berüchtigten Erklärung, etwas Derartiges, wenigstens zeitweilig, gewollt hat: dem Glauben Bahn machen, dadurch, daß er dem Wissen seine Schranken wies? – was ihm nun freilich nicht gelungen ist, ihm so wenig wie seinen Nachfolgern auf den Wolfs- und Fuchsgängen dieses höchst verfeinerten und gefährlichen Obskurantismus, ja des gefährlichsten: denn die schwarze Kunst erscheint hier in einer Lichthülle.
28
An welcher Art von Philosophie die Kunst verdirbt. – Wenn es den Nebeln einer metaphysisch-mystischen Philosophie gelingt, alle ästhetischen Phänomene undurchsichtbar zu machen, so folgt dann, daß sie auch unter einander unabschätzbar sind, weil jedes Einzelne unerklärlich wird. Dürfen sie aber nicht einmal mehr mit einander zum Zwecke der Abschätzung verglichen werden, so entsteht zuletzt eine vollständige Unkritik, ein blindes Gewährenlassen: daraus aber wiederum eine stetige Abnahme des Genusses an der Kunst (welcher nur durch ein höchst verschärftes Schmecken und Unterscheiden sich von der rohen Stillung eines Bedürfnisses unterscheidet). Je mehr aber der Genuss abnimmt, um so mehr wandelt sich das Kunstverlangen zum gemeinen Hunger um und zurück, dem nun der Künstler durch immer gröbere Kost abzuhelfen sucht.
29
Auf Gethsemane. – Das Schmerzlichste, was der Denker zu den Künstlern sagen kann, lautet: »könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?«
30
Am Webstuhl. – Den Wenigen, welche eine Freude daran haben, den Knoten der Dinge zu lösen und sein Gewebe aufzutrennen, arbeiten Viele entgegen (zum Beispiel alle Künstler und Frauen), ihn immer wieder neu zu knüpfen und zu verwickeln und so das Begriffne in's Unbegriffne, womöglich Unbegreifliche umzubilden. Was dabei auch sonst herauskomme – das Gewebte und Verknotete wird immer etwas unreinlich aussehen müssen, weil zu viele Hände daran arbeiten und ziehen.
31
In der Wüste der Wissenschaft. – Dem wissenschaftlichen Menschen erscheinen auf seinen bescheidenen und mühsamen Wanderungen, die oft genug Wüstenreisen sein müssen, jene glänzenden Lufterscheinungen, die man »philosophische Systeme« nennt; sie zeigen mit zauberischer Kraft der Täuschung die Lösung aller Rätsel und den frischesten Trunk wahren Lebenswassers in der Nähe; das Herz schwelgt, und der Ermüdete berührt das Ziel aller wissenschaftlichen Ausdauer und Not beinahe schon mit den Lippen, so daß er wie unwillkürlich vorwärts drängt. Freilich bleiben andere Naturen, von der schönen Täuschung wie betäubt, stehen: die Wüste verschlingt sie, für die Wissenschaft sind sie tot. Wieder andere Naturen, welche jene subjektiven Tröstungen schon öfter erfahren haben, werden wohl auf's Äußerste missmutig und verfluchen den Salzgeschmack, welchen jene Erscheinungen im Munde hinterlassen und aus dem ein rasender Durst entsteht – ohne daß man nur Einen Schritt damit irgend einer Quelle näher gekommen wäre.
32
Die angebliche »wirkliche Wirklichkeit.« – Der Dichter stellt sich so, wenn er die einzelnen Berufsarten z. B. die des Feldherrn, des Seidenwebers, des Seemanns schildert, als ob er diese Dinge von Grund aus kenne und ein Wissender sei; ja bei der Auseinandersetzung menschlicher Handlungen und Geschicke benimmt er sich, wie als ob er beim Ausspinnen des ganzen Weltennetzes zugegen gewesen sei; insofern ist er ein Betrüger. Und zwar betrügt er vor lauter Nichtwissenden – und deshalb gelingt es ihm: diese bringen ihm das Lob seines ächten und tiefen Wissens entgegen und verleiten ihn endlich zu dem Wahne, er wisse die Dinge wirklich so gut wie der einzelne Kenner und Macher, ja wie die große Welten-Spinne selber. Zuletzt also wird der Betrüger ehrlich und glaubt an seine Wahrhaftigkeit. Ja die empfindenden Menschen sagen es ihm sogar in's Gesicht, er habe die höhere Wahrheit und Wahrhaftigkeit, – sie sind nämlich der Wirklichkeit zeitweilig müde und nehmen den dichterischen Traum als eine wohltätige Ausspannung und Nacht für Kopf und Herz. Was dieser Traum ihnen zeigt, erscheint ihnen jetzt mehr wert, weil sie es, wie gesagt, wohltätiger empfinden: und immer haben die Menschen gemeint, das wertvoller Scheinende sei das Wahrere, Wirklichere. Die Dichter, die sich dieser Macht bewußt sind, gehen absichtlich darauf aus, Das, was für gewöhnlich Wirklichkeit genannt wird, zu verunglimpfen und zum Unsichern, Scheinbaren, Unächten, Sünd-, Leid- und Trugvollen umzubilden; sie benützen alle Zweifel über die Grenzen der Erkenntnis, alle skeptischen Ausschreitungen, um die faltigen Schleier der Unsicherheit über die Dinge zu breiten: damit dann, nach dieser Umdunkelung, ihre Zauberei und Seelenmagie recht unbedenklich als Weg zur »wahren Wahrheit«, zur »wirklichen Wirklichkeit« verstanden werde.
33
Gerecht sein wollen und Richter sein wollen. – Schopenhauer, dessen große Kennerschaft für Menschliches und Allzumenschliches, dessen ursprünglicher Thatsachen-Sinn nicht wenig durch das bunte Leoparden-Fell seiner Metaphysik beeinträchtigt worden ist (welches man ihm erst abziehen muß, um ein wirkliches Moralisten-Genie darunter zu entdecken) – Schopenhauer macht jene treffliche Unterscheidung, mit der er viel mehr Recht behalten wird, als er sich selber eigentlich zugestehen durfte: »die Einsicht in die strenge Notwendigkeit der menschlichen Handlungen ist die Grenzlinie, welche die philosophischen Köpfe von den andern scheidet.« Dieser mächtigen Einsicht, welcher er zu Zeiten offen stand, wirkte er bei sich selber durch jenes Vorurteil entgegen, welches er mit den moralischen Menschen ( nicht mit den Moralisten) noch gemein hatte und das er ganz harmlos und gläubig so ausspricht: »der letzte und wahre Aufschluss über das innere Wesen des Ganzen der Dinge muß notwendig eng zusammenhängen mit dem über die ethische Bedeutsamkeit des menschlichen Handelns« – was eben durchaus nicht »notwendig« ist, vielmehr durch jenen Satz von der strengen Notwendigkeit der menschlichen Handlungen, das heißt der unbedingten Willens-Unfreiheit und -Unverantwortlichkeit, eben abgelehnt wird. Die philosophischen Köpfe werden sich also von den andern durch den Unglauben an die metaphysische Bedeutsamkeit der Moral unterscheiden: und das dürfte eine Kluft zwischen sie legen, von deren Tiefe und Unüberbrückbarkeit die so beklagte Kluft zwischen »Gebildet« und »Ungebildet«, wie sie jetzt existiert, kaum einen Begriff gibt. Freilich muß noch manche Hintertüre, welche sich die »philosophischen Köpfe«, gleich Schopenhauern selbst, gelassen haben, als nutzlos erkannt werden: keine führt in's Freie, in die Luft des freien Willens; jede, durch welche man bisher geschlüpft ist, zeigte dahinter wieder die ehern blinkende Mauer des Fatums: wir sind im Gefängnis, frei können wir uns nur träumen, nicht machen. Daß dieser Erkenntnis nicht lange mehr widerstrebt werden kann, das zeigen die verzweifelten und unglaublichen Stellungen und Verzerrungen Derer an, welche gegen sie andringen, mit ihr noch den Ringkampf fortsetzen. – So ungefähr geht es bei ihnen jetzt zu: »also kein Mensch verantwortlich? Und Alles voll Schuld und Schuldgefühl? Aber irgend wer muß doch der Sünder sein: ist es unmöglich und nicht mehr erlaubt, den Einzelnen, die arme Welle im notwendigen Wellenspiele des Werdens anzuklagen und zu richten – nun denn: so sei das Wellenspiel selbst, das Werden, der Sünder: hier ist der freie Wille, hier darf angeklagt, verurteilt, gebüßt und gesühnt werden: so sei Gott der Sünder und der Mensch sein Erlöser: so sei die Weltgeschichte Schuld, Selbstverurteilung und Selbstmord; so werde der Missetäter zum eigenen Richter, der Richter zum eigenen Henker.« – Dieses auf den Kopf gestellte Christentum – was ist es denn sonst? – ist der letzte Fechter-Ausfall im Kampfe der Lehre von der unbedingten Moralität mit der von der unbedingten Unfreiheit – ein schauerliches Ding, wenn es mehr wäre als eine logische Grimasse, mehr als eine häßliche Gebärde des unterliegenden Gedankens – etwa der Todeskampf des verzweifelnden und heilsüchtigen Herzens, dem der Wahnsinn zuflüstert: »Siehe, du bist das Lamm, das Gottes Sünde trägt.« – Der Irrtum steckt nicht nur im Gefühle »ich bin verantwortlich«, sondern ebenso in jenem Gegensatz »ich bin es nicht, aber irgendwer muß es doch sein«. – Dies ist eben nicht wahr: der Philosoph hat also zu sagen, wie Christus, »richtet nicht!«, und der letzte Unterschied zwischen den philosophischen Köpfen und den andern wäre der, daß die ersten gerecht sein wollen, die andern Richter sein wollen.
34
Aufopferung. – Ihr meint, das Kennzeichen der moralischen Handlung sei die Aufopferung? – Denkt doch nach, ob nicht bei jeder Handlung, die mit Überlegung getan wird, Aufopferung dabei ist, bei der schlechtesten wie bei der besten.
35
Gegen die Nierenprüfer der Sittlichkeit. – Man muß das Beste und das Schlechteste kennen, dessen ein Mensch fähig ist, im Vorstellen und Ausführen, um zu beurteilen, wie stark seine sittliche Natur ist und wurde. Aber Jenes zu erfahren ist unmöglich.
36
Schlangenzahn. – Ob man einen Schlangenzahn habe oder nicht, weiß man nicht eher, als bis Jemand die Ferse auf uns gesetzt hat. Eine Frau oder Mutter würde sagen: bis Jemand die Ferse auf unsern Liebling, unser Kind gesetzt hat. – Unser Charakter wird noch mehr durch den Mangel gewisser Erlebnisse als durch Das, was man erlebt, bestimmt.
37
Der Betrug in der Liebe. – Man vergißt Manches aus seiner Vergangenheit und schlägt es sich absichtlich aus dem Sinn: das heißt, man will, daß unser Bild, welches von der Vergangenheit her uns anstrahlt, uns belüge, unserm Dünkel schmeichele – wir arbeiten fortwährend an diesem Selbstbetrug. – Und nun meint ihr, die ihr so viel vom »Sichselbstvergessen in der Liebe«, vom »Aufgehen des Ich in der anderen Person« redet und rühmt, dies sei etwas wesentlich Anderes? Also man zerbricht den Spiegel, dichtet sich in eine Person hinein, die man bewundert, und genießt nun das neue Bild seines Ich, ob man es schon mit dem Namen der anderen Person nennt – und dieser ganze Vorgang soll nicht Selbstbetrug, nicht Selbstsucht sein, ihr Wunderlichen! – Ich denke, Die, welche Etwas von sich vor sich verhehlen und Die, welche sich als Ganzes vor sich verhehlen, sind darin gleich, daß sie in der Schatzkammer der Erkenntnis einen Diebstahl verüben: woraus sich ergibt, vor welchem Vergehen der Satz »erkenne dich selbst« warnt.
38
An den Leugner seiner Eitelkeit. – Wer die Eitelkeit bei sich leugnet, besitzt sie gewöhnlich in so brutaler Form, daß er instinktiv vor ihr das Auge schließt, um sich nicht verachten zu müssen.
39