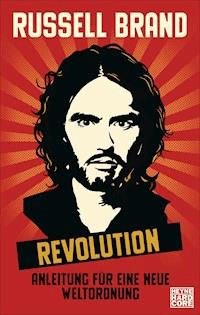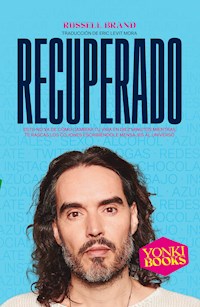18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Level Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Könnte es sein, dass wahres Glück darin liegt, anderen zu helfen und von anderen Hilfe anzunehmen? »Mentoren« – das Nachfolgebuch des »Sunday Times«-Bestsellers »Die 12 Schritte aus der Sucht« – geht genau dieser Frage nach und erklärt, was zwischenmenschliche Hilfe bewirken kann. »Ich habe in jedem Lebensbereich Mentoren an meiner Seite – als Schauspieler, als Vater, als Ex-Junkie, als spiritueller Mensch –, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Einzelne – wie die Welt als Ganzes – im stetigen Wandel sind und wir uns nur als Gemeinschaft weiterentwickeln können.« Russell Brand In »Mentoren« verrät Russell Brand, wie eine Reihe bedeutender Menschen sein Leben verändert hat – angefangen von seiner missratenen Jugend in Essex über seine Jahre als Ex-Junkie bis hin zur Gegenwart, in der seine Mentoren ihm helfen, ein guter Mensch und Vater zu sein. In seinem Buch ergründet er, wie jeder Mensch – bewusst oder unbewusst – nach Vorbildern, Mentoren und Helden sucht und wie sie neue Perspektiven in das eigene Leben bringen können. Und er ermuntert den Leser, selbst einen Mentor fürs Leben zu finden, um von dessen Erfahrungen zu profitieren und schließlich selbst einmal die eigenen Erfahrungen als Mentor teilen zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Russell Brand
MENTOREN
Russell Brand
MENTOREN
Wie ich den Weg zu mir selbst fand und helfen lernte
Aus dem Englischen von Maria Müller-de Haën
Wichtige Hinweise
Die im Buch veröffentlichten Empfehlungen wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Auch wenn eine gendergerechte Sprache wünschenswert ist, gibt es aus Sicht des Verlages bisher keine befriedigende, gut lesbare Lösung. Der leichteren Lesbarkeit zuliebe haben wir des Öfteren von der Doppelung männlicher und weiblicher Formen Abstand genommen. Selbstverständlich liegt es uns fern, dadurch einen Teil der Bevölkerung zu diskriminieren.
Titel der Originalausgabe:
Mentors. How to Help and Be Helped.
© 2019 by Russell Brand
First published 2019 by Bluebird,
an imprint of Pan Macmillan, London, UK
www.panmacmillan.com
Deutsche Ausgabe:
© 2022 NEXT LEVEL Verlag,
ein Imprint der MOMANDA GmbH, Rosenheim
www.next-level-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Maria Müller-de Haën
Lektorat: Gitta Lingen; Layout: Birgit-Inga Weber
Fotos im Innenteil: https://www.russellbrand.com/photos/
Cover: Guter Punkt, München
Gesamtherstellung: Bernhard Keller
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-949458-19-4ISBN ePub: 978-3-949458-20-0
Für meine Töchter
Inhalt
Einleitung
1 Einer der verlorenen Jungs: die Zeit, bevor ich Mentoren hatte
2 Mentor Nummer 1: Einweihung und Initiation bei einem erklärten Atheisten
3 Mentorin Nummer 2: Zen-Fürsorge von der weisen Frau
4 Mentor Nummer 3: der Guru aus dem Goodison Stadion
5 Mentor Nummer 4: der Krieger auf der Matte
6 Mentor Nummer 5: der Merlin auf der Parkbank
7 Mentorin Nummer 6: die Aphrodite der Verdammten
8 Mentorin Nummer 7: die göttliche Mutter
9 Verpasste Gelegenheiten – bevor der Lernende bereit ist
10 Mentor Nummer 8: der Bruder Swami
11 Vaterschaft einüben
12 Zu einem Mentor werden
13 Dem Ruf folgen
Zum Abschluss
Die 12 Schritte
Danksagung
Über den Autor
Einleitung
Hast du schon einmal gehört, wie Brian Cox oder ein anderer genialer Teilchenphysiker (davon gibt es ja jede Menge!) die Weite unseres Universums beschrieben hat? Wie sie davon berichten, dass es wahrscheinlich auch jenseits seiner unermesslichen Weite noch mehr, wahrscheinlich unendlich viele Universen gibt? Wenn ich mich mit meinem abgestumpften Intellekt mit diesen Unwägbarkeiten beschäftige, hänge ich irgendwo zwischen Gefühlen der Ehrfurcht und der Verzweiflung. Im Unendlichen wird jegliches Maßnehmen bedeutungslos, da es sich nur auf enge, beschränkte Muster beziehen kann; Zeit und die Gesetzmäßigkeiten der Physik sind nur lokal geltende Bräuche in unserem universellen Dorf.
Wenn ich Cox jedoch von Carl Sagan sprechen höre, dem großen Star der Astronomie, der den jungen Cox inspirierte, schwanke ich zwischen Ehrfurcht und Hoffnung. Sagan war ein Mentor für Cox. Obwohl sie sich nie kennenlernten, fungierte Sagan als geistiges Symbol, ein Ziel, ein Vorbild, dem der jüngere Mann auf seinem eigenen Weg zur Größe nacheifern konnte.
Ein Held ist ein Sinnbild, das aufzeigt, dass sich innere Antriebe im Außen manifestieren können. Das könnte John Lennon sein, dessen Reise von der Alltäglichkeit zur Größe, vom Glamour zur Häuslichkeit, von der Erhabenheit zur Demut Koordinaten für andere liefert, die eine vergleichbare Reise unternehmen wollen. Es könnte Amma sein, die indische Lehrerin und Mystikerin, die mit ihrer Gewissheit und Überzeugung von der Liebe Gottes einen tiefgreifenden sozialen Wandel in ganz Asien bewirkt hat. Ihre Hingabe hat andere zu philanthropischen Taten inspiriert, Schulen zu gründen sowie Krankenhäuser und Heime zu bauen. Anfangs wurde sie natürlich als ein verrücktes Teenager-Mädchen aus einem Fischerdorf in Kerala abgetan, das in Trance verfällt und alle umarmt. Die Leute hielten sie für durchgeknallt. Größe sieht wie Wahnsinn aus, bis sie ihren Kontext findet.
Mentorenschaft bzw. Mentoring ist ein Faden, der sich durch mein Leben zieht, inzwischen in beide Richtungen. Ich habe Männer und Frauen, an die ich mich wende, wenn der Weg vor mir nicht klar erkennbar ist, und jüngere Menschen, die mich für ihr verrücktes Leben um Rat fragen. Die Rolle des Mentors ist nicht nur die eines Lehrers, obwohl das Lehren natürlich einen großen Teil davon darstellt. Wenn Cox bewundernd über Carl Sagan spricht, dann nicht nur wegen seiner akademischen Erfahrung, sondern weil er ihn als seinen persönlichen Führer empfand. Wegen Sagans emotionaler Sicht auf die Wissenschaft in dem Dokumentarfilm »Unser Kosmos« beschloss Cox als Zwölfjähriger, Wissenschaftler zu werden.
Im Lauf unseres Lebens wählen wir uns immer wieder Mentoren, manchmal bewusst, manchmal nicht, manchmal weise, manchmal nicht. Der Kern dieses Buches ist es, diesen Prozess zu verstehen und zu verbessern. Wenn wir einen Mentor oder eine Mentorin auswählen, müssen wir uns bewusst sein, was wir von ihm bzw. von ihr wollen. Werden wir selbst als Mentor gewählt, müssen wir wissen, was diese Rolle mit sich bringt.
Einer der unerwarteten Vorteile meiner Drogensucht ist die Mentoren-Tradition des 12-Schritte-Prozesses der Genesung, den ich praktiziere. [Eine Auflistung der 12 Schritte ist auf den letzten Seiten dieses Buches zu finden; siehe auch Russell Brands Buch »Die 12 Schritte aus der Sucht« (Anm.dt.Red.).]
Wenn du in ein 12-Schritte-Programm einsteigst, musst du eine andere Person bitten, dich durch die Schritte zu führen bzw. dein »Sponsor« zu sein. Das führt normalerweise ganz unwissentlich zu einer gewissen Demut; nur wenige Menschen würden wohl sagen: »Hey, Baby, heute ist dein Glückstag – ich möchte, dass du mich auf eine spirituelle Reise mitnimmst.« Man ist eher ein wenig schüchtern, wenn man jemanden bittet, als Sponsor zu agieren, ein wenig demütig, ein bisschen so, als würde man diese Person um ein Date bitten. Damit akzeptieren wir, dass unsere bisherigen Methoden versagt haben, dass wir Hilfe brauchen, dass unsere eigenen Ansichten gegenüber der Weisheit des Mentors und hoffentlich auch dem Glaubensbekenntnis, dem er angehört, unterlegen sind. Im 12-Schritte-Programm lehrt der Sponsor den »Sponsee« die Methode, mit der er selbst die 12 Schritte praktiziert hat; er tritt an die Stelle seines eigenen Sponsors und gibt das, was ihm gegeben wurde, an eine andere Person weiter, und zwar auf eine Weise, die vielleicht eine persönliche Prägung hat, aber doch getreu genug dem ursprünglichen Programm folgt, um seine Kraft zu bewahren. Das Gleiche, stelle ich fest, gilt in den Traditionen der Kampfkünste; es gibt eine Linie und ein System, das vom Lehrer an den Schüler weitergegeben wird. Natürlich gibt es auch Parallelen in der akademischen Welt, aber wer schon einmal zur Schule gegangen ist, weiß, dass Breitenbildung ziemlich widersprüchlich sein kann und der durchschnittliche gehetzte Pädagoge zu viele bürokratische und finanzielle Belastungen zu stemmen hat, um mehr als einer Handvoll Schüler voller Aufmerksamkeit das Elixier der Mentorenschaft zuteilwerden zu lassen.
In diesem Buch werde ich dir von meinen Mentoren und Mentorinnen erzählen, davon, wie sie mein Leben auf praktische und esoterische, offensichtliche und ungewöhnliche Weise bereichert haben, indem sie mir gezeigt haben, dass ich trotz der inneren und äußeren Hindernisse, mit denen ich konfrontiert bin, die Person werden kann, die ich sein möchte. Ich werde dich dazu ermutigen, deine eigenen Mentoren zu finden, und dir erklären, wie du jene, die du bereits hast, besser nutzen kannst. Darüber hinaus werde ich dir von meinen Erfahrungen als Mentor anderer Menschen erzählen, wie wertvoll das auf meiner immer anhaltenden Reise hin zur Selbstakzeptanz war und wie es mir geholfen hat, mich von einem verwirrten und unbeständigen Vagabunden in einen (meist) präsenten und (meist) fokussierten Ehemann und Vater zu verwandeln.
Ich habe Mentoren in allen Bereichen meines Lebens: als Comedian, als Vater, als genesender Drogenabhängiger, als spirituelles Wesen und als Mann, der daran glaubt, dass wir als Individuen genauso wie der große Globus unfertige Werke sind und uns durch eine Kette von Mentoren – und die gemeinschaftliche Weiterentwicklung von Systemen – individuell und auf globaler Ebene verbessern können.
Manchmal frage ich in meinen Live-Shows die Leute im Publikum, ob sie einer Gruppe angehören: einer Fußballmannschaft, einer religiösen Gemeinschaft, einer Gewerkschaft, einem Buchclub, einem Wohnungsausschuss, einem Ruderverein – und bin überrascht, wie wenige Menschen Mitglieder eines »Stammes« sind. Die Auswirkungen der Globalisierung auf die nationale Identität werden zwar noch nicht vollständig verstanden, doch die reduktive Anziehungskraft des statischen Mythos kann ich durchaus nachvollziehen. Während einer Weltmeisterschaft werde ich zum Über-Engländer, besonders die letzte war wie eine fröhliche Neuaufführung des Dramas »Dianas Tod« insofern, als sie es schaffte, eine Nation in kollektiver Hysterie zusammenzubringen. Aber schon bald werden die Fahnen abgenommen, die Bildschirme auf den öffentlichen Plätzen verdunkeln sich, und wir sind wieder atomisiert. Der Raum zwischen uns ist nicht mehr mit Gesängen, Liedern und Insider-Witzen gefüllt, die Augen sind wieder auf den Gehweg gerichtet, die Aufmerksamkeit ist wieder nach innen gelenkt. Ich behaupte nicht, dass die vom Spätkapitalismus verursachte tiefe Entfremdung weggespült werden kann, indem man einem Bowlingclub beitritt; aber es ist ein Anfang, und einen Lehrer innerhalb der Gruppe zu haben, zu der man gehört, bietet Nähe und Sinn. In den Guru-Traditionen Indiens übertrifft die Liebe zwischen Lehrer und Schüler alle anderen Formen der Liebe, denn in dieser Beziehung wird explizit nichts Geringeres als die Liebe Gottes weitergegeben und wie ein Individuum das Göttliche verkörpern kann.
Wir leben in einsamen und polarisierten Zeiten, in denen sich viele von uns verloren und zerrissen fühlen. Das zeigt sich in unserer Politik; aber die politischen Ereignisse spiegeln tiefere und persönlichere Wahrheiten wider. Ich versuche nun schon eine ganze Weile zu erklären, was meiner Meinung nach in den Gesellschaften passiert, mit denen ich vertraut bin; damit meine ich Europa, Australien, die Vereinigten Staaten – nicht dass ich behaupte, ein Soziologe zu sein, ich habe keine Ahnung, wie ich mich dem nähern soll, was zur Hölle auch immer in Pakistan oder China passieren mag, aber hier, hier in unseren postsäkularen Randgebieten, wo die alten Ideen sterben und die neuen noch nicht geboren sind, spüre ich eine beständige und erkennbare Sehnsucht nach Sinn, der über die glühende Asche des ausgebrannten Konsumdenkens, den taumelnden, dummen Zombie-Nationalismus, die steife, korrupte Religion und den CGI-Zirkus der modernen Mainstream-Medien hinausgeht [CGI: computergenerierte Bilder (Anm.dt.Red.)]. Ich beobachte das schon lange und wusste schon vor Trump, Brexit, Radikalismus und der »neuen Rechten«, dass etwas Ernstes im Gange ist. Auch du weißt das. Manchmal verzweifeln wir, und manchmal lenken wir ab, weil es zu viel für eine Person zu sein scheint und wir vergessen haben, wie man zusammenarbeitet. Doch alleine bin ich nichts.
1
Einer der verlorenen Jungs: die Zeit, bevor ich Mentoren hatte
Niemand kommt unbeschadet und ohne Narben durch die Kindheit. Die ursprüngliche animalische Natur wird von Ereignissen und besten Absichten grob zurechtgeformt. Triebe, die eigentlich dem Überleben und Gedeihen in einer Welt dienen sollen, die wir schon lange zubetoniert haben, toben gegen Bildschirme und werden durch Zuckerkonsum aufgepeitscht. Und als Vater wird meine zärtliche Gefühlsduselei in der Praxis vom eisernen Willen eines Kleinkindes auf die Probe gestellt: »Ich werde diesen wilden, vollkommenen Geist nähren und fördern« wird morgens um drei Uhr zu »Lieber Gott, bitte, bitte lass dieses verdammte Kind endlich einschlafen«.
Gibt es überhaupt jemanden, der einen so weiten Weg zurücklegt wie Rousseau’sche Idealisten, die Eltern werden? Wenn ein Konservativer ein überfallener Liberaler ist, dann ist ein Vater ein abgekämpfter Jesus.
Kein Kind hat so viel Bewusstsein, dass es sich einen Mentor aussucht; es nimmt, was ihm gegeben wird. Erst als Jugendliche tasten wir uns über die mütterlichen und väterlichen Grenzen hinaus bzw. die Grenzen der Person, die diese Aufgabe übernommen hat. Manche Jungen geben diese Aufgabe an Mitglieder ihrer Gang weiter, manche Mädchen überlassen sie einem Pony, doch auf uns alle warten jenseits dieser eng gefassten Rollen zahlreiche Obi-Wan Kenobis und Maya Angelous, die unbedingt die funkelnde Weisheit ihres Lebens weitergeben wollen. Wohlgemerkt: Wenn der Teenager, der sich nach einem Idol sehnt, vom faden Konsumdenken aufgesaugt wird, könnte sich die hormonbedingte gute Absicht auf eine digitale Kardashian oder einen beatboxenden Typen mit verkehrt aufgesetzter Baseballkappe ergießen. Oh ja, der Jugendliche wünscht sich Geschlechtsverkehr, aber was verbirgt sich hinter diesem Wunsch?
In unseren eisigen Tagen der digitalen Ewigkeit leben wir in einem ständigen »Jetzt«, ohne jemals wirklich präsent zu sein, und die Ikonen werden auseinandergenommen. Kaum ist ein Held aufgestiegen, wird er als Heuchler entlarvt. Malcolm X war ein Stricher, Gandhi hatte merkwürdige nächtliche Angewohnheiten, und selbst Che, der obligatorische Einstieg für Teenager in rebellische Gefühle, war ein homophober Mörder. Zu viel Informationen: Der Bildersturm unserer allwissenden, aber alldummen Zeit entwebt die Teppiche, auf denen wir vielleicht einmal gelaufen sind, und lässt uns in der Einöde des »Auch nur ein Mensch« zurück.
Bevor ich so etwas wie bewusstes Mentoring kannte, verehrte ich meine älteren Cousins, und das führte zu Morrissey (Moz), der die Fackel der Bewunderung auf Jimmy Dean und Oscar Wilde leuchten ließ. Sie alle haben ihren Platz in der Konstellation meines Selbst, während ich in meine mittleren Jahre eintrete. Meine Cousins mit ihrer kantigen Essex-Coolness, Moz’ Überhöhung des Leidens, Deans sexy Verkorkstheit …, und Wilde ist ein wenig zu komplex, um ihn mit einer Handvoll Adjektive zu übergehen, aber – mein Gott! – die Tragödie, der Witz, die Zweideutigkeit, das soziale Gewissen und die Widersprüche!
Wir erschaffen uns selbst, bewusst oder unbewusst, Muster im Unendlichen, halten uns an Strängen inmitten des Unendlichen fest, greifen manchmal aus Angst, manchmal aus Sehnsucht danach. Durch die richtige Mentorenschaft kann eine Übertragung der Fähigkeiten, ein Nähren der Energie stattfinden und aus den schönen Trümmern der Kindheit ein Erwachsener hervorgebracht werden, ein nüchterner Mann aus dem Betrunkenen, ein Meister aus dem Schüler, eine Mutter aus dem Mädchen.
Mit sechzehn verließ ich mein Zuhause auf der Suche nach meinem Unglück und wurde schnell fündig, und zwar in Bermondsey. In Südlondon gibt es genug Elend für alle, damals war es noch nicht so cool, wie es heute angeblich ist. Dort habe ich mich mit ein paar verlorenen Jungs verkrochen, die zwei Jahre älter und viel weiser waren, und habe sie mir in der Fantasie zu Legenden hochgejubelt. Wenn ich jetzt auf diese achtzehnjährigen Typen zurückblicke, sehe ich, dass sie ungepflegte Penner waren, aber ich brauchte sie, um cool zu sein, also waren sie in meinen Augen cool.
Frage: Gibt es eine objektive »Realität« oder eine Reihe voneinander abhängiger mentaler Projektionen? Mit anderen Worten: Waren die Beatles ein Viererpack erwachender Schamanen, die eine Generation vom schwerfälligen Rock zum sexy Pop, dann zu Psychedelika und schließlich zum Konsumdenken führten? Die Ereignisse in der Außenwelt werden von subtileren Energien gesteuert, von denen viele unsere kollektive Psyche durchdringen. Zweifellos formen Meteoriten und Wirbelstürme die Umwelt, aber Kultur ist per Definition die Manifestation menschlicher Triebe. Es gibt Muster, Formen und Archetypen, die immer wieder auftreten.
Als ich mit neunzehn Jahren zum ersten Mal den bereits verstorbenen Bill Hicks sah, spürte ich eine körperliche Übertragung. Ich will mir bestimmt nicht anmaßen, ich sei in die Fußstapfen des großen amerikanischen Stand-up-Künstlers getreten, das tun schon genug andere, aber er gab mir Kraft und inspirierte mich. »Inspiriert«, das heißt, er hauchte mir Atem ein. Und Atem ist Leben. Ich finde es merkwürdig, dass meine Mentoren in meinen jungen Jahren so weit weg waren.
Berühmt oder tot oder beides. Erst mit Chip Somers entschied ich mich, einem anderen Mann nachzueifern, um von einem Zustand in einen anderen zu gelangen.
2
Mentor Nummer 1: Einweihung und Initiation bei einem erklärten Atheisten
Ein genesender Drogensüchtiger ist per Definition ein Widerspruch in sich, und Chip ist ein gutes Beispiel dafür. Ein streberhafter Bankräuber. Abschaum der Mittelschicht. Frommer Atheist. Als er mir meine Sucht diagnostizierte, machte ich ihn noch nicht zu meinem Mentor. Zu diesem Zeitpunkt war er nur der Leiter des Behandlungszentrums, in das man mich unfreiwillig verfrachtet hatte, jemand, den ich mit Charme dazu bringen musste, mich irgendwann zu entlassen. Soweit ich wusste, würde es einen Test und ein Zertifikat geben. Und so war es auch: Drogentests und eine Art »Gut gemacht!«-Zertifikat – so wie »Medaillen am Tag des Sports für alle« an einer fortschrittlichen Schule.
Als ich Chip kennenlernte, war er schon etwas länger clean als ich jetzt, nämlich sechzehn Jahre. Er war in London als eifriger Weltverbesserer unterwegs, mischte sich in das Leben von Davina McCall ein und war mit Eric Clapton befreundet; er hatte also Referenzen. Natürlich war ich zu dieser Zeit nicht berühmt, aber wenn man mich aufgeschnitten hätte, wäre ich der reine Ehrgeiz gewesen. Na ja, rein nicht, ich war erheblich mit Crack und Heroin verseucht – genau das war ja das Problem.
Chip war ein weitaus schlimmerer Drogensüchtiger gewesen als ich. Zum einen hatte er Drogen gespritzt, zum anderen hatte er wegen echter Verbrechen gesessen; in der verdrehten Ökologie der Junkies und Unterweltler bedeutete das einen gewissen Status. Praktisch hieß es, dass ich ihm vertrauen konnte, wenn es um das Thema »Sucht« und den Ausstieg aus dem Drogenkonsum ging.
Hinzu kam der Vorteil, dass ich in einer Einrichtung untergebracht war, ein klares Ziel vor Augen hatte – Abstinenz – und eine Methode hatte, um dieses Ziel zu erreichen: das 12-Schritte-Programm. Vielleicht sind das die perfekten Bedingungen für Mentorenschaft: ein Mentor, ein Mentee, eine Methode und eine Einrichtung. Die hinduistische Guru-Schüler-Beziehung funktioniert typischerweise nach diesem Muster, ebenso wie das Training in den Kampfkünsten. Interessanterweise hat keiner dieser Wege ein offensichtliches westliches Gegenstück; der naheliegendste Vergleich – die Handwerkslehre – ist in einen bestimmten Kontext gestellt, sie hat mit Handel bzw. Wirtschaft und beruflichen Anforderungen zu tun. Meiner Erfahrung nach ist eine Mentorenschaft erfolgreicher, wenn es keine finanzielle Komponente gibt.