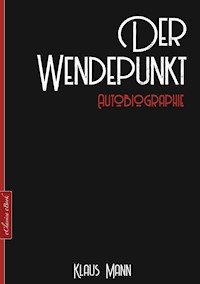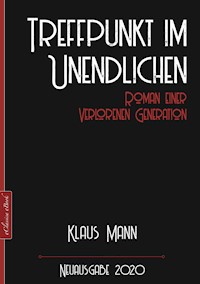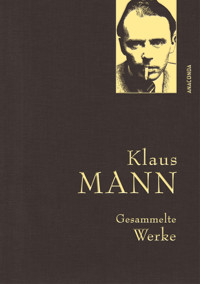Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Null Papier VerlagHörbuch-Herausgeber: hoerbuchedition words and music
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung »Mephisto« von Klaus Mann erzählt die fesselnde Geschichte des Schauspielers Hendrik Höfgen, der im Dritten Reich seine moralischen Prinzipien opfert, um Karriere zu machen. In scharfsinniger und psychologisch tiefer Erzählweise zeigt Mann, wie Höfgen zum Star des nationalsozialistischen Regimes wird und sich dabei in Verrat und Opportunismus verstrickt. Der Roman ist mehr als ein historisches Dokument. Er beleuchtet die Verführbarkeit des Menschen und die Kompromisse zwischen Kunst, Moral und Macht, die auch heute relevant sind. Mit sprachlicher Brillanz und dichter Atmosphäre bleibt "Mephisto" ein zeitloses Meisterwerk, das lange nachwirkt und zum Nachdenken anregt. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Mann
Mephisto
Roman einer Karriere
Klaus Mann
Mephisto
Roman einer Karriere
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Querido Verlag N.V. Amsterdam, 1936 2. Auflage, ISBN 978-3-962819-03-3
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Mephisto: Teuflischer Pakt mit dem Erfolg – Vorwort zur Neuauflage 2024
Vorspiel – 1936
I. H.K.
II. Die Tanzstunde
III. Knorke
IV. Barbara
V. Der Ehemann
VI. »Es ist doch nicht zu schildern …«
VII. Der Pakt mit dem Teufel
VIII. Über Leichen
IX. In vielen Städten
X. Die Drohung
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Mephisto: Teuflischer Pakt mit dem Erfolg – Vorwort zur Neuauflage 2024
Klaus Manns Roman »Mephisto« – erschienen 1936 im Exil – zählt zu den bedeutendsten Werken der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Der Schlüsselroman erzählt die Geschichte des talentierten Schauspielers Hendrik Höfgen, der seine künstlerischen Ideale für Ruhm und Erfolg im nationalsozialistischen Deutschland opfert.
Ein Roman von zeitloser Aktualität
Mephisto zeichnet ein beklemmendes Bild der moralischen Verstrickungen und fragwürdigen Anpassungen im Angesicht des Nazi-Regimes. Höfgens Weg vom idealistischen Künstler zum gefeierten Star unter den Nationalsozialisten steht sinnbildlich für den Opportunismus und die Gewissenskonflikte vieler Intellektueller jener Zeit.
Kontroverse und Verbotsgeschichte
Der Roman sorgte bereits nach seiner Veröffentlichung für große Kontroversen. Gustaf Gründgens, ein berühmter deutscher Schauspieler, sah sich in der Figur des Hendrik Höfgen porträtiert und fühlte sich dadurch diffamiert. 1968 erreichte sein Adoptivsohn Peter Gorski ein Verbot des Romans in der Bundesrepublik Deutschland, welches 1971 vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde. Das Verbot, das bis 1981 Wirkung zeigte, trug zur Legendenbildung um Gründgens bei und schürte das Interesse am Werk.
Mephisto: Ein wichtiger Beitrag zur deutschen Literatur und Zeitgeschichte
Die Neuauflage von »Mephisto« im Jahr 2024 macht diesen literarischen Meilenstein erneut der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Der Roman, der weit mehr ist als ein Schlüsselroman, besticht durch seine vielschichtige Charakterzeichnung, seine tiefe psychologische Prägnanz und seine schonungslose Zeitkritik.
Mephisto ist nicht nur ein packendes Leseerlebnis, sondern auch ein wichtiges Zeugnis der deutschen Geschichte und eine zeitlose Auseinandersetzung mit Fragen von Kunst, Moral und Politik.
J.S.
DER SCHAUSPIELERIN THERESE GIEHSE GEWIDMET
»Alle Fehler des Menschen verzeih’ ich dem Schauspieler, keine Fehler des Schauspielers verzeih’ ich dem Menschen.«
Goethe, »Wilhelm Meister«
Vorspiel – 1936
»In einem der westdeutschen Industriezentren sollen neulich über achthundert Arbeiter verurteilt worden sein, alle zu hohen Zuchthausstrafen, und das im Laufe eines einzigen Prozesses.«
»Nach meinen Informationen sind es nur fünfhundert gewesen; über hundert andere hat man erst gar nicht abgeurteilt, sondern heimlich umbringen lassen, ihrer Gesinnung wegen.«
»Sind die Löhne wirklich so entsetzlich schlecht?«
»Miserabel. Dabei fallen sie noch – und die Preise steigen.«
»Die Dekorierung des Opernhauses für heute Abend soll 60.000 Mark gekostet haben. Dazu kommen mindestens noch 40.000 Mark andere Spesen – nicht mitgerechnet die Unkosten, die es der öffentlichen Kasse gemacht hat, das Opernhaus, wegen der Vorbereitungen für den Ball, fünf Tage lang geschlossen zu halten.«
»Eine nette kleine Geburtstagsfeier.«
»Ekelhaft, dass man den Rummel mitmachen muss.«
Die beiden ausländischen jungen Diplomaten verneigten sich, auf den Gesichtern das liebenswürdigste Lächeln, vor einem Offizier in großer Uniform, der hinter seinem Monokel einen misstrauischen Blick auf sie geworfen hatte.
»Die ganze hohe Generalität ist da.« Sie sprachen erst wieder, als sie die große Uniform außer Hörweite wussten.
»Aber sie sind alle für den Frieden begeistert«, fügte der andere boshaft hinzu.
»Wie lange noch?« fragte fröhlich lächelnd der Erste, wobei er eine kleine Dame von der japanischen Botschaft begrüßte, die am Arm eines hünenhaften Marineoffiziers klein und zierlich einherschritt.
»Wir müssen auf alles gefasst sein.«
Ein Herr vom Auswärtigen Amt gesellte sich zu den beiden jungen Botschaftsattachés, die sofort dazu übergingen, Pracht und Schönheit der Saaldekoration zu preisen. »Ja, der Herr Ministerpräsident hat Freude an diesen Dingen«, sagte, etwas verlegen, der Herr vom Auswärtigen Amt. – »Aber es ist alles geschmackvoll«, versicherten die beiden jungen Diplomaten, beinah im gleichen Atem. – »Gewiss«, sprach gequält der Herr aus der Wilhelmstraße. – »Eine so prachtvolle Veranstaltung kann man heute nirgends als in Berlin finden«, sagte einer der beiden Ausländer noch. Der Herr vom Außenministerium zögerte eine Sekunde lang, ehe er sich zu einem höflichen Lächeln entschloss.
Es entstand eine Gesprächspause. Die drei Herren blickten um sich und lauschten dem festlichen Lärm. »Kolossal«, sagte schließlich einer von den beiden jungen Leuten leise – diesmal ohne jeden Sarkasmus, sondern wirklich beeindruckt, beinah verängstigt von dem riesenhaften Aufwand, der ihn umgab. Das Flimmern der von Lichtern und Wohlgerüchen gesättigten Luft war so stark, dass es ihm die Augen blendete. Ehrfurchtsvoll, aber misstrauisch blinzelte er in den bewegten Glanz. ›Wo bin ich nur?‹ dachte der junge Herr – er kam aus einem der skandinavischen Länder –. ›Der Ort, an dem ich mich befinde, ist ohne Frage sehr lieblich und verschwenderisch ausgestattet; dabei aber auch etwas grauenhaft. Diese schön geputzten Menschen sind von einer Munterkeit, die nicht gerade vertrauenerweckend wirkt. Sie bewegen sich wie die Marionetten – sonderbar zuckend und eckig. In ihren Augen lauert etwas, ihre Augen haben keinen guten Blick, es gibt in ihnen so viel Angst und so viel Grausamkeit. Bei mir zu Hause schauen die Leute auf eine andere Art – sie schauen freundlicher und freier, bei mir zu Hause. Man lacht auch anders, bei uns droben im Norden. Hier haben die Gelächter etwas Höhnisches und etwas Verzweifeltes; etwas Freches, Provokantes, und dabei etwas Hoffnungsloses, schauerlich Trauriges. So lacht doch niemand, der sich wohl fühlt in seiner Haut. So lachen doch Männer und Frauen nicht, die ein anständiges, vernünftiges Leben führen …‹ –
Der große Ball zum 43. Geburtstag des Ministerpräsidenten fand in allen Räumen des Opernhauses statt. In den ausgedehnten Foyers, in den Couloirs und Vestibülen bewegte sich die geputzte Menge. Sie ließ Sektpfropfen knallen in den Logen, deren Brüstungen mit kostbaren Draperien behängt waren; sie tanzte im Parkett, aus dem man die Stuhlreihen entfernt hatte. Das Orchester, das auf der leergeräumten Bühne seinen Platz hatte, war umfangreich, als sollte es eine Symphonie aufführen, mindestens von Richard Strauss. Es spielte aber nur, in keckem Durcheinander, Militärmärsche und jene Jazz-Musik, die zwar wegen niggerhafter Unsittlichkeit verpönt war im Reiche, die aber der hohe Würdenträger auf seinem Jubelfeste nicht entbehren wollte.
Hier hatte alles sich eingefunden, was in diesem Lande etwas gelten wollte, niemand fehlte – außer dem Diktator selbst, der sich wegen Halsschmerzen und angegriffener Nerven hatte entschuldigen lassen, und außer einigen etwas plebejischen Parteiprominenten, die nicht eingeladen worden waren. Hingegen bemerkte man mehrere kaiserliche und königliche Prinzen, viele Fürstlichkeiten und fast den ganzen Hochadel; die gesamte Generalität der Wehrmacht, sehr viele einflussreiche Finanziers und Schwerindustrielle; verschiedene Mitglieder des diplomatischen Corps – meistens von den Vertretungen kleinerer oder weit entfernter Länder –; einige Minister, einige berühmte Schauspieler – die huldvolle Schwäche des Jubilars für das Theater war bekannt – und sogar einen Dichter, der sehr dekorativ aussah und übrigens die persönliche Freundschaft des Diktators genoss. – Über 2000 Einladungen waren verschickt worden; von diesen waren etwa tausend Ehrenkarten, die zum unentgeltlichen Genuss des Festes berechtigten; von den Empfängern der übrigen tausend hatte jeder fünfzig Mark Eintritt zahlen müssen: so kam ein Teil der ungeheuren Spesen wieder herein – der Rest blieb zulasten jener Steuerzahler, die nicht zum näheren Umgang des Ministerpräsidenten und also keineswegs zur Elite der neuen deutschen Gesellschaft gehörten.
»Ist es nicht ein wunderschönes Fest!« rief die umfangreiche Gattin eines rheinischen Waffenfabrikanten der Frau eines südamerikanischen Diplomaten zu. »Ach, ich amüsiere mich gar zu gut! Ich bin so glänzender Laune, und ich wünschte mir, dass alle Menschen in Deutschland, und überall, glänzender Laune würden!«
Die südamerikanische Diplomatenfrau, die nicht gut Deutsch verstand und sich langweilte, lächelte säuerlich.
Die muntere Gattin des Fabrikanten war von solchem Mangel an Enthusiasmus enttäuscht und entschloss sich dazu, weiter zu promenieren. »Entschuldigen Sie mich, meine Liebe!« sagte sie fein und raffte die glitzernde Schleppe. »Ich muss eben mal eine alte Freundin aus Köln begrüßen – die Mutter unseres Staatstheaterintendanten, Sie wissen doch, des großen Hendrik Höfgen.«
Hier tat die Südamerikanerin zum ersten Mal den Mund auf, um zu fragen: »Who is Henrik Hopfgen?« – was die Fabrikantengattin veranlasste, leise aufzuschreien: »Wie?! Sie kennen unseren Höfgen nicht? – Höfgen, meine Beste – nicht Hopfgen! Und Hendrik, nicht Henrik – er legt größten Wert auf das kleine ›D‹!«
Dabei war sie schon auf die distinguierte Matrone zugeeilt, die am Arme des Dichters und Führerfreundes würdevoll durch die Säle schritt. »Liebste Frau Bella! Es ist eine Ewigkeit her, dass man sich nicht gesehen hat! Wie geht es Ihnen denn, Liebste? Haben Sie manchmal Heimweh nach unserem Köln? Aber Sie befinden sich hier ja in einer so glänzenden Position! Und wie geht es Fräulein Josy, dem lieben Kind? Vor allem: Was macht Hendrik – Ihr großer Sohn! Himmel, was ist aus ihm alles geworden! Er ist ja fast so bedeutend wie ein Minister! Ja ja, liebste Frau Bella, wir in Köln haben alle Sehnsucht nach Ihnen und Ihren herrlichen Kindern!«
In Wahrheit hatte sich die Millionärin niemals um Frau Bella Höfgen gekümmert, als diese noch in Köln gelebt und ihr Sohn die große Karriere noch nicht gemacht hatte. Die Bekanntschaft zwischen den beiden Damen war nur eine flüchtige gewesen; niemals war Frau Bella eingeladen worden in die Villa des Fabrikanten. Nun aber wollte die lustige und gemütvolle Reiche die Hand der Frau, deren Sohn man zu den nahen Freunden des Ministerpräsidenten zählte, gar nicht mehr loslassen.
Frau Bella lächelte huldvoll. Sie war sehr einfach, aber nicht ohne eine gewisse ehrbare Koketterie gekleidet; auf ihrer schwarzen, glatt fließenden Seidenrobe leuchtete eine weiße Orchidee. Das graue, schlicht frisierte Haar bildete einen pikanten Kontrast zu ihrem ziemlich jung gebliebenen, mit dezenter Sorgfalt hergerichteten Gesicht. Aus weiten, grünblauen Augen schaute sie mit einer reservierten, nachdenklichen Freundlichkeit auf die geschwätzige Dame, die den lebhaften deutschen Kriegsvorbereitungen ihr wundervolles Collier, ihre langen Ohrgehänge, die Pariser Toilette und all ihren Glanz verdankte.
»Ich kann nicht klagen, es geht uns allen recht gut«, sprach mit stolzer Bescheidenheit Frau Höfgen. »Josy hat sich mit dem jungen Grafen Donnersberg verlobt. Hendrik ist ein wenig überanstrengt, er hat rasend zu tun.«
»Das kann ich mir denken.« Die Industrielle schaute respektvoll.
»Darf ich Ihnen unseren Freund Cäsar von Muck vorstellen«, sagte Frau Bella.
Der Dichter neigte sich über die geschmückte Hand der reichen Dame, die sofort wieder zu schwätzen begann. »Ungeheuer interessant, ich freue mich wirklich, habe Sie sofort nach den Fotografien erkannt. Ihr Tannenberg-Drama habe ich in Köln bewundert, eine recht gute Aufführung, natürlich fehlen die überragenden Leistungen, wie man sie in Berlin jetzt gewöhnt ist, aber wirklich recht anständig, ohne Frage sehr achtbar. Und Sie, Herr Staatsrat – Sie haben doch inzwischen eine so großartige Reise gemacht, alle Welt spricht von Ihrem Reisebuch, ich will es mir dieser Tage besorgen.«
»Ich habe viel Schönes und viel Hässliches gesehen in der Fremde«, sagte der Dichter schlicht. »Jedoch reiste ich durch die Lande nicht nur als Schauender, nicht nur als Genießender, sondern mehr noch als Wirkender, Lehrender. Mich deucht, es ist mir gelungen, dort draußen neue Freunde für unser neues Deutschland zu werben.« Mit seinen stahlblauen Augen, deren durchdringende und feurige Reinheit in vielen Feuilletons gepriesen wurde, taxierte er den kolossalen Schmuck der Rheinländerin. ›Ich könnte in ihrer Villa wohnen, wenn ich das nächste Mal in Köln einen Vortrag oder eine Premiere habe‹, dachte er, während er weitersprach: »Es ist für unseren geraden Sinn unfassbar, wie viel Lüge, wie viel boshaftes Missverständnis über unser Reich im Umlauf sind – draußen in der Welt.«
Sein Gesicht war so beschaffen, dass jeder Reporter es »holzgeschnitten« nennen musste: zerfurchte Stirn, Stahlauge unter blonder Braue und ein verkniffener Mund, der leicht sächsischen Dialekt sprach. Die Waffenfabrikantin war sehr beeindruckt, von seinem Aussehen wie von seiner edlen Rede. »Ach«, schaute sie ihn schwärmerisch an. »Wenn Sie einmal nach Köln kommen, müssen Sie uns unbedingt besuchen!«
Staatsrat Cäsar von Muck, Präsident der Dichterakademie und Verfasser des überall gespielten »Tannenberg«-Dramas, verneigte sich mit ritterlichem Anstand: »Es wird mir eine echte Freude sein, gnädige Frau.« Dabei legte er sogar die Hand aufs Herz.
Die Industrielle fand ihn wundervoll. »Wie köstlich es sein wird, Ihnen einen ganzen Abend zuzuhören, Exzellenz!« rief sie aus. »Was Sie alles erlebt haben müssen! Sind Sie nicht auch schon Staatstheaterintendant gewesen?«
Diese Frage wurde als taktlos empfunden, und zwar sowohl von der distinguierten Frau Bella, als auch vom Autor der »Tannenberg«-Tragödie. Dieser sagte denn auch nur, mit einer gewissen Schärfe: »Gewiss.«
Die reiche Kölnerin merkte nichts. Vielmehr sprach sie noch, mit durchaus deplazierter Schelmerei: »Sind Sie denn da nicht ein klein bisschen eifersüchtig, Herr Staatsrat, auf unseren Hendrik, Ihren Nachfolger?« Nun drohte sie auch noch mit dem Finger. Frau Bella wusste nicht, wohin sie blicken sollte.
Cäsar von Muck aber bewies, dass er weltmännisch und überlegen war, und zwar in einem Grade, der an Edelmut grenzt. Über sein Holzschnittgesicht ging ein Lächeln, das nur in seinen ersten Anfängen etwas bitter schien, dann aber milde, gut und sogar weise wurde. »Ich habe diese schwere Last gerne – ja, von Herzen gerne an meinen Freund Höfgen abgegeben, der wie kein anderer berufen ist, sie zu tragen.« Seine Stimme bebte; er war stark ergriffen von der eigenen Großmut und von der Schönheit seiner Gesinnung.
Frau Bella, die Mutter des Intendanten, zeigte eine beeindruckte Miene; die Lebensgefährtin des Kanonenkönigs aber war derartig gerührt von der edlen und majestätischen Haltung des berühmten Dramatikers, dass sie beinahe weinen musste. Mit tapferer Selbstüberwindung schluckte sie die Tränen hinunter; tupfte sich die Augen flüchtig mit dem Seidentüchlein und schüttelte die weihevolle Stimmung mit einem sichtbaren Ruck von sich ab. In ihr siegte die typisch rheinische Munterkeit; sie schaute wieder strahlend und jubilierte: »Ist es nicht ein ganz herrliches Fest?!«
Es war ein ganz herrliches Fest, darüber konnte gar kein Zweifel bestehen. Wie das glitzerte, duftete, rauschte! Gar nicht festzustellen, was mehr Glanz verbreitete: die Juwelen oder die Ordenssterne. Das verschwenderische Licht der Kronleuchter spielte und tanzte auf den entblößten, weißen Rücken und den schön bemalten Mienen der Damen; auf den Specknacken, gestärkten Hemdbrüsten oder betreßten Uniformen feister Herren; auf den schwitzenden Gesichtern der Lakaien, die mit den Erfrischungen umherliefen. Es dufteten die Blumen, die in schönem Arrangement verteilt waren durch das ganze Lusthaus; es dufteten die Pariser Parfums all der deutschen Frauen; es dufteten die Zigarren der Industriellen und die Pomaden der schlanken Jünglinge in ihren kleidsam knappen S.S.-Uniformen; es dufteten die Prinzen und die Prinzessinnen, die Chefs der Geheimen Staatspolizei, die Feuilletonchefs, die Filmdivas, die Universitätsprofessoren, die einen Lehrstuhl für Rassen- oder Wehrwissenschaft innehatten, und die wenigen jüdischen Bankiers, deren Reichtum und internationale Beziehungen so gewaltig waren, dass man sie sogar an dieser exklusiven Veranstaltung teilhaben ließ. Man verbreitete Wolken künstlichen Wohlgeruchs, als gälte es, ein anderes Aroma nicht aufkommen zu lassen – den faden, süßlichen Gestank des Blutes, den man zwar liebte und von dem das ganze Land erfüllt war, dessen man sich aber bei so feinem Anlass und in Gegenwart der fremden Diplomaten ein wenig schämte.
»Tolle Sache«, sagte ein hoher Herr von der Reichswehr zum anderen. »Was der Dicke sich alles leistet!«
»So lange wir es uns gefallen lassen«, sagte der Zweite. Sie machten gutgelaunte Gesichter; denn sie wurden fotografiert.
»Lotte soll ein Kleid anhaben, das dreitausend Mark kostet«, erzählte eine Filmschauspielerin dem Hohenzollernprinzen, mit dem sie tanzte. Lotte war das Eheweib des Gewaltigen mit den vielen Titeln, der sich zu seinem 43. Geburtstag feiern ließ wie ein Märchenprinz. Lotte war eine Provinzschauspielerin gewesen und galt als herzensgute, schlichte, urdeutsche Frau. An ihrem Hochzeitstage hatte der Märchenprinz zwei Proleten hinrichten lassen.
Der Hohenzollernprinz sagte: »Einen solchen Aufwand hat meine Familie niemals getrieben. – Wann wird das hohe Paar denn übrigens Einzug halten? Unsere Erwartung soll wohl auf das Äußerste gesteigert werden!«
»Lottchen versteht’s«, meinte sachlich die ehemalige Kollegin der Landesmutter.
Ein ausgesprochen herrliches Fest: alle Anwesenden schienen es aufs Intensivste zu genießen, sowohl die mit den Ehrenkarten, als auch die anderen, die fünfzig Mark hatten zahlen müssen, um dabei sein zu dürfen. Man tanzte, schwatzte, flirtete; man bewunderte sich selbst, die anderen und am meisten die Macht, die sich so üppige Veranstaltungen wie diese gönnen durfte. In den Logen und Wandelgängen, an den verführerischen Buffets waren die Konversationen sehr lebhaft. Man diskutierte über die Toiletten der Damen, über das Vermögen der Herren und über die Preise, welche die Wohltätigkeits-Tombola bringen würde: als das wertvollste Stück wurde ein Hakenkreuz aus Brillanten genannt, etwas sehr Niedliches und Teures, als Brosche oder als Anhänger an einem Collier zu tragen. Eingeweihte wollten wissen, dass es auch höchst amüsante Trostpreise geben würde, zum Beispiel naturgetreu nachgebildete Tanks und Maschinengewehre aus Lübecker Marzipan. Einige Damen behaupteten launig, dass sie noch lieber ein Mordinstrument aus so süßem Stoff haben wollten, als das kostbare Hakenkreuz. Es wurde viel und herzlich gelacht. Mit gedämpfteren Stimmen besprach man sich über die politischen Hintergründe der Veranstaltung. Es fiel auf, dass der Diktator abgesagt hatte und mehrere Parteiprominente nicht eingeladen worden waren; dass man aber Mitglieder der fürstlichen Familien in so großer Anzahl anwesend sah. An diesen Umstand knüpften sich mancherlei dunkle und bedeutungsvolle Gerüchte, die man sich im Flüsterton weitergab. Auch über den Gesundheitszustand des Diktators wollte der oder jener finstere Neuigkeiten wissen; man besprach sie leise und leidenschaftlich, sowohl im Kreise der auswärtigen Pressevertreter und Diplomaten, als auch bei den Herren von der Reichswehr und der Schwerindustrie.
»Es scheint also doch Krebs zu sein«, berichtete hinter vorgehaltenem Taschentuch ein Herr von der englischen Presse dem Pariser Kollegen. Bei diesem aber war er an den Falschen geraten. Pierre Larue hatte das Aussehen eines höchst gebrechlichen, dabei recht tückischen Zwerges; schwärmte aber für den Heroismus und für die schönen uniformierten Burschen des neuen Deutschland. Übrigens war er kein Journalist, sondern ein reicher Mann, der verklatschte Bücher über das gesellschaftliche, literarische und politische Leben der europäischen Hauptstädte schrieb und dessen Lebensinhalt es bedeutete, berühmte Bekanntschaften zu sammeln. Dieser ebenso groteske wie anrüchige kleine Kobold, mit dem spitzen Gesichtchen und der lamentierenden Fistelstimme einer kränklichen alten Dame, verachtete die Demokratie seines eigenen Landes und erklärte jedem, der es hören wollte, dass er Clemenceau für einen Schurken und Briand für einen Idioten halte, jeden höheren Gestapo-Beamten1 Beamten jedoch für einen Halbgott und die Spitzen des neudeutschen Regimes für eine Garnitur von tadellosen Göttern.
»Was verbreiten Sie für infamen Unsinn, mein Herr!« Das Männchen schaute erschreckend boshaft; seine Stimme raschelte dürr wie gefallenes Laub. »Der Gesundheitszustand des Führers lässt nichts zu wünschen übrig. Er ist nur ein bisschen erkältet.«
Diesem kleinen Scheusal war es zuzutrauen, dass es hinging und denunzierte. Der englische Korrespondent wurde nervös; er versuchte, sich zu rechtfertigen: »Ein italienischer Kollege hat mir im Vertrauen so etwas angedeutet …« Aber der schmächtige Liebhaber prall gefüllter Uniformen schnitt ihm mit Strenge das Wort ab: »Genug, mein Herr! Ich will nichts mehr hören! Das ist alles unverantwortliches Geschwätz! – Entschuldigen Sie«, fügte er sanfter hinzu. »Ich muss den Exkönig von Bulgarien begrüßen. Die Prinzessin von Hessen ist bei ihm, ich habe die Bekanntschaft Ihrer Hoheit am Hofe ihres Vaters in Rom gemacht.« Er rauschte davon, die bleichen und spitzen Händchen auf der Brust gefaltet, in der Haltung und mit dem Gesichtsausdruck eines intriganten Abbés. Der Engländer murmelte hinter ihm her: »Damned snob.«
Eine Bewegung ging durch den Saal, es gab ein hörbares Rauschen: der Propagandaminister war eingetreten. Man hatte ihn heute Abend nicht hier erwartet, alle wussten um seine gespannte Beziehung zu dem fetten Geburtstagskind – das sich übrigens seinerseits noch immer verborgen hielt, um aus seinem Entrée dann den ganz großen Clou zu machen.
Der Propagandaminister – Herr über das geistige Leben eines Millionenvolkes – humpelte behände durch die glänzende Menge, die sich vor ihm verneigte. Eine eisige Luft schien zu wehen, wo er vorbeiging. Es war, als sei eine böse, gefährliche, einsame und grausame Gottheit herniedergestiegen in den ordinären Trubel genusssüchtiger, feiger und erbärmlicher Sterblicher. Einige Sekunden lang war die ganze Gesellschaft wie gelähmt von Entsetzen. Die Tanzenden erstarrten mitten in ihrer anmutigen Pose und ihr scheuer Blick hing, zugleich demütig und hassvoll, an dem gefürchteten Zwerg. Der versuchte durch ein charmantes Lächeln, welches seinen mageren, scharfen Mund bis zu den Ohren hinaufzerrte, die schauerliche Wirkung, die von ihm ausging, ein wenig zu mildern; er gab sich Mühe, zu bezaubern, zu versöhnen und seine tief liegenden, schlauen Augen freundlich blicken zu lassen. Seinen Klumpfuß graziös hinter sich her ziehend, eilte er gewandt durch den Festsaal und zeigte dieser Gesellschaft von zweitausend Sklaven, Mitläufern, Betrügern, Betrogenen und Narren sein falsch-bedeutendes Raubvogel-Profil. An den Gruppen von Millionären, Botschaftern, Regimentskommandanten und Filmstars huschte er, tückisch lächelnd, vorüber. Es war der Intendant Hendrik Höfgen, Staatsrat und Senator, bei welchem er stehen blieb.
Noch eine Sensation! Intendant Höfgen gehörte zu den deklarierten Favoriten des Ministerpräsidenten und Fliegergenerals, der seine Berufung an die Spitze der Staatstheater durchgesetzt hatte gegen den Willen des Propagandaministers. Dieser war, nach einem langen und heftigen Kampf, dazu gezwungen worden, seinen eigenen Protegé, den Dichter Cäsar von Muck, zu opfern und auf Reisen zu schicken. Nun aber ehrte er demonstrativ das Geschöpf seines Feindes durch seine Begrüßung und durch sein Gespräch. Wollte der schlaue Meister der Propaganda auf solche Weise vor der internationalen Elitegesellschaft bekunden, dass es Unstimmigkeiten und Ränke zwischen den Spitzen des deutschen Regimes garnicht gebe und dass die Eifersucht zwischen ihm, dem Reklamechef, und dem Fliegergeneral ins hässliche Gebiet der Gräuelmärchen gehöre? Oder war Hendrik Höfgen – eine der meistbesprochenen Figuren der Hauptstadt – seinerseits so unermesslich schlau, dass er es fertig brachte, zum Propagandaminister ebenso intime Beziehungen zu unterhalten wie zum Fliegergeneral-Ministerpräsidenten? Spielte er den einen Machthaber gegen den anderen aus, ließ sich von den beiden großen Konkurrenten protegieren? Seiner legendären Geschicklichkeit wäre es zuzutrauen …
Das war ja alles ungeheuer interessant! Pierre Larue ließ den Exkönig von Bulgarien einfach stehen und trippelte durch den Saal – von seiner Neugierde dahingeweht, wie eine Feder vom Winde –, um dieses sensationelle Rencontre2 aus der nächsten Nähe mit anzuschauen. Cäsar von Mucks stählerne Augen kniffen sich misstrauisch zusammen, die Millionärin aus Köln stöhnte wollüstig vor lauter Angeregtheit und Freude an der erhabenen Situation; während Frau Bella Höfgen, die Mutter des großen Mannes, allen, die in ihrer Nähe standen, gnädig und gleichsam ermunternd zulächelte, als wollte sie ihnen bedeuten: Mein Hendrik ist groß und ich bin seine distinguierte Mutter. Trotzdem braucht ihr nun nicht gleich in die Knie zu sinken. Er und ich, wir sind auch nur von Fleisch und Blut, wenngleich sonst ausgezeichnet vor den übrigen Menschen.
»Wie geht es Ihnen, mein lieber Höfgen?« fragte der Propagandaminister anmutig lächelnd den Intendanten.
Auch der Intendant lächelte, aber nicht gleich bis zu den Ohren hinauf, sondern mit einer Vornehmheit, die fast schmerzlich wirkte. »Ich danke Ihnen, Herr Minister!« Er sprach leise, etwas singenden Tones, dabei äußerst akzentuiert. Der Minister hatte seine Hand noch immer nicht losgelassen. »Darf ich mich nach dem Befinden Ihrer Frau Gemahlin erkundigen«, sagte der Intendant, und nun musste sein hoher Gesprächspartner endlich ein ernstes Gesicht machen. »Sie ist heute Abend ein wenig unpässlich.« Dabei ließ er die Hand des Senators und Staatsrats los. Dieser sagte wehmütig: »Wie leid mir das tut.«
Natürlich wusste er – was allen hier im Saale bekannt war –, dass die Frau des Propagandaministers völlig verzehrt und innerlich verwüstet war, von Eifersucht auf die Gattin des Ministerpräsidenten. Da der Diktator selber unverehelicht blieb, war das angetraute Weib des Reklamechefs die Erste Dame im Reiche gewesen, und sie hatte diese ihre gottgewollte Funktion mit Anstand und Würde erfüllt, ihr Todfeind konnte es nicht bestreiten. Dann aber kam diese Lotte Lindenthal daher, eine mittlere Schauspielerin – jung war sie auch nicht mehr –, und ließ sich heiraten von dem prachtliebenden Dicken. Die Frau des Propagandaministers litt unbeschreiblich. Man machte ihr den Rang der Ersten Dame streitig! Eine andere drängte sich vor! Mit einer Komödiantin ward ein Kult getrieben, als ob die Königin Luise auferstanden wäre! Immer wenn es eine Veranstaltung zu Lottes Ehren gab, ärgerte sich Frau Reklamechef so ungeheuer, dass sie Migräne bekam. Auch heute Abend war sie im Bett geblieben.
»Gewiss hätte sich Ihre Frau Gemahlin hier sehr gut unterhalten.« Höfgen machte immer noch die feierliche Miene. In seinen Worten war von Ironie keine Spur zu finden. »Zu schade, dass der Führer absagen musste. Auch der englische und der französische Botschafter sind verhindert.«
Mit diesen Feststellungen, die er in sanftestem Tone vorbrachte, verriet Höfgen seinen eigentlichen Freund und Gönner – den Ministerpräsidenten, dem er all seinen Glanz zu danken hatte – an den eifersüchtigen Propagandaminister: diesen aber hielt er sich für alle Fälle in der Reserve.
Der gewandte Klumpfuß fragte vertraulich, nicht ohne Hohn: »Und wie ist hier die Stimmung?«
Der Intendant der Staatstheater sagte zurückhaltend: »Man scheint sich zu amüsieren.«
Die beiden Würdenträger führten ihre Unterhaltung leise; denn um sie drängten sich Neugierige, auch mehrere Fotografen waren herbeigekommen. Die Kanonenfabrikantin flüsterte eben Pierre Larue zu, der in Verzückung die bleichen Knochenhändchen über der Brust gegeneinander rieb: »Unser Intendant und der Minister – sind sie nicht ein herrliches Paar? Beide so bedeutend! Beide so schön!« Sie drängte ihren üppigen, geschmückten Leib nahe an das gebrechliche Körperchen des Kleinen. Der zarte gallische Liebhaber des germanischen Heroismus, der strammen Jünglinge, des Führergedankens und der hohen Adelsnamen fürchtete sich vor der atmenden Nähe so viel weiblichen Fleisches. Er versuchte, sich ein wenig zurückzuziehen, während er zirpte: »Exquisit! Ganz charmant! Unvergleichlich!« Die Rheinländerin beteuerte: »Unser Höfgen – das ist ein ganzer Mann, sage ich Ihnen! Ein Genie, so etwas gibt es weder in Paris noch in Hollywood! Und so urdeutsch, so gerade, einfach und ehrlich! Ich habe ihn ja schon gekannt, als er noch so klein gewesen ist.« Mit der vorgestreckten Hand deutete sie an, wie klein Hendrik gewesen war, als sie, die Millionärin, seine Mutter auf den Kölner Wohltätigkeitsveranstaltungen konsequent geschnitten hatte. »Ein herrlicher Junge!« sagte sie noch, und bekam so sinnliche Augen, dass Larue panisch die Flucht ergriff.
Man hätte Hendrik Höfgen für einen Mann von etwa fünfzig Jahren gehalten; er war aber erst neununddreißig – ungeheuer jung für seinen hohen Posten. Seine fahle Miene mit der Hornbrille zeigte jene steinerne Ruhe, zu der sich sehr nervöse und sehr eitle Menschen zwingen können, wenn sie sich von vielen Leuten beobachtet wissen. Sein kahler Schädel hatte edle Form. Im aufgeschwemmten, grauweißen Gesicht fiel der überanstrengte, empfindliche und leidende Zug auf, der von den hochgezogenen blonden Brauen zu den vertieften Schläfen lief; außerdem die markante Bildung des starken Kinns, das er auf stolze Art hochgereckt trug, sodass die vornehm schöne Linie zwischen Ohr und Kinn kühn und herrisch betont ward. Auf seinen breiten und blassen Lippen lag ein erfrorenes, vieldeutiges, zugleich höhnisches und um Mitleid werbendes Lächeln. Hinter den großen, spiegelnden Brillengläsern wurden seine Augen nur zuweilen sichtbar und wirksam: dann erkannte man, nicht ohne Schrecken, dass sie, bei aller Weichheit, eiskalt, bei aller Melancholie sehr grausam waren. Diese grüngrau schillernden Augen ließen an Edelsteine denken, die kostbar sind, aber Unglück bringen; gleichzeitig an die gierigen Augen eines bösen und gefährlichen Fisches. – Alle Damen und die meisten Herren fanden, dass Hendrik Höfgen nicht nur ein bedeutender und höchst geschickter, sondern auch ein bemerkenswert schöner Mann sei. Seine zusammengenommene, vor lauter bewusster und berechneter Anmut fast steife Haltung und sein kostbarer Frack ließen es übersehen, dass er entschieden zu fett war, vor allem in der Hüftengegend und am Hinterteil.
»Ich muss Ihnen übrigens zu Ihrem Hamlet gratulieren, mein Lieber«, sprach der Propagandaminister. »Eine famose Leistung. Die deutsche Bühne kann stolz auf Sie sein.«
Höfgen neigte ein wenig das Haupt, indem er das schöne Kinn etwas nach unten drückte: oberhalb des hohen, blendenden Kragens entstanden zahlreiche Falten am Hals. »Wer vor dem Hamlet versagt, verdient den Namen eines Schauspielers nicht.« Seine Stimme klagte vor Bescheidenheit. Der Minister konnte eben noch konstatieren: »Sie haben die Tragödie ganz gefühlt« – da ging ein ungeheurer Aufruhr durch den Saal.
Der Fliegergeneral und seine Gattin, die gewesene Aktrice Lotte Lindenthal, waren durch die große Mitteltüre eingetreten: brausendes Beifallsklatschen und dröhnender Zuruf begrüßten sie. Durch ein Spalier von Menschen, aus dem Jubel stieg, schritt das erlauchte Paar. Kein Kaiser hatte jemals schöneren Einzug gehalten. Der Enthusiasmus schien ungeheuer: Jeder von den zweitausend auserlesen feinen Menschen wollte sich, den anderen und dem Ministerpräsidenten, durch möglichst lautes Geschrei und Händeklatschen beweisen, einen wie glühenden Anteil er am 43. Geburtstag des Hohen Herrn im Besonderen und am Nationalen Staate im Allgemeinen nahm. Man brüllte: »Hoch!«, »Heil!« und: »Wir gratulieren!« Man warf Blumen, die von Frau Lotte mit würdevoller Grazie empfangen wurden. Die Kapelle spielte großen Tusch. Der Propagandaminister bekam ein hassverzerrtes Gesicht; aber darauf achtete niemand, außer vielleicht Hendrik Höfgen. Dieser stand unbeweglich: er erwartete seinen Gönner in zusammengenommener, anmutig steifer Haltung.
Man hatte Wetten darüber abgeschlossen, in welcher Fantasieuniform der Dicke heute Abend erscheinen würde. Es war eine asketische Koketterie von ihm, nun die Gesellschaft durch den allerschlichtesten Aufzug zu verblüffen. Die flaschengrüne Litewka3 die er trug, wirkte fast wie eine streng geschnittene Hausjacke. Auf der Brust blitzte ihm nur ein ganz kleiner silberner Ordensstern. In den grauen Hosen wirkten seine Beine – die er sonst gerne unter langen Mänteln verbarg – besonders umfangreich: es waren Säulen, auf denen er sich langsam dahinbewegte. Die kolossalische Größe und Breite seiner monströsen Figur waren geeignet, Schrecken und Ehrfurcht um sich zu verbreiten – zumal kein Anlass bestand, irgendetwas an ihm komisch zu finden: dem Kühnsten verging das Lachen, wenn er erwog, wie viel Blut schon auf den Wink des Speck- und Fleisch-Riesen geflossen war und wie unermesslich viel Blut vielleicht noch strömen würde zu seinen Ehren. Auf dem kurzen, wulstigen Hals erschien sein massives Haupt wie übergossen von dem roten Safte: das Haupt eines Cäsars, von dem man die Haut abgezogen hat. An diesem Gesicht war nichts Menschliches mehr: es war aus rohem, ungeformtem Fleisch, ein Klotz.
Der Ministerpräsident schob seinen Bauch, dessen enorme Wölbung in die der Brust überging, majestätisch durch die strahlende Versammlung. Der Ministerpräsident grinste.
Sein Weib Lotte grinste nicht, sondern verschenkte Lächeln, eine Königin Luise in jedem Zoll. Auch ihre Robe, deren Kostbarkeit den Gesprächsstoff der Damen gebildet hatte, war einfach bei allem Pomp: glatt fließend, aus einem schimmernden Silbergewebe, endend in einer königlich langen Schleppe. Das Brillantendiadem aber in der ährenblonden Frisur, die Perlen und Smaragde auf dem Busen übertrafen an Gewicht und Strahlenglanz alles, was es sonst noch zu bewundern gab in dieser üppigen Runde. Das riesenhafte Geschmeide der Provinzschauspielerin repräsentierte Millionenwerte: sie verdankte es der Galanterie eines Gatten, der gerne die Prunksucht und Korrumpiertheit republikanischer Minister und Bürgermeister in öffentlicher Rede geißelte, und der Treue einiger wohlsituierter und bevorzugter Untertanen. Frau Lotte verstand es, Aufmerksamkeiten von solchem Gewicht mit jener anspruchslosen Heiterkeit hinzunehmen, die ihr den Ruf der naiven und mütterlichen, verehrungswürdigen Frau einbrachte. Sie galt als uneigennützig, unantastbar rein. Sie war zur Idealgestalt geworden unter den deutschen Frauen. Sie hatte große, runde, etwas hervortretende Kuhaugen von einem feuchtstrahlenden Blau; schönes blondes Haar und einen schneeweißen Busen. Übrigens war auch sie schon ein wenig zu dick – man speiste gut und reichlich im Präsidentenpalais. Man erzählte sich bewundernd von ihr, dass sie sich gelegentlich bei ihrem Gatten für Juden aus der guten Gesellschaft einsetze – die Juden kamen trotzdem ins Konzentrationslager. Man nannte sie den guten Engel des Ministerpräsidenten; indessen war der Fürchterliche nicht milder geworden, seitdem sie ihn beriet. Eine ihrer berühmtesten Rollen war die Lady Milford in Schillers »Kabale und Liebe« gewesen: jene Mätresse eines Gewaltigen, die den Glanz ihres Geschmeides und die Nähe ihres Fürsten nicht mehr erträgt, da sie erfahren hat, womit man Edelsteine bezahlt. Als sie zum letzten Mal im Staatstheater auftrat, spielte sie die Minna von Barnhelm: so deklamierte sie, ehe sie in den Palast des Fliegergenerals übersiedelte, noch einmal die Sätze eines Dichters, den ihr Gemahl und seine Spießgesellen hetzen und verfolgen lassen würden, lebte er heute und hier. In ihrer Gegenwart wurden die schauerlichen Geheimnisse des totalen Staates besprochen: sie lächelte mütterlich. Morgens, wenn sie ihrem Gatten neckisch über die Schulter lugte, sah sie Todesurteile vor ihm auf dem Renaissanceschreibtisch – und er unterzeichnete sie; abends zeigte sie den weißen Busen und die ährenblonde Kunstfrisur in Opernpremieren oder an den geschmückten Tafeln der Bevorzugten, die ihres Umgangs gewürdigt wurden. Sie war unberührbar, unangreifbar; denn sie war ahnungslos und sentimental. Sie glaubte sich umgeben von der »Liebe ihres Volkes«, weil zweitausend Ehrgeizige, Käufliche und Snobs Lärm machten zu ihren Ehren. Sie schritt durch den Glanz und verschenkte Lächeln – mehr verschenkte sie nie. Sie glaubte allen Ernstes, dass Gott ihr wohlwollte, weil er ihr so viel Geschmeide hatte zukommen lassen. Mangel an Fantasie und an Intelligenz bewahrte sie davor, an eine Zukunft zu denken, die mit dieser schönen Gegenwart vielleicht wenig Ähnlichkeit haben würde. Wie sie dahinschritt, erhobenen Hauptes, übergossen vom Licht und von der allgemeinen Bewunderung, gab es keinen Zweifel in ihrem Herzen an der Haltbarkeit solchen Zaubers. Niemals – so meinte sie zuversichtlich – niemals würde abfallen von ihr dieser Glanz; niemals würden die Gemarterten sich rächen, niemals würde die Finsternis nach ihr greifen.
Immer noch wurde Tusch gespielt, ebenso laut wie ausführlich; immer noch dauerte das huldigende Geschrei. Inzwischen waren Lotte und ihr Dicker beim Propagandaminister und bei Höfgen angekommen. Die drei Herren hoben flüchtig die Arme, die Grußzeremonie lässig andeutend. Dann neigte Hendrik sich mit einem ernsten und innigen Lächeln über die Hand der großen Dame, die er so oft auf der Bühne hatte umarmen dürfen. – Hier standen sie, dargeboten der brennenden Neugier einer gewählten Öffentlichkeit: vier Mächtige in diesem Lande, vier Gewalthaber, vier Komödianten – der Reklamechef, der Spezialist für Todesurteile und Bombenflugzeuge, die geheiratete Sentimentale und der fahle Intrigant. Die gewählte Öffentlichkeit beobachtete, wie der Dicke dem Herrn Intendanten auf die Schulter schlug, dass es krachte, und sich mit einem grunzenden Lachen erkundigte: »Na, wie geht’s, Mephisto?«
Vom ästhetischen Gesichtspunkt aus war die Situation für Höfgen vorteilhaft: neben dem gar zu ausladenden Ehepaar wirkte er schlank, und neben dem agilen aber krüppelhaften Reklamezwerg hochgewachsen und stattlich. Übrigens bildete auch sein Gesicht, so fahl und fatal es sein mochte, einen immerhin erfreulichen Gegensatz zu den drei Gesichtern, die es umgaben: mit den empfindlichen Schläfen und dem kräftig geprägten Kinn erschien es doch als das Antlitz eines Menschen, der gelebt und gelitten hat; das Gesicht seines fleischigen Protektors aber war eine verquollene Maske; das der Sentimentalen eine törichte Larve und das des Propagandisten eine verzerrte Fratze.
Die Sentimentale sagte mit seelenvollem Blick zum Intendanten, für den sie eine geheime – jedoch nicht gar zu geheime – Zuneigung im Busen trug: »Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, Hendrik, wie wunderschön ich Ihren Hamlet finde.« Er drückte ihr schweigend die Hand, wobei er einen Schritt näher an sie herantrat und ebenso innig zu blicken versuchte, wie es ihr von der Natur gegeben war. Der Versuch musste missglücken: seine fischigen Juwelenaugen gaben so viel sanfte Wärme nicht her. Deshalb machte er ein ernstes, beinah etwas ärgerliches, offizielles Gesicht und murmelte: »Ich muss ein paar Worte sprechen.« Dann erhob er die Stimme.
Sie hatte einen leuchtenden, raffiniert geschulten Metallton und war bis in die entferntesten Winkel des großen Saales hörbar und wirksam, als sie ausrief: »Herr Ministerpräsident! Hoheiten, Exzellenzen, meine Damen und Herren! Wir sind stolz – ja, wir sind stolz und froh, dass wir dieses Fest heute in diesem Hause mit Ihnen, Herr Ministerpräsident, und mit Ihrer wundervollen Gattin begehen dürfen …«
Mit dem ersten seiner Worte war das bewegte Gespräch der Zweitausend-Personen-Gesellschaft verstummt. In vollkommener Stille, in devoter Regungslosigkeit lauschte man der langen, pathetischen und platten Glückwunschrede, die der Intendant, Senator und Staatsrat für seinen Ministerpräsidenten hielt. Alle Augen waren auf Hendrik Höfgen gerichtet. Alle bewunderten ihn. Er gehörte zur Macht. Er war ihres Schimmers teilhaftig – so lange der Schimmer hielt. Von ihren Repräsentanten war er einer der Feinsten und Gewandtesten. Seine Stimme brachte, anlässlich des 43. Geburtstages seines Herrn, die überraschendsten Jubeltöne hervor. Er hielt das Kinn hochgereckt, die Augen schimmerten, seine sparsamen und kühnen Gesten hatten den schönsten Schwung. Er vermied es aufs Sorgsamste, ein wahres Wort zu sagen. Der skalpierte Cäsar, der Reklamechef und die Kuhäugige schienen darüber zu wachen, dass nur Lügen, nichts als Lügen von seinen Lippen kämen: eine geheime Verabredung verlangte es so, in diesem Saale wie im ganzen Land.
Während er sich dem Ende seiner Ansprache mit bravourös gesteigertem Tempo näherte, flüsterte eine hübsche, kindlich aussehende kleine Dame – die Gattin eines bekannten Filmregisseurs –, die im Hintergrund des Raumes ein bescheidenes Plätzchen hatte, tonlos ihrer Nachbarin zu:
»Wenn er fertig ist, muss ich hingehen und ihm die Hand schütteln. Ist es nicht fantastisch? Ich kenne ihn doch noch von früher – ja, wir sind in Hamburg zusammen engagiert gewesen. Das waren ulkige Zeiten! Und was hat der Mensch seitdem für eine Karriere gemacht!!«
Gestapo: Die Geheime Staatspolizei, auch kurz Gestapo genannt, war ein kriminalpolizeilicher Behördenapparat und die Politische Polizei während der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945. <<<
Zusammenstoß, feindliche Begegnung <<<
Uniformrock mit Umlegekragen <<<
I. H.K.
In den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz. Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt a.M.: in dem engen, stimmungsvoll intimen Kellerraum traf sich die intellektuelle Gesellschaft der Stadt und vor allem eine angeregte, von den Ereignissen aufgewühlte, diskussions- und beifallsfreudige Jugend, wenn es die Neuinszenierung eines Stückes von Wedekind oder Strindberg gab oder eine Uraufführung von Georg Kaiser, Sternheim, Fritz von Unruh, Hasenclever oder Toller. Oskar H. Kroge, der selbst Essays und hymnische Gedichte schrieb, empfand das Theater als die moralische Anstalt: von der Schaubühne sollte eine neue Generation erzogen werden zu den Idealen, von denen man damals glaubte, dass die Stunde ihrer Erfüllung gekommen sei – zu den Idealen der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens. Oskar H. Kroge war pathetisch, zuversichtlich und naiv. Am Sonntagvormittag, vor der Aufführung eines Stückes von Tolstoi oder von Rabindranath Tagore, hielt er eine Ansprache an seine Gemeinde. Das Wort »Menschheit« kam häufig vor; den jungen Leuten, die sich im Stehparkett drängten, rief er mit bewegter Stimme zu: »Habet den Mut zu euch selbst, meine Brüder!« – und er erntete Beifallsstürme, da er mit den Schillerworten schloss: »Seid umschlungen, Millionen!«
Oskar H. Kroge war sehr beliebt und angesehen in Frankfurt a.M. und überall dort im Lande, wo man an den kühnen Experimenten eines geistigen Theaters Anteil nahm. Sein ausdrucksvolles Gesicht mit der hohen, zerfurchten Stirn, der schütteren, grauen Haarmähne und den gutmütigen, gescheiten Augen hinter der Brille mit schmalem Goldrand war häufig zu sehen in den kleinen Revuen der Avantgarde; zuweilen sogar in den großen Illustrierten. Oskar H. Kroge gehörte zu den aktivsten und erfolgreichsten Vorkämpfern des dramatischen Expressionismus.
Es war ohne Frage ein Fehler von ihm gewesen – nur zu bald sollte es ihm klar werden –, sein stimmungsvolles kleines Haus in Frankfurt aufzugeben. Das Hamburger Künstlertheater, dessen Direktion man ihm im Jahre 1923 anbot, war freilich größer. Deshalb akzeptierte er. Das Hamburger Publikum aber erwies sich als längst nicht so zugänglich dem leidenschaftlichen und anspruchsvollen Experiment, wie jener zugleich routinierte und enthusiastische Kreis, der den Frankfurter Kammerspielen treu gewesen war. Im Hamburger Künstlertheater musste Kroge, außer den Dingen, die ihm am Herzen lagen, immer noch den »Raub der Sabinerinnen« und »Pension Schöller« zeigen. Darunter litt er. Jeden Freitag, wenn der Spielplan für die kommende Woche festgesetzt wurde, gab es einen kleinen Kampf mit Herrn Schmitz, dem geschäftlichen Leiter des Hauses. Schmitz wollte die Possen und Reißer angesetzt haben, weil sie Zugstücke waren; Kroge aber bestand auf dem literarischen Repertoire. Meistens musste Schmitz, der übrigens eine herzliche Freundschaft und Bewunderung für Kroge hatte, nachgeben. Das Künstlertheater blieb literarisch – was seinen Einnahmen schädlich war.
Kroge klagte über die Indifferenz der Hamburger Jugend im Besonderen und über die Ungeistigkeit einer Öffentlichkeit im Allgemeinen, die sich allem Höheren entfremdet habe. »Wie schnell es gegangen ist!« stellte er mit Bitterkeit fest. »Im Jahre 1919 lief man noch zu Strindberg und Wedekind; 1926 will man nurmehr Operetten.« Oskar H. Kroge war anspruchsvoll und übrigens ohne prophetischen Geist. Hätte er sich beschwert über das Jahr 1926, wenn er sich hätte vorstellen können, wie das Jahr 1936 aussehen würde? – »Nichts Besseres zieht mehr«, grollte er noch. »Sogar bei den ›Webern‹ gestern ist das Haus halb leer gewesen.«
»Immerhin kommen wir doch zur Not noch auf unsere Rechnung.« Direktor Schmitz bemühte sich, den Freund zu trösten: Die Kummerfalten in Kroges gutmütigem und kindlichem alten Katergesicht taten ihm weh, wenngleich er doch selber allen Grund zur Sorge und auch schon mehrere Falten hatte in seiner feisten, rosigen Miene.
»Aber wie!« Kroge wollte sich durchaus nicht trösten lassen. »Aber wie kommen wir denn auf unsere Rechnung! Berühmte Gäste aus Berlin müssen wir uns einladen – so wie heute Abend –, damit die Hamburger ins Theater gehen.«
Hedda von Herzfeld – Kroges alte Mitarbeiterin und Freundin, die schon in Frankfurt Dramaturgin und Schauspielerin bei ihm gewesen war – bemerkte: »Du siehst wieder mal alles schwarz in schwarz, Oskar H.! Es ist ja schließlich keine Schande, Dora Martin gastieren zu lassen – sie ist wundervoll –, und übrigens kommen unsere Hamburger auch, wenn Höfgen spielt.« Während sie Höfgens Namen aussprach, lächelte Frau von Herzfeld klug und zärtlich. Über ihr großes, matt gepudertes Gesicht mit der fleischigen Nase, den großen, goldbraunen, wehmütig intelligenten Augen ging ein bescheidenes Aufleuchten.
Kroge sagte brummig: »Höfgen wird überzahlt.«
»Die Martin übrigens auch«, fügte Schmitz hinzu. »Ihren ganzen Zauber in Ehren und zugegeben, dass sie ungeheuer zieht: aber tausend Mark Abendgage, das ist doch wohl ein bisschen toll.«
»Berliner Staransprüche«, machte Hedda spöttisch. Sie hatte in Berlin nie zu tun gehabt und behauptete, den Betrieb der Hauptstadt zu verachten.
»Tausend Mark im Monat für Höfgen ist auch übertrieben«, behauptete Kroge, plötzlich gereizt. »Seit wann hat er denn eigentlich tausend?« fragte er herausfordernd Schmitz. »Es sind doch immer nur achthundert gewesen, und das war reichlich genug.«
»Was soll ich machen?« Schmitz entschuldigte sich. »Er ist zu mir ins Büro gesprungen und er hat sich mir auf den Schoß gesetzt.« Frau von Herzfeld konnte mit Belustigung feststellen, dass Schmitz etwas rot wurde, während er dies erzählte. »Er hat mich am Kinn gekitzelt und hat immer wieder gesagt: ›Tausend Mark müssen es sein! Tausend, Direktorchen! Es ist eine so schöne runde Summe!‹ Was sollte ich da machen, Kroge? Sagen Sie selbst!«
Es war Höfgens schlaue Gewohnheit, wie ein nervöser kleiner Sturmwind in Schmitzens Büro zu fahren, wenn er Vorschuss oder Gagenerhöhung wollte. Zu solchen Anlässen spielte er den übermütig Launischen und Kapriziösen, und er wusste, dass der ungeschickte dicke Schmitz verloren war, wenn er ihm die Haare zauste und den Zeigefinger munter in den Bauch stieß. Da es sich um die tausend-Mark-Gage handelte, hatte er sich ihm sogar auf den Schoß gesetzt: Schmitz gestand es unter Erröten.
»Das sind Albernheiten!« Kroge schüttelte ärgerlich das versorgte Haupt. »Überhaupt ist Höfgen ein grundalberner Mensch. Alles an ihm ist falsch, von seinem literarischen Geschmack bis zu seinem sogenannten Kommunismus. Er ist kein Künstler, sondern ein Komödiant.«
»Was hast du gegen unseren Hendrik?« Frau von Herzfeld zwang sich zu einem ironischen Ton; in Wahrheit war ihr keineswegs nach Ironie zumute, wenn sie von Höfgen sprach, für dessen geübte Reize sie nur zu empfänglich war. »Er ist unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren.«
»Ich bin gar nicht so besonders stolz auf ihn«, sagte Kroge. »Er ist doch nicht mehr als ein routinierter Provinzschauspieler, und das weiß er übrigens im Grunde selbst ganz genau.«
Schmitz fragte: »Wo steckt er denn heute Abend?« – worauf Frau von Herzfeld leise durch die Nase lachte: »Er hat sich in seiner Garderobe hinter einem Paravent versteckt – der kleine Böck hat es mir erzählt. Er ist immer furchtbar aufgeregt und eifersüchtig, wenn Berliner Gäste da sind. So weit wie die werde er es niemals bringen, sagt er dann – und versteckt sich hinter einem Paravent, vor lauter Hysterie. Die Martin bringt ihn wohl besonders aus der Fassung, das ist so eine Art von Hassliebe bei ihm. Heute Abend soll er schon einen Weinkrampf gehabt haben.«
»Da seht ihr seinen Minderwertigkeitskomplex!« rief Kroge und schaute triumphierend um sich. »Oder vielmehr: dass er im Grunde irgendwo die richtige Einschätzung hat für sich selber.« –
Die Drei saßen in der Theaterkantine, die, nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters kurz »H. K.« genannt wurde. Über den Tischen mit den fleckigen Tüchern gab es eine verstaubte Bildergalerie: die Fotografien all jener, die sich im Lauf der Jahrzehnte hier produziert hatten. Frau von Herzfeld lächelte während des Gesprächs manchmal hinauf zu den Naiven und Sentimentalen, den komischen Alten, Heldenvätern, jugendlichen Liebhabern, Intriganten und Salondamen, die von Schmitz und Kroge übersehen wurden.
Drunten, im Theater, spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit des ephebischen Körpers und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren und Frau von Herzfeld hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen.
»Das Ensemble, das sie sich mitgebracht hat, ist ja wirklich unter jeder Kritik«, stellte Kroge verächtlich fest.
»Was wollen Sie?« meinte Schmitz. »Wie soll sie jeden Abend ihre tausend Mark verdienen, wenn sie sich auch noch teure Leute mit auf die Reise nimmt?«
»Aber sie selber wird immer besser«, sagte die kluge Herzfeld. »Sie kann sich jede Manieriertheit leisten. Sie kann wie ein geisteskrankes Baby sprechen: sie bezwingt.«
»Geisteskrankes Baby ist nicht schlecht«, lachte Kroge. »Man scheint unten fertig zu sein«, fügte er hinzu, mit einem Blick durchs Fenster. Die Leute kamen den gepflasterten Weg herauf, der vom Theater, an der Kantine vorbei, zu dem Tor führte, durch das man auf die Straße trat.
Nach und nach füllte sich die Kantine. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Väterchen Hansemann, der Kantinenbesitzer, war für das Ensemble eine beinah ebenso bedeutungsvolle Persönlichkeit wie Schmitz, der geschäftliche Direktor. Von Schmitz konnte man Vorschuss bekommen, wenn er sich gerade in gnädiger Laune befand; bei Hansemann aber musste man anschreiben lassen, wenn in der zweiten Monatshälfte die Gage aufgebraucht und ein Vorschuss nicht genehmigt worden war. Alle standen bei ihm in der Kreide; man behauptete, dass Höfgen ihm mehr als hundert Mark schuldig war. Hansemann hatte es also keineswegs nötig, auf die Witze seiner unsoliden Gäste einzugehen; unbewegten Gesichtes, drohenden Ernst auf der Stirn, servierte er Cognac, Bier und kalten Aufschnitt, den niemand bezahlte.
Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung; nur darüber, dass sie entschieden zu viel Geld verdiente, waren sich alle einig.
Die Motz erklärte: »An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde« – wozu ihr Freund Petersen grimmig nickte. Petersen war Väterspieler mit dem Ehrgeiz zum Heroischen; er bevorzugte Könige oder adlige alte Haudegen in historischen Stücken. Leider war er etwas zu klein und dick für diese Partien – was er auszugleichen suchte durch eine stramme und kampfeslustige Haltung. Zu seinem Gesicht, das den Ausdruck falscher Biederkeit zeigte, hätte ein grauer Schifferbart gepasst; da er fehlte, wirkte seine Miene ein wenig kahl, mit der langen, rasierten Oberlippe und den sehr blauen, ausdrucksvoll blitzenden, zu kleinen Augen. Die Motz liebte ihn mehr, als er sie: das wussten alle. Da er genickt hatte, wandte sie sich nun direkt an ihn, um in einem intimen und bedeutungsvollen Ton zu sagen: »Nicht wahr, Petersen: über diese Misswirtschaft haben wir schon häufig miteinander gesprochen?« Er bestätigte treuherzig: »Gewiss doch, Frau!« und blinzelte Rahel Mohrenwitz zu, die aufgemacht war als das perverse und dämonische junge Mädchen: mit schwarzen Ponies bis zu den rasierten Augenbrauen und einem großen, schwarzgerandeten Monokel im Gesicht, das übrigens kindlich, pausbäckig und völlig ungeformt war.
»In Berlin wirken die Martinschen Mätzchen vielleicht«, sprach die Motz resolut. »Aber unsereinem kann sie nichts vormachen, wir sind schließlich lauter alte Theaterhasen.« Sie blickte beifallheischend um sich. Ihr Fach war die komische Alte; zuweilen durfte sie auch reife Salondamen spielen. Sie lachte gern, viel und laut, wobei sie scharfe Falten um den Mund bekam, in dessen Innern Gold funkelte. Im Augenblick freilich zeigte sie eine würdevoll ernste, beinah zornige Miene.
Rahel Mohrenwitz sagte, wobei sie hochmütig mit ihrer langen Zigarettenspitze spielte: »Niemand kann schließlich leugnen, dass die Martin irgendwo eine enorm starke Persönlichkeit ist. Was sie auf der Bühne auch macht: immer ist sie unerhört intensiv da – ihr versteht, was ich meine …« Alle verstanden es; die Motz aber schüttelte missbilligend den Kopf, während die kleine Angelika Siebert mit ihrem hohen, schüchternen Stimmchen erklärte: »Ich bewundere die Martin. Es geht eine zauberhafte Kraft von ihr aus, finde ich …« Sie wurde sehr rot, weil sie einen so langen und gewagten Satz vorgebracht hatte. Alle sahen mit einer gewissen Rührung zu ihr hin. Die kleine Siebert war reizend. Ihr Köpfchen mit dem kurzgeschnittenen, links gescheitelten blonden Haar glich dem eines dreizehnjährigen Buben. Ihre hellen und unschuldigen Augen wurden dadurch nicht weniger anziehend, dass sie kurzsichtig waren: manche fanden, dass gerade die Art, auf die Angelika beim Schauen die Augen zusammenkniff, ihren besonderen Charme ausmache.
»Unsere Kleine schwärmt wieder einmal«, sagte der schöne Rolf Bonetti und lachte etwas zu laut. Er war jenes Mitglied des Ensembles, das die meisten Liebesbriefe aus dem Publikum erhielt: daher sein stolzer, müder, vor lauter Blasiertheit beinah angewiderter Gesichtsausdruck. Der kleinen Angelika gegenüber jedoch war er der Werbende: schon seit längerem bemühte er sich um sie. Auf der Bühne durfte er sie oft in den Armen halten, das brachte sein Rollenfach mit sich. Im Übrigen aber blieb sie spröde. Mit einer wunderlichen Hartnäckigkeit verschenkte sie ihre Zärtlichkeit nur dorthin, wo nicht die mindeste Aussicht bestand, dass man sie erwiderte oder auch nur wünschte. Rührend und begehrenswert, wie sie war, schien sie ganz dafür gemacht, viel geliebt und sehr verwöhnt zu werden. Der sonderbare Eigensinn ihres Herzens aber ließ sie kühl und spöttisch bleiben vor Rolf Bonettis stürmischen Beteuerungen, und ließ sie bitterlich weinen über die eisige Geringschätzung, die Hendrik Höfgen ihr gegenüber an den Tag legte.
Rolf Bonetti sagte kennerhaft: »Als Frau kommt diese Martin jedenfalls gar nicht in Frage: ein unheimlicher Zwitter – sicher hat sie so etwas wie Fischblut in den Adern.«
»Ich finde sie schön«, sagte Angelika, leise aber entschlossen. »Sie ist die schönste Frau, finde ich.« Schon standen ihr die Augen voll Tränen: Angelika weinte häufig, auch ohne besonderen Anlass. Träumerisch sagte sie noch: »Es ist merkwürdig – ich spüre irgend eine geheimnisvolle Ähnlichkeit zwischen Dora Martin und Hendrik …« Dies erregte allgemeine Verwunderung.
»Die Martin ist eine Jüdin.« Es war der junge Hans Miklas, der sich unvermittelt so vernehmen ließ. Alle schauten betroffen und etwas angewidert zu ihm hin. – »Der Miklas ist köstlich«, sprach die Motz in ein betretenes Schweigen hinein und versuchte zu lachen. Kroge runzelte die Stirn, verwundert und degoutiert, während Frau von Herzfeld nur den Kopf schütteln konnte; übrigens war sie blass geworden. Da die Pause lang und peinlich wurde – der junge Miklas stand bleich und trotzig an die Theke gelehnt – sagte Direktor Kroge schließlich ziemlich scharf: »Was soll denn das?« und machte ein Gesicht, so böse, wie es ihm eben möglich war. Ein anderer junger Schauspieler, der sich bis dahin leise mit Vater Hansemann unterhalten hatte, sagte forsch und versöhnlich: »Hopla, das ist daneben gegangen! Lass nur, Miklas, sowas kann vorkommen, du bist sonst ein ganz braves Kind!« Dabei klopfte er dem Übeltäter auf die Schulter und lachte so herzlich, dass alle einstimmen konnten; sogar Kroge entschloss sich zu einer Heiterkeit, die freilich krampfhaften Charakter hatte: er schlug sich mit der flachen Hand auf den Schenkel und warf den Oberkörper nach vorne, so heftig schien er sich plötzlich zu amüsieren. Miklas aber blieb ernst; er drehte das verstockte, bleiche Gesicht zur Seite, die Lippen böse aufeinander gepresst. »Sie ist doch eine Jüdin.« Er sprach so leise, dass fast niemand es hören konnte; nur Otto Ulrichs, der gerade erst durch seine Unbefangenheit die Situation gerettet hatte, hörte es, und nun strafte er ihn mit einem ernsten Blick.
Nachdem Direktor Kroge durch sein Gelächter ausführlich bekundet hatte, dass er die Entgleisung des jungen Miklas durchaus von der komischen Seite nahm, winkte er Ulrichs. »Ach Ulrichs, kommen Sie doch bitte mal einen Augenblick!« Ulrichs setzte sich an den Tisch zu den Direktoren und Frau von Herzfeld.
»Ich will mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, wirklich nicht.« Kroge ließ es sich anmerken, dass die Sache ihm äußerst peinlich war. »Aber es kommt jetzt immer häufiger vor, dass Sie in kommunistischen Versammlungen auftreten. Gestern haben Sie schon wieder irgendwo mitgemacht. Das schadet Ihnen doch, Ulrichs, und uns schadet es auch.« Kroge sprach leise. »Sie wissen doch, wie die bürgerlichen Zeitungen sind, Ulrichs«, sagte er eindringlich. »Suspekt sind wir den Leuten ohnedies. Wenn eines unserer Mitglieder sich nun politisch exponiert – es kann verhängnisvoll für uns sein, Ulrichs.« Kroge trank sehr hastig seinen Cognac aus, er war sogar etwas rot geworden.
Ulrichs antwortete ruhig: »Es ist mir sehr erwünscht, Herr Direktor, dass Sie von diesen Dingen zu mir sprechen. Natürlich habe ich auch schon über sie nachgedacht. Vielleicht ist es besser, wir trennen uns, Herr Direktor – glauben Sie mir, dass es mir nicht leicht fällt, diesen Vorschlag zu machen. Aber auf meine politische Betätigung kann ich nicht verzichten. Ihr müsste ich sogar mein Engagement opfern, und das wäre ein Opfer; denn ich bin gerne hier.« Er sprach mit einer angenehmen, dunklen und warmen Stimme. Während er redete, schaute Kroge mit einer väterlichen Sympathie auf sein intelligentes, kraftvolles Gesicht. Otto Ulrichs war ein gut aussehender Mann. Seine hohe, freundliche Stirn, von der das schwarze Haar weit zurückwich, und die engen, dunkelbraunen, gescheiten und lustigen Augen flößten Vertrauen ein. Kroge mochte ihn sehr. Deshalb wurde er jetzt beinah zornig.
»Aber Ulrichs!« rief er aus. »Davon kann doch gar keine Rede sein. Sie wissen ganz genau, dass ich Sie niemals fortlassen würde!« »Wir können Sie gar nicht entbehren!« fügte Schmitz hinzu – der dicke Mensch überraschte zuweilen durch eine merkwürdig vibrierende, helle und hübsche Stimme –; wozu die Herzfeld ernst bestätigend nickte. »Es ist doch nur ein klein bisschen Zurückhaltung, worum ich Sie bitte«, versicherte Kroge.
Ulrichs sagte mit Herzlichkeit: »Ihr seid alle sehr nett zu mir – wirklich sehr nett – und ich werde mir Mühe geben, dass ich euch nicht gar zu sehr kompromittiere.« Die Herzfeld lächelte ihm vertraulich zu. »Es ist Ihnen jawohl nicht ganz unbekannt«, sagte sie leise, »dass wir politisch weitgehend mit Ihnen sympathisieren.« – Der Mann, mit dem sie in Frankfurt verheiratet gewesen war und dessen Namen sie führte, war Kommunist. Er war viel jünger als sie und hatte sie verlassen. Zurzeit arbeitete er in Moskau als Filmregisseur.
»Weitgehend!« betonte Kroge mit lehrhaft erhobenem Zeigefinger. »Wenngleich nicht ganz, nicht in allen Stücken. Nicht alle unsere Träume haben sich in Moskau erfüllt. Können die Träume, die Forderungen, die Hoffnungen der Geistigen sich erfüllen unter der Diktatur?«
Ulrichs antwortete ernst, wobei seine engen Augen noch schmaler wurden und einen beinah drohenden Blick bekamen: »Nicht nur die Geistigen – oder die, welche sich so nennen – haben ihre Hoffnungen und Forderungen. Noch dringlicher sind die Forderungen des Proletariats. Diese waren, so wie die Welt heute ist, nur zu erfüllen mittels der Diktatur.« Hier zeigte Direktor Schmitz ein bestürztes Gesicht. Ulrichs, um dem Gespräch eine leichtere Wendung zu geben, sagte lächelnd: »Übrigens wäre auf der Versammlung gestern das Künstlertheater beinah durch sein prominentestes Mitglied repräsentiert worden. Hendrik wollte eigentlich auftreten – im letzten Augenblick ist er dann leider verhindert gewesen.«
»Höfgen wird immer im letzten Augenblick verhindert sein, wenn es sich um Angelegenheiten handelt, die bedenklich für seine Karriere werden könnten.« Kroge hatte verächtlich den Mund verzogen, während er dies sagte. Hedda von Herzfeld sah ihn flehend und kummervoll an. Als aber Otto Ulrichs mit Überzeugung äußerte: »Hendrik gehört zu uns«, lächelte sie erlöst. »Hendrik gehört zu uns«, wiederholte Ulrichs. »Und er wird das durch die Tat beweisen. Seine Tat wird das Revolutionäre Theater sein. In diesem Monat soll es eröffnet werden.«
»Noch ist es nicht eröffnet.« Kroge lächelte boshaft. »Zunächst ist nur das Briefpapier da, mit der schönen Überschrift ›Revolutionäres Theater‹. Nehmen wir aber sogar einmal an, es kommt zur Eröffnung: glauben Sie, Höfgen wird sich heraustrauen mit einem wirklich revolutionären Stück?«
Ziemlich heftig erwiderte Ulrichs: »In der Tat glaube ich das! Übrigens ist das Stück ja schon ausgesucht – man kann wohl sagen, dass es ein revolutionäres ist.«
Kroge machte, mit der Miene und Gebärde eines müden und verächtlichen Zweifels: »Wir werden ja sehen.« Hedda von Herzfeld, die bemerkte, dass Ulrichs rot wurde vor Ärger, fand es geraten, nunmehr das Thema zu wechseln.
»Was war das eigentlich vorhin für eine fantastische kleine Äußerung von diesem Miklas? Stimmt es also doch, dass der Bursche Antisemit ist und mit den Nationalsozialisten zu tun hat?« Bei dem Wort »Nationalsozialisten« verzerrte sich ihr Gesicht vor Ekel, als hätte sie eine tote Ratte berührt. Schmitz lachte verächtlich, während Kroge sagte: »So einen können wir gerade gebrauchen!« Ulrichs versicherte sich durch einen Seitenblick, dass Miklas ihnen nicht zuhörte, ehe er mit gedämpfter Stimme erklärte:
»Hans ist im Grunde ein guter Kerl – ich weiß das, denn ich habe mich oft mit ihm unterhalten. Mit so einem Jungen muss man sich viel und nachsichtig beschäftigen – dann gewinnt man ihn vielleicht noch für die gute Sache. Ich glaube nicht, dass er für uns schon ganz verloren ist. Seine Aufsässigkeit, seine allgemeine Unzufriedenheit sind falsch gelandet – verstehen Sie, was ich meine?« Frau Hedda nickte; Ulrichs flüsterte eifrig: »In so einem jungen Kopf ist alles wirr, alles ungeklärt – es laufen ja heute Millionen herum wie dieser Miklas. Bei denen gibt es vor allem einen Hass, und der ist gut, denn er gilt dem Bestehenden. Aber dann hat so ein Bursche Pech und fällt den Verführern in die Hände, und die verderben seinen guten Hass. Sie erzählen ihm, an allem Übel seien die Juden schuld, und der Vertrag von Versailles, und er glaubt den Dreck, und vergisst, wer eigentlich die Schuldigen sind, hier und überall. Das ist das berühmte Ablenkungsmanöver, und bei all diesen jungen Wirrköpfen, die nichts wissen und nicht richtig nachdenken können, hat es Erfolg. Da sitzt dann so ein Häufchen Unglück und lässt sich Nationalsozialist schimpfen!«
Sie schauten alle vier zu Hans Miklas hin, der an einem kleinen Tisch in der entferntesten Ecke des Raumes, bei der dicken alten Souffleuse, Frau Efeu, bei Willi Böck, dem kleinen Garderobier, und bei dem Bühnenportier, Herrn Knurr, Platz genommen hatte. Von Herrn Knurr wurde behauptet, dass er ein Hakenkreuz unter dem Rockaufschlag versteckt trage und dass seine Privatwohnung voll sei von den Bildern des nationalsozialistischen »Führers«, die er in der Portiersloge denn doch nicht aufzuhängen wagte. Herr Knurr hatte heftige Diskussionen und Streitigkeiten mit den kommunistischen Bühnenarbeitern, die ihrerseits nicht im H. K. verkehrten, sondern ihren eigenen Stammtisch in einer Kneipe gegenüber hatten – wo sie zuweilen von Ulrichs besucht wurden. Höfgen wagte sich beinah nie an den Stammtisch der Arbeiter; er fürchtete, die Männer würden über sein Monokel lachen. Andererseits pflegte er zu klagen, das H. K. sei ihm durch die Anwesenheit des nationalistischen Herrn Knurr ganz verleidet. »Dieser verfluchte Kleinbürger«, sagte Höfgen von ihm, »der auf seinen Führer und Erlöser wartet, wie die Jungfer auf den Kerl, der sie schwängern soll! Mir wird immer heiß und kalt, wenn ich an der Portiersloge vorbeigehen muss und an das Hakenkreuz unter seinem Rockaufschlag denke …«