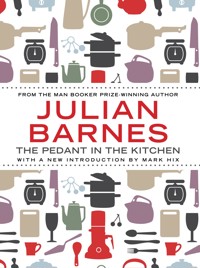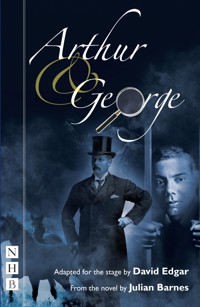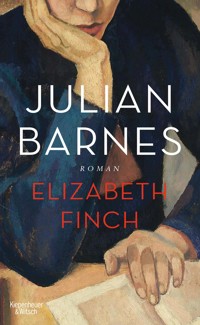19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christopher Lloyd wächst in Metroland auf, dem Londoner Vorort, der von der Metropolitan Line bedient wird. Er und Tony gehen in die gleiche Klasse – und heben sich von den anderen Schülern ab, indem sie sich in Weltverachtung üben. Nach der Schule trennen sich zunächst ihre Wege: Christopher geht nach Paris, wo er in den Armen seiner ersten Freundin den Beginn der 1968er Studentenrevolution verschläft.1977 ist Christopher ruhig geworden, ein Familienmensch, während sein Freund Tony als radikaler Publizist immer noch die Verwirklichung der gemeinsamen Jugendideale einfordert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Julian Barnes
Metroland
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Julian Barnes
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Julian Barnes
Julian Barnes, geboren 1946, erhielt zahlreiche europäische und amerikanische Literaturpreise, zuletzt den Man Booker Prize. Er hat ein umfangreiches erzählerisches Werk vorgelegt, u.a. die Romane »Flauberts Papagei«, »Die Geschichte der Welt in 10½ Kapiteln«, »Darüber reden« und »Arthur & George«. Sein Roman »Vom Ende einer Geschichte« verkaufte sich über 130000 Mal.
Die Übersetzerin
Gertraude Krueger, 1949 geboren, lebt als Dozentin und freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson Wesley, Jhumpa Lahiri und E. L. Doctorow.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Christopher Lloyd erzählt von drei entscheidenden Jahren seines Lebens. 1963 übt er sich während seiner Schulzeit mit seinem Freund Toni in Dandytum und Weltverachtung. 1968 studiert er in Paris und verschläft in den Armen seiner ersten Liebe die revolutionären Mai-Ereignisse. 1977 ist der ehemalige Lebemann bürgerlich und Familienvater geworden, während sein Freund Toni immer noch die Verwirklichung der gemeinsamen Jugendideale einfordert.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
ERSTER TEIL Metroland (1963)
1 Orange plus Rot
2 Zwei kleine Jungen
3 Kaninchen, Mensch
4 Das Konstruktive Gammeln
5 J’habite Metroland
6 Verbrannte Erde
7 Verlogenheitskurven
8 Sex, Magere Zeiten, Krieg, Magere Zeiten
9 Groß T
10 Tunnel, Brücken
11 SLT
12 Tiefhalten
13 Objektbeziehungen
ZWEITER TEIL Paris (1968)
1 Karezza
2 Demandez Nuts
3 Redon, Oxford
4 Glückstrahlende Paare
5 Je t’aime bien
6 Objektbeziehungen
DRITTER TEIL Metroland II (1977)
1 Riesige, nackte Mädchen
2 Laufende Kosten
3 Steifer Petticoat
4 Ist Sex Verkehr?
5 Die Ehrentafel
6 Objektbeziehungen
Anmerkung
Für Laurien
ERSTER TEILMetroland (1963)
»A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu«
Rimbaud
Nirgendwo steht geschrieben, dass man in der National Gallery keine Ferngläser tragen darf.
An diesem Mittwochnachmittag im Sommer 1963 hatte Toni das Notizbuch, und ich hatte das Fernglas. Der Besuch war so weit ergiebig gewesen. Da war die junge Nonne, die eine Männerbrille trug und bei der »Hochzeit Arnolfini« sentimental lächelte, dann, nach einiger Zeit, die Stirn runzelte und missbilligend tz-tz machte. Da war das Anorak-Wandermädchen, so gebannt von Crivellis Altarbild, dass wir einfach auf beiden Seiten neben ihr standen und jedes feine Öffnen der Lippen, jedes leise Straffen der Haut an Wangenknochen und Stirn festhielten (»Bei dir was an der Schläfe zu erkennen?« – »Null« – also schrieb Toni: Schläfenzucken; nur l). Und da war der Mann im Kreidestreifenanzug, das Haar zweieinhalb Zentimeter über dem rechten Ohr präzise gescheitelt, der sich vor einer kleinen Landschaft von Monet wand und krümmte. Er blies die Backen auf, lehnte sich langsam auf den Fersen zurück und hauchte aus wie ein diskreter Ballon.
Dann kamen wir zu einem unserer Lieblingssäle und zu einem unserer brauchbarsten Bilder: van Dycks Porträt von Charles I. zu Pferde. Eine mittelalterliche Dame in einem roten Regenmantel saß davor. Toni und ich gingen leise zu der Polsterbank am anderen Ende des Saals und taten, als wären wir an einem plump-fröhlichen Frans Hals interessiert. Dann rückte ich, von ihm gedeckt, ein bisschen vor und richtete das Fernglas auf sie. Wir waren weit genug weg, dass ich Toni relativ gefahrlos Beobachtungen zuflüstern konnte; wenn sie was hörte, würde sie es für das übliche Hintergrundgemurmel von Bewunderung und Einverständnis halten.
Das Museum war ziemlich leer an diesem Nachmittag, und die Frau hatte es sich bei dem Porträt richtig bequem gemacht. Ich hatte Zeit, spekulativ ein paar biografische Angaben kundzutun.
»Dorking? Bagshot? Fünfundvierzig – fünfzig. Einkaufsbummel-Tageskarte. Verheiratet, zwei Kinder, lässt sich nicht mehr von ihm figgen. Fassade glücklich, innerlich unzufrieden.«
Das deckte es wohl ungefähr ab. Sie starrte jetzt wie eine Ikonenanbeterin zu dem Bild hoch. Die Augen schlauchten es eilig auf und ab, kamen dann zur Ruhe und bewegten sich langsam darüber hin. Bisweilen legte sich ihr Kopf schräg zur Seite, und der Hals reckte sich vor; die Nasenflügel schienen sich zu weiten, als wittere sie neue Bezüge in dem Gemälde; die Hände machten kleine Flatterer auf den Oberschenkeln. Allmählich wurden ihre Bewegungen ruhiger.
»So was wie religiöser Friede«, murmelte ich Toni zu. »Na ja, quasireligiös jedenfalls; schreib das.«
Ich konzentrierte mich wieder auf ihre Hände; sie waren jetzt gefaltet wie bei einem Messdiener. Dann schwenkte ich das Fernglas auf ihr Gesicht zurück. Sie hatte die Augen geschlossen. Ich gab das weiter.
»Schafft wohl die Schönheit dessen nach, was sie vor sich hat; oder kostet das Nachbild aus; nicht ganz klar.« Zwei volle Minuten hielt ich das Fernglas auf sie gerichtet, während Toni, den Kuli gezückt, auf meinen nächsten Kommentar wartete.
Es gab zwei Lesarten: Entweder war sie jenseits aller beobachtbaren Wonne, oder sie war eingeschlafen.
1 Orange plus Rot
Frisch geschnittener Liguster riecht immer noch nach sauren Äpfeln, wie damals, als ich sechzehn war; doch das ist eine seltene, zählebige Ausnahme. In dem Alter schien alles offener für Analogien, für Metaphern zu sein als jetzt. Es gab mehr Bedeutungen, mehr Interpretationen, ein größeres Sortiment an zur Verfügung stehenden Wahrheiten. Es gab mehr Symbolgehalt. In den Dingen steckte mehr drin.
Nimm zum Beispiel mal den Mantel von meiner Mutter. Sie hatte ihn selbst genäht, an einer Schneiderpuppe, die unter der Treppe hauste und einem alles und nichts über den weiblichen Körper verriet (verstehst du, was ich meine?). Es war ein Wendemantel, auf der einen Seite signalrot und auf der anderen mit einem ausladenden schwarz-weißen Karomuster; die Revers waren aus dem Innenstoff, setzten einen »kontrastierenden Akzent am Hals«, wie es im Schnittmusterbogen hieß, und harmonierten mit den großen rechteckigen aufgesetzten Taschen. Er war, wie ich jetzt begreife, eine überaus kunstvolle Schneiderarbeit; damals war er mir ein Beweis dafür, dass meine Mutter den Mantel nach dem Wind drehte.
Dieses Anzeichen des Doppelbödigen fand seine Bestätigung in dem Jahr, als die Familie auf den Channel Islands Ferien machte. Die Manteltaschen waren, wie nun herauskam, exakt so groß wie eine Packung mit 100 Zigaretten; so ging meine Mutter auf dem Rückweg mit 400 geschmuggelten Senior Service durch den Zoll. Als Mitwisser verspürte ich Schuld und Aufregung; aber auch, tiefer drin, das Gefühl, insgeheim recht zu haben.
Doch es ließ sich noch mehr aus diesem einfachen Mantel herausholen. Seine Farbe war, wie seine Konstruktion, voller Geheimnisse. Eines Abends, als ich mit meiner Mutter von der Haltestelle nach Hause ging, sah ich ihren Mantel an, der mit der roten Seite nach außen gedreht war, und merkte, dass er braun geworden war. Ich sah die Lippen meiner Mutter an, und sie waren braun. Hätte sie ihre Hände aus den (nunmehr schmutzig) weißen Handschuhen gezogen, wären ihre Fingernägel, ich wusste es, auch braun gewesen. Heutzutage eine banale Erscheinung; aber in den ersten Monaten mit orange Natriumdampflicht war es wundersam beunruhigend. Orange auf Rot gibt Dunkelbraun. Nur in Suburbia, dachte ich, konnte das passieren.
Am nächsten Morgen in der Schule zog ich Toni aus einem Vorunterrichtsgebolze und erzählte ihm davon. Er war der Vertraute, mit dem ich alle Hassgefühle und die meisten Schwärmereien teilte.
»Die verfiggen sogar das Spektrum«, sagte ich, gleichsam zermürbt angesichts dieser neuen Zumutung.
»Verfiggt noch mal, wie meinst du das?«
»Die« war eindeutig. Wenn ich das sagte, waren nicht näher bestimmte Gesetzgeber, Moralisten, Leuchten der Gesellschaft und Eltern aus den Außenbezirken von Suburbia gemeint. Wenn Toni das sagte, waren die entsprechenden Leute in der Londoner Innenstadt gemeint. Das war, daran zweifelten wir nicht, alles die gleiche Sorte.
»Die Farben. Die Straßenlampen. Die verfiggen die Farben, wenn’s dunkel ist. Alles wird braun oder orange. Du siehst aus, als kämst du vom Mond.«
Mit Farben waren wir damals sehr empfindlich. Das Ganze hatte damit angefangen, dass ich in den Sommerferien einmal Baudelaire als Strandlektüre mitgenommen hatte. Wenn man den Himmel durch einen Strohhalm anschaut, stand da, hat er ein viel satteres Blau, als wenn man ein großes Stück Himmel anschaut. Diese Entdeckung teilte ich Toni auf einer Postkarte mit. Danach fingen wir an, uns um die Farben Sorgen zu machen; als etwas unbestreitbar Grundlegendes, Reines galten sie Gottlosen besonders viel. Damit wollten wir die Bürokraten nicht rumfiggen lassen. Die hatten sich schon an
»… der Sprache …«
»… der Ethik …«
»… den Prioritäten …«
vergriffen, doch über diese Dinge konnte man sich letzten Endes hinwegsetzen. Man konnte erhobenen Hauptes seinen eigenen Weg gehen. Aber wenn die sich an den Farben vergriffen? Da konnten wir uns nicht mal darauf verlassen, dass wir wir selbst blieben. Tonis dunkles, wulstlippiges Mitteleuropäergesicht würde durch Natrium total vernegern. Meine eigenen stupsnasigen, unbestimmt-englischen Züge (des großen Sprungs ins Erwachsensein noch aufgeregt harrend) waren fürs Erste sicher; aber »die« würden sich zweifellos noch einen satirischen Dreh dafür einfallen lassen.
Man sieht, es waren große Dinge, um die wir uns damals Sorgen machten. Warum auch nicht? Wann sonst kommt man denn dazu, sich darum Sorgen zu machen? Um unsere künftige Karriere bangten wir nicht im Entferntesten, denn wir wussten, wenn wir erst erwachsen wären, würde der Staat Leuten wie uns Geld zahlen, bloß damit es sie gäbe, bloß damit sie wie die Sandwichmänner rumliefen und für das gute Leben Reklame machten. Aber so was wie die Reinheit der Sprache, das Trachten nach Selbstvervollkommnung, die Funktion der Kunst, dazu noch ein Schock nicht greifbarer Werte mit großen Lettern wie LIEBE, WAHRHEIT, AUTHENTIZITÄT … also, das war etwas anderes.
Seinen Ausdruck gegenüber der Öffentlichkeit fand unser blitzender Idealismus natürlich in einer Pose von rauem Zynismus. Nur ein Drang nach Läuterung mochte hinreichen als Erklärung dafür, wie harsch und bereitwillig Toni und ich andere anpissten. Die Motti, die wir für unsere Sache angemessen hielten, hießen écraser l’infâme und épater la bourgeoisie. Wir bewunderten das gilet rouge[1] von Gautier, den Hummer von Nerval; die bataille d’Hernani[2] war unser Spanischer Bürgerkrieg. Wir skandierten im Chor:
Le Belge est très civilisé;
Il est voleur, il est rusé;
Il est parfois syphilisé;
Il est donc très civilisé.
Der Endreim entzückte uns, und wir flochten das verschwommene Homophon bei jeder Gelegenheit in unsere gestelzten Französisch-Konversationsstunden ein. Zuerst brachte man einen verdienten Stümper mit einer aufreizend verächtlichen, in einfacher Sprache gehaltenen Bemerkung auf Touren; der Stümper legte dann los mit:
»Je ne suis pas, äh, d’accord avec ce qui, ce que?« (stirnrunzelnder Blick zum Lehrer) »Barbarowski a, öhm, juste dit …«, und dann fuhr einer von uns kichernden Konspirateuren dazwischen, ehe der Lehrer noch aus seiner Depression über die Beklopptheit des Stümpers aufgetaucht war, und meinte:
»Carrément, M’sieur, je crois pas que Phillips soit assez syphilisé pour bien comprendre ce que Barbarowski vient de proposer …«
– und sie ließen es jedes Mal durchgehen.
Wir machten, wie man sich denken kann, vor allem Französisch. Die Sprache lag uns am Herzen, weil ihre Laute plosiv und präzise waren; und die Literatur lag uns in erster Linie ihrer Kampflustigkeit wegen am Herzen. Französische Schriftsteller waren ständig am Kämpfen miteinander – sie verteidigten und reinigten die Sprache, merzten Slangwörter aus, schrieben präskriptive Wörterbücher, wurden verhaftet, wurden wegen Obszönität verfolgt, waren aggressive parnassiens, schlugen sich um einen Sitz in der Académie, intrigierten um Literaturpreise, mussten ins Exil gehen. Der kultivierte Rabauke war für uns eine ausgesprochen attraktive Vorstellung. Montherlant und Camus waren beide Tormänner gewesen; ein Foto aus Paris-Match, das ich innen in meinem Schrank angebracht hatte – Henri de, der nach einem hohen Ball hechtete –, genoss die gleiche Verehrung wie June Ritchies signiertes Geoff-Glass-Porträt in Nur ein Hauch Glückseligkeit.
In unseren Englischstunden schienen keine kultivierten Rabauken vorzukommen. Auf jeden Fall keine Tormänner. Johnson war wohl ein Rabauke, doch kaum weltgewandt genug für uns: Der war ja erst auf die andere Seite des Kanals gelangt, als er schon so gut wie tot war. Mit einem Typen wie Yeats dagegen lief es genau umgekehrt: weltgewandt, aber dafür ständig am Rumfiggen mit Elfen und solchem Kram. Was die beiden wohl machten, wenn alle Rots dieser Welt plötzlich braun würden? Der eine würde es kaum mitbekommen; der andere von dem Schock erblinden.
2 Zwei kleine Jungen
Toni und ich schlenderten die Oxford Street entlang und versuchten, wie flâneurs auszusehen. Das war nicht so leicht, wie es sich vielleicht anhört. Zunächst mal braucht man dazu gewöhnlich einen quai oder, allerwenigstens, einen boulevard; und dann hatten wir, egal wie gut wir die Ziellosigkeit der flânerie selbst nachmachten, immer das Gefühl, wir hätten die Ereignisse vor und nach dem Schlendern nicht richtig hingekriegt. In Paris würde man eine zerwühlte Couch in einer chambre particulière hinterlassen; hier aber hatten wir bloß die U-Bahn-Station Tottenham Court Road hinter uns gelassen und strebten Richtung Bond Street.
»Sollen wir jemanden écrasieren?«, schlug ich vor und ließ meinen Regenschirm herumwirbeln.
»Eigentlich keine Lust. Hab gestern Dewhurst erledigt.« Dewhurst war ein zum Priesteramt erkorener Aufsichtsschüler, den Toni, wie wir beide meinten, im Laufe einer wütenden metaphysischen Diskussion total fertiggemacht hatte. »Aber auf einen épat könnte ich Lust haben.«
»Sixpence?«
»Okay.«
Während wir dahinwanderten, hielt Toni nach Objekten Ausschau. Eisverkäufer? Kroppzeug und wohl kaum bourgeois genug. Der Polizist da drüben? Zu gefährlich. Die fielen in die gleiche Kategorie wie schwangere Frauen und Nonnen. Da ruckte Toni plötzlich bedeutungsvoll mit dem Kopf und machte sich daran, seine Schulkrawatte abzunehmen. Ich tat das Gleiche, rollte sie um vier Finger und steckte sie in die Tasche. Jetzt waren wir bloß noch zwei nicht identifizierbare Jungs mit weißen Hemden, grauen Hosen und schwarzen, leicht schuppengesprenkelten Jacketts. Ich folgte ihm über die Straße zu einer neuen Boutique (wie wir diese linguistischen Importe missbilligten); sie verkündete in großen gelben Lettern MAN SHOP. Das war, so argwöhnten wir, einer von diesen neuen und gefährlichen Orten, wo sie, in Schändungsabsicht, bei dir in der Kabine auftauchen, bevor du noch die Hosen hochziehen kannst. Toni musterte die Verkäufer und wählte den mit dem seriösesten Äußeren: angejahrt, angegraut, ausknöpfbarer Kragen, breit hervorstehende Manschetten, noch dazu eine Krawattennadel. Eindeutig eine Hinterlassenschaft des Vorbesitzers.
»Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir?«
Toni sah stur an ihm vorbei auf die offenen Holzfächer mit Dralonsocken.
»Ich hätte gern einen Mann und zwei kleine Jungen.«
»Ich bitte um Verzeihung?«, sagte Krawattennadel.
»Einen Mann und zwei kleine Jungen, bitte«, wiederholte Toni im Tonfall eines hartnäckigen Kunden. Die Regeln des épat bestimmten, dass man weder kichern noch nachgeben durfte. »Die Größe ist egal.«
»Ich verstehe nicht recht, Sir.« Das Sir war ganz schön cool unter den Umständen, dachte ich. Ich meine, der Kerl war doch bestimmt kurz vorm Ausrasten, nicht?
»Herrgott noch mal«, sagte Toni ziemlich schroff, »so was nennt sich Man Shop? Ich sehe schon, ich muss es woanders versuchen.«
»Das würde ich Ihnen auch raten, Sir. Von welcher Schule sind Sie denn?«
Wir machten, dass wir wegkamen.
»Cooler Figger«, beschwerte ich mich bei Toni, als wir im Eiltempo davonflânierten.
»Yeah. Glaubst du, ich hab ihn sehr épatiert?«
»Ganz bestimmt, ganz bestimmt.« Ich war wirklich beeindruckt, besonders davon, wie Toni den richtigen Verkäufer ausgesucht hatte, nicht einfach den, der am nächsten an der Tür stand. »Jedenfalls kriegst du deinen Sechser.«
»Darum mach ich mir keine Gedanken. Ich will nur wissen, ob ich ihn épatiert hab.«
»Na klar. Na klar. Sonst hätt er doch nicht nach unserer Schule gefragt. Überhaupt, hast du das Sir bemerkt?«
Toni schielgrinste, wobei sein Mund sich wie aus Loyalität zu den Augen verzog.
»Yeah.«
Es war der Lebensabschnitt, wo das Gesirtwerden von unschätzbarer Bedeutung ist; ein Emblem, dessen Begehrtheit in keinerlei Verhältnis zu seinem Wert steht. Es war besser, als in der Schule über die Vordertreppe gehen zu dürfen; besser, als keine Mütze tragen zu müssen; besser, als in der Pause auf dem Balkon für die oberen Klassen zu sitzen; sogar besser, als einen Regenschirm zu tragen. Und das wollte etwas heißen. Ich habe meinen Regenschirm einmal das ganze drei Monate lange Sommertrimester jeden Tag zur Schule und wieder zurück getragen, obwohl es nie geregnet hat. Der Status zählte, nicht die Funktion. In der Schule zog man eine Schau damit ab – mit Gleichaltrigen fechten oder mit der angeschliffenen Schirmspitze kleineren Jungs die Schuhe an den Boden nageln; doch draußen machte er einen zum Mann. Auch wenn man kaum einen Meter fünfzig groß war und als Gesicht ein von wucherndem pubertären Flaum überschattetes Akne-Schlachtfeld hatte; auch wenn man mit Schlagseite ging, auf einer Seite von einem schwärenden Cricketbeutel mit modernden Fußballhemden und brandigen Stiefeln runtergezogen; solange man einen Regenschirm hatte, gab es immer eine kleine Chance, dass man von irgendwem ein Sir einheimsen konnte, die kleine Chance einer Aufwallung von Freude.
Montagmorgens fragten Toni und ich einander immer dasselbe.
»Irgendwen écrasiert?«
»Leider nein.«
»Épatiert?«
»Nja, nicht richtig …«
»Gesirt?«
Ein spöttisches, bejahendes Lächeln, und das ganze Wochenende war gerettet.
Wir zählten, wie oft wir gesirt wurden; die besten Fälle merkten wir uns und tischten sie dem andern auf wie alte Roués, die ihren Eroberungen nachhängen; und das erste Mal vergaßen wir natürlich nie.
Mein erstes Mal, an das ich noch immer voller Glück zurückdachte, war beim Anmessen meiner ersten langen Hose passiert. Es war in einem schmalen, korridorähnlichen Laden in Harrow, der mit Kleiderkartons tapeziert war; Ständer mit tarnfarbenen Windjacken und pappsteifen Cordhosen machten es zu einer Hindernisbahn. Egal, welche Farbe man trug, wenn man in den Laden reinging, raus kam man immer in Grau oder Flaschengrün. Braun verkauften sie auch – aber niemand, so versicherte mir meine Mutter, trug Braun, bevor er pensioniert war. Mir war es diesmal beschieden, in Grau rauszukommen.
Meine Mutter war, bei aller Schüchternheit im Familien- und Gesellschaftsleben, in Geschäften stets präzise und autoritär. Ein tief sitzender Instinkt sagte ihr, dass hier eine Hierarchie waltete, die nie erschüttert würde.
»Eine Hose bitte, Mr Foster«, sagte sie in ungewohnt forschem Ton. »Grau. Lang.«
»Selbstverständlich, Madam«, schleimte Mr Foster. Dann, mit einem Blick auf mich: »Lang. Selbstverständlich, Sir.«
Ich hätte in Ohnmacht fallen können; ich hätte, allerwenigstens, grinsen können. Stattdessen stand ich nur da, hilflos vor Glück, während Mr Foster zu meinen Füßen kniete und ein Lob aufs andere häufte.
»Wir messen mal nach, Sir. Schön gradeaus schauen. Schultern zurück. Beine auseinander, Sir, bitte. So ist’s recht.«
Er ließ von seinem Hals ein Maßband gleiten, bei dem die letzten fünfzehn Zentimeter mit Messing versteift waren. Das hielt er bei Zentimeter 13 fest (damit man ihn nicht verhaftet, nehm ich an) und stach mir dreimal heftig in die Schamleiste.
»Stillhalten, Sir«, kalfakterte er, in erster Linie meiner Mutter zuliebe, die sich fragen mochte, warum er so lange brauchte. Doch ich dachte nicht daran, mich zu bewegen. Die Angst um meine Gonaden, selbst die Angst davor, in eine Umkleidekabine verfrachtet und roh vergewaltigt zu werden, wurde bedeutungslos angesichts der Anerkennung als Mann. Verwirrung und Freude waren derart, dass ich nicht einmal auf die Idee kam, als beunruhigenden Trost den Schlachtruf der Schule zu flüstern: »Ruiniert!«
3 Kaninchen, Mensch
»RuuuiiinIIIIIIIIiiiert …«
Das war der Schlachtruf der Schule, so lang gezogen und moduliert, wie wir uns Hyänengeheul vorstellten. Gilchrist gab die gellendste, schreckensvollste Version von sich; die von Leigh hatte mitten in den Heullauten einen gebrochenen Schluchzer; aber alle machten ihn zumindest angemessen. Er war, wenn auch spielerisch, Ausdruck der zwanghaften Kastrationsängste männlicher Jungfrauen. Ausgestoßen wurde er bei jeder passenden Gelegenheit: wenn ein Stuhl umgestoßen, ein Fuß getreten, ein Federmäppchen verschwunden war. Selbst in unsere parodistische Art, einen Kampf anzufangen, fand er Eingang: Die Kombattanten rückten gegeneinander vor, die Linke wie einen Tiefschutz stramm über der Leiste, die Rechte vorgestreckt, Handfläche nach oben, die Finger klauenartig durch die Luft zuckend; derweil gaben die Zuschauer stellvertretend Miniquieker von sich: »RuuuinIIIiert«.
Doch die Parodie war von einem Schauder begleitet. Wir alle hatten von den Kastrationsmethoden der Nazis durch Röntgenbestrahlung gelesen und benutzten das, um einander zu triezen. Wem dies passierte, der war erledigt: In der Literatur gab es Beweise dafür, dass man verfettete, zu einer Statistenrolle verdammt wurde und allein noch dem Wohlergehen anderer diente. Entweder das, oder man war aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, Opernsänger in Italien zu werden. Was den ganzen grauenvollen Prozess nun eigentlich in Gang setzte, war uns nicht so recht klar: Es hatte aber etwas mit Umkleideräumen und öffentlichen Toiletten und spätabendlichen U-Bahn-Fahrten zu tun.
Sollte man aber durch irgendeinen – wohl recht unwahrscheinlichen – Zufall unbeschadet davonkommen, dann passierte bestimmt irgendwas Schönes, sonst würden die Informationen nicht dermaßen geheim gehalten. Aber was genau? Und wie kriegte man es heraus?
Auf die Eltern war offensichtlich kein Verlass: Doppelagenten, die schon früh aufflogen bei ihrem Versuch der vorsätzlichen Desinformation. Meinen hatte ich eine ganz einfache Frage vorgelegt – zu der ich die Lösung natürlich schon kannte –, und sie hatten die Antwort vermasselt. Als ich einmal abends für die Schule in der Bibel las, riss ich meine Mutter aus ihren Gedanken über das She-Preisausschreiben:
»Mami, was ist ein E-unuch?«
»Oh, das weiß ich nicht, mein Schatz, nicht genau jedenfalls«, antwortete sie mit gleichmütiger Stimme. (Es konnte durchaus sein, dass sie es nicht wusste.) »Fragen wir doch deinen Vater. Jack, Christopher will wissen, was ein Eunuch ist …« (Guter Schachzug, Aussprache korrigieren und gleichzeitig Wissen verhehlen.) Mein Vater schaute von seiner Zeitschrift für Buchführung hoch (kriegte er bei der Arbeit nicht genug von dem Zeugs?), stockte, fuhr sich mit der Hand über den kahlen Schädel, stockte, nahm die Brille ab, stockte. Dabei sah er die ganze Zeit meine Mutter an (war der Große Augenblick da?); ich aber gab die ganze Zeit vor, in meine Bibel zu starren, als gäbe eine nachdrückliche Untersuchung des Kontexts Antwort auf meine Frage. Eben hatte mein Vater den Mund aufgemacht, da sprach meine Mutter weiter, in ihrem Geschäftston:
»… so eine Art abessinischer Diener, glaub ich, nicht wahr, Liebling?« Ich spürte, dass sie einander scharf ansahen. Mein Verdacht war bestätigt, und ich sah zu, dass ich möglichst schnell aus der Sache rauskam:
»Ah so, ja, das kommt hin … danke.«
Wieder ein Zugang versperrt. Die Schule, wo man theoretisch was lernen sollte, war auch keine große Hilfe. Colonel Lowson, der fahrige Biolehrer, den wir verachteten, weil er sich bei einem Jungen entschuldigte, nachdem er ihn geschlagen hatte, war sowieso schon rot im Gesicht; doch wir waren sicher, er wäre noch röter geworden, wenn er gekonnt hätte, als wir ein ganzes Trimester lang zweimal die Woche auf sein mechanisches »Gibt’s noch Fragen?« am Ende der Stunde antworteten:
»Wann machen wir menschliche Fortpflanzung, Sir, es steht doch im Lehrplan?«
Wir wussten, da hatten wir ihn. Gilchrist, der zu den Schlitzohren der Klasse gehörte, hatte den Lehrplan des Prüfungsausschusses zu fassen gekriegt und die unbestreitbare Wahrheit entdeckt. Am Schluss des Kurses Allgemeine Naturwissenschaft (Biologie) stand: FORTPFLANZUNG: PFLANZE, KANINCHEN, MENSCH. Wir verfolgten Lowsons schwerfälligen Marsch durch den Kurs wie Indianerkundschafter, die einen Trupp US-Kavallerie von selbstmörderischer Berechenbarkeit beobachten. Endlich waren nur noch zwei Worte im gesamten Lehrplan unbesprochen – KANINCHEN, MENSCH – und zwei Stunden übrig. Lowson war in ein Tal ohne Wiederkehr geritten.
»Nächste Woche«, begann Lowson die erste von diesen zwei letzten Stunden, »mache ich eine Wiederholung …«
»Ruiniert«, sagte Gilchrist leise vor sich hin, und durch die Klasse ging ein enttäuschtes Murmeln.
»… aber heute will ich mich mit der Fortpflanzung der Säugetiere beschäftigen.« Schweigen; ein oder zwei von uns bekamen bei der Ankündigung einen Steifen. Lowson wusste, an dem Tag würde er keinerlei Schwierigkeiten haben; und während wir mehr mitschrieben als je zuvor, erzählte er uns von Kaninchen, zum Teil auf Lateinisch. Es hörte sich, ehrlich gesagt, nicht besonders großartig an. Es konnte offenbar nicht ganz genau dasselbe sein. Bestimmt war der Teil, wo … Doch da begriffen wir langsam, dass Lowson drauf und dran war, sich aus der Affäre zu ziehen. Die fünfundvierzig Minuten waren fast vollständig um. Unsere wachsende Verdrossenheit war nicht zu übersehen. Schließlich, eine Minute vor Schluss:
»Tja, irgendwelche Frage?«
»Sir, wannmawi menschlifortpflanzgsir, stehtmlerplan?«
»Ach«, antwortete er (und war da ein hämisches Grinsen zu erkennen?), »das ist im Prinzip genau wie bei anderen Säugetieren.« Dann marschierte er aus dem Zimmer.
Anderswo in der Schule waren Informationen genauso schwer zu erlangen, jedenfalls auf dem Dienstweg. Der Artikel über Familienplanung in dem Band »Heim und Familie« der großen Enzyklopädie war aus der Ausgabe in der Schulbücherei herausgerissen. Die einzige andere Informationsquelle war viel zu riskant – der Konfirmationsunterricht beim Direktor. Der schloss eine kurze Sitzung über die Ehe ein, »was ihr im Moment ja nicht braucht, aber es schadet nichts, wenn ihr Bescheid wisst«. Es schadete in der Tat nichts: Die aufregendste Formulierung, die der hagere und misstrauische Herr über unser Leben gebrauchte, war »eheliche Gemeinschaft und gegenseitiger Beistand«. Am Ende der Sitzung wies er auf einen Stapel Broschüren an seiner Schreibtischecke.
»Wenn jemand mehr wissen will, kann er sich beim Hinausgehen eins dieser Hefte ausleihen.«
Er hätte ebenso gut sagen können: »Wer sich mehr als sechsmal pro Tag selbst befleckt, soll sich melden.« Ich hab nie gesehen, dass einer eine Broschüre genommen hätte. Ich hab nie jemand gekannt, der eine genommen hätte. Ich hab nie von jemand gehört, der von jemand gehört hatte, der eine genommen hätte. Höchstwahrscheinlich würde schon das bloße Langsamergehen in der Nähe des Direktorenschreibtischs mit Prügeln geahndet.
Wir mussten also, wie Toni sich gern ausdrückte, die Sache selbst in die Hand nehmen; und was dabei herauskam, war wahrlich Flickwerk. Man konnte ja nicht einfach andere Jungs fragen – John Pepper etwa, der behauptete, eine verheiratete Frau »gehabt« zu haben, oder Fuzz Woolley, dessen Kalender voll war mit roten Kreuzchen, die wohl anzeigen sollten, wann seine Freundin ihre Periode hatte. Man konnte nicht fragen, denn bei allen Witzen und Gesprächen über dieses Thema war ein auf beiden Seiten gleicher Kenntnisstand vorausgesetzt; Unwissenheit zu bekennen hätte unbestimmte, aber entsetzliche Folgen gehabt – etwa so, wie wenn man einen Kettenbrief nicht weiterschickt.
Von dem Hauptereignis hatten wir eine gewisse Ahnung – selbst Lowsons kärgliche Unterweisung hatte uns eine Vorstellung der Intromission vermittelt; aber die tatsächliche Strategie des Ganzen war noch nebulös. Von unmittelbarer und grundlegender Bedeutung aber war, wie der Körper der Frau nun wirklich aussah. Da waren wir stark auf das National Geographic Magazine angewiesen, Pflichtlektüre für die Intellektuellen unserer Schule; trotzdem war es manchmal schwierig, aus einer Pygmäenfrau mit tätowierten Narbenmustern, Körperbemalung und einem Lendenschurz viel zu extrapolieren. Reklamebilder für Büstenhalter und Korsetts, Plakate für nicht jugendfreie Filme sowie Sir William Orpens History of Art trugen auch alle ihr Scherflein bei. Aber erst als Brian Stiles seinen Blitz hervorholte, ein Nudistenheft im Taschenformat (Stallgefährte von Blank), wurden die Dinge ein wenig klarer. So sieht das also aus, dachten wir, auf den retouchierten Unterbauch einer Trampolinspringerin glotzend.
Unserer unermüdlichen Fleischeslust zum Trotz waren wir auch zutiefst idealistisch. Die Mischung kam uns ganz gut vor. Racine konnten wir nicht ausstehen, weil die Gewalt der Emotionen, denen seine Gestalten ausgesetzt waren, zwar – so dachten wir – ähnlich groß war wie die, von der wir wiederum gebeutelt werden würden, doch der Reigen der Leidenschaft, in dem sich die Handlung immer drehte, widerte uns an. Corneille war unser Mann; vielmehr, seine Frauen waren unsere Frauen – leidenschaftlich, doch pflichtbewusst, treu und jungfräulich. Toni und ich diskutierten viel über die Frauenfrage; allerdings wich das selten von eingefahrenen Bahnen ab.
»Dann muss ich also eine Jungfrau heiraten?« (Wer von uns beiden anfing, war gleichgültig.)
»Na ja, nicht unbedingt; aber wenn du eine heiratest, die keine Jungfrau ist, entpuppt sie sich womöglich als Nympho.«
»Aber wenn du eine Jungfrau heiratest, entpuppt sie sich womöglich als frigide?«
»Schon, doch wenn sie frigide ist, kannst du dich jederzeit scheiden lassen und noch mal von vorn anfangen.«
»Dagegen …«
»… dagegen, wenn sie eine Nympho ist, kannst du ja nicht gut zum Gericht gehen und sagen, sie lässt dich nicht. Die wirst du nicht mehr los. Dann bist du …«
»… ruiniiiert. Genau.«
Wir dachten an Shakespeare, Molière und andere Autoritäten. Sie waren sich alle einig, dass der lächerliche Ehemann gar nicht lustig ist.
»Dann muss es also eine Jungfrau sein.«
»Es muss.«
Und das bekräftigten wir mit Handschlag.
Doch unsere praktischen Schritte in Richtung Mädchen waren zögernder als unsere Grundsatzentscheidungen. Woran erkannte man eine Nympho? Woran erkannte man eine Jungfrau? Woran erkannte man – das war das Schwierigste – eine Ehefrau: eine, die wie eine Nympho aussah, in Wirklichkeit aber eine Jungfrau war.
Abends, auf dem Heimweg, beäugten Toni und ich meistens zwei Tussis von der Mädchenschule, die gewöhnlich an der U-Bahn-Station Temple standen und auf denselben Zug warteten wie wir. Purpurfarbene Uniformen, beide ordentliche schwarze Haare und richtige Strümpfe. Ihre Schule lag unserer direkt gegenüber, Sororisieren wurde jedoch nicht gern gesehen. Sie hatten sogar eine Viertelstunde eher Schluss als wir, damit sie sich in Sicherheit bringen konnten vor … was? Und was dachten die Mädchen selbst, wovor sie sich in Sicherheit bringen durften? Ergo hatten alle Mädchen, die mit demselben Zug fuhren wie wir, offensichtlich extra getrödelt, um mit demselben Zug zu fahren wie wir. Ergo wollten sie, dass wir uns an sie ranmachten. Ergo waren sie potenzielle Nymphos. Ergo waren Toni und ich nicht bereit, ihr schüchternes Lächeln zu erwidern.
4 Das Konstruktive Gammeln
Mittwochnachmittags hatten wir immer frei. 12 Uhr 30, und eine Horde von Jungs brach, Mützen in Schultaschen stopfend, aus dem Seiteneingang des hochviktorianischen Baus am Embankment hervor; ein paar Minuten später schlenderte dann eine gesetztere Reihe mützenloser Oberklässler die Vordertreppe hinab, lässig ihren Regenschirm schwingend. Mittwochs veranstaltete die History Society Bildungsausflüge nach Hatfield House; die CCF[3]-Fanatiker ölten ihre Bajonette; Jungs rannten los mit Handtuchrouladen unter dem Arm, mit Floretten, Cricketbeuteln, ranzigen Fives[4]-Handschuhen. Ängstlichere Gemüter machten sich eilig auf den Heimweg, einigermaßen sicher, dass die Schänder und Kastrierer sich noch nicht in der U-Bahn herumtrieben.
Toni und ich frönten dem Konstruktiven Gammeln. London, hatten wir irgendwo gelesen, biete einem alles, was man brauche. Reisen konnte man natürlich auch, und wir hatten vor, das später ein wenig zu betreiben (wenngleich wir beide schon auf dem Land gewesen waren und es enttäuschend leer gefunden hatten), denn unsere Autoritäten waren sich alle einig, es sei gut fürs Gehirn. Aber London war der Ausgangspunkt; und nach London kehrte man, mit Weisheit gespickt, letzten Endes zurück. Und Londons Geheimnisse knackte man durch Gammeln. Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n’en rien faire.
Die Konzeption des Konstruktiven Gammelns stammte ursprünglich von Toni. Unsere Zeit, erklärte er, ging dahin, indem wir zwangsweise mit Wissen vollgestopft oder aber zwangsweise zerstreut wurden. Seiner Theorie zufolge konnte man das Leben am Schlafittchen packen – konnte alle aperçus eines flâneur einheimsen, wenn man angemessen insouciant und doch allzeit wachen Auges herumlungerte. Außerdem gammelten wir sowieso gerne rum und sahen zu, wie sich andere Leute fleißig müde schufteten. Wir gingen in die Hinterhöfe von Fleet Street und guckten, wie fette Rollen Zeitungspapier abgeladen wurden. Wir gingen auf Märkte und in Gerichtssäle, hingen vor Kneipen und Büstenhalterläden herum. Wir gingen mit unserem Fernglas in die St. Paul’s Cathedral, angeblich um die Fresken und Mosaike in der Kuppel zu besichtigen, in Wirklichkeit aber um die Leute beim Beten zu beobachten. Wir fahndeten nach Prostituierten – den einzigen anderen konstruktiven Gammlern, wie wir geistreich meinten –, die man damals noch an einem feinen Goldkettchen am Fußgelenk erkennen konnte. Dann fragten wir uns gegenseitig:
»Meinst du, die ist auf Kundenfang?«
Wir taten eigentlich nichts als beobachten; allerdings wurde Toni eines feuchten und nebligen Nachmittags von einer kurzsichtigen (oder verzweifelten) Hure angemacht. Auf ihr geschäftsmäßiges:
»Na, wie wär’s, mein Süßer?«
antwortete er selbstsicher, wenn auch piccolostimmig:
»Wie viel krieg ich denn dafür?«,
und wollte sich das als épat anrechnen lassen.
»Disqualifiziert.«
»Wieso?«
»Du kannst doch nicht épater la Bohème. Das ist lächerlich.«
»Wieso nicht? Huren sind integraler Bestandteil des bürgerlichen Lebens. Denk an deinen Maupassant. Das ist wie bei den Hunden, die allmählich so werden wie ihr Herrchen: Huren werden so verbohrt und spießig in ihren Wertvorstellungen wie ihre Kunden.«
»Die Analogie stimmt nicht – die Kunden sind der Hund, die Huren das Frauchen …«
»Wenn du das Prinzip der gegenseitigen Beeinflussung gelten lässt, ist das egal …«