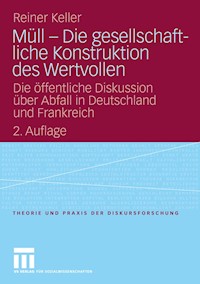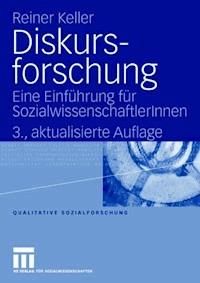Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Klassiker der Wissenssoziologie
- Sprache: Deutsch
Michel Foucault (1926–1984) gilt als einer der wichtigsten, eigenwilligsten und aktuellsten Denker des zwanzigsten Jahrhunderts. Bis zu seinem frühen Tod im Jahre 1984 war er Inhaber eines philosophischen Lehrstuhls für die 'Geschichte der Denksysteme' am renommierten Pariser Collège de France. Seine Arbeiten waren aus gegenwartsbezogenen Fragestellungen abgeleitet und zielten auf das allgemeine Projekt einer 'Geschichte der Gegenwart', einer 'Ethnologie unserer Kultur' oder einer Untersuchung der historischen Abfolge von 'Wahrheitsspielen'. Ihn interessierte insbesondere der Zusammenhang von Wissen, Macht und Subjektkonstitution. Anhand unterschiedlicher historisch-gesellschaftlicher Praxisfelder – etwa der Umgangsweisen mit Wahnsinn oder der Veränderungen des Überwachens und Strafens – untersuchte er die Veränderungen der jeweiligen Wissens- und Machtbeziehungen. Der einleitende Band von Reiner Keller stellt das Foucault'sche Werk in seinem biografischen und zeitgenössischen Kontext vor und geht dabei sowohl auf Foucaults Arbeitsweise wie auf die Inhalte und Wirkungen seiner Studien ein. Dies geschieht entlang einer originellen, in der deutschen Foucault-Rezeption bislang kaum verfolgten Perspektive: Keller schlägt vor, Foucault als einen 'Klassiker der Wissenssoziologie' neu zu lesen und aus seinem Werk Anregungen für heutiges soziologisches Forschen zu gewinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detailliertebibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.de abrufbar.
Reiner Keller
Michel Foucault
Klassiker der Wissenssoziologie, 7
Halem: Köln 2023
Die Reihe Klassiker der Wissenssoziologie wird herausgegeben
von Prof. Dr. Bernt Schnettler.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme (inkl. Online-Netzwerken) gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
1. Auflage2008
2. Auflage2023
© 2023 by Herbert von Halem Verlag, Köln
ISSN 1860-8647
ISBN (Print):978-3-7445-2073-7
ISBN (PDF):978-3-7445-2074-4
ISBN (ePub):978-3-7445-2075-1
Den Herbert von Halem Verlag erreichen Sie auch imInternet unter http://www.halem-verlag.de
E-Mail: [email protected]
EINBAND: Herbert von Halem Verlag; Susanne Fuellhaas, Konstanz
SATZ: Herbert von Halem Verlag
LEKTORAT: Julian Pitten
DRUCK: docupoint GmbH, Magdeburg
Copyright Lexicon ©1992 by The Enschedé Font Foundry.
Lexicon® is a Registered Trademark of The Enschedé Font Foundry.
Klassiker der Wissenssoziologie
Reiner Keller
Michel Foucault
Danksagung
Wir danken dem Suhrkamp-Verlag für die Abdruckgenehmigung der Umschlagabbildung.
Reiner Keller dankt Angelika Poferl und Bernt Schnettler für hilfreiche Kommentierungen.
Zum Autor
Reiner Keller ist Inhaber des Lehrstuhls für Soziologie an der Universität Augsburg.
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
I.»Der Philosoph Foucault spricht. Denken Sie.«
II.Leben und Zeitkontext
III.Hintergründe einer kritischen Geschichte des Denkens
Ein »Philosoph im Geiste der Soziologie«?
Anders denken
Wahlgegner und Wahlverwandte
Foucault, der glückliche nietzscheanische Positivist
Wahrheitsspiele
Historische Subjektivierungsweisen
Regime von Praktiken – die Freiheit der Menschen
IV.Blick in die Werkzeugkiste
Vorgehensweisen einer interpretativen Analytik
Die Untersuchung von Problematisierungen
Lösung von etablierten Denk- und Analysekategorien
Kausale Demultiplikation
Erstellung des Datenkorpus’
Arbeit am Datenmaterial: Interpretative Analytik
Analysebegriffe
Archäologie und Genealogie
Diskurs
Macht/Wissen
Gouvernementalität
Dispositiv
V.Historische Wissenssoziologie der Subjektivierungen
Irre sein – vernünftig sein
»Öffnen Sie einige Leichen«
Die Humanwissenschaften und der endliche Mensch
Disziplinierung der Körper
Ein sexuelles Wesen?
Regieren der Bevölkerungen
Technologien des Selbst
VI.Die Aktualität Foucaults
VII.Literatur
Primärliteratur
Bücher
Herausgeberbände
Vorlesungen am Collège de France
Aufsätze, Interviews,Vorträge
Weiterführende Literatur
Sekundärliteratur
Zeittafel
Sachregister
Personenregister
Vorwort zur zweiten Auflage
Die vorliegende Einführung erschien erstmals im Jahre 2008. Sie berücksichtigte die bis dahin zugänglichen deutsch- und französischsprachigen Veröffentlichungen von Michel Foucault und schlug eine wissenssoziologisch und pragmatistisch akzentuierte Lesart seiner historischen Analysen von Macht-Wissen-Regimen vor. Sowohl die wissenssoziologische wie auch die pragmatistische Deutung konnten sich auf ähnliche Werkauslegungen im englischsprachigen Raum stützen, und ich sehe mich darin auch durch einige seitdem erschienene Beiträge u.a. in den Foucault Studies bestärkt. Vielleicht findet der anhaltende weltweite Rezeptionserfolg des Foucault’schen Werkes gerade in diesen beiden Dimensionen eine wichtige Erklärung. Dies gilt auch für die Erfolgsbegriffe ›Diskurs‹ und ›Dispositiv‹, die zunehmend zu Ankerpunkten und Werkzeugen empirischer Forschungen geworden sind.
Seit der Erstveröffentlichung erschienen posthum zahlreiche weitere Vorlesungsmitschriften und ›vermischte Texte‹ Foucaults, nicht zuletzt auch der vierte Band der Reihe Sexualität und Wahrheit mit dem Titel Die Geständnisse des Fleisches. Gerade der Vergleich zwischen Vorlesungsmitschriften und regulär veröffentlichten Büchern ist sehr interessant, wenn man sich Foucaults Denken und Argumentieren ›on the road‹ nähern möchte – die Art und Weise, wie er Vorhaben angeht, sich durch Literaturberge arbeitet und sukzessive seine eigene theoretische Diagnostik dazu entwickelt. In vielen Teilen seines Werkes ist Foucault eben genau das: ein empirisch arbeitender Diagnostiker, für den Begriffe wie ›Disziplinargesellschaft‹, ›Biopolitik‹ und ›Gouvernementalität‹ in erster Linie ex post eingesetzte Konzepte zur Benennung spezifischer historischer institutioneller Konstellationen darstellen, die das Resultat einer Gesamtanalyse in sich bündeln. Es sind keineswegs Theorien oder Theoreme, die zur Vorab-Erklärung taugen. Eine Goldmine der Foucault-Forschung stellen sicher auch die in der französischen Nationalbibliothek nunmehr (z.T. auch online) zugänglichen Arbeitsnotizen Foucaults dar, deren inhaltliche Erschließung gerade erst begonnen hat. Verschiedene Webseiten bieten zu all dem hilfreiche Zugänge.a Unübersichtlich wird die Literaturlage vor allem durch die immer wieder neuen thematischen Zusammenstellungen bereits (mehrfach) erschienener Texte, die spezifische Werkaspekte hervorheben.b Dies gilt auch für die Veröffentlichungssituation insbesondere in Großbritannien oder den USA bzw. allgemeiner dem englischsprachigen Raum.
Die vorliegende Neuauflage unternimmt moderate Ergänzungen, aber keine wesentlichen Veränderungen oder Korrekturen gegenüber der Erstauflage. Zudem wurden die Literaturangaben da aktualisiert und ergänzt, wo dies geboten schien. Nach wie vor erscheinen neue, in Foucaults Werk oder einzelne Werkaspekte einführende Artikel oder Bücher. Und auch die sich auf Foucault stützenden Diskussionen und Forschungen in ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sind hoch lebendig. Sie hier aufzunehmen oder auch nur ansatzweise abzubilden, hätte allerdings ein anderes, deutlich umfangreicheres Buch erfordert, das an dieser Stelle gar nicht nötig sein mag. Denn es soll im Kern bleiben, wie es konzipiert war – als Einladung, sich dem Foucault’schen Werk in seiner Vielfalt und mit Blick auf seine empirischen Forschungen mit Neugier und ohne allzu starke Vor-Urteile zu nähern, um von dort aus dann ›selber‹ zu denken.
Ich danke Samuel Brand, Julia Schönwerth und Brigitte Ploner für Ihre Unterstützung bei den notwendigen Korrekturen, dem Herbert von Halem Verlag für die Anregung zur sowie Geduld mit der Erstellung der Neuauflage.
Reiner Keller, München, im Oktober 2023
aZ. B. vor allem die Seiten Centre Michel Foucault (https://centremichelfoucault.com/ressources-en-ligne/ [3.10.22]); Foucault News (https://michel-foucault.com/category/foucault-archives/ [3.10.22]); oder das Journal Foucault Studies (https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies [3.10.22]); auch Foucault-Info (https://foucault.info/ [3.10.22]). Hinzu kommen unzählige im Netz verfügbare Videoclips von Vorträgen oder Diskussionen, an denen Foucault beteiligt war, sowie die Tonaufzeichnungen seiner Vorlesungen, Radiointerventionen usw. Vgl. bspw. das Foucault Audio Archive an der University of California, Berkeley (u. a. mit zahlreichen englischen Vorträgen): https://guides.lib.berkeley.edu/mfaa [3.10.22].
bZu Foucaults Vorgehensweisen bspw. Foucault (2009b), zu seinen Schriften zur Literatur Foucault (2003), zur ›Lebenskunst‹ Foucault (2007), zur politischen Philosophie Foucault (2009c), zu Medien Foucault (2012). Vergleichsweise kostengünstig ist die bei Suhrkamp 2008 erschienene Zusammenstellung Die Hauptwerke; zahlreiche aufschlussreiche Werkbegleitungen finden sich nach wie vor in den vier Bänden seiner verstreuten Schriften (ebenfalls im Suhrkamp-Verlag). Zudem sind (nicht nur in) deutscher Sprache zahlreiche Sammelbände erschienen, die sich mit der Foucault-Rezeption und ihren Wirkungen in verschiedensten Wissensgebieten (Gender Studies, politische Philosophie, Raumforschung usw.) beschäftigen. Ein Einbezug dieser aktuellen Diskussionen würde jedoch den Rahmen einer Einführung sprengen.
I.»Der Philosoph Foucault spricht. Denken Sie.«
»Wenn Foucault die Arena betritt, rasch, draufgängerisch, wie jemand, der ins Wasser springt, steigt er über Gliedmaßen und Körper von Hörern, um sein Pult zu erreichen, schiebt er Tonbandgeräte beiseite, um sein Manuskript ablegen zu können – er öffnet seine Jacke, schaltet eine Lampe an und beginnt, auf die Minute pünktlich. Eine starke, tragende Stimme, von Lautsprechern verstärkt, die einzige Konzession an die Moderne in einem Saal, der von einem aus Stuckbecken aufsteigenden Licht nur spärlich erhellt wird. Es sind dreihundert Plätze vorhanden und fünfhundert zusammengepferchte Personen, die auch das kleinste Fleckchen Raum mit Beschlag belegen. Nicht einmal eine Katze würde da noch einen Fuß hineinsetzen […]. Keinerlei rednerischer Effekt. Das Ganze ist vollkommen klar und schrecklich durchschlagend. Nicht die geringfügigste Konzession an die Improvisation« (zit. nach ERIBON 1991: 315f.).
Michel Foucault (1926-1984), dessen Auftritt an der renommiertesten französischen Denkakademie, dem Collège de France, hier von einem Journalisten der französischen Wochenzeitschrift Nouvel Observateur geschildert wird, war seit Mitte der 1960er-Jahre zu einem Star der französischen Intellektuellenszene geworden. Das verdankte er vor allem einem sperrigen Buch, das 1966 unter dem Titel Les mots et les choses (»Die Wörter und die Dinge«; dt. Titel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften) in Frankreich erschien, und dessen Schlusszeilen noch Jahre später manchen Kritiker in Wallung versetzten. Das Erscheinen der »Gestalt des Menschen«, so schrieb Foucault,
»[…] war die Wirkung einer Veränderung in den fundamentalen Dispositionen des Wissens. Der Mensch ist eine Erfindung, deren junges Datum die Archäologie unseres Denkens ganz offen zeigt. Vielleicht auch das baldige Ende. Wenn diese Dispositionen verschwänden, so wie sie erschienen sind, […] dann kann man sehr wohl wetten, daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand« (FOUCAULT 1974a: 462).
Obwohl diese Schrift allen verlegerischen Grundsätzen eines erfolgversprechenden Textes widersprach, wurde die Ordnung der Dinge zum editorischen Ereignis des Jahres, mehr noch des Jahrzehnts.
»Foucault geht weg wie warme Semmeln«, hieß es dazu im Nouvel Observateur (zit. nach ERIBON 1991: 242). Der Verlag kam kaum mit dem Drucken nach. Das Buch war wohl allgegenwärtig: Man trug es am Strand, man zeigte sich damit im Café, man bestritt damit Konversationen (vgl. ebd.: 242f.). Erst Ende der 1970er-Jahre wurde es in Frankreich stiller um den eigenwilligen Denker, ein enfant terrible des Collège de France, das neben seinem akademischen Wirken vielfältiges politisch-praktisches Engagement gezeigt hatte, beispielweise die Gefangenenbewegung oder die polnische Solidarność unterstützte, gegen Rassismus auf die Straße ging und in der einen oder anderen Gefängnisnacht die polizeiliche Gewalt der Staatsmacht unmittelbar zu spüren bekam. In dieser Zeit begann jedoch sein Aufstieg in der englischsprachigen Welt, nicht unbedingt in den Sozialwissenschaften, sondern eher in den Humanities und Cultural Studies. Dies veranlasste den ebenfalls weltbekannten deutschen Philosophen und kritischen Theoretiker Jürgen Habermas zu einer posthum rühmenden Einschätzung, in der gleichwohl leichtes Bedauern anklingt: Foucault sei aus dem Kreis der philosophischen Zeitdiagnostiker seiner Generation derjenige, der den »Zeitgeist am nachhaltigsten affiziert« habe (vgl. den Klappentext von ERIBON 1991). Habermas, der weithin als eher verständnisloser Kritiker Foucaults auftrat, hat auch damit nicht unbedingt den Punkt getroffen, zumindest dann nicht, wenn die Rede vom ›Zeitgeist‹ das Modische und Flüchtige, das nahende Verfallsdatum bezeichnen sollte. Foucault ist, so kann man vielmehr festhalten, heute ›verbreiteter‹ denn je und hat zuletzt auch die Sozialwissenschaften erobert – mehr noch, er ist inzwischen eine »moderne kulturelle Ikone« geworden (o’FARRELL 2005: 1).1
Zwanzig Jahre nach seinem Tod sei Foucault immer noch präsent, heißt es in einem Dossier des Magazine Littéraire (Nr. 435, Oktober 2004: 29) anlässlich des ihm gewidmeten Pariser Herbst-Festivals für Kultur und Kunst. Vierzig Jahre danach hat sich diese Präsenz noch einmal in fast unglaublicher Weise potenziert – was sicherlich auch viele ›nachlässig-modische‹ An- und Aufrufungen beinhaltet. Und sicherlich halten seine nunmehr (zum Teil auch schon digitalisiert) zugänglichen Notizen weitere Überraschungen bereit (vgl. die Hinweise im Vorwort zu diesem Buch sowie: Le Magazine Littéraire Nr. 540: Dossier Foucault Inédit, 2014).
Noch bis Anfang der 2000er-Jahre wäre es unwahrscheinlich gewesen, sein Werk in einer Buchreihe zu den Klassikern der Wissenssoziologie zu behandeln, obwohl er zweifellos historisch-empirische Analysen von Wissensformationen betrieb. Foucault war von seiner akademischen Ausbildung her in erster Linie Philosoph, auch Psychologe. Allerdings arbeitete er, ungewöhnlich genug für einen Philosophen, empirisch an historischen Materialien und bewegte sich damit auf geschichtswissenschaftlichem Terrain. Dies wiederum verknüpfte er mit einem gegenwartsbezogenen diagnostischen Frageinteresse, bei dem jedoch Bezüge zur Soziologie keine maßgebliche Rolle spielten, abgesehen von wenigen, unsystematischen (und überwiegend kritischen) Erwähnungen von Auguste Comte, Émile Durkheim, Marcel Mauss sowie einzelnen Verweisen auf Erving Goffmans Untersuchung der ›Asyle‹ oder teils zustimmenden, teils kritischen Bezügen auf die Kritische Theorie. Häufiger und positiver ist allerdings die Referenz auf Max Weber, vor allem dessen Protestantische Ethik und die Analyse der abendländischen Rationalisierung. Foucault verstand sich nicht als Soziologe, auch wenn er hier und da Bezüge zur Soziologie herstellte und zumindest in einem Interview seine Arbeiten als ›soziologische Institutionenanalyse‹ einordnen ließ (S. 46f.). In einem späten, für ein Philosophielexikon verfassten und unter einem Pseudonym erschienenen Selbstporträt verortete er sich in der kritischen philosophischen Tradition Immanuel Kants und schrieb, man könne »sein Unternehmen Kritische Geschichte des Denkens nennen« (FOUCAULT 2005q: 776f.). Aufgabe der Philosophie sei es, »anders zu denken«:
»Aber was ist die Philosophie heute – ich meine die philosophische Aktivität –, wenn nicht die kritische Arbeit des Denkens an sich selber? Und wenn sie nicht, statt zu rechtfertigen, was man schon weiß, in der Anstrengung liegt, zu wissen, wie und wieweit es möglich wäre, anders zu denken?« (FOUCAULT 1989b: 15f.).
Damit greift Foucault Kants Bestimmung der ›Aufklärung‹ auf; auch der Titel des vorliegenden Kapitels lässt sich so verstehen: »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!« (KANT 1978: 53). An anderer Stelle sprach er davon, zu diesem Zwecke eine »Ethnologie unserer eigenen Kultur« zu betreiben. Man könne seine Untersuchungen »als eine Analyse der für unsere Kultur charakteristischen kulturellen Tatsachen definieren. In diesem Sinne handelt es sich gewissermaßen um eine Ethnologie der Kultur, der wir selbst angehören« (FOUCAULT 2001c: 776).
Foucault gebraucht den Begriff der ›Kritik‹ im Sinne Kants, als Frage nach den Grundlagen, Möglichkeitsbedingungen und Funktionsweisen des Untersuchungsgegenstandes (vgl. FOUCAULT 2005l, 1992): Es handele sich um »eine Ethnologie unserer Rationalität, unseres Diskurses« (FOUCAULT 2001c: 776). Sein Lehrstuhl am prestigeträchtigen Collège de France, den er von 1970 bis zu seinem frühen Tod innehatte, trug den Titel ›Geschichte der Denksysteme‹.
Es ist wenig verwunderlich, dass Foucault das Schicksal etlicher ›Grenzgänger zwischen den Disziplinen‹ teilte. Vielen Philosophen2 war (und ist) er zu wenig philosophisch, Historikern zu wenig historisch, Soziologen zu wenig soziologisch, Politikwissenschaftlern zu wenig politologisch usw. Umgekehrt erklärt sich aus diesem Grenzgängertum sein Erfolg, nicht zuletzt in Fächern wie den interdisziplinären Cultural Studies und verwandten Gebieten, die seit den 1970er-Jahren entstanden sind. Der französische Historiker Paul Veyne, ein Freund Foucaults, sah in seinem Werk »das bedeutsamste Denkereignis unseres Jahrhunderts« (in Le Monde vom 27.6.1984; zit. nach ERIBON 1991: 476, vgl. VEYNE 2009). Foucault selbst hat die Kontroversen um dieses Werk durch (häufig verdeckte) philosophische Seitenhiebe, eingestreute Ironisierungen, nachträgliche Redigierungen und Kommentierungen seiner Texte durchaus befördert. All denjenigen, die auf Eindeutigkeit, Konsistenz und Kohärenz wissenschaftlicher Welterklärung setzten, gab er einen Korb und galt ihnen damit als zwielichtige Gestalt. ›Anders zu denken‹ bedeutet für ihn die Umsetzung philosophischen Fragens in konkreten, historischempirischen Untersuchungen. Dafür wählte er geschichtliche Gegenstandsbereiche, die meist einen unmittelbaren lebensgeschichtlichen Bezug aufweisen: die Trennung von Wahnsinn und Vernunft als Grundlage der Entwicklung der Psychologie, die Entstehung der klinischen Medizin, die Wissensorganisation der Humanwissenschaften, die Strafpraktiken und Disziplinartechnologien oder die Geschichte der Sexualität. Ziel dieser Untersuchungen sei nicht die Erklärung der jeweiligen Entwicklungen durch vorab entworfene Theorien, sondern die Möglichkeit, daraus durch ein unvoreingenommenes »sich Einlassen« einen Gewinn in Form einer Erfahrung zu ziehen:
»Eine Erfahrung ist etwas, aus dem man verändert hervorgeht. Wenn ich ein Buch schreiben sollte, um das mitzuteilen, was ich schon gedacht habe, ehe ich es zu schreiben begann, hätte ich niemals die Courage, es in Angriff zu nehmen. Ich schreibe nur, weil ich noch nicht genau weiß, was ich von dem halten soll, was mich so sehr beschäftigt. So dass das Buch ebenso mich verändert wie das was ich denke. […] Ich bin ein Experimentator und kein Theoretiker. Als Theoretiker bezeichne ich jemanden, der ein allgemeines System errichtet, sei es ein deduktives oder ein analytisches, und es immer in der gleichen Weise auf unterschiedliche Bereiche anwendet. Das ist nicht mein Fall. Ich bin ein Experimentator in dem Sinne, dass ich schreibe, um mich selbst zu verändern und nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor« (FOUCAULT 1996: 24).
Zu einer solchen Haltung gehört auch sein bereits in der Archäologie des Wissens formulierter Appell, man möge ihn nicht auf eine ›lebenslängliche‹ Position festlegen, sondern ihm Veränderung zugestehen (vgl. FOUCAULT 1988a: 30). Wiederholt betonte er, seine Arbeiten seien ›Werkzeugkisten‹, aus denen man sich nach eigenen theoretischen und praktischen Zwecken bedienen solle (FOUCAULT 2002a, 2002b): »Der Philosoph Foucault spricht. Denken Sie«, lautete einer seiner Vortragstitel aus dem Jahre 1973 (FOUCAULT 2002c).
Die ernsthafte Auseinandersetzung mit Foucault im deutschsprachigen Raum stand lange Zeit im Schatten heftiger Polemiken anderer Intellektueller. Von Jean Améry über Jürgen Habermas bis hin zu Hans Ulrich Wehler reichen die Kritiker, die aus einflussreichen Positionen heraus verdammende Urteile gegen sein ›unverantwortliches Denken und Philosophieren‹ formulierten.3 Er blieb davon nicht unberührt. So schildert Paul Veyne ein gemeinsames Abendessen mit Habermas, das anlässlich von Vorträgen des Letzteren in Paris im März 1983 stattfand:
»Foucault konnte nicht umhin, Habermas zum Abendessen einzuladen. […] Es wird englisch gesprochen. Die Unterhaltung, von eisiger Höflichkeit, begann mit einer Diskussion, in der Habermas gegen ich weiß nicht mehr welche politische Haltung Mitterands in jener Woche protestierte […; Ausl. i. O.]. Dann begann man über Philosophie zu sprechen, und der latente clash war so offensichtlich, daß Foucault am Ende nach einem Satz von Habermas eine Pause eintreten läßt, sich zu ihm dreht, in einem breiten, eher verschlingenden und grausamen als liebenswürdigen Lächeln die zwei Reihen seiner Haifischzähne entblößt und sagt: ›Bin ich vielleicht ein Anarchist?‹ wobei er das Wort Anarchist sarkastisch betont« (zit. nach ERIBON 1998: 289).
Zunächst schien es für Foucault also keinen Platz im etablierten akademischen und intellektuellen Feld Deutschlands zu geben. Die Rezeption seiner Arbeiten fand eher an den Rändern des universitären Betriebes statt. Doch inzwischen haben sich die Wogen geglättet; selbst im Frankfurter Umkreis der Kritischen Theorie ist der Name Foucault zitierfähig geworden (HONNETH/SAAR 2003). Die Auseinandersetzung mit seinen Arbeiten ist quer durch die verschiedenen geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen lebendiger denn je.
Auch ›Foucault und die Soziologie‹ – das ist kein einfaches Verhältnis und immer wieder einer Diskussion wert (OTERO 2006; FABIANI 2004). Nach wie vor behaupten ebenso eingefleischte wie kurzsichtige Foucault-Adepten, mit Foucault wäre ›die‹ Soziologie überwunden. Foucaults häufig zitierte Ablehnung von ›Interpretation‹ und ›Hermeneutik‹ hat zusätzlich für Missverständnisse und Streitereien gesorgt. Sie wurde und wird immer wieder für Generalangriffe des ›Poststrukturalismus‹ (STÄHELI 2000) auf soziologische Positionen des ›interpretativen Paradigmas‹ (KELLER 2012) benutzt. Doch was bedeuten die Begriffe ›Interpretation‹ und ›Hermeneutik‹ für Foucault? Beziehen sie sich tatsächlich auf das, was heute in Teilen der Soziologie darunter verstanden wird?4 Betreffen sie das Anliegen der vorliegenden Arbeit, ihn als Wissenssoziologen in der Tradition qualitativer, also eben im heutigen soziologischen Verständnis interpretativer und hermeneutischer Forschung zu lesen (KELLER 1997, 2005, 2011b)? Diese Fragen sind im weiteren Textverlauf zu beantworten. Hier muss der Hinweis genügen, dass es ›die‹ Soziologie nicht gibt. Foucaults Denken und Arbeiten lässt größere Affinitäten zu einigen soziologischen Vorgehensweisen und Erkenntnisinteressen erkennen, als es oberflächlichen Polemiken erträglich erscheint. Ehemalige Mitarbeiter wie Robert Castel haben einflussreiche soziologische Studien vorgelegt, auf die sich Foucault selbst zustimmend bezogen hatte, und bereits mehrfach sind Wahlverwandtschaften zwischen Foucault und manchen soziologischen Ansätzen betont worden (z. B. DEAN 1994; KENDALL/WICKHAM 1999; LAW 1994; HALL 2002). Wer das Denken Foucaults als Alternative zur Soziologie insgesamt betrachtet, verkennt die Komplexität des ›soziologischen Feldes‹ (Pierre Bourdieu), das sich in den 1960er-Jahren wie überall in Europa auch in Frankreich gerade erst konstituierte und zunächst noch gar nicht als Referenzgröße herangezogen werden konnte.
Die vorliegende Einführung folgt dem Grundgedanken, im Unterschied zu anderen Werkerläuterungen Foucault weder als Philosophen noch als Historiker zu rezipieren, sondern die wissenssoziologischen Momente seines Werks herauszuarbeiten. Dass man ihn nicht nur als allgemeinen ›Klassiker des Denkens‹, sondern als ›Klassiker der Soziologie‹ interpretieren kann, wurde im anglo-amerikanischen Kontext von Barry Smart (2002) schon lange und mit großer Selbstverständlichkeit behauptet, der ihn in einer Einführungsreihe neben die ›key sociologists‹ des 20. Jahrhunderts, Émile Durkheim, Georg Simmel, die Frankfurter Schule, Max Weber u. a. stellt. In der soziologischen Theorie haben Foucault’sche Konzepte deutliche Spuren bei Anthony Giddens sowie in vielen Spezialsoziologien hinterlassen (BERT 2006). Auch im deutschsprachigen Raum ist eine Aufnahme in den Klassikerhimmel erfolgt (KNOBLAUCH 2000; STÄHELI 2001; KAESLER 2005; TREIBEL 2006).
Das Anliegen, Foucault als Wissenssoziologen zu lesen, kann an einige Vorarbeiten anschließen. 1982 stellte Philipp Manning fest, Foucault erkunde das Feld der Wissenssoziologie, d. h. die Bedeutung von Ideen in ihrem sozialen Kontext, die Erklärung ihrer Kontinuität und ihres Wandels. Wissenssoziologisch sei auch seine Frage nach den Konzepten, die zeigen, wie bestimmte Praktiken in einem institutionellen Feld sich unterscheiden, welche Rolle Machtbeziehungen bzw. materielle und politische Kräfte für Strukturierungen des Wissens spielen sowie welche Folgen sich daraus ergeben (MANNING 1982: 65). 1987 sprach der Philosoph Manfred Frank von Foucault als einem ›Wissenssoziologen‹ (vgl. BRIELER 1998a: 123). Für die australische Kulturwissenschaftlerin Clare O’Farell wiederum bezeichnen Foucaults Kulturverständnis und sein Forschungsinteresse die Art und Weise, in der eine Gesellschaft Wissen über die Welt und über die Sozialbeziehungen konstruiere und organisiere sowie spezifische Verhaltensweisen und Wissensformen bzw. Wissensbestände als akzeptabel oder inakzeptabel definiere (o’FARELL 2005: 17). Vor einiger Zeit erfolgten auch im deutschsprachigen Raum weitere Einordnungen Foucaults in die Wissenssoziologie (KNOBLAUCH 2014: 209ff.; MAASEN 2007; vgl. bereits KELLER 1997 sowie 2011b). Gegenüber diesen meist knappen Präsentationen wird hier eine umfassende Interpretation vorgestellt, die neben einem biografischen Überblick auch Hintergründe des Werkes, Vorgehensweisen und materiale Analysen berücksichtigt. Gezeigt werden soll, dass sich die Überlegungen Foucaults gewinnbringend auf wissenssoziologische Fragestellungen anwenden lassen.
Foucault bewegte sich in seinem Denken und Arbeiten weg von der ›reinen‹ Philosophie und ihren Fragen nach den universalen Merkmalen des Menschseins hin zur historisch-empirischen Analyse der vielfältigen und kontingenten Konstitutionsprozesse menschlicher Subjektformen in gesellschaftlichen Praxisfeldern, im Zusammenspiel von Wissen und Macht, von Diskursen und institutionellen Praktiken im Umgang mit Wahnsinnigen, der Behandlung von Kranken oder der Bestrafung von Gesetzesbrechern etc.5 Er greift dabei auf Ideen der französischen geschichtswissenschaftlichen Annales-Schule zurück, die ihrerseits stark durch die Soziologie Émile Durkheims geprägt war. Diese hatte auch den sprachwissenschaftlichen und ethnologischen Strukturalismus beeinflusst, auf den sich Foucault in seinen Arbeiten der 1960er-Jahre hin und wieder bezog:
»Der alte Gegensatz zwischen den Humanwissenschaften und der Geschichtswissenschaft […], dieser Gegensatz verschwindet. Veränderungen können auch mit Strukturbegriffen analysiert werden, und der historische Diskurs ist durchsetzt mit Analysen, die der Ethnologie, der Soziologie, den Humanwissenschaften entnommen sind« (FOUCAULT 2001j: 752).
Wenn sich Foucault ironisch und selbstbewusst in seiner Archäologie des Wissens von 1969 als »glücklichen Positivisten« bezeichnet (s. S. 57ff.) und damit das blanke Entsetzen seiner Philosophenkollegen hervorruft, so nimmt er doch nur ein Etikett auf, das spätestens seit Auguste Comte und dann bei Émile Durkheim den Anspruch der Soziologie anmeldete, der Philosophie den Königsthron der Disziplinen streitig machen zu wollen – »positive Philosophie«, so lautete der Titel von Comtes soziologischen Vorlesungen.
Zwischen Durkheim und Foucault lassen sich manche Interessensüberschneidungen erkennen. Durkheim wandte sich in seinem Spätwerk einer wissenssoziologischen Geschichte der »systèmes de représentation collectives«, also der kollektiven Vorstellungs- und Glaubenssysteme zu. Foucaults Lehrstuhl war mit »Geschichte der ›systèmes de pensées‹« (Denksysteme) tituliert, und er hatte das zuvor entsprechend entworfen und begründet. Beide behandelten Aspekte der sozialen Herkunft, Grundlagen und Folgen von Klassifikationssystemen und Wissensregimen (z. B. DURKHEIM 1981: 27; FOUCAULT 1974a, 2001d; vgl. auch ESSBACH 1997). Beide wandten sich damit gegen Immanuel Kant und dessen Annahme von ahistorischen, universalen Apriori des menschlichen Erkenntnisvermögens und der Verstandestätigkeit, die – wie Kausalität, Raum und Zeit – von Menschen zur deutenden Ordnung der Welt benutzt werden. Stattdessen insistierten sie auf der sozialen Genese und Geschichtlichkeit, d. h. einem ›historischen Apriori‹ des Wissens. Dennoch ist Foucault nicht einfach ›Durkheimianer‹. Dazu unterscheiden sich ihre Herangehensweisen an diese Fragen doch zu sehr. Eher ließe sich sagen, dass Foucault zwar einige der von Durkheim aufgeworfen Fragen aufgreift, aber darauf völlig andere Antworten gibt. Durkheim analysierte am Beispiel der australischen Ureinwohner die Wissenssysteme als Ausdruck sozialer Hierarchien und Strukturierungen (vgl. DURKHEIM 1981; EGGER 2008).6 Foucault dagegen lehnt eindeutige Kausalitäten und Funktionalitäten ab; er fragt nach dem Entstehen, dem Gebrauch, den Effekten, dem Wandel und den Ersetzungen von Wissensregimen – den Unterscheidungen von Wahnsinn und Vernunft, von gesund und krank, von moralisch guter und schlechter Sexualität – in konkreten gesellschaftlichen Praxisfeldern. Auch in anderer Hinsicht findet sich ein deutlicher Unterschied. Foucaults Interesse, seine Sorge, gilt gerade nicht den Fragen nach der gesellschaftlichen Integration und der Sicherung der moralischen Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, die Émile Durkheim (und schon zuvor Auguste Comte) beschäftigten. Für ihn lässt sich das Gegenteil behaupten: Er will in kritischer Absicht ›Evidenzen‹ zerstören und dazu anstiften, ›anders zu denken‹. Dazu untersuchte er die neuere Geschichte und die europäische bzw. die französische Wissenskultur. Gegen Fortschrittsperspektiven, welche die Entwicklung beispielsweise des medizinischen Wissens als stetigen Rationalitätszuwachs beschrieben, konzentrierte er sich auf unbeabsichtigte Folgen gesellschaftlicher ›Problembearbeitungen‹. Darin verortet er die Mechanismen der historischen Veränderung und Transformation von Wissen-Macht-Beziehungen, deren Folgen bis in unsere Gegenwart reichen. Die Gegenstände, mit denen er sich in diesem Zusammenhang beschäftigte, haben einen gemeinsamen Fluchtpunkt. Sie stellen Mosaiksteine zur Beantwortung von Grundfragen bereit, mit denen sich Foucault zeit seines Lebens befasste: Woher rührt die Art und Weise, wie ›moderne‹ Menschen sich heute als wahrnehmende, fühlende, denkende, handelnde Individuen erfahren? Wie wird ›der Mensch‹ zum Subjekt und Objekt von wissenschaftlichen und anderen Erkenntnisprozessen? Inwiefern können im historischen Prozess unterschiedliche Erfahrungsformen herausgearbeitet werden, und durch welches Wissen werden sie ermöglicht? Die Frage nach dem Wissen ist für Foucault untrennbar mit derjenigen nach der Macht verbunden, nach den gesellschaftlichen Kämpfen um die Wahrheit und die Etablierung von Wissens sowie Praxisformen in der Abfolge gesellschaftlicher Wahrheitsspiele.
Die Originalität und Relevanz der Foucault’schen Perspektive für wissenssoziologische Fragestellungen liegt zum einen in seinem disziplinären Grenzgängertum, das philosophische Fragen durch empirische Problemstellungen ersetzt und mit geschichts- und sozialwissenschaftlichen Mitteln bearbeitet. Sie liegt zum anderen in seiner Vorgehensweise bei der empirischen Analyse der verflochtenen gesellschaftlichen Machtbeziehungen und Wissensentwicklungen. Diese Untersuchungen setzen – ähnlich wie die Forschungsstrategien qualitativer Sozialforschung – gleichsam ›unten‹, auf der Ebene institutioneller und diskursiver Praktiken an, und entwickeln von da aus Konzepte mit weitreichendem Diagnosegehalt. Foucault nimmt einen Bereich des Wissens in den Blick, der weit über das engere Feld der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsforschung hinausreicht, sich aber auch nicht mit den Phänomenen des ›Jedermann-Wissens‹ (BERGER/LUCKMANN 2003; HITZLER/REICHERTZ/SCHRÖER 1999) oder Alltagswissens begnügt. Damit ermöglicht er einen umfassenden Zugriff auf Prozesse der gesellschaftlichen Produktion und Zirkulation von Wissen in seiner Verknüpfung mit sozialen Praktiken, die bislang kaum Gegenstand der Wissenssoziologie gewesen sind. Die vorliegende Einführung kann und will keine umfassende Darstellung seines Gesamtwerkes bieten; dazu muss auf die weiterführenden Hinweise im Literaturverzeichnis und die Originalschriften verwiesen werden. Im anschließenden Kapitel II werden zunächst Foucaults Lebensweg und der zeitgenössische Kontext seines Denkens vorgestellt. Kapitel III erläutert den Hintergrund seiner Fragestellungen, die ihn von der Philosophie weg und hin zu einer ›empirischen‹ Analyseperspektive führen. Die Vorgehensweise sowie zentrale Konzepte Foucaults werden in Kapitel IV diskutiert. Kapitel V beschäftigt sich mit den empirischen Studien, die zu einer Wissenssoziologie der modernen Subjekte beitragen. Das abschließende Kapitel VI beleuchtet Foucaults gegenwärtige Bedeutung.
Am Ende dieser einführenden Bemerkungen muss noch auf einen misslichen Umstand hingewiesen werden: Die Zitationslage zu Foucault ist kompliziert. Er hat ein umfangreiches Werk aus Büchern, posthumen Vorlesungsmitschriften und weltweit gestreuten kleineren Texten hinterlassen. Letztere sind in der deutschen Ausgabe der Schriften (2001ff.) enthalten, allerdings in Übersetzungen, die von existierenden älteren deutschsprachigen Veröffentlichungen abweichen. Im vorliegenden Buch wird überwiegend nach diesen Neuübersetzungen zitiert; sofern auf ältere Versionen Bezug genommen wurde, hat dies pragmatische Gründe. Auch die Bücher Foucaults stimmen in ihren verschiedenen Auflagen und Übersetzungen nicht überein; mitunter wurden einzelne Kapitel weggelassen, Vorworte für Neuauflagen und Übersetzungen hinzugefügt oder Texte stark redigiert. Übersetzungen in andere Sprachen – insbesondere ins wahlweise amerikanische oder britische Englisch – wählten mitunter Begriffe, die dem französischen Original nicht wirklich entsprachen und neue Assoziationen erzeugten, welche zur Konfusion beitrugen. So wurde ›dispositif‹ häufig als ›apparatus‹ übersetzt, ein Begriff, der eher für Louis Althussers Konzept der ›Staatsapparate‹ passt. Die Vorlesung Die Ordnung des Diskurses wurde im Englischen als The Discourse on Language veröffentlicht. Kommentierungen in der Sekundärliteratur beziehen sich mitunter auf französische Textversionen, die in Übersetzungen nie verfügbar waren. Zumindest im vorliegenden Band sollten jedoch alle Verweise eindeutig zuordenbar sein.
1In den Untiefen des World Wide Web sind nicht nur Filmausschnitte und Radioaufnahmen zu finden, sondern der fotoillustrierte Foucault-Spaziergang durch Paris, Foucault-Spielzeugfiguren mit magischen Kräften ebenso wie die Musikalisierung in Gestalt eines Foucault-Funk, das Foucault-Quiz oder mehrere weltweite ›Wer sieht aus wie Foucault?‹-Wettbewerbe – schließlich hat er nicht nur ein Werk, sondern auch einen ›Look‹ geschaffen.
2Um der Lesbarkeit willen wird in diesem Buch das generische Maskulinum verwendet. Sofern nicht explizit anders angegeben, sind immer alle Geschlechter gemeint.
3Vgl. Eribon (1991: 241ff.) und exemplarisch Habermas (1985: 279-312). Eine engagierte Verteidigung Foucaults präsentiert Schäfer (1995).
4Vgl. zu Foucault vor allem Dreyfus und Rabinow (1987), zum Begriff der Hermeneutik allgemeiner Jung (2018) und Kurt (2008), im Zusammenhang mit Fragen der Diskursforschung Keller u. a. (2015).
5Solche Fragen sind schon früh auch für wissenssoziologische Positionen bedeutsam. 1926 forderte Max Scheler eine wissenschaftliche »Geschichte des Selbstbewußtseins des Menschen von sich selbst« (zitiert nach BRIELER 1998a: 164). Marcel Mauss hatte in den 1930er-Jahren von »Techniken des Körpers« (MAUSS 1978a) gesprochen, an die Foucaults »Technologien des Selbst« (s. u. S. 144) erinnern. Derselbe Mauss schrieb in einem Aufsatz über den Begriff der Person: »Wie hat sich im Laufe der Jahrhunderte und in den verschiedenen Gesellschaften nicht nur das ›Ich‹-Gefühl, sondern wie haben sich Vorstellung und Begriff entwickelt, die die Menschen verschiedener Zeiten sich davon gebildet haben? Was ich Ihnen vorführen will, ist die Reihe der Gestalten, die dieser Begriff im Leben der Menschen in der Gesellschaft angenommen hat […]« (MAUSS 1978b: 225; vgl. MOEBIUS 2006).
6Ludwik Fleck (1980) veröffentlichte bereits in den frühen 1930er-Jahren eine eindrucksvolle Studie der sozialen Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, die an Durkheim anschloss.
II.Leben und Zeitkontext
Vielleicht lässt sich, wie Didier Eribon schreibt, Foucaults Leben und Werk durch einen Satz des französischen Poeten René Char begreifen, mit dem er Anfang der 1960er-Jahre die französische Originalausgabe seiner Habilitationsschrift über die Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft einleitete: »Entwickelt eure rechtmäßige Fremdheit« (ERIBON 1991: 13; hier zit. nach FOUCAULT 2001g; vgl. CHAR 1983). Diese Aufforderung wäre demnach, in all ihren Schattierungen, Prinzip seiner eigenen Lebensführung, seiner intellektuellen Anstrengungen, seiner empirischen Sensibilität und seines politischen Engagements. Beginnen wir zunächst mit dem Lebensweg.7 Foucault gab verschiedentlich zur Auskunft, er interessiere sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit für Dinge, die mit seinem Leben zu tun hätten, die ihn in je unterschiedlicher Weise und aus ebenso unterschiedlichen Gründen berührten:
»Wenn ich mich an eine theoretische Arbeit gemacht habe, geschah das stets auf der Basis meiner eigenen Erfahrung und im Zusammenhang mit Prozessen, die vor meinen Augen abliefen. Weil ich in den Dingen, die ich sah, in den Institutionen, mit denen ich zu tun hatte, und in meinen Beziehungen zu anderen Risse, versteckte Erschütterungen oder Dysfunktionen zu erkennen glaubte, begann ich mit Arbeiten, die gleichsam Fragmente einer Autobiographie darstellten« (FOUCAULT 2005b: 223).