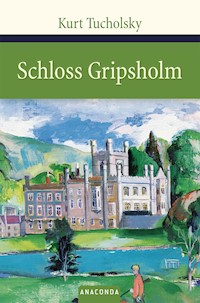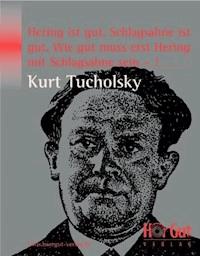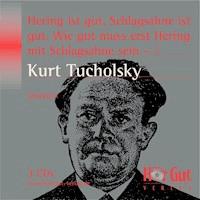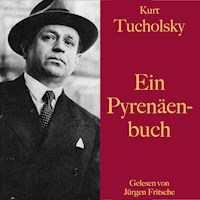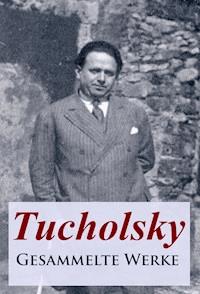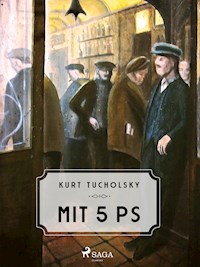
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Sammelband von Kurt Tucholsky sind in 15 Kapiteln zusammengefasst 100 Kurzgeschichten zu finden. Der Autor thematisiert aus seiner Sicht und aus der Sicht seiner vier erfundenen Pseudonyme – also mit 5 PS – viele soziale und wirtschaftliche Themen seiner Zeit. Die Entwicklung der Städte und ihrer Bewohner spielt eine große Rolle sowie die Blindheit der Menschen gegenüber Veränderungen. Das sture Befolgen gesellschaftlicher Werte und Normen lässt die Menschen wie Marionetten erscheinen, die mit Scheuklappen durch das Leben gehen und sich steuern lassen, anstatt selbst zu denken zu beginnen.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Tucholsky
Mit 5 PS
Saga
Mit 5 PS
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1928, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728015469
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Dem Andenken Siegfried Jacobsohns
Gestorben am 3. Dezember 1926
*
Die Welt sieht anders aus. Noch glaub ichs nicht.
Es kann nicht sein.
Und eine leise, tiefe Stimme spricht:
„Wir sind allein.“
Tag ohne Kampf — das war kein guter Tag.
Du hasts gewagt.
Was jeder fühlt, was keiner sagen mag:
du hasts gesagt.
Ein jeder von uns war dein lieber Gast,
der Freude macht.
Wir trugen alles zu dir hin. Du hast
so gern gelacht.
Und nie pathetisch. Davon stand nichts drin
in all der Zeit.
Du warst Berliner, und du hattest wenig Sinn
für Feierlichkeit.
Wir gehen, weil wir müssen, deine Bahn.
Du ruhst im Schlaf.
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan.
Der aber traf.
Du hast ermutigt. Still gepflegt. Gelacht.
Wenn ich was kann:
Es ist ja alles nur für dich gemacht.
So nimm es an.
START
Wir sind fünf Finger an einer Hand.
Der auf dem Titelblatt und:
Ignaz Wrobel. Peter Panter. Theobald Tiger. Kaspar Hauser.
Aus dem Dunkel sind diese Pseudonyme aufgetaucht, als Spiel gedacht, als Spiel erfunden — das war damals, als meine ersten Arbeiten in der „Weltbühne“ standen. Eine kleine Wochenschrift mag nicht viermal denselben Mann in einer Nummer haben, und so erstanden, zum Spass, diese homunculi. Sie sahen sich gedruckt, noch purzelten sie alle durcheinander; schon setzen sie sich zurecht, wurden sicherer, sehr sicher, kühn — da führten sie ihr eigenes Dasein. Pseudonyme sind wie kleine Menschen; es ist gefährlich, Namen zu erfinden, sich für jemand anders auszugeben, Namen anzulegen — ein Name lebt. Und was als Spielerei begonnen, endete als heitere Schizophrenie.
Ich mag uns gern. Es war schön, sich hinter den Namen zu verkriechen und dann von Siegfried Jacobsohn solche Briefe gezeigt zu bekommen:
„Sehr geehrter Herr! Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich Ihr geschätztes Blatt nur wegen der Arbeiten Ignaz Wrobels lese. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Dagegen haben Sie da in Ihrem Redaktionsstab einen offenbar alten Herrn, Peter Panter, der wohl das Gnadenbrot von Ihnen bekommt. Den würde ich an Ihrer Stelle . . .“
Und es war auch nützlich, fünfmal vorhanden zu sein — denn wer glaubt in Deutschland einem politischen Schriftsteller Humor? dem Satiriker Ernst? dem Verspielten Kenntnis des Strafgesetzbuches, dem Städteschilderer lustige Verse? Humor diskreditiert.
Wir wollten uns nicht diskreditieren lassen und taten jeder seins. Ich sah mit ihren Augen, und ich sah sie alle fünf: Wrobel, einen essigsauern, bebrillten, blaurasierten Kerl, in der Nähe eines Buckels und roter Haare; Panter, einen beweglichen, kugelrunden, kleinen Mann; Tiger fang nur Verse, waren keine da, schlief er — und nach dem Kriege schlug noch Kaspar Hauser die Augen auf, sah in die Welt und verstand sie nicht. Eine Fehde zwischen ihnen wäre durchaus möglich. Sie dauert schon siebenunddreissig Jahre.
Woher die Namen stammen —?
Die alliterierenden Geschwister sind Kinder eines juristischen Repetitors aus Berlin. Der amtierte stets vor gesteckt vollen Tischen, und wenn der pinselblonde Mann mit den kurzsichtig blinzelnden Augen und dem schweren Birnenbauch dozierte, dann erfand er für die Kasperlebühne seiner „Fälle“ Namen der Paradigmata.
Die Personen, an denen er das Bürgerliche Gesetzbuch und die Pfändungsbeschlüsse und die Strafprozessordnung demonstrierte, hiessen nicht A und B, nicht: Erbe und nicht Erblasser. Sie hiessen Benno Büffel und Theobald Tiger; Peter Panter und Isidor Iltis und Leopold Löwe und so durchs ganze Alphabet. Seine Alliterationstiere mordeten und stahlen; sie leisteten Bürgschaft und wurden gepfändet; begingen öffentliche Ruhestörung in Idealkonkurrenz mit Abtreibung und benahmen sich überhaupt recht ungebührlich. Zwei dieser Vorbestraften nahm ich mit nach Hause — und, statt Amtsrichter zu werden, zog ich sie auf.
Wrobel — so hiess unser Rechenbüch; und weil mir der Name Ignaz besonders hässlich erschien, kratzbürstig und ganz und gar abscheulich, beging ich diesen kleinen Akt der Selbstzerstörung und taufte so einen Bezirk meines Wesens.
Kaspar Hauser braucht nicht vorgestellt zu werden.
Das sind sie alle fünf.
Und diese fünf haben nun im Lauf der Jahre in der Weltbühne“ gewohnt und anderswo auch. Es mögen etwa tausend Arbeiten gewesen sein, die ich durchgesehen habe, um diese daraus auszuwählen — und alles ist noch einmal vorbeigezogen. . . Vor allem der Vater dieser Arbeit: Siegfried Jacobsohn.
*
Fruchtbar kann nur sein, wer befruchtet wird. Liebe trägt Früchte, Frauen befruchten, Reisen, Bücher . . . in diesem Fall tat es ein kleiner Mann, den ich im Januar 1913 in seinem runden Bücherkäfig aufgesucht habe und der mich seitdem nicht mehr losgelassen hat, bis zu seinem Tode nicht. Vor mir liegen die Mappen seiner Briefe: diese Postkarten, eng bekritzelt vom obern bis zum untern Rand, mit einer winzigen, fetten Schrift, die aussah wie ein persisches Teppichmuster. Ich höre das „Ja —?“, mit dem er sich am Telephon zu melden pflegte; mir ist, als klänge die Muschel noch an meinem Ohr. . . Was war es —?
Es war der fast einzig dastehende Fall, dass dem Gebenden ein Nehmender gegenüberstand, nicht nur ein Druckender. Wir senden unsere Wellen aus — was ankommt, wissen wir nicht, nur selten. Hier kam alles an. Der feinste Aufnahmeapparat, den dieser Mann darstellte, feuerte zu höchster Leistung an — vormachen konnte man ihm nichts. Er merkte alles. Tadelte unerbittlich, aber man lernte etwas dabei. Ganze Sprachlehren wiegt mir das auf, was er „ins Deutsche übersetzen“ nannte. Einmal fand er eine Stelle, die er nicht verstand. „Was heisst das? Das ist wolkig!“ sagte er. Ich begehrte auf und wusste es viel besser. „Ich wollte sagen . . .“ erwiderte ich — und nun setzte ich ihm genau auseinander, wie es gemeint war. „Das wollte ich sagen“, schloss ich. Und er: „Dann sags.“ Daran habe ich mich seitdem gehalten. Die fast automatisch arbeitende Kontrolluhr seines Stilgefühls liess nichts durchgehen — kein zu starkes Interpunktionszeichen, keine wilde Stilistik, keinen Gedankenstrich nach einem Punkt (Todsünde!) — er war immer wach.
Und so waren unsere Beiträge eigentlich alle nur Briefe an ihn, für ihn geschrieben, im Hinblick auf ihn: auf sein Lachen, auf seine Billigung — ihm zur Freude. Er war der Empfänger, für den wir funkten.
Ein Lehrer, kein Vorgesetzter; ein Freund, kein Verlagsangestellter; ein freier Mann, kein Publikumshase. „Sie haben nur ein Recht“, pflegte er zu sagen; „mein Blatt nicht zu lesen.“ Und so stand er zu uns, so hat er uns geholfen, zu uns selbst verholfen, und wir haben ihn alle lieb gehabt.
Wir beide nannten uns, nach einem revolutionären Stadtkommandanten Berlins, gegenseitig: Kalwunde.
„Kalwunde!“ sagtest du, wenn du dreiunddreissig Artikel in der Schublade hattest, „Kalmunde, warum arbeitest du gar nicht mehr —?“ Und dann fing ich wieder von vorne an. Und wenn das dicke Couvert mit einem satten Plumps in den Briefkasten fiel, dann hatte der Tag einen Sinn gehabt, und ich stellte mir, in Berlin und in Paris, gleichmässig stark vor, was du wohl für ein Gesicht machen würdest, wenn die Sendung da märe. Siehst du, nun habe ich das alles gesammelt . . . Und du kannst es nicht mehr lesen . . . ,,Mensch!“ hättest du gesagt, „ick wer’ doch det sich lesen! Ich habe es ja alles ins Deutsche übersetzt —!“
Das hast du.
Und so will ich mich denn mit einem Gruss an dich auf den Weg machen.
Starter, die Fahne —! Ab mit 5 PS. —
DORF BERLIN
Affenkäfig
Der Affe (von den Besuchern): „Wie gut dass die alle hinter Gittern sind —!“
Alter Simplicissimus
In Berlins Zoologischem Garten ist eine Affenhorde aus Abessinien eingesperrt, und vor ihr blamiert sich das Publikum täglich von nenn bis sechs Uhr. Hamadryas Hamadryas L. sitzt still im Käfig und muss glauben, dass die Menschen eine kindische und etwas schwachsinnige Gesellschaft sind. Weil es Affen der alten Welt sind, haben sie Gesässschwielen und Backentaschen. Die Backentaschen kann man nicht sehen. Die Gesässschwielen äussern sich in flammender Röte — es ist, als ob jeder Affe auf einem Edamer Käse sässe. Die Horde wohnt in einem Riesenkäfig, von drei Seiten gut zu besichtigen; wenn man auf der einen Seite steht, kann man zur andern hindurchsehen und sieht: Gitterstangen, die Affen, wieder Gitterstangen und dahinter das Publikum. Da stehen sie.
Da stehen Papa, Mama, das Kleinchen; ausgeschlafen, fein sonntagvormittaglich gebadet und mit offenen Nasenlöchern. Sie sind leicht amüsiert, mit einer Mischung von Neugier, vernünftiger Überlegenheit und einem Schuss gutmütigen Spottes. Theater am Vormittag — die Affen sollen ihnen etwas vorspielen. Vor allem einen ganz bestimmten Akt.
Zunächst ist alles still im Affenkäfig. Auf den hohen Brettern sitzen die Tiere umher, allein, zu zweit, zu dritt. Da oben sitzt eine Ehe — zwei in sich versunkene Tiere; umschlungen, lauscht jedes auf den Herzschlag des andern. Einige lansen sich. Die Gelausten haben im zufriedenen Gesichtsausdruck eine überraschende Ähnlichkeit mit eingeseiften Herren im Friseurladen, sie sehen würdig aus und sind durchaus im Einverständnis mit dem guten Werk, das da getan wird. Die Lauser suchen, still und sicher, kämmen sorgsam die Haare zurück, tasten und stecken manchmal das Gejagte in den Mund . . . Einer hockt am Boden, Urmensch am Feuer, und schaufelt mit langen Armen Nussreste in sich hinein. Einer rutscht vorn an das Gitter, lässt sich mit zufriedenem Gesichtsausdruck vor dem Publikum nieder, seinerseits im Theater, setzt sich behaglich zurecht . . . So . . . es kann anfangen.
Es fängt an. Es erscheint Frau Dembitzer, fest überzeugt, dass der Affe seit frühmorgens um sieben darauf gewartet habe, dass sie „Zi—zi—zi!“ zu ihm mache. Der Affe sieht sie an . . . mit einem himmlischen Blick. Frau Dembitzer ist unendlich überlegen. Der Affe auch. Herr Dembitzer wirft dem Affen einen Brocken auf die Nase. Der Affe hebt den Brocken auf, beriecht ihn, steckt ihn langsam in den Mund. Sein hart gefalteter Bauernmund bewegt sich. Dann sieht er gelassen um sich. Kind Dembitzer versucht, den Affen mit einem Stock zu necken. Der Affe ist plötzlich sechstausend Jahre alt.
Drüben muss etwas vorgehen. In den Blicken der Beschauer liegt ein lüsterner, lauernder Ausdruck. Die Augen werden klein und zwinkern. Die Frauen schwanken zwischen Abscheu, Grauen und einem Gefühl: nostra res agitur. Was ist es? Die Affen der andern Seite sind dazu übergegangen, sich einer anregenden Okularinspektion zu unterziehen. Sie spielen etwas, das nicht Mahjong heisst. Das Publikum ist indigniert, amüsiert, aufgeregt und angenehm unterhalten. Ein leiser Schauer von bösem Gewissen geht durch die Leute — jeder fühlt sich getroffen. „Mama!“ sagt ganz laut ein Kind, „was ist das für ein roter Faden, den der Affe da hat —?“ Mama sagt es nicht. Mein liebes Kind, es ist der rote Faden, der sich durch die ganze Weltgeschichte zieht.
In die Affen ist Bewegung gekommen. Die Szene gleicht etwa einem Familienbad in Zinnowitz. Man geht umher, berührt sich, stösst einander, betastet fremde und eigne Glieder . . . Zwei Kleine fliehen unter Gekreisch im Kreise. Ein bebarteter Konsistorialrat bespricht ernst mit einem Studienrat die Schwere der Zeiten. Eine verlassene Äffin verfolgt aufmerksam das Treiben des Ehemaligen. Ein junger Affe spricht mit seinem Verleger — der Verleger zieht ihm unter heftigen Arm- und Beinbewegungen fünfzig Prozent ab. Zwei vereinigte Sozialdemokraten sind vernünftig und realpolitisch geworden; missbilligend sehen sie auf die Jungen — gleich werden sie ein Kompromiss schliessen. Zwei Affen bereden ein Geheimnis, das nur sie kennen.
Das Publikum ist leicht enttäuscht, weil wenig Unanständiges vorgeht. Die Affen scheinen vom Publikum gar nicht enttäuscht — sie erwarten wohl nicht mehr. Hätten wir Revue-Theater und nicht langweilige Sportpaläste voll geklauter Tricks — welch eine Revue-Szene!
In dem Riesenkäfig wohnten früher die Menschenaffen aus Gibraltar. Grosse, dunkle und haarige Burschen, grösser als Menschen — mit riesigen alten Negergesichtern. Eine Mutter hatte ein Kleines — sie barg es immer an ihrer Brust, eine schwarze Madonna. Sie sind alle eingegangen. Das Klima hat ihnen wohl nicht zugesagt. Sie sind nicht die einzigen, die dieses Klima nicht vertragen können.
Ob die Affen einen Präsidenten haben? Und eine Reichswehr? Und Oberlandesgerichtsräte? Vielleicht hatten sie das alles, im fernen Gibraltar. Und nun sind sie eingegangen, weil man es ihnen weggenommen hat. Denn was ein richtiger Affe ist, der kann ohne so etwas nicht leben.
Plötzensee
Ach, nicht das von heute. Das ist genau so traurig, wie alles andre auf dieser gottverflucht preussischen Welt. Nein, „Plötzensee“ ist der Titel eines kleinen, anonym erschienenen Bändchens, das heute vergriffen ist und das die Verbrecherwelt aus dem vorigen Frieden gemütlich-bürgerlich schildert. Natürlich nicht richtig — Gott bewahre. Alles, was in dem Buch ernst sein soll, ist rettungslos verkitscht, die sozialen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Gefängnis sind dem Verfasser unbekannt, und so nett und freundlich, wie in dem kleinen Buche, wird es ja auch wahrscheinlich im vorigen Frieden da nicht zugegangen sein. Aber, aber . . .
Aber Berlin ist in dem Buche. Es muss einer geschrieben haben, der sonst überhaupt nicht schreibt, und diese Leute treffen manchmal den Lokalton am besten, viel besser als irgendeiner von uns. (Ich habe später von dem Verfasser des Bändchens andre Geschichten gelesen, bei denen er sich als „Verfasser von Plötzensee“ angab — die waren scheusslich, weil erfunden.) Dieses hier aber hat er alles gesehen — der Mann hat offenbar wegen irgendeiner Kleinigkeit gesessen, was bei der lotterieartigen Austeilung von Strafen hierzulande leicht vor sich gehen kann — und nun hat er notiert.
Das Ernste also gestatte man mir zu übergehen — aber wie das Lustige wiedergegeben ist, das wirft einen um. Wundervoll die berlinische Diktion in den Reden — der Berliner redet gern und viel —; das hat nur noch Hyan in seinen besten Zeiten so gehört. Am schönsten sind die Passagen, in denen die Herrschaften philosophisch werden und das Fazit eines Krachs, des Gefängnisses oder des Lebens überhaupt ziehen. „Ja,“ sagte dieser, „so sind nu die Leite. Draussen, da sind sie froh, wenn sie ’ne Bleibe haben und können ’n Kaffeestamm machen bei Knitschken, und hier drin haben sie zu ,beanspruchen‘!“ Oder die historischen Geschichten. „Als einmal ein vollkommener Neuling einen Zellengenossen und alten Ehrenbürger nach der Qualität des Essens fragte, führte dieser ihn schweigend in eine Efe der Zelle, wo ein kleines Loch im Fussboden war und sagte: ,Das sind die Erbsen.‘ Und als der andre ihn erstaunt ansah, fügte er hinzu: ,Da hat mal einer ’ne Erbse vons Mittagessen ausgespuckt, und davon is das Loch in die Diele.‘ Dann zeigte er ihm einen grossen Schmutzfleck an der Wand und sagte wieder: ,Das ist der Käse.‘ Diesen geheimnisvollen Ausspruch erklärte er also: ,Jede Woche gibt es einmal abends ’n Sechserkäse, und damit wird immer Zentrum an die Wand jeschmissen. Meistens bleibt er kleben.‘“
Jedes Wort ist eine Erbauung. Denn namentlich der Berliner ältern Stils setzt seine Worte mit einem gewissen Bedacht, und das wirkt am komischsten, wenn er jemand beschimpft, wobei sich das gebildete Dativ-E besonders hübsch ausnimmt. Am schönsten aber ist die Geschichte von dem Käse-Karl, der alles „immer mit die Ruhe“ macht. „Immer mit die Ruhe . . .“. „Wissen Sie,“ sagt er zu einem Neuling, einem „Zugang“, „det muss man erst lernen, mit die Leite hier umzujehn. Die meisten haben son mächtigen Vogel, dass es wirklich unverantwortlich von die Polizei wäre, wenn man sie draussen frei rumloofen liesse. Die rejen sich über alles uff: wat et morjen zu essen jibt, wat eener für ’ne Jacke anhat und lauter son Quatsch. Det darf ’n vernünftiger Mensch jarnich. Hier muss eener ’ne Ruhe haben. Sehn Se, da war mein Freund Orje Bergmann, mit die acht Jahre. Wie der ankam — da war ick ooch zufällig hier — da sage ick: ,Na, Orje,‘ sage ick, ,wie lange bringste denn mit?‘ ,Et jeht, Karl,‘ sagte er, ,acht Jahre sind et.‘ ,Na,‘ sage ick mit meine Ruhe, ,denn jehst du ja bald!‘“ Immer mit die Ruhe.
Das ist der Verbrecher aus der Bürgerperspektive. Es ist der Schlumps, der von dem Schutzmann, dem Vertreter der guten Ordnung, in das Loch gestossen wird, und der immer ein bisschen besoffen ist und immer was verbricht. Aber schliesslich ist viel Echtes drin. Und wie fehlen uns solche Bücher —! Im Englischen und auch bei den Amerikanern gibts das viel mehr: Bücher, die ganz unliterarisch schildern, wie die Fischer leben oder die Heizer auf den grossen Dampfern, ihren Humor und ihr Tagemerk, ihre Keilereien und ihre Frauen. Aber das hat mit Kunst nichts zu tun. Bei uns bemächtigen sich dieser Dinge die Feuilletonisten, und dann ist es aus. Lest mal dies kleine Büchlein „Plötzensee“, und ihr werdet starken Hunger nach mehr der Art bekommen. Aber es ist ja vergriffen. Und weil es vergriffen ist, habe ich es hier erzählt.
Erotische Filme
Die Wand wurde weiss. Ein an vielen Stellen brüchiges, fahriges Silberweiss leuchtete zittrig auf. Es begann.
Aber alle lachten. Auch ich lachte. Hatten wir etwas Unerhörtes, Massloses erhofft, so balgten sich jetzt auf der Leinewand spielend ein Miau-Kätzchen und ein Wauwau-Hundchen. Vielleicht hatte der Exporteur das vorgeklebt, um die Polizei zu täuschen — wer weiss. Der Film lief eintönig klappernd, ohne Musik; das war unheimlich und nicht sehr angenehm.
Aber ganz unvermittelt erschien ein Satyr auf der Bildfläche und erschreckte in einem Waldgewässer kreischende und plantschende Mädchen. Nun, ich war enttäuscht, immerhin . . . Ich war hierher gekommen, um etwas recht Unanständiges zu sehen, ein dicker Freund hatte mich mitgenommen; Gott mochte wissen, woher er es hatte. Sah ich ihn, so senkte sich bewundernder Neid auf mich herab: er hatte die Fähigkeit, auch diese Dinge — neben verschiedenen andern — bis auf den Grund auszukosten.
Hoh, aber jetzt gab es: Szene im Harem. Man hatte sich den Schauplatz der Handlung etwa am Schlesischen Tor vorzustellen, denn das Tapetenmuster des ausgeräumten kleinen Zimmers war ganz so, und auch die Gardinen und der Teppich. Fatinga tanzt. Das lasterhafte Mädchen entkleidete sich aus pompöser Wäsche und tanzte; das heisst: sie drehte sich bequem um sich selbst, und jeder konnte sie bewundern — und sie tanzte vor ihrem Sultan, der sich faul und lässig in den Schössen der andern Haremsmitglieder lümmelte. Er war ein Geniesser. Sie bewedelten ihn mit grossen japanischen Papierschirmen, und vorn auf einem Tisch stand ein Weissbierglas. Die Szene fand nicht den Beifall des Auditoriums. Ermunternde Zurufe wurden laut. Man hätte sich den Herrscher wohl etwas agiler gewünscht, aber er blieb ruhig liegen — wozu war er auch Sultan!
Und dann kam „Klostergeheimnisse“ und „Annas Nebenberuf“, und zwei „perverse Schönheiten“ wälzten sich auf einem Läufer herum. Die eine von ihnen war eine gewisse Emmi Raschke, die fortwährend lachte, weil es ihr wohl selbst ein bisschen komisch vorkam. Nun, sie waren alle engagiert, um eiskalt, mit einem Unmass von Geschäftlichkeit, unter den scheltenden Zurufen des Photographen, Dinge darzustellen, die, wenn man den Beschauern glauben wollte, doch wohl an das Himmlischste grenzten. Sie glaubten alle, dass Emmi Raschke für sie und ganz speziell für sie erschaffen war — vorgebildet allerdings durch eine Reihe von nunmehr vergangenen Handlungen ähnlicher Art. Es war nicht ganz klar, was sie eigentlich von den Frauen wollten, wenn diese mit ihnen geschlafen hatten — sicher war, dass sie allesamt nicht zögerten, sich als die Gnadenspender des weiblichen Geschlechts anzusehen.
Es folgten nunmehr zwei längere Stücke, und es war nicht zu sagen, wie lasterhaft sie waren. Eine schwüle Sinnlichkeit wehte von den verdorbenen, also üppigen Gestalten herüber, sie gaben sich den unerhörtesten Genüssen hin — und währenddessen bot eine Kellnerstimme gefällig Bier an. Worauf mit Recht aus dem Dunkel ein tiefer Raucherbass ertönte: ,,Ach, wer braucht denn hier jetzt Bier —!“ Das wurde lebhaft applaudiert, und von nun an beteiligte sich das Publikum intensiver an den Darbietungen: Rufe, ratende Stimmen, Grunzen, Beifall und anfeuernde Aufschreie wurden laut, einer gab Privatfreuden vergleichend zum Besten, viele lärmten und schrien.
Oben spielten sie: „Die Frau des Hauptmanns.“ Während der würdige Militär seine Gemahlin mit der Leutnantsfrau betrog, nutzte jene — die Gemahlin — die Zeit nicht schlecht aus, denn der Hauptmann hatte einen Burschen. Sie wurden überrascht, und es setzte Ohrfeigen. Mochte man übrigens sagen, was man wollte: ehrlich war der Film. Ein bisschen merkwürdig schien es allerdings im französischen Soldatenleben zuzugehen: es gab da Situationen, die sich so unheimlich rasch abwickelten, dass man nur wünschen konnte, ein piou-piou zu sein. Immerhin gab es doch einige Augenblicke, in denen sich die Spielenden ihrer Rollen mit hingebendem Eifer annahmen. Und selbst der war gespielt.
Im Parkett blieb es gemütlich. Man fasste da die Dinge nicht so gefährlich auf, sah nicht, dass auch Tristan und Isolde hier einen lächerlichen Aspekt darbieten würden, und dass Romeo und Julia, von einem andern Stern, objektiv und nüchtern, also unabhängig betrachtet, ein ulkiges und verkrampftes Paar darstellten.
Nein, davon war im Parkett keine Rede. Wenn sie nicht Skat spielten, so lag das nur daran, dass es zu dunkel war, und im übrigen herrschte eine recht feiste und massive Freude. Das musste man selbst sagen: immer diese verlogenen Sachen — hier wusste man doch . . .
Als es dann aus war — so ein trüber Schluss, wo jeder denkt, dass noch was kommt —, da zeigte sich, dass es mit der Sexualität so eine Sache ist. Die Männer standen heram und genierten sich voreinander, wobei sie den Mangel an Höherem betonten . . . Und dann schoben wir uns durch schmale Gänge in das benachbarte Lokal, und die Musik spielte lant und grell, und da waren alle so merkwürdig still und erregt. Ich hörte später, der Wirt habe zwanzig Mädchen dorthin bestellt.
Ich weiss es nicht, denn ich bin fortgegangen und habe mir so gedacht, wie doch die Worte „Laster“ und „Unzucht“ hohle Bezeichnungen für Dinge sind, die jeder mit sich selbst abzumachen hat.
„Der Lasterpfuhl“ — du lieber Gott! Auch dort wird man zu Neujahr Pfannkuchen essen und die Gebräuche halten, wie es der kleine Bürger liebt. Denn das Laster ist kein Gewerbe — und ein Augenzwinkern und ein tiefes Frauenlachen können lasterhafter sein als das ganze Hafenviertel Port Saids.
Der Portier vom Reichskanzlerpalais spricht
Ja, man hat ja so allerhand erlebt in der letzten Zeit. Früher — Gott! war diss jemietlich! Da kam wirklich mal hier und da Majetztät zu Bethmann zum Frühstück, aber sonst war alles still, janz still. Und wenn ick noch an den Pudel von ollen Bülow zurückdenke, denn wird mir janz schwummrig, und ich muss jleich ’n Schnaps trinken . . . Ja, früher . . . Also diss is nu vorbei. Schon in’n Krieg jing die Aufrejung los. Da kam eines Tages ein Mann her, das war der neue Reichskanzler Michaelis, der bekam so’n mächtigen Schreck bei seine Ernennung, dass er sich die janze Zeit nich davon erholen konnte . . . Und denn kam so’n alter Herr, der wackelte immer mit ’n Kopp, und denn dachten die Leute, er sacht: Ja — und da machte Jeder, wat er wollte. Na, und denn kam Prinz Max von Baden — und denn jing der Klamauk los . . . Sehn Se ma, früher, da stand ick morjens um neune auf, und denn fegten die Frauen det Jächtchen und den Flur, und ich sah mir das alles mit an, und wenn nicht jrade een Besucher kam, den ich anschnauzen musste — denn jing es mir soweit janz gut. Aber nu? Also am neunten November — det weess ick noch wie hente — da kamen auf einem Male Autos anjesaust, und denn kamen solche Kerls hier rin, die guckten an die Decke, fühlten sich mächtig unbehaglich, und ick sachte: „Zu wen wünschen Sie?“ sachte ick. Aber die sachten: „Nu regieren wir!“ Und ick jing denn janz ruhig in meine Portierklause und dachte: Immer regiert ihr man! Ihr werdet det schonst über kriejen! Und denn regierten die. Und einmal, einmal, da stand Liebknecht vor die Türe und hielt eine grosse Rede — und ich dachte schon, nu kommt der mir hier ooch noch rin — aber dann schrien se alle „Hoch!“ und „Nieder!“, und denn war es ja wieder jut. Na — und eines Morgens — ick sahre noch zu meine Olle: „Du,“ sahre ick, „mir is heute so merkwürdig“ — da kam denn so’n Herr an, so einer mit’n Bart und ’n Jesicht wie’n Bureauvorsteher — der sachte: „Morgen! Ich bin hier nu Reichskanzler!“ Na, ick jing denn janz ruhig in meine Klause und dachte: Mach man! Diss wird dir bald über werden! — und denn jing det so ’ne janze Weile. So fein wie früher war es ja nu nich. Die feinen Leute, die noch so manchmal so von früher herkamen, die lachten mir denn immer so vertraut an, so, als wollten sie sahren: Was? Wir zwei Beede haben doch schon bessere Tage gesehn! Aber ick sachte janischt und stand mit meine Olle auf den Boden der gegebenen Tatsachen. Na — und neulich, am dreizehnten März — ick sahre noch zu meine Olle: ,,Du,“ sahre ick, „jib mir mal ’n Kümmel — mir is heute so komisch“ — da kloppt et janz frühmorgens zu nachtschlafende Zeit an mein Guckfenster, und draussen steht ’n Herr — und lacht und sagt: „Nu regieren wir hier!“ Na, ick jing denn janz still in meine Klause und dachte: Macht man! Diss wird euch bald über werden! Und richtig: das wurde sie auch. Erst liefen ja hier mächtig ville Offiziere rum, mit Monokel, und Ludendorff kam auch, und ick riss die Knochen zusammen und jrüsste ihm, und er winkte jnädig ab — und denn rejierten sie da. Aber wie das so is: eines Morgens — da waren sie weg — und zwei Stunden später — da kloppt et an meine Türe, und da stand der Herr von früher und sachte: „Morgen! Morgen!“ sacht er. „Ja — nu rejieren wir hier!“ Und ich jing janz still in meine Klause . . . Und jeden Morgen, wenn ick uffstehe un meine Olle sich die Zeppe uffstecken tut, denn die hat se, denn steh ick ans Fenster und gucke so uff die leere Wilhelmstrasse, wo die Spatzen in die Pferdeäppel picken, und denn denk ick mir so: Wer kommt nu —?
Dorf Berlin
„Eine Grossstadt?“ sagte meine greise Freundin Lisa, als sie aus Paris zurückkam, „eine Grossstadt? Kinder, auf dem Potsdamer Platz gackern ja die Hühner —!“ Das könnte wohl sein.
*
Frühmorgens, beim ersten Hahnenschrei, erhebt sich der Grossbauer Wresczynski von seinem kargen Strohlager. Die Mistforke in der nervigten Faust, ruft er Weib und Kind zu: „Auf! Auf! Die Sonne vergoldet schon den Synagogenknopf!“ und geräuschvoll poltert er durchs einfache Bauernhänsel, das sich, mit Stroh gedeckt, an der Leibnizstrasse erhebt. Draussen gluckert der freundliche Bach, umwogen die Bananenfelder und jungen Gemüsebeete den stolzen Besitz, die mächtigen Bologneser Wachthunde bellen, nationale Ochsen brüllen, und demokratische Schafe wandeln gesenkten Hauptes auf die magere Geschäftsweide. Die Bäuerin tritt auf die Schwelle und sieht frohgemut in die weite Landschaft: vom Lunapark bis zum Nelsonberg eine einzige üppige und fruchtbare Gegend. Der Hafer blüht 354 fob, die milde Kuh blickt verächtlich in ein Fass mit Margarine, und die Schweine wühlen behaglich in der weichen Streu, die man ihnen aus den Blättern der Deutschen Tageszeitung bereitet hat. Wo sind die Hühner? War der Fuchs im Hühnerstall? Aber Fuchs ist doch in Marienbad — nein, die Hühner sind schon frühmorgens auf den Geflügelmarkt gegangen, die guten Tiere, und haben sich da im Preis etwas heraufsetzen lassen. Erleichtert atmet die Grossbäuerin auf.
Die Dorfkinder eilen in die Schule, und bald hört man die kleinen Stimmchen aus dem Schulfenster singen:
Siegreich wolln wir Frankreich schlagen
als ein tapfrer Heheheld . . .!
„Herr Lehrer,“ sagt der kleine Gothein, „ich muss mal rausgehn — mir ist mein Kompromiss geplatzt!“ Und dann singen sie wieder.
Das Leben im Dorf hat sich unterdessen mächtig entwickelt. Die wackern Knechte verladen die Saisonarbeiter auf grosse ratternde Wagen, die tragen vorn eine Nummer, oben eine Stange und hinten einen Mann, der schimpft. Manchmal fahren sie. Die Frömmern werden in den Aboackerwagen geladen, und bald ist das ganze Volk rüstig bei der Arbeit. Emil Jannings geht hinter dem Pfluge einher und singt ein gar fröhlich Liedlein. In den Zeitungsredaktionen dreschen sie leeres Stroh. Die Grosskopfeten lassen ein goldenes Haus am Brandenburger Tor schwarzweissrot anstreichen, von oben bis unten, und dass die Farbe auch regenfest ist, dafür sorgt schon der Obermeister aus Ludendorf; er trägt eine blaue Brille gegen die Sonne und hinkt etwas: er hat sich einmal vor Jahren das Ehrenwort gebrochen, aber es ist schon beinahe wieder zugeheilt. In einer Ecke hat Schlächtermeister Wulle eine kleine Judenschlächterei aufgetan und steht, mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, vor der Tür. Dampfend raucht er aus einer ungeheuren Pfeife und liest die Memoiren des Herrn Tirpitz. Das ist ein starker Toback.
Zwei Büttel mit dem feierlichen Dreispitz und langen Obrigkeitsstock mit goldenem Knopf führen einen Mann einher, der lacht und wirft mit vollen Händen Geld unter die bettelnden Bankiers, die am Wege kauern. Neidisch zischelts hinter ihm: „Ja, der Müller! Der kann sich das leisten! Der steht unter Geschäftsaufsicht —!“ Zwei dralle Mägde kommen mit weiten Netzen aus der Au — man sieht ihnen die fünfundvierzig gar nicht an, wie sie so elastisch einherschreiten in dem putzigen Bubenkopf und dem guten Büstenformer! Sie kommen vom Tauentzien-Fluss, da haben sie nachts dem Fischfang obgelegen, und sie müssen gute Beute gemacht haben, denn die eine sagt zur andern, in ihrem bäuerischen Dialekt: „Det kann ich da sahrn, Else, ich hab den ollen Seeje die ganze Marie aus de Brusttasche jeklaut —! Wat heisst hier!“ Muntere Dirnen.
Schwerbeladene Wagen mit Dung schwanken unter den Torbogen, sie karren den Mist fort, kommen sie doch von einem sozialdemokratischen Parteitag. Halt! geht da nicht der schöne Rudi? Ja, er ist’s; das grüne Hütl keck auf einem Ohr, ein breites Scheit an der Seite, die Flinte auf der Schulter, so kommt Deutschlands beliebtester Sozialist durch die schmalen Dorfgassen, und strahlt, der Jägersmann: er hat wieder einmal einen fetten Bock geschossen. Im Dorfwirtshaus nehmen sie das Mittagsmahl; nach dem guten Essen sitzen sie an einem grossen runden Tisch: Erich Koch, der Zentrumsschreiber Schreiber und Hugenberg, und spielen Skat. Man hört ein mächtiges Geschrei, sie scheinen also ganz gut miteinander auszukommen. Hugenberg, wie immer, mogelt.
Gewichtige Amtspersonen gehen durch die Wilhelmstrasse: der Dorfschulze und die Mitglieder der Gemeindeversammlung. Viele haben ein blaues Auge, mit dem sind sie gerade davongekommen, und sie haben soeben beschlossen, mit dem Nachbardorf nur bei schönem Wetter Krieg anzufangen. Und eine neue Fahne wollen sie auch. Sonst haben sie keine Sorgen. Der Dorfschneider Haferl hütet seinen Laden, der alte Ladenhüter; er setzt den Mädchen alte Obstkörbe auf den Kopf und redet ihnen ein, das seien die neuen Modelle aus Paris. Mitten in der Gesellschaft sitzt ein armes Bäuerlein, das hat schon manches Anwesen ruiniert; während andre ackern, rechnet er und malt grosse Tabellen, da steht es alles drin. Aber obgleich er noch nie auf einen grünen Zweig gekommen ist, so wartet er doch und ist fein geduldig. Gut Hilferding will Weile haben.
Jetzt leuchtet die goldene Abendsonne über das Panketal, die Bäuerinnen treiben müd die Gänse heim, ihr Brusttuch steht, Gott behüte, offen, man hört das tiefe Muh der Rinder und: ,,Achtuhrabendblattachtuhrabendblatt!“ schnattern die Enten. Die Stalltüren öffnen sich langsam und weit.
Alt und Jung hat sich auf dem Dorfplatz unter der grünen Linde versammelt. Da steht herumfahrendes Gauklervolk und zeigt seine Künste. Einer kann eine ganze deutsche Grammatik verschlucken und gibt sie nur stückweise wieder von sich, der heisst Sternheim. Ein Alter ist da in würdevollem weissem Bahr, der ist katholisch und dreht sich herum und — husch! — ist er ein Freigeist, und wieder herum und — husch! — ist er ein Hitlermann. Keine Verpackung, nur Ausstattung! Und einer dreht auf der Laterna magica schöne Bilder; da kann man einen Berliner Schauspieler sehen, tiefe Schmink- und Sorgenfalten durchfurchen sein Gesicht, und alles Volk schreit: Hurra! Denn die dummen Bauern glauben, das sei Fridericus Rex mit der Königin Luise, und nur der Gaukler an der Laterne weiss es besser. Aber er sagt nichts und schmunzelt und streicht das Eintrittsgeld ein. Und in einer Ecke haben sie ein Theater aufgeschlagen, aber das ist ganz leer, nur ein Mann sitzt darin, der hat sein Billett bezahlt. Es ist der Dorftrottel.
Nun ruhen alle Wälder, und der gute Mond scheint seins durch die silberblassen Wolken. Alt und Jung . . . ach, das hatten wir schon. Normal und Andersrum ist zur Ruh gegangen, allein, zu zweit und assortiert. Vor dem Haus eines Weingrosshändlers rauscht zauberhaft und familiär ein Brunnen. Die Schenken haben geschlossen. Der letzte Fiedelton erstarb.
Klappt da ein Fenster —? Auf schmanker Leiter steht ein junger Bauer mit nackten Knien in der krachledernen Hos auf der obersten Sprosse und busselt sein Mädel ab, die da vollbusig zum Fenster heraushängt. Es ist der Graf Keyserling, der voll Weisheit, wie er es in der Schule gelernt hat, einer drallen Bauerndirn den Hof macht. „O Katharina —!“ flüstert er heiss. Der Mond versinkt hinter dem Pallenberg, der Graf rutscht von der Leiter, ein leiser Abendlandwind gespenstert durchs Gras . . . Das Dorf schläft.
EIN MANN AM WEGE: HERR WENDRINER
Herr Wendriner kauft ein
„. . . ’n Abend . . . ’ne schöne Fülle hier . . . Na, wollen mal sehen . . . Drängeln Se doch nich so . . . Nein, ich drängle gar nicht! . . . Ochse! . . . Unglaublich. Wir kommen ja gleich ran, wir waren zuerst hier. Warten Sie auch noch ’n bisschen? ’ne Goldgrube, diss Geschäft, was meinen Sie! Die verdienen hier, was se wolln. Ja — nun habe ich den Leuten geschrieben, wenn sie die Hypothek per 15. übernehmen, dann werde ich die Sache machen. Die Leute sind gut — aber bei der jetzigen Stagnation, kein Mensch hat Geld . . . Wem sagen Sie das! Ich hab den Leuten erklärt: Entweder ihr entschliesst euch gleich, oder ich gehe raus — Frollein! Frollein, ja wir waren zuerst da. Padong! . . . Also zuerst mal von den Sardellen hier — sind se auch frisch? Na gut, ein halbes. Entweder ihr entschliesst euch gleich, oder die Provision geht zu euern Lasten — nicht so kleine, Frollein, ja, mehr von unten! Und dann ein halbes Pfund Gemüsesalat . . . Wissen Se, in der Woche ess ich immer mit meiner Frau zu Hause, es ist billiger, und man weiss doch, was man hat. Ich hab heut abend noch ’ne Konferenz, und vorher will ich noch essen. Gefüllte Tomaten — nee. Aber ’n bisschen Aufschnitt können Sie mir geben. Haben Sie die gesehn? Erinnert ein bisschen an die Klara von Fritz. Die Frau ist schon fabelhaft. Wissen Se, wenn ich noch so wär wie früher — aber man hat ja so viel zu tun. . . Nu sehen Sie sich das Stück da hinten an! Eine dolle Angelegenheit! Schweinebraten, Frollein, aber nicht so fett. Ja, Schüh auch. Nein, die Sache ist noch nicht abgeschlossen — wissen Sie, steuertechnisch ist das nicht ganz einfach — aber wir haben da einen sehr tüchtigen Syndikus . . . Jäck macht noch Schwierigkeiten —— immer gibt er Konterorders. Ein Fläschchen englische Sauce, Frollein, aber recht scharf! Gott, ich hab ihn genommen, weil ich mir gesagt habe: Er hält mir wenigstens die Angestellten zusammen. Sie, Sie kennen doch auch den Lachmann? Kommt doch der Junge heute morgen zu Jäck und will Gehaltszulage haben! Wie finden Sie das? Von den Kallmill-Äpfeln, Frollein! Ich hab mir aber den Jungen vorgenommen! Jetzt, in dieser Zeit — was denkt sich so ein Bengel eigentlich . . .? Waren Sie schon in den neuen Revuen? Da soll sich ja was tun! Wir gehn Sonnabend. Ich will mal sehen, ob ich nicht durch Lachmann ermässigte Billetts kriegen kann. Haben Se gelesen, heute im Achtuhrabendblatt, mit den Gespenstern? Okkultismus — ich weess nich . . . Sie? Wer singt da auf der Strasse? Kommunisten? Ich denke, das ist vorbei? Ach so, bloss Wandervögel! Sie — heute hab ich die Reichswehr vorbeiziehn sehn, die sind da an unserm Geschäft langgekommen — ich sage Ihnen: fabelhaft! Wie früher! Sehr gut. Na, der Hindenburg macht seine Sache schon ausgezeichnet, das muss man ihm lassen. Prozess in Leipzig?. . . Ich weiss nicht — nu geben Sie schon den Zettel her!. . . Ich lese keine Politik. Nee, wissen Se, grundsätzlich nicht. Man hat ja nichts wie Ärger davon. Vierundzwanzig achtzig, wieso? Ach so — ja. Kommen Se, da kommt die Neun! Ich weiss nicht, ich hab wieder meine Leberbeschwerden beim Gehen — ich muss doch mal zum Spezialisten. Nein, wir haben einen sehr guten, einen Vetter von meiner Frau. Eine erste Kapazität. Er nimmt fünfzig Mark für eine Konsultation. Na — mir macht ers natürlich billiger. Wissen Sie, hier oben fangen die Schmerzen an, und da unten hören sie auf. Nachts gar nicht — bloss am Tage. Dabei leb ich schon Diät. Was haben Sie? Neuralgie? Sollten Se mal ein heisses Bad nehm. Grüssen Sie Ihre Frau! Atchö.
Auch ’n Mensch. Wissen möcht ich: wovon lebt der eigentlich —?“
Herr Wendriner erzieht seine Kinder
„… Nehm’ Sie auch noch ’n Pilsner? Ja? Ober! Ober, Himmelherrgottdonnerwetter, ich rufe hier nu schon ’ne halbe Stunde — nu kommen Se doch ma endlich her! Also zwei Pilsner! Was willst du? Kuchen? Du hast genug Kuchen. Also zwei Pilsner. Oder lieber vielleicht — na, is schon gut. Junge, sei doch mal endlich still, man versteht ja sein eignes Wort nicht. Du hast doch schon Kuchen gegessen! Nein! Nein. Also, Ober: noch ’n Apfelkuchen mit Sahne. Wissen Se, was einem der Junge zusetzt! Na, Max, nu geh spielen! Hör nicht immer zu, wenn Erwachsene reden. Zehn wird er jetzt. Ja, also ich komme nach Hause, da zeigt mir meine Frau den Brief. Wissen Sie, ich war ganz konsterniert. Ich habe meiner Frau erklärt: So geht das auf keinen Fall weiter! Raus aus der Schule — rein ins Geschäft! Max, lass das sein! Du machst sich schmutzig! Der Junge soll den Ernst des Lebens kennenlernen! Wenn sein Vater so viel arbeitet, dann kann er auch arbeiten. Wissen Se, es is mitunter nicht leicht. Dabei sieht der Junge nichts andres um sich herum als Arbeit: morgens um neun gehe ich weg, um halb neun, um acht — manchmal noch früher — abends komme ich todmüde nach Hause . . . Max, nimm die Finger da raus, du hast den neuen Anzug an! Sie wissen ja, die grosse Konjunktur in der Zeit, das war im Januar, dann die Liquidation — übrigens: glauben Sie, Fehrwaldt hat bezahlt? ’n Deubel hat er! Ich habe die Sache meinem Rechtsanwalt übergeben. Der Mann ist nicht gut, glauben Sie mir! Ja, also mein Ältester ist jetzt nicht mehr da. Max, lass das! Angefangen hat er bei . . . Also hören Sie zu: ich hab ihn nach Frankfurt gegeben, zu S. & S. — kennen Sie die Leute auch? — und da hat er als Volongtär angefangen. Ich hab mir gedacht: So, mein Junge, nu stell dich mal auf eigne Füsse und lass dir mal den Wind ein bisschen um die Nase wehn — Max, tu das nicht! — jetzt werden wir mal sehn. Meine Frau wollte erst nicht — ich bin der Auffassung, so was ist materiell und ideell sehr gut für den Jungen. Er liest immer. Max, lass das! Ich habe gesagt: Junge, treib doch Sport! Alle deine Kameraden treiben Sport — warum treibst du keinen Sport? Ich komme ja nicht dazu, mit ihm hinzugehn, mir täts ja auch mal sehr gut, hat mir der Arzt gesagt, aber er hat in Berlin doch so viel Möglichkeiten! Max, lass das! Was meinen Sie, was der Junge macht? Er fängt sich was mit einer Schickse an aus einem Lokal; ’nem Büfettfräulein, was weiss ich! Max, was willste nu schon wieder? Nein, bleib hier! Du sollst hierbleiben! Max! Max! Komm mal her! Du sollst mal herkommen! Max, hörst du nicht? Kannst du nicht hören? Du sollst mal herkommen! Hierher sollst du kommen! Komm mal her! Hierher. Was hast du denn? Sieh dich vor! Jetzt reisst der Junge die Decke . . . ei weh, der ganze Kaffee auf Ihre Hose! Kaffee macht keine Flecke. Du dummer Junge, warum kommst du nicht gleich, wenn man dich ruft! Jetzt haste den ganzen Kaffee umgeworfen! Setz dich hin! Jetzt gehste überhaupt nicht mehr weg! Setz dich hin! Hier setzte dich hin! Nicht gemuckst! Giesst den ganzen Kaffee um! Hier — haste ’n Bonbon! Nu sei still. Ja — er war schon immer so komisch! Bei seiner Geburt habe ich ihm ein Sparkassenkonto angelegt — meinen Se, er hats einem gedankt? Schule — das wollt er nicht! Aber Theater! Keine Premiere hat er versäumt, jede Besetzung bei Reinhardt wusste er, und dann Film . . . Nee, wissen Se, das war schon nicht mehr schön! Ja, nu hat er mit der . . . em . . . Max, sieh mal nach, ob da vorn die Lampen schon angezündet sind! Aber komm gleich wieder! Mit dieser Schickse geht er los! Natürlich kostet das ’n Heidengeld, können Se sich denken! Nu, es sind da Unregelmässigkeiten vorgekommen — ich hab ihn wegnehmen müssen, und jetzt ist er in Hamburg. Ach, wissen Se, ich hab schon zu meiner Frau gesagt: Was hat einem der liebe Gott nicht zwei Mädchen gegeben! Die zieht man auf, zieht sie an, legt sie abends zu Bett, und zum Schluss werden sie verheiratet. Da hat man keine Mühe. Und hier! Nichts wie Ärger! Max! Max! Wo bloss der Junge bleibt! Max! Wo warst du denn so lange? Setz dich hierhin! Der Junge ist noch mein Grab — das sage ich Ihnen. Kommen Se, es ist kalt, wir wollen gehn.
Ich frage mich bloss eins: diese Unbeständigkeit, diese Fahrigkeit, diese schlechten Manieren — von wem hat der Junge das —?“
Herr Wendriner telephoniert
Der gesamte Postbetrieb des Reiches ruhte am Tage der Beerdigung Walter Rathenaus von zwei Uhr bis zwei Uhr zehn Minuten.
„Wenn er die Faktura nicht anerkennt, dann werde ich ihn eben einfach mal anrufen. Legen Sie die Kuverts inzwischen auf ’n Stuhl. Welches Amt hat Skalitzer? Amt Königstadt? Na, warte . . . Nu? Na? Na, was ist —? Fräulein! Warum melden Sie sich denn nicht? Haste gesehen: sie sagt nicht, warum sie sich nicht meldet! Fräulein! Na, ist denn der Apparat nicht in Ordnung . . .? Fräulein Tinschmann, was ist mit dem Apparat? Ist er nicht in Ordnung? Wie oft hab ich Ihnen schon gesagt . . . Was? Was ist? Der Betrieb ruht? Was heisst das? Warum . . .? Ach so — wegen Rathenau. Danke, Sie können wieder gehn . . . Wegen Rathenan. Sehr gut. Sehr richtig ist das. Der Mann ist ein königlicher Kaufmann gewesen und unser grösster Staatsmann. Das ist unbestritten. Schkandal, dass sie ihn erschossen haben! So ein effektiv anständiger Mensch! Ich hab noch den alten Rathenau gut gekannt — das waren Kaufleute waren das! Na, er hat eine hervorragende Trauerfeier im Reichstag gehabt! Sehr eindrucksvoll. Glänzend war der Leitartikel heute morgen — ausgezeichnet. Ja, die Regierung wird ja kräftig durchgreifen — eine Verordnung haben sie ja schonerlassen. Ausm Auto raus zu erschiessen — unerhört! Die Polizei sollte da . . . Fräulein! Die zehn Minuten sind noch nicht um. Glänzende Schützen müssen das gewesen sein, die Jungens. Vielleicht Offiziere . . . Aber das kann ich mir eigentlich gar nicht denken: die Regimentskameraden von Walter waren doch damals alle zu Tisch bei uns — alles so nette und feine Leute! Famose Erscheinungen darunter! Ich hab mich ja damals doch gefreut, wie der Junge Reserveoffizier geworden ist! Fräulein! Fräulein! Ein bisschen länglich die zehn Minuten! Fräulein! Aber wenn sie eine Minute länger streiken als zehn Minuten — ich bin imstande und beschwer mich! Fräulein! Ich muss doch den alten Skalitzer haben! Kateridee, deshalb das Telephon abzusperren! Davon wird er auch nicht lebendig. Solln se lieber die Steuern gerecht verteilen, das wär mehr im Sinne des Verstorbenen gewesen! Fräulein! Wer sperrt das Telephon ab, wenn ich mal nicht mehr bin? Kein Mensch! Meschugge, das Telephon abzusperren! Wie soll ich jetzt an Skalitzers ran? Nachher ist der Alte sicherlich zu Tisch gegangen. Schkandal! Mehr Lohn wollen die Leute — das ist alles. Was sind das für Sachen, einem am hellerlichten Tage das Telephon vor der Nase abzusperren! Unterm Kaiser sind doch gewiss manche Sachen vorgekommen — aber so was hab ich noch nicht erlebt! Unerhört! Das ist eine Belästigung der Öffentlichkeit! Solln se sich totschiessen oder nicht — aber bis ins Geschäft darf das doch nicht gehn! Überhaupt: ein Jude soll nicht solches Aufsehen von sich machen! Das reizt nur den Antisemitismus. Seit dem neunten November ist hier keine Ordnung mehr im Lande. Ist das nötig, einem das Telephon abzusperren? Wer ersetzt mir meinen Schaden, wenn ich Skalitzer nicht erreiche? Fräulein! Nu hör an — da draussen gehn se demonstrieren! Sieh doch — mit rote Fahnen — das hab ich gar gern! Was singen sie da? Fräulein! Se wern noch so lange machen, bis es wieder Revolution gibt! Fräulein! Mich kann die ganze Republik . . . Fräulein! Fräulein! Mein politischer Grundsat ist . . . Fräulein! Endlich! Fräulein! Königstadt —!“
Herr Wendriner hat Gesellschaft
„Auf Wiedersehn, Frau Doktor! Auf Wiedersehn, Herr Welsch! Kommen Sie gut nach Hause, guten Abend! Gunahmt . . .! Uff.