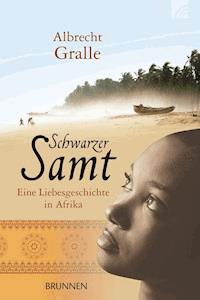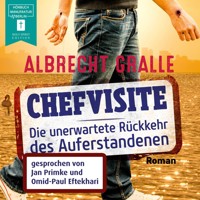Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Vorort von Stuttgart, 1957: Es gibt offene Straßenbahnen, eine Dorfschmiede, den Geruch von Bohnerwachs auf Linoleum, das magische Auge im Radio und selbstgemachte Maultaschen. Gleichzeitig liegt ein Mann im Sterben: Franks Vater. Frank, sieben Jahre, Schulanfänger, erlebt alles hautnah mit. Trotz der schwierigen Umstände schmunzelt der Leser, wenn er den seltsamen Alltag der Erwachsenen mit den Augen eines Siebenjährigen sieht: Warum darf kein fremder Mann im Bett von Franks Tante schlafen, wenn er müde ist? Was geschieht eigentlich mit dem toten Mädchen, das in der Leichenhalle liegt und mitten in dem Blumenmeer wie Schneewittchen aussieht? Was hat ein heimlicher Nazi 1957 im Haus der jungen Witwe verloren? Rückblenden schildern die Liebesgeschichte von Franks Eltern, Arnold und Elisabeth, zwischen Berlin und Stuttgart in den Wirren des Zweiten Weltkriegs und ihre erschreckend blauäugige Sicht auf das "Dritte Reich".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albrecht Gralle Mit blauen Augen
Albrecht Gralle
Mit blauen Augen
Roman
Albrecht Gralle ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Der ausgebildete Theologe lebte mit seiner Familie fünf Jahre in Westafrika. Freischaffender Schriftsteller ist er seit 1993 und veröffentlichte zahlreiche historische Romane, Erzählungen, Kinder- und Jugendbücher in verschiedenen Verlagen. Gralle wohnt in Northeim bei Göttingen.
Für das erste Kapitel seines Romans erhielt der Autor den Schwäbischen Literaturpreis der Stadt Augsburg.
1. Auflage 2016
© 2016 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung: Anette Wenzel, Tübingen,
unter Verwendung einer Fotografie aus dem Privatarchiv von Eberhard Seiffert.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1736-3 E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1737-0 Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1477-5
Besuchen Sie uns im Internet und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms: www.silberburg.de
Für Brigitte und Eberhard
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
1
JANUAR 1957. Draußen schneit es endlich. Ein Vorort von Stuttgart: Platanenallee, ein paar Streuobstwiesen und dazwischen die Häuser. Es gibt eine Metzgerei, die selbst gemachte Maultaschen anbietet und eine Schmiede, in der Pferde beschlagen werden. Freitags stinkt es nach verbranntem Horn.
Mitten durch den Ort: die Straßenbahn. Offene Waggons, die man noch während der Fahrt durch beherztes Aufspringen erreichen kann und die einen direkt bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof bringen.
Frank ist gerade sieben geworden und steht am Fenster. Die Schneedecke ist zu dünn für Schneemänner und zum Rodeln reicht es auch noch nicht. Er hat schlechte Laune, will den Kinderfunk hören, aber der einzige Radioapparat ist in Brittas Zimmer, in dem sein kranker Vater inzwischen liegt und schläft.
Frank blickt schräg nach oben. Weißkörniger Himmel wie Grießbrei. Er wird noch ein Weilchen warten müssen, bis der Schnee zu gebrauchen ist. Inzwischen wirbeln die Flocken herunter und bleiben auf den Platanenästen liegen. Seltsame Bäume, deren Rinde so aussieht, als würden die Bäume ständig ihre Haut wechseln.
Auf dem Trottoir der Schokoladenstraße, die eigentlich anders heißt, wird die Schneeschicht immer dicker. Weil die amerikanischen Soldaten, die mit ihren Militärlastern hier vorbeifahren, Schokoladenstücke nach draußen werfen, hat Frank die Straße so genannt. Und wenn die armen, deutschen Kinder ihnen zuwinken und hau du ju du und sänk ju rufen, lachen die Soldaten und werfen manchmal noch mehr. Frank weiß, dass man das sänk ju so aussprechen muss, als ob man lispelt. Neulich war nämlich ein echter Amerikaner zu Besuch gewesen, ein Freund von seinem Vater, den er getroffen hat, als er von den Amis gefangen gehalten wurde, und der hat es Frank beigebracht und viel gelacht. Aber die fröhliche Stimmung ist jetzt vorbei.
Hinter ihm und neben ihm hört er die Stimmen der anderen. Flüstern, verhaltenes Husten, leise Tritte, obwohl sein Vater sie sowieso nicht hört. Er hat die Augen geschlossen, schwitzt und stöhnt. Einmal hat Frank das Krankenzimmer betreten, hat sich leise hereingeschlichen, um zu sehen, wie es mit dem Kinderfunk aussieht. Es ist eigentlich das Zimmer seiner Schwester. Das Gesicht seines Vaters ohne Brille: blass und fremd.
Er ist sogar wach gewesen und lächelte kurz, als Frank neben seinem Bett stand.
»Na wie geht’s?«, fragte sein Vater.
»Ganz gut, aber dir nicht so gut.«
»Ziemlich schwach«, flüsterte er. Da sah Frank eine Spinne, die über die Bettdecke krabbelte.
»Da ist … da ist eine Spinne«, sagte er.
»Wo?«
»Auf der Bettdecke. Soll ich sie …?«
Sein Vater richtete sich auf und schüttelte den Kopf. »Nein, nein!«, krächzte er. »Lass sie, du weißt doch, dass ich … dass ich Spinnen mag. Wenn ich wieder … gesund bin, erzähl ich dir, warum.«
Frank nickte und ließ die Spinne mit seinem Vater allein.
Es fällt ihm wieder ein, dass sein Vater auch früher schon versucht hat, die Spinnen vor dem Staubwedel seiner Frau zu retten. Komisch, denkt er. Er selbst findet Spinnen eher eklig.
In der ganzen Wohnung riecht es nach Bohnerwachs, weil die Mutter das Linoleum auf Hochglanz gebracht hat mit ihrem Blocker. Schweres Instrument. Eisen mit Putzlappen und langem Stiel, auf das sich Frank manchmal stellen darf, wenn seine Mutter blockt. Bohnern und Blocken ist wichtig. Gerade jetzt! Der Arzt und die Besucher sollen nicht überall herumerzählen, es sei dreckig bei ihnen. Seine Mutter ist nämlich eine ganz saubere Frau und kommt aus Wasseralfingen von der Schwäbischen Alb. Stuttgart, die Stadt, in der sie wohnen, ist zwar auch schwäbisch, aber nur sanft schwäbisch. Dort sagt man zu Frauen Frauen und nicht Weiber.
Frank hat genug von dem leisen Gemurmel und von seinem kranken Vater, der ihm den Kinderfunk vermiest hat. Er möchte nach draußen.
Im Treppenhaus riecht es nach Königsberger Klopsen, das Essen der Flüchtlinge aus dem Osten. An dem Nagel neben der Tür hängt das Pappschild, auf dem »Kehrwoche« mit verschnörkelten Buchstaben steht.
Es ist gar nicht so kalt. Nach dem Bohnerwachsduft, in dem der dünne Geruch von Krankheit wie ein roter Faden verwoben ist, riecht die Luft draußen doppelt so gut: Wasser, frische Wäsche, Winter.
Der Grießbreihimmel ist von irgendwelchen Himmelsbewohnern teilweise weggefressen worden. Es sind sogar ein paar himmelblaue Flecken zu sehen. Wie Blaubeermilch.
Seine Hände hat Frank in der abgetragenen Cordjacke seines großen Bruders vergraben und drückt die Absätze in den Schnee. Direkt gegenüber der Haustür steht ein riesiger Kirschbaum, der bis über das Hausdach reicht und an dem im Sommer große Herzkirschen hängen. Aber jetzt ist er kahl und macht mit dem Wachsen Pause. Eine papierdünne Rinde, die sich ringelt, wenn man sie abzieht. Weiß bestäubt, dort, wo sie sich zu viel ringelt.
»So viel Aufregung, nur weil Papa Grippe hat«, murmelt Frank und öffnet das Gartentor. Er wird Bernhard besuchen, der am Ende der Hauptstraße wohnt. Fünf Minuten Fußweg.
Bernhard wird ihn auf andere Gedanken bringen. Er ist bekannt wegen seiner kühnen Aktionen. Letztes Jahr fand er Gefallen daran, immer knapp vor einer fahrenden Straßenbahn über die Straße zu rennen. Vor zwei Wochen hat er sich vom dritten Stock abgeseilt und das Seilende im Zimmer um die Kommode gebunden, die sich dann durch Bernhards Gewicht quer durchs Zimmer geschoben und ein paar Schleifspuren auf dem Linoleum hinterlassen hat, ganz abgesehen von den Gläsern, die im Inneren der Kommode umgefallen sind.
»Was soll aus dem Jungen bloß werden?«
Die ständigen Ausrufe von Bernhards Mutter, dabei sollte sie stolz sein auf Bernhard, denkt Frank. Keiner ist so mutig wie er.
Diesmal hat Bernhard einen Abgrund entdeckt. Bauarbeiter haben ein Loch gegraben, um Rohre zu verlegen. Wenn man ein Seil um einen Baum bindet, kann man sich in den Abgrund hinunterlassen. Es ist zwar ein bisschen dreckig, aber richtig gefährlich und toll.
Als Frank nach Hause kommt, sieht er den Krankenwagen. Zwei Männer tragen auf einer Krankenbahre jemanden heraus. Als er seine Mutter mit roten Augen sieht, fällt ihm ein, dass es vielleicht sein Vater sein könnte. Aber der hat doch nur eine Grippe!
»Was ist denn los?«, fragt er Britta, seine Schwester.
»Papa muss ins Krankenhaus. Kein Mensch weiß genau, was er hat. Wie siehst du denn aus? Zieh dich mal schnell um, bevor dich Mama sieht. Die hat jetzt genug Sorgen.«
Frank schleicht durch den Hausflur und denkt, dass er morgen endlich wieder den Kinderfunk hören kann.
Die nächsten Tage sind seltsam: Der Schnee fällt, und Frank ist draußen, wenn er seine paar Schularbeiten gemacht hat. Aber immer, wenn er nach Hause kommt, ist es so, als würden die anderen gerade aufhören zu reden. Und seine Mutter blickt manchmal nach draußen, ohne nach draußen zu blicken, was sie sonst nicht macht. Meistens fehlt sie aber nachmittags, weil sie nach Stuttgart ins Krankenhaus fährt.
Drei Tage später ist sein Vater im Krankenhaus gestorben. Die kleine Wohnung wird voll. Überall stehen oder sitzen Leute herum mit nassen oder roten Augen. Seine Mutter weint still vor sich hin. Frank weint nicht, obwohl er doch traurig sein müsste. Immerhin ist sein Vater gestorben. Aber der Junge spürt keinen Kloß im Hals, seine Augen brennen nicht und die Heulschlange, die doch sonst so schnell nach oben kriecht, um seine Tränen herauszupressen, liegt ruhig zusammengerollt in seinem Bauch.
Da legt ihm jemand die Hand auf die Schulter. Frank blickt hoch. Es ist Eduard, der Freund von seinem Onkel Hermann.
»Na, Frank?«, sagt er und lächelt. »Traurig, dass dein Vater gestorben ist?«
Frank findet es seltsam, dass der Mann lächelt, obwohl er eine traurige Frage gestellt hat.
»Ja, schon«, sagt er einsilbig.
»Wenn du mal einen Ersatzvater brauchst, dann melde dich.« Er tätschelt ihm lässig auf den Rücken. »Alles klar?«
»Mm«, sagt Frank und versucht, Eduard und seinem Vaterangebot zu entkommen. Später sieht er ihn in der Küche, wie er versucht, mit seiner Mutter zu scherzen.
Die nächsten Tage nach dem Tod des Vaters sind unheimlich. Frank kann schlecht einschlafen, weil er in der vorigen Nacht im Traum gesehen hat, wie sein Vater durch die Wohnung gegangen ist, um ihm das Radio wegzunehmen. Einfach so, ohne Kommentar, als ob er gewusst hätte, dass Frank sich nur für den Kinderfunk interessiert und nicht für den kranken Vater.
Obwohl der Vater sonst ein ganz netter Mensch ist. Oder gewesen ist. Er hat mit Frank Waldspaziergänge gemacht, hat ihm Lieder auf dem Klavier vorgespielt, kürzlich noch die sechste Symphonie von Beethoven erklärt, wo es blitzt und donnert und die Sonne wieder scheint. Und er hat ihm beim Baden in der Wanne seine Kriegsnarbe auf dem Oberschenkel gezeigt, wo sich ein Granatsplitter in das Fleisch gebohrt hat und wieder herausgeschnitten wurde. Er hat Frank allerdings auch mal verhauen, weil er zu spät nach Hause gekommen ist und sich alle Sorgen um ihn gemacht haben.
Manchmal hat sich sein Vater von der Arbeit heimlich ins Haus geschlichen, um die Familie beim Abendessen zu überraschen, zusammen mit einem Bückling. Geräucherte Heringe, die nicht viel kosten, aber trotzdem gut schmecken. Delikatessen für kleine Leute.
Wenn Franks Vater nachts im Traum durch die Wohnung in Stuttgart schleicht, hat er seinen dicken Mantel mit dem Fischgrätmuster an. Es muss ja auch ziemlich kalt sein, wenn man im Januar im Grab liegt.
Aber liegt er überhaupt tagsüber in seinem Grab? Und wartet er wirklich auf das ewige Leben? Frank weiß es nicht so genau.
Er würde gerne einmal im Sarg nachschauen, aber das geht nicht. Er hat zu große Angst, und außerdem kann er allein den Sarg gar nicht ausgraben und aufmachen. Er ist ja erst sieben.
Gegen die Totenangst, die ihn manchmal aufwachen lässt, hilft nur das große Bett der Mutter, die warme Haut auf ihren Armen und der weiche Stoff ihres Nachthemds, den er in der Dunkelheit zu Hügeln und Bergen formt und dann durch Glattstreichen wieder in Flachland verwandelt.
»Was machsch denn dauernd an meim Nachthemed rom?«, murmelt sie. Und er versucht, ohne Landschaften einzuschlafen.
Und die weichen Zöpfe von Martina helfen auch gegen die Totengedanken. Die Zöpfe sind so schön dick, biegsam und rot, riechen so gut. Martina ist seine Freundin, ohne seine Freundin zu sein. Niemals würde er zu den anderen sagen, dass sie seine Freundin sei. Aber sie spielen manchmal zusammen und ab und zu darf er ihre Zöpfe in die Hand nehmen und daran riechen. Sie haben einen so besonderen Mädchenhaarduft, dass er sie am liebsten aufessen möchte, wenn sie nicht so haarig wären. Sie riechen ein bisschen nach Haut und Seife und nach einem Geruch, der Ähnlichkeit mit Vanillepudding hat.
Frank hat sich in sie von hinten verliebt, in ihre Zöpfe, und er nimmt das Übrige eben in Kauf. Und ihre Stimme klingt nicht schlecht.
Abends braucht sich Frank nur die Zöpfe von Martina vorzustellen, wenn der Geist mit dem Fischgrätmuster durchs Haus schleicht, dann kommt er auf andere Gedanken.
Oft steht Frank vor dem Fenster und blickt auf die Straße. Seine Mutter denkt wahrscheinlich, dass er vielleicht doch ein bisschen traurig ist, weil sein Vater gestorben ist, und streicht ihm über den Kopf. Aber er denkt an etwas anderes. Es könnte doch sein, dass wieder mal ein Laster die Straße herunterholpert und die Soldaten aus Amerika mit Schokolade werfen. Und dann muss er schnell hinaus und hau du ju du und sänk ju rufen, obwohl hau du ju du ziemlich komisch klingt, als ob jemand verhauen wird. Da ist doch Grüß Gott viel kürzer und schöner.
Am Tag, als die Traueranzeige in der Zeitung erscheint, kommen die Leute, die im Haus wohnen, zu ihnen hinunter, um ihr Beileid auszudrücken. Komisch, dass es ein Beileid und ein Mitleid gibt, denkt Frank. Dann müsste es doch auch ein Umleid oder ein Nebenleid geben.
Direkt über ihnen wohnt eine Frau, die Martha Granuleit heißt und dauernd im Bett liegen muss. Eine von den Flüchtlingen.
Weil sie nicht schwäbisch spricht, hat Frank ein wenig Angst vor ihr. Er war früher nur kurz mal oben und hat sie gesehen, wie sie auf ihrem Bett liegt wie auf einem Thron. Sie kommt nicht herunter, weil sie gelähmt ist, aber ihre Tochter und ein Mann, der nicht ihr Ehemann ist, kommen zu einem Beileidsbesuch. Seine Mutter sagt, Frau Granuleit hat sich mit den Amis eingelassen und hat vor vielen Jahren einen Autounfall gehabt, weil sie zu übermütig war. Und seitdem sei sie gelähmt. Das hat sie nun davon.
»Ibermut tut sälden gut«, sagt seine Mutter. Jetzt liegt Frau Granuleit im Bett, direkt neben dem Fenster und sieht auch ab und zu die Amilaster vorbeifahren. Sie ist ziemlich fromm geworden und hat sogar ein Harmonium in ihrem Zimmer stehen, das hat Frank einmal gesehen. Manchmal spielt jemand einen Choral darauf, der bis zu ihnen nach unten wimmert. »Harre, meine Seele …«
Die sechzehnjährige Tochter von Frau Granuleit heißt Tamara. Sie ist schon voll entwickelt, sagt sein Bruder, und kann mit den Hüften wackeln. Außerdem hat sie keinen richtigen Vater, aber dafür schon einen Freund, der abends sogar vor ihrem Fenster Lieder singt. Hartmut findet das idiotisch und überlegt, ob er an der Dachrinne einen Blumentopf befestigt, den man mit Hilfe einer Schnur herunterfallen lassen kann.
»Von den Amis ist die Tochter jedenfalls nicht«, sagt seine Mutter. »Dafür ist sie zu alt.«
Und ganz oben unter dem Dach wohnen die Mergenthalers, zwei Eltern, zwei Kinder und eine Oma. Der Junge, der Jürgen heißt, ist in Franks Alter und seine Schwester Margret liebt Lakritzschnecken und hat oft braune Zähne. Dann lebt die Oma dort, deren Mann im ersten Krieg gefallen ist. Er muss ziemlich stark gefallen sein, denkt Frank, sonst wäre er nicht tot.
Überhaupt der Krieg! Frank ist ja erst fünf Jahre danach geboren und seine Geschwister sagen immer, er sei deswegen ein Friedenskind. Einmal hat ihn sein Bruder Hartmut so wütend gemacht, dass er ein Vergrößerungsglas nach ihm geworfen hat, und dabei ist Hartmuts Vorderzahn abgebrochen. Seitdem hat das Gerede mit dem Friedenskind aufgehört.
Für Frank ist der Krieg unheimlich. Er hat viel von Dinosauriern gehört und stellt sich vor, dass sie auch im Krieg mitgemischt haben. Andererseits muss der Krieg auch toll gewesen sein, denn Onkel Fritz aus der Verwandtschaft seines Vaters, erzählt immer begeistert davon, wo er überall gewesen ist und wie sie dem Iwan eingeheizt haben. Aber gewonnen haben sie dann trotzdem nicht. Es gibt Nächte, da lässt ihn sein toter Vater in Ruhe, und dann denkt er daran, dass er gar nicht so schlecht gewesen ist. Er konnte ziemlich viel. Zum Beispiel konnte er schwäbisch sprechen, ohne Schwabe zu sein. Seine Familie stammt aus Braunschweig und Sachsen, und deswegen ist auch Onkel Fritz kein richtiger Schwabe.
Sein Vater ist auch furchtbar musikalisch gewesen. Er konnte wahnsinnig gut Klavier und Orgel spielen.
Wenn Frank abends nicht schlafen kann, pfeift er manchmal vor sich hin, weil er denkt, dass er auch musikalisch ist. Und dabei hat er das ewige Pfeifen entdeckt. So nebenbei. Er hat nämlich gemerkt, dass man ununterbrochen pfeifen kann, wenn man beim Einatmen auch pfeift.
Es ist komisch, aber irgendwie mag Frank Gott, obwohl er ihn nie gesehen hat, außer in der Kinderbibel, wo er Mose die zehn Gebote überreicht. Auf diesem Bild sieht er ziemlich alt aus, etwas streng, aber auch nett. Man muss ihn einfach mögen, denkt Frank, weil er ja alles so wunderbar erschaffen hat: die Ameisen, die Affen, die Platanen mit der dünnen Rinde, den Schwarzwald und den Bodensee, die weiche Haut seiner Mutter, Martinas Zöpfe und die Kakaonüsse, aus denen man Schokolade herstellen kann.
Klar, es gibt auch Unglücke und Vulkanausbrüche. Aber das Schlimmste, was einem da passieren kann, denkt Frank, ist ja, dass man stirbt. Und dann geht es einem im Himmel sogar noch besser als vorher, wenn man nicht das Pech hat und in der Hölle landet.
Eigentlich müsste er vor seinem toten Vater gar keine Angst haben, weil er ja im Himmel ist, das ewige Pfeifen übt, mit Gott vierhändig spielt und frisch geräucherte Bücklinge isst. Aber das modrig Tote ist immer noch ein bisschen da, wie Knoblauch, der in einem Pullover festhängt. Ein paar Tage später hat Frank den furchtbarsten Traum seines Lebens.
Ein großer, dunkler Mann steigt durch das offene Klofenster. Er sieht ein bisschen aus wie Eduard, der Freund von Onkel Hermann, und ruft: »Elisabeth, komm!« Und als die Mutter kommt, packt er sie und trägt sie wie ein Paket nach draußen. Frank ist im Traum zunächst ahnungslos. Er sucht seine Mutter überall und ruft ihren Namen, obwohl er eigentlich weiß, dass sie gestohlen worden ist. Dann sieht er das offene Fenster, steigt auf einen Stuhl und blickt hinaus. Da ist der Mann, der seine Mutter gerade wegträgt. Frank fängt zu schreien an, bis er wach wird. Dann steht er auf, torkelt zum Bett seiner Mutter und sieht mit klopfendem Herzen nach, ob sie noch da ist. Da liegt sie friedlich unter ihrer Decke. Schnell schlüpft er zu ihr ins warme Bett und erzählt schluchzend von seinem Traum. Diesmal darf er ganz viele Berge und Täler aus dem Stoff ihres Nachthemds formen. Er ist noch nie so erleichtert gewesen wie in diesem Augenblick, als er ihren weichen Körper fühlt.
Am nächsten Morgen findet Frank hinter dem Wohnzimmerschrank die Schwalbe, die er vor ein paar Wochen gebastelt hat, nachdem ihm sein Vater gezeigt hat, wie’s geht. Das war, bevor die Krankheit so schlimm wurde. Die Papierschwalbe ist zwischen Wand und Schrank eingeklemmt gewesen. Frank geht in das Treppenhaus und steigt einen Stock höher, wo das Fenster ist und lässt die Schwalbe fliegen. Sie fliegt sehr schön, aber ein Wind kommt plötzlich auf und weht sie weg.
2
STUTTGART, JANUAR 1957. Elisabeth Schering kann es nicht fassen, dass ihr Mann so krank sein soll. Vor einer Woche kam er nach Hause, fühlte sich nicht wohl, bekam Fieber, legte sich ins Bett. Eine Grippe, denkt sie. Mit Wadenwickeln, Schwitzen, mit Tee, Kraftbrühe und Schlafen wird das Fieber zurückgehen. Aber es geht nicht zurück. Schließlich ruft sie nach dem Arzt. Er verordnet fiebersenkende Mittel. Das Fieber steigt.
Ein anderer Arzt kommt. Es ist alles rätselhaft. Sie unterhalten sich in ihrer Fachsprache. Bis dahin war sie noch nicht besorgt, erst als sie sagen, er müsse ins Krankenhaus, macht sie sich Gedanken.
Arnold Schering liegt im Bett und glüht, er scheint immer kleiner zu werden. Kraftlos hängt er an ihr, als sie ihn in die Badewanne bugsiert. Aber es ist ihr egal, Hauptsache, er kommt wieder auf die Beine.
Und was für ein herrlicher Mann er war. Selbstbewusst, charmant. Seine Hände, schlank und groß, tanzten lässig über die Tasten des Klaviers.
Wie er auf einer Bahre hinausgetragen wird! Das Bild vergisst sie nicht. Der Krankenwagen. Neugierige Schatten hinter den Vorhängen der anderen Häuser.
Und Frank, der wie verloren allen im Weg steht. Wie gut, dass Britta da ist, die sich um ihn kümmert.
Aber Schluss mit den Gedanken, sie muss sich konzentrieren. Der Schnee draußen. Die Kehrwoche. Auch das noch! Und der Geruch von Königsberger Klopsen im Flur. Kapern! Machen die Granuleits beim Kochen nie die Tür zu?
Sie könnte kotzen.
Hartmut muss den Schnee wegmachen. Er ist kräftig, aber faul. Dauernd muss ich ihm sagen, was er mir abnehmen kann. Haben Jungen eigentlich keine Augen für das, was getan werden muss?
Sie fährt in jeder freien Minute ins Krankenhaus. Eine halbe Stunde mit der Straßenbahn. Aber es ist gut. In dieser halben Stunde ist sie ganz allein. Niemand will etwas von ihr. Sie blickt nach draußen in den Schnee, der ungerührt nach unten fällt. Tröstlich. Ganz gleich, wie sie sich fühlt, der Schnee kümmert sich nicht darum. Er macht seine Arbeit und fällt. Das ist alles, was er zu tun hat.
Und was wird, wenn Arnold nicht mehr … Daran will sie gar nicht denken. Sie muss das Nächstliegende tun: Arnold besuchen, ihn aufmuntern.
Wenn … ja wenn er überhaupt ansprechbar ist. Meine Zeit, diese Krankheit kann doch nicht so schlimm sein. Seit wann muss man denn bei einer Grippe ins Krankenhaus? Die Männer sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Dieser fürchterliche Krieg hat allen die Kraft geraubt.
Wenn sie daran denkt, dass Arnold vor dem Krieg kräftiges Haar gehabt hat und als er dann zurückkam: dünn und schütter. Furchtbar. Sie hatte ihn kaum wiedererkannt, so abgemagert wie er war.
Und alles musste man ihm aus der Nase ziehen, 1947. Erzähl doch mal, hat sie zu ihm gesagt.
Was soll ich denn erzählen? Von den Leichen, die wir zurückgelassen haben? Erst nach zwei Jahren hat er mehr erzählt. Zuerst stockend. Konnte es nicht mehr bei sich behalten. Eine Art Kriegsdurchfall.
Aber sie hat ihn wieder hingekriegt. Sie liebt ihn ja. Und sie ist eine gute Köchin. Ja, das ist sie. Sie kann aus wenigen Sachen Gerichte zaubern.
Hirnsuppe, zum Beispiel, oder Saure Kutteln. Und die Spätzle macht sie immer selbst. Den Teig am Vorabend schon ansetzen und rühren, bis er Blasen schlägt. Über Nacht zum idealen Spätzlesteig heranreifen lassen.
Als Arnold wieder zu Kräften kommt, kommt auch die Lust zurück. Zuerst die Zärtlichkeit, dann die Lust. Jede Nacht. Als müsse man alles aufholen. Frank war einfach nicht zu verhindern.
Aber jetzt ist sie froh, dass sie noch so einen kleinen Jungen hat. Wenn ein Kind erst da ist, schafft man es irgendwie, hat sie gemerkt.
Das Krankenhaus! Beinahe hätte sie es verpasst. Sie steigt aus.
Dieser Blick der Diakonisse an der Pforte des Rosenberg-Krankenhauses. Mitleid mit einem Hauch Überlegenheit: Wieder so eine, die ihren kranken Mann besucht.
Ja, die hat ihr Herz an keinen Mann gehängt, nur an die Arbeit oder an Gott. Praktisch. Den muss man nicht im Krankenhaus besuchen. Ewige Ehe.
Erdgeschoss. Auf Intensiv. Ein weißer Kittel. Man kennt sie schon.
Da liegt er. Mit geschlossenen Augen.
Sie setzt sich neben ihn und hält seine heiße Hand, streichelt vorsichtig über seine kratzige Wange. Ach ja, sie könnte ihn rasieren.
Sie nimmt sich die gebogene Nierenschale, füllt sie mit lauwarmem Wasser, greift nach Pinsel und Rasierseife. Und da ist ein tiefer Teller, in dem man den Rasierschaum schlagen kann. Fast wie Teig herstellen.
Als sie ihm vorsichtig die Wangen einseift, schlägt er die Augen auf. Sie hält inne.
»Was machst du?«, murmelt er.
Das Schwäbische ist abgefallen, es war ja doch nur eine Fremdsprache für ihn.
Sie lächelt ihn zaghaft an. »Ich rasier dich.« Wie kann es nur sein, dass sie dieses Häufchen Elend immer noch liebt? Schmerzhaft liebt. Das gibt’s doch nicht!
Er murmelt leise Unverständliches.
Sie hält die Nierenschale unters Kinn und gleitet mit dem Rasierer vorsichtig an seiner Wange entlang, lässt den Schaum mit den Bartstoppeln in das Metall tropfen, zusammen mit ein paar Tränen.
Die Tür geht auf, eine Schwester schaut herein. »Frau Schering«, sagt sie. »Nett, dass Sie Ihren Mann rasieren.«
Sie nickt.
»Kommen Sie doch nachher ins Stationszimmer, der Arzt möchte mit Ihnen reden.«
»Isch recht.«
Sie hat Herzklopfen, als sie ins Zimmer kommt, der Geruch von echtem Bohnenkaffee liegt in der Luft und kalter Rauch von Zigaretten.
Dr. Henner sitzt am Schreibtisch und blickt auf. Er nimmt seine Brille ab, steht auf und gibt ihr die Hand. »Bitte, setzen Sie sich doch, Frau Schering.« Er dreht den Schreibtischstuhl um und setzt sich auch.
»Er hat die Augen aufgemacht«, sagt sie, »und etwas geflüstert.«
Dr. Henner nickt professionell. »Ja«, sagt er, »wenigstens das.« Er macht eine Pause, dreht seine Brille in der Hand. »Frau Schering, ich möchte nicht groß herumreden. Um Ihren Mann steht es sehr ernst. Er scheint aus einem Grund, den wir noch nicht kennen, sehr hohes Fieber zu haben. Es gibt Bakterien im Blut, die für uns ein Rätsel sind. Wir haben alles Mögliche probiert. Auf Penicillin reagiert er nicht. Irgendwo muss ein Entzündungsherd sein. Das Herz ist stark angegriffen. Er fällt immer wieder in eine Ohnmacht, die Abstände, in denen er bei Bewusstsein ist, werden kürzer …«
»Ich … Ich versteh das nicht«, sagt sie. »Es war doch nur eine harmlose Grippe.«
»Wir vermuten einen unbekannten Bakterienherd.«
Sie senkt den Kopf und merkt, wie ihre Augen wieder feucht werden. »Gibt es denn … überhaupt noch Hoffnung?«
»Nur, wenn wir die Ursache herausgefunden haben.«
Sie nickt wortlos.
»Morgen können Sie zwar kommen, aber ich kann Ihnen nichts versprechen.« Er steht auf. »Tut mir leid, dass ich Ihnen nichts Genaueres sagen kann.«
Ein Händedruck. Es sieht so aus, als ob er flieht.
Wie betäubt fährt sie nach Hause, nachdem sie sich von Arnold verabschiedet hat.
Am nächsten Morgen klingelt das Telefon. Er sei gegen vier Uhr morgens gestorben. Sie könne leider noch nicht zu ihrem Mann. Ob sie mit einer Obduktion einverstanden sei?
Der Nachmittag wie Nebel. Britta und Hartmut kochen Kaffee und Tee. Freunde kommen vorbei. Alles weint, selbst Hartmut hat rote Augen. Nur Franks Gesicht bleibt trocken. Wahrscheinlich begreift er die ganze Tragweite noch nicht.
Nachts wird sie wach, weil Frank weinend in ihr Bett kriecht. Schlimmer Traum. Jetzt ist er der Einzige, der für die nächste Zeit ab und zu neben ihr im Bett liegen wird. Da kann er so viele Nachthemdlandschaften formen, wie er will, der arme Kerl.
Zwei Tage später bekommt sie einen Brief vom Krankenhaus. Sie haben die Ursache herausgefunden. Eine alte Kriegsverletzung am Kopf, eingekapselte Bakterien, die durch die Grippe freigesetzt wurden.
Aber das hilft ihr jetzt auch nicht weiter. Immerhin kann sie jetzt den Beerdigungstermin festlegen.
Achtzehn Jahre Liebe werden nächste Woche zu Grabe getragen.
3
DER LETZTE SOMMER VOR DEM KRIEG. Aber niemand weiß, dass es der letzte Sommer ist, bevor die Welt langsam auseinanderbricht. Im Juli 1939 ist es brütend heiß. Man sitzt draußen vor den Restaurants und trinkt Kaffee. In Polen klettert das Thermometer bis auf fünfunddreißig Grad. Die Kinder plantschen in den Springbrunnen oder in den Flüssen. Polen ist froh über den Korridor zur Ostsee. In Berlin wird am Fließband Eis verkauft.
Arnold Schering sitzt im Speisewagen, im D-Zug von Leipzig nach Berlin über Cottbus. Er hat die Ärmel seines weißen Hemds nach oben gekrempelt und den zweiten Knopf am Kragen geöffnet und starrt unauffällig zu Slowfox hinüber. Zur Tarnung hat er ein Buch aufgeschlagen und hält es hoch. Er nennt diesen älteren Herrn schräg gegenüber Slowfox, weil er noch nie einen Menschen gesehen hat, der so langsam isst.
Millimeter für Millimeter nähert sich die Gabel mit dem Rührei dem Mund. Jetzt schwebt sie einen Zentimeter vor Slowfox’ Gesicht. Wird die Gabel es schaffen, den offenen Mund zu erreichen?
Nein. Der Zug bremst, und das Rührei fällt von der Gabel, landet auf dem Teller und auf dem Tischtuch.
Arnold lässt das Buch sinken, Versucht, sein Lachen zu unterdrücken, beißt in seinen Zeigefinger und atmet tief durch.
Herrlich, dieser Speisewagen. Unterhaltung pur. Wer kann es sich schon leisten, im Speisewagen zu sitzen? Zum Glück hat seine Mutter einen reichen Bruder und wird von ihm kräftig unterstützt, seit ihr Mann im Weltkrieg gefallen ist. Und bei ihm, dem einzigen Sohn, wird immer ein Auge zugedrückt. Der Junge muss etwas Gutes essen und braucht zum Lesen im Zug einen Tisch, weil er Worte unterstreichen muss. Oder sein eigenes Zugabteil. »Coupé«, wie seine Mutter es immer noch nennt. Lächerlich, diese französischen Worte. Völlig überflüssig. Auf jeden Fall ist Jura ein hartes Studium. Und wer im Speisewagen sitzt, muss auch etwas bestellen.
Arnold zündet sich eine Zigarre an, die er von seinem Onkel bekommen hat, lässt den Rauch genüsslich zur Decke schweben, vernebelt die rasende Landschaft vor ihm. Seine Mutter weiß nicht, wie es ist, zu studieren. Für sie ein geheimnisvolles Wort. Eine höhere Weihe (mein Sohn studiert Jura!).
Man muss die anderen im Glauben lassen, dass das eigene Leben hart ist.
Arnold hat bei einer Schwester gelernt, für sich selbst zu sorgen und sich kleine Inseln zu schaffen, Inseln, auf denen er sich ausruhen kann.
Ja, man muss sich Räume schaffen, um zu überleben. Wer seinen Nächsten lieben will, muss auch für sich selbst sorgen können.
Sicher, man sollte auch an die Gemeinschaft denken, an die Volksgemeinschaft. Aber auch sie setzt sich schließlich aus Einzelnen zusammen und …
»Noch einen Kaffee«, sagt Arnold, als der Kellner des Speisewagens vorbeikommt. »Und was haben Sie an Kuchen?«
»Einen gedeckten Apfelkuchen, Streuselkuchen, Obstschnitten.«
»Bringen Sie mir den Apfelkuchen. Mit Sahne!«
»Haben wir zurzeit nicht.«
Der Kellner kommt mit einer großen Metallkanne und schenkt nach.
Flache Wälder wie grüner Pelz. Schlafende Riesentiere zwischen den Hügeln. Und Slowfox, der entsetzt die gelben Rühreiflecken auf dem Tischtuch anstarrt. Sehr langsam. Ist das Langsame eine Krankheit?
Arnold genießt die Zugfahrt. Kaffee, Zigarre, Slowfox. Es könnte kaum besser sein. Student mit Mütze, eigenes Zimmer in Leipzig, die Tochter seiner Vermieterin lächelt ihn immer an.
Er wird Jurist, wird später seine eigene Kanzlei aufmachen oder als Richter in einem Gericht arbeiten. Bürgerliches Recht.
Und: Claudia. Das Mädchen mit den kurzen flotten Haaren aus Cottbus. Ungewöhnlich, intelligent, manchmal etwas frech. Und ihr Name klingt ausgefallen, irgendwie römisch. Die Verlobung steht an. Alle wollen es. Gleiches Niveau, gut situiert. Vielleicht etwas dünn. Aber sonst? Warum nicht? Wenn er wirklich will, wird er sich in sie verlieben. Er mag sie immerhin ein bisschen. Und es prickelt, wenn sie zusammen sind und sich küssen.
Das Küssen reicht erst mal. Er sieht es doch an den Ehen um ihn herum. Es ist viel Gewohnheit, Vertrautheit. Und das Verliebtsein, wenn es überhaupt kommt, geht sowieso bald zurück.
Aber er freut sich auf Claudia. Es ist nicht so, dass er von ihr träumt, es ist eine wachsende Vertrautheit, ein bisschen Frauenduft atmen, ein paar Küsse, Streicheln an gewagten Stellen. Mehr wird nicht drin sein. Natürlich übernachtet er im Gästezimmer. Man ist anständig, weiß, was sich gehört.
Und er nimmt gern den Umweg über Cottbus in Kauf. Morgen früh, wenn er von Cottbus aus weiterfährt, wird er in Lübbenau aussteigen. Die Spreekanäle! Eine kleine Fahrt im Stocherkahn. Man muss die Dinge genießen, die auf dem Weg liegen: Leipzig, Kaffee, Slowfox, Claudia, Spree, Berlin.
Arnold nimmt das kleine, schwere Silberkännchen und gießt Milch nach. Vom Milchstrahl zur Milchstraßenspirale. Das Große im Kleinen. Die Zukunft ist klar, schön, glänzend. Und der mögliche Krieg gegen Polen? Eine kurze Unterbrechung. Wenn es überhaupt dazu kommt. Es kann auch eine friedliche Übernahme werden wie bei der Tschechei. Der Führer will ja grundsätzlich den Frieden. Das betont er doch immer wieder.
»Ihr Kuchen!«
»Danke.«
Herrlich. Alles klappt. Es geht aufwärts. Apfelkuchen im Speisewagen, wenn auch ohne Sahne. Dem Führer sei Dank!
Hat ja Unglaubliches geleistet. Endlich muss man sich nicht mehr schämen, ein Deutscher zu sein. Die Olympischen Spiele in Berlin vor ein paar Jahren waren ein Traum.
Slowfox hat sehr langsam das Rührei wieder aufgesammelt und nimmt einen zweiten Anlauf.
Eine ältere Dame setzt sich an einen freien Tisch. Gut situiert, dunkelgrünes Kostüm, weiße Bluse mit Brosche. Prominente Nase. Sieht irgendwie jüdisch aus, denkt Arnold.
Der Kellner ist sofort da. Zackig.
»Haben Sie noch ein Déjeuner?«, fragt die Gutsituierte.
Der Kellner zögert, sagt mit einer Spur Ärger in der Stimme: »Eine Deeschönnee führen wir hier nicht, aber Sie können ein deutsches Frühstück bekommen!«
»Na gut. Dann nehme ich das deutsche Frühstück.«
Ist es Einbildung, dass Arnold einen sanften Spott heraushört? Warum Spott? Ist es nicht gut, die vielen Fremdwörter zu vermeiden? Die Überwelschung der deutschen Sprache treibt manchmal Blüten! Erst neulich wieder von jemandem merci gehört. Affig! Danke klingt doch viel besser, irgendwie voller. Déjeuner statt Frühstück. Gut, seine Mutter benutzt auch diese französischen Wörter. Ist halt Gewohnheit bei ihr.
Irgendwie ist ihm diese Dame unsympathisch. Diese Brosche sieht protzig aus.
Hinterher hört er, wie der Kellner sich halblaut mit seinem Kollegen über das »Deeschönnee« auslässt: » … Die Franzosen sind doch wie die Juden. Die haben keine Liebe zum Tier!«
Arnold greift wieder zu seinem Buch, liest: »So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln: Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn.«
Arnold trinkt einen Schluck Kaffee und denkt nach. Hitlers Gedanken klingen brutal und scharf, das stimmt. Er sieht sich also als ein Knecht Gottes, der gegen die Juden für das Werk des Herrn kämpft. So deutlich hat er es bisher nicht gewusst. Wunderbar, fast christlich. Und haben sich die Juden nicht selbst in den Abgrund getrieben? Ihren Messias nicht erkannt und ihn getötet? Musste nicht ein Fluch auf ihnen liegen. »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!«, sagt doch schon der Evangelist Matthäus. Und dann noch dieses internationale Gehabe … das internationale Finanzjudentum.
Arnold denkt an Erwin Radowitz, seinen Klavierlehrer. Seinen persönlichen Juden. Sicher, er ist Jude, aber doch ein harmloser, netter Mann, der einen Schalk im Nacken und Musik im Blut hat. Wie er die »Mondscheinsonate« spielt! Großartig!
Was für einen Sinn sollte es haben, sich gegen diesen Mann zu wehren? Vielleicht gegen die jüdischen Blutsauger, die kriminellen Elemente, die jüdischen Marxisten. Aber Hitler würde doch niemals den Befehl geben, Erwin Radowitz umzubringen. Das wäre ein Witz. Jemand, der das Werk des Herrn vorantreibt, hat es nicht nötig, vor Erwin Radowitz Angst zu haben.
Arnold erinnert sich an sein letztes Gespräch mit Theo, seinem Kollegen. Beunruhigender Ton.
»Ich weiß nicht, wie das mit dem Studium weitergehen soll!«
»Warum denn, Theo?«
Theo blickte sich um. Sie saßen in einem Café.
»Der ganze Apparat verändert sich, Arnold. Unmerklich. Bei dir vielleicht nicht so stark, bürgerliches Gesetz hat seine Grenzen, aber sonst …«
Er flüsterte: »Es geht nicht mehr nach herkömmlichen Werten, humanistischen Grundlagen, christlicher Ethik. Die höchste Autorität in Rechtsfragen ist das Führerprinzip und das …«, er lachte bitter auf, »das gesunde Volksempfinden. Wenn das so weitergeht, bestimmt allein der Führer, wer verurteilt wird und wer nicht. Auch beim Beamtengesetz. Das baut nicht mehr auf der Weimarer Verfassung auf, sondern auf dem Treueverhältnis zum Führer. Es ist unglaublich, dass die Wehrmacht einen Eid auf Hitler ablegt. Im Grunde geht das juristisch gar nicht. Stell dir vor, der Führer wird krank! Ich weiß nicht, ob ich unter diesen Umständen …«
Arnold seufzt, während er daran denkt. Unvorstellbar, sich gegen das Führerprinzip zu stellen. Zwei Studienkollegen sind schon verschwunden. Man weiß nicht warum. Keiner getraut sich zu fragen. Die Praxis der Schutzhaft hat inzwischen Ausmaße erreicht, die an Willkür grenzen.
Und dann das hier: diese fast christliche Passage in »Mein Kampf«. Wenn der Führer von Gott geschickt wurde, dann wird er doch das Richtige tun. Gerecht sein. Die Demokratie war ja zu einem Debattierklub verkommen, es musste ein starker Mann her. Und der Erfolg …
Der Apfelkuchen schmeckt für einen Speisewagen gar nicht so schlecht.
Draußen ziehen Wälder vorbei. Ein Storch auf einem baufälligen Kaminschlot. Der Zug fährt langsamer. Finsterwalde.
Staunend liest Arnold, dass der Führer Gesangsunterricht genommen und sich an den kirchlichen Festen berauscht hat … Berauscht? Seltsames Wort … Den Abt im Chorherrenstift Lambach soll er sogar regelrecht bewundert haben.
Arnold greift zur Tasse, leert den lauwarmen Rest auf einen Schluck.
Schau an, der Führer! Abt wollte er mal werden. Interessant. Und er findet Gefallen an den prunkvollen kirchlichen Festen. Vielleicht steckt doch in ihm mehr Religion, als man so denkt. Er muss von Gott geschickt worden sein, um Deutschland wieder groß zu machen! Ganz sicher!
Und der Eid, den ich letztes Jahr bei meiner Einberufung abgelegt habe, ist doch eine gute Sache … Wie auch immer, jetzt muss ich zu meinem Eid stehen. Versprochen ist versprochen.
Slowfox hat eben sein Rührei verspeist. Großartige Leistung. Herzlichen Glückwunsch!
»Zahlen, bitte!«
4
BERLIN, SOMMER 1939. Wenn es im Schwarzwald regnet, scheint in Berlin die Sonne, das hat Elisabeth schon nach ein paar Tagen festgestellt, als sie einmal ganz kurz nach Freudenstadt telefonieren darf, weil ihre Freundin gerade dort ist und es ein Telefon im Wohnzimmer gibt. Während es von Freudenstadt aus durch das Telefon regnet, ist der Sommer in Berlin 1939 warm, staubig und laut.
Sie solle mal aus Wasseralfingen weg, hat ihre Mutter gemeint, damit sie einen Mann kennenlernt. Immerhin ist sie schon vierundzwanzig, sieht gut aus mit ihrem hellen Teint, den dunklen, schweren Haaren, ihren himmelblauen Augen. Und wenn sie Lippenstift aufträgt: wie Schneewittchen. Meine Güte, die Männer müssten sich doch um sie reißen!
In Berlin, in der Bäckerei ihres Onkels, wird sie unter Leute kommen. Vor allem draußen, im Cafégarten, wenn sie bedient und ihr blaues Sommerkleid mit den weißen Punkten anzieht. Und darüber eine weiße Schürze. Aber Elisabeth hat so etwas an sich, das die Männer auf Distanz hält.
»Musst du denn so … so kratzig sein?«, hat ihre Freundin gefragt.
Jetzt trägt Elisabeth ein einteiliges hellgraues Kleid ohne Ärmel. Darüber eine weiße Schürze. Die Ränder unter den Achseln vom Schweiß schon dunkel.
Bäckereien sind ja auch heimliche Wärmestuben. Elisabeths Haare fangen an, sich aus der Spange zu lösen. Ein Hauch von bezaubernder Verwahrlosung.
Die Klingel geht.
»Heil Hitler!«, sagt sie.
»Hei-tler!« Der Mann mit dem zackigen Gruß, die fettigen Haare mit Pomade straff nach hinten gebürstet, blickt Elisabeth kurz an.
»Aha, neue Bedienung, was?« Das Zackige scheint bei ihm eine Lebensauffassung zu sein.
Elisabeth lächelt nach Standard. »Ja, ich helf hier grad bei meiner Tante aus.« Sie bemüht sich, Hochdeutsch zu sprechen, aber hat sich schon verraten, durch die Melodie, durch das typisch breite au bei aus und durch das grad.
»Aus Süddeutschland, was? Womöglich aus dem Schwarzwald?«
»Nicht ganz, aber in der Nähe!« Du geleckter Halbdackel!, denkt sie.
»Ein rundes Bauernbrot und fünf Schrippen!« Es klingt wie ein Befehl.
Und überhaupt: Schrippen! Ein merkwürdiges Wort. Hört sich irgendwie brutal an. Da klingt doch Weckle viel netter.
Elisabeth streckt sich nach dem Regal, ihr Kleid rutscht ein paar Zentimeter höher, sie holt das vorletzte Brot herunter und spürt die Blicke des Mannes hinter sich. Packt die Brötchen ab.
»Sonst noch etwas, der Herr?«
»Danke, das wär’s.«
Immerhin danke. War doch net so schwer, oder? Und dann laut: »Des sind … achtunddreißig Pfennige fürs Brot und fünfundzwanzig für die Weckle … ahm … Schrippen, macht … dreiundsechzig.«
Der Mann mit den straffen Haaren holt umständlich seine Geldbörse heraus und blickt Elisabeth dabei an. Er grinst. Sie senkt den Blick und ordnet die Mohnschnecken, obwohl sie schon ordentlich daliegen.
Ein aufdringlicher Kerl. Wenn er wenigstens nett wär.
Er legt das Geld in die Holzschale. Sie tippt die Zahlen ein, kurbelt an der Kasse, bis die Schublade klingelnd aufspringt, und legt das Geld sortiert in Reihen.
»Und?«
Elisabeth blickt auf. »Was und?«
»Wie wär’s mit uns beiden? Hast du morgen Abend etwas vor?«
»Ob ich was vor hab?«
»Japp.«
Jetzt wird es Elisabeth zu bunt. Sie spürt Ärger. In ihrem Bauch brodelt es. Sie weiß, dass es eigentlich nicht gut ist, sich mit Leuten anzulegen. Kostbare Kunden. Aber egal.
»Höret Sie! Mit Leut, die mich mit Du anreden, obwohl wir uns gar net kennen, geh ich net aus. Suchet Sie sich jemand anders. Hei-tler!« Sie kann es nämlich auch so zackig sagen, wenn sie will.
Sie dreht sich um, geht zu einem anderen Regal und packt ein paar Brötchen ab für einen imaginären Kunden.
Der Mann steht noch ein paar Sekunden verblüfft da, dann hört sie seine Schritte. »Hei-tler!«
Die Ladentür knallt ins Schloss.
»Wer knallt denn so mit der Tür?« Elisabeths Tante Berta, groß, sehr rundlich, rotes Gesicht, aufgesteckte Haare, die in einer Art Zwiebel enden.
Elisabeth zuckt mit den Schultern.
»Der Kerl hat mich einladen wollen und redet mich gleich mit Du an. Dem hab ich’s zeigt.«
Die Tante ist nicht sehr erbaut. »Meinst du nicht, Betti, dass man das auch höflicher sagen kann? Immerhin ist der Mann ein …«
»… ein koschtbarer Kunde, ich weiß.«
»Man muss trotzdem nicht ausfallend werden.«
Elisabeth sagt nichts, beißt sich auf die Unterlippe und quetscht schließlich den Satz heraus: »Meeglich isch elles.«
»Was?«
»Mööklich ist alles.«
»Das will ich doch meinen.«
Als Elisabeth völlig verschwitzt nach Ladenschluss in ihre kleine, stickige Kammer geht, die unter dem Dach die Hitze gespeichert hat, lässt sie sich auf ihr Bett fallen und nimmt sich vor, freundlich abweisend zu sein, wenn jemand wieder so plump daherkommt.
Ja, wenn er sie freundlich angelächelt hätte und gesagt hätte: »Fräulein Elisabeth, haben Sie morgen Abend vielleicht etwas vor?« Ja, dann wäre sie unter Umständen bereit gewesen, darüber nachzudenken. Aber dieser Kerl mit seinem zackigen Hei-tler hat so ein komisches, abstehendes Ohr. Affig. Und seine fettigen Haare! Der Fettfleck morgens auf dem Kopfkissen! Eklig!
»Betti!« Die Stimme ihrer Tante.
»Komm runter, Abendessen machen!«
»Ich komm gleich!«
Eine Hetze ist das! Betti! Abendessen machen! Beruf: Sklavin aus Schwaben. Den ganzen Tag in der warmen Bäckerei stehen und dann das Abendessen machen. Und wo kann man sich hier abkühlen? Mit der Wasserschüssel auf ihrem Zimmer?
Mechanisch richtet sie das Abendessen für die fünfköpfige Familie: Brot schneiden mit dem Brotlaib vor dem Bauch. Salami, Margarine, Schmalz und die Kartoffeln vom Mittagessen noch mal anbraten mit Zwiebeln und Speck und das Glas Spreewald-Gurken.
Onkel Hubert ist schweigsam wie immer, außer wenn es um den Krieg geht, der kommen soll. Die beiden Schwestern streiten sich, wer den neuen Kaugummiautomaten an der Ecke ausprobieren darf.
Plötzlich Onkel Hubert: »Der Doktor Neumann sagt, dass der Krieg gegen den Polen kommt. Aber das wird kurz sein: drei Tage oder eine Woche und dann ist Schluss. Der Engländer ist feige und wird sich nicht rühren.«
Kurzes Schweigen. Alle sind über den Wortschwall von Onkel Hubert verblüfft.
Tante Berta: »Ja, wir haben ja auch das beste und schnellste Heer der Welt. Das hat ein Kunde neulich gesagt und der Pole ist vom Juden durchsetzt und schwach.«
»Wie das klingt«, sagt Elisabeth und nimmt sich ein Stück Brot.
Max, der Dreizehnjährige: »Betti hat einen dunklen Rand unter der Achsel.«
Da wird sie wütend: »Ja, steh du mal den ganzen Tag in der warmen Bäckerei bei dem Wetter, und in der Kammer bloß a Krügle mit Wasser, da tät’s du au schwitze!«
»Da tät’s du au schwitze!« Max lacht.
Elisabeth zwickt ihn kräftig in die Seite.
»Au! Die Betti hat mich gekniffen.«
»Das geschieht dir ganz recht!«, sagt Tante Berta. »Du brauchst dich gar nicht über sie lustig machen. Sie kann ja nichts dafür, dass sie so seltsam spricht.«
Sie sieht ihre Nichte an und sagt: »Draußen im Hof ist eine Ecke mit einem Haken, da hängst du dir die Gießkanne an. Vorne ist ein Seil, an dem ziehst du und dann duscht es.«
»Aber ich kann mich doch da nicht einfach ausziehen!« »Da steht eine spanische Wand davor.«
»Eine spanische …?«
»Na ja, eine Stoffwand.«
Elisabeth kommt sich, je länger sie hier lebt, immer unbeholfener vor. Sie kann ja nichts dafür, dass sie so seltsam spricht.Eine Frechheit!
Und überhaupt: Der Mörike und der Schiller haben breitestes Schwäbisch zu Hause gesprochen! Brei-tes-tes! Und die gelten was in der Welt!
Sie schluckt ihren Ärger hinunter und beißt herzhaft in ihre Schmalzstulle. Stulle! Wieder so ein komisches Wort. Stulle, Mulle, Schrulle, Pulle. Klingt irgendwie abfällig.
»Ach Betti?«
Sie schreckt auf.
»Meine andere Nichte Klara hat mich heute gefragt, ob du nicht morgen Abend zu ihr kommen kannst, um auf die Kinder aufzupassen. Sie will mit ihrem Mann und ein paar Freunden ausgehen. Du hast doch nichts vor, oder?«
Sie tut so, als ob sie nachdenkt. Sie hätte morgen Abend mit dem Fetthaarheini ausgehen können.
»Ich hab nix vor.«
»Ich zeig dir, wie du mit der Elektrischen hinkommst.« Da fällt ihr etwas ein: »Tante Berta, ich tät so gern mit der U-Bahn fahren. So was haben wir in Stuttgart nicht.«
Tante Berta überlegt. »Dass ihr jungen Leute immer mit unserer Tunnel-Eule fahren wollt. Na ja. Ich schreib dir alles auf. Aber zurück fährst du mit der Elektrischen! Die U-Bahn ist nachts nichts für junge Mädchen!«
»Isch guat!«
Max rührt sich wieder und will sich auf das Isch guat stürzen, aber Elisabeth blickt ihn mit ihren blauen Augen so funkelnd an, dass er es bleiben lässt.
Nachher im Hof probiert sie die Außendusche aus. Aber sich ganz ausziehen traut sie sich nicht. Diese spanische Wand ist an den Scharnieren nicht ganz dicht. Ihren Schlüpfer behält sie an und ihren Büstenhalter nimmt sie nur ganz kurz ab, seift sich ein, spült und zieht ihn gleich wieder an.
Irgendwie freut sie sich auf morgen Abend. Es ist eine Abwechslung. Allein mit der U-Bahn unterwegs in Berlin und abends zurück!