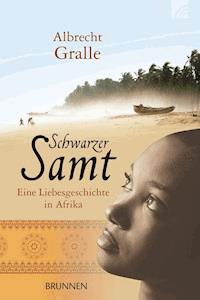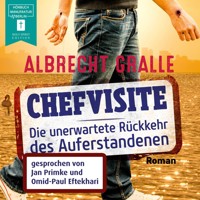Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brendow, J
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der 11-jährige René führt ein ziemlich normales Leben. Er mag gerne komische Wörter, ist verliebt in seine Klassenkameradin Leili, besucht den Gottesdienst seiner kleinen Gemeinde und streitet und versöhnt sich mit seinen Geschwistern Anna und Sven. Eines Tages teilt die Mutter den drei Kindern mit, dass ihr verwitweter Opa zu ihnen zieht. Alle sind gespannt, haben sie doch eher … ungewöhnliche Geschichten von dem Alten gehört. Dass er komische Zeitungsberichte sammelt, raucht (Sünde!), mit Gott und dem Glauben so gar nichts anfangen kann und auch sonst eher nicht dem Bild von einem lieben Großvater entspricht. Und tatsächlich bringt Opa Elias das heimelige Familienleben kräftig durcheinander. Im Gottesdienst kommentiert er lautstark die Predigt und unternimmt ungeniert Annäherungsversuche an die Nachbarsfrau. Was hat sich die Familie da nur ins Haus geholt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Albrecht Gralle
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-96140-085-0
© 2018 by Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers
Zitate aus:
Sadhu, Sundar Singh, gesammelte Schriften, hrsg. von Friso Melzer,
12. Auflage, Christliches Verlagshaus, Stuttgart, 1993
Einbandgestaltung: Brendow Verlag, Moers
Titelgrafik: fotolia channarongsds; fotolia amorroz;
fotolia Alexander Pokusay; shutterstock Jorgen Mus
Satz: Brendow Web & Print, Moers
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
www.brendow-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
1
René
Ich bin elf Jahre alt, eigentlich fast zwölf, und erzähle jetzt mal die Geschichte mit unserem Großvater. Ob alles haargenau so abgelaufen ist, kann ich nicht sagen, aber so ungefähr. Manchmal erfinde ich auch was dazu. Meine Mutter ist der Meinung, ich hätte eine blühende Fantasie, und Sven, mein großer Bruder, behauptet, ich hätte ein Gedächtnis wie ein Tesafilm, aber das würde nicht bedeuten, dass ich besonders schlau wäre, sondern nur, dass der ganze Dreck der Erinnerungen an mir kleben bleibt.
Jedenfalls, bevor mein Großvater zu uns kam, wusste ich nur, dass er humpelte, einen Revolver besaß und in Biberach wohnte. Ich stellte mir vor, dass Biberach eine Stadt wäre, in der viele Biber wohnen.
Einmal hatte ich in einer Zeitschrift einen Bilderwitz gesehen, aber nicht gleich gemerkt, dass es ein Witz war. Da saßen ungefähr zwanzig Biber auf Stühlen, und vorne stand ein Pastor und sagte: „Sicher haben Sie gemerkt, dass sich in die Einladung ein Druckfehler eingeschlichen hat. Es sollte Bibelstunde heißen.“
Auf jeden Fall war Biberach für mich die Stadt der Biber, und ich war ganz froh, dass wir da nicht hinfuhren. Ich fand, dass die Zähne der Biber ganz schön scharf aussahen, obwohl die Biber auf dem Bild ziemlich gläubig blickten.
Und nun war beschlossen worden, dass der Großvater aus Biberach zu uns ziehen sollte. Er war der Vater von meiner Mutter und war Witwer geworden (komisches Wort, hört sich an wie ein Beruf).
Und da wir ein Haus mit vielen Zimmern hatten und eine Wohnung daneben, die man herrichten konnte, wollte meine Mutter ihren Vater zu sich holen. Mein eigener Vater war vor zwei Jahren gestorben, und ich bekam allmählich das Gefühl, dass in unserer Familie alle Männer starben, weil der andere Opa, also der Vater meines Vaters, schon im Krieg gestorben war. Ich fragte mich, wann Sven, mein Bruder, und ich dran wären. Aber so richtig glaubte ich nicht daran, dass wir demnächst sterben würden. Ich fühlte mich noch ziemlich fit, hatte keinen Krebs (ein merkwürdiges Wort), und mein Herz schlug regelmäßig, außer, wenn ich beim Sportunterricht zufällig neben Leili stand. Na ja, es war nicht immer zufällig. Übrigens möchte ich mal sagen, dass sich Jungs schon mit elf verlieben können, nicht erst, wenn sie Stimmbruch haben. Eigentlich auch schon mit sechs. Ich muss es schließlich wissen.
Übrigens wohnten wir deshalb in einem Haus, weil Onkel Georg uns ein Haus geschenkt hat, als mein Vater gestorben ist. Er hat, glaube ich, drei davon. Außerdem ist er stinkreich. Wahrscheinlich wollte er nicht, dass der Schuppen total auseinanderfällt. Das Haus sah von außen etwas hässlich aus, aber wir Kinder hatten zumindest ein eigenes Zimmer. Vorher hatten wir ziemlich eng zur Miete in einem Dreifamilienhaus gewohnt. Onkel Georg besserte auch die Witwenrente meiner Mutter auf. Trotzdem mussten wir einigermaßen sparsam leben.
Auf jeden Fall waren meine Geschwister und ich nicht gerade begeistert, plötzlich einen alten Mann im Haus zu haben.
„Der meckert nur den ganzen Tag an uns herum“, maulte mein Bruder.
„Ach was, er ist nicht ständig da“, sagte meine Mutter. „Er lebt im Prinzip in seiner eigenen Wohnung und kommt zum Essen rüber, aber damit er nicht so allein ist, zieht er eben zu uns. Wir haben dieses große Haus bekommen, da kann man auch mal ein Stück abgeben. Außerdem hat er ein Auto und fährt auch. Das ist ganz praktisch für mich, wenn ich größere Sachen einkaufen muss. Er ist auch gar nicht so hilflos und kann sich gut alleine beschäftigen. Was er braucht, ist nur etwas Familienanschluss.“
Familienanschluss! Ein komisches Wort, dachte ich. Das hört sich so an, wie wenn man eine Wasserleitung irgendwo anschließt oder ein neues Stromkabel verlegt. Übrigens gibt es viele seltsame Worte, manchmal auch welche, die wirklich gut klingen und was darstellen, zum Beispiel Wolkenbruch.
„Ich könnte ja den Führerschein machen“, sagte Sven zu meiner Mutter, „und dann fahre ich dich überallhin.“
„In der Zwischenzeit ist es ganz praktisch, jemanden zu haben, der fährt.“
„Warum machst du eigentlich nicht selbst den Führerschein?“, piepste Anna, meine kleine Schwester. Sie ist sieben, in der ersten Klasse und lernt ganze Wörter auf einen Schlag, obwohl sie noch nicht alle Buchstaben kennt. Meine Mutter sagte, die Kinder kämen ganz durcheinander. Vor zwanzig Jahren hätten sie auch schon mit diesem Mist angefangen. Ich hatte Glück, weil ich in der ersten Klasse jeden Buchstaben einzeln gelernt habe, und danach konnte ich eigentlich alle Wörter lesen, auch die, die ich gar nicht kannte, zum Beispiel Fatalismus. Zuerst dachte ich, es hätte was mit dem Wort Vater zu tun, aber jetzt weiß ich, dass es bedeutet: Ist sowieso alles egal.
Übrigens sieht meine Schwester Anna meistens niedlich aus. Sie flechtet sich (oder flicht sich? Egal). … Sie macht sich jedenfalls eine Menge kleiner Zöpfe in ihre blonden Haare, und die hüpfen dann hin und her, wenn sie durch die Gegend läuft. Als sie kleiner war, hat sie mir immer alles nachgemacht, das fand ich blöd. Inzwischen macht sie viele Sachen für sich selbst, seit sie ein Playmobil-Krankenhaus hat.
„Ich soll den Führerschein machen?“, stöhnte meine Mutter. „Das traue ich mich nicht. Bei dem Verkehr.“
„Aber deinen uralten Vater lässt du herumfahren“, meinte Sven.
Dazu sagte meine Mutter nichts.
„Was für ein Auto fährt er denn?“ Sven fing an, sich Gedanken zu machen.
„Ich glaube, einen Opel.“
„Und wie sieht Opa Elias überhaupt aus?“, fragte ich.
„Aber René, du hast ihn doch schon ein paarmal gesehen.“
„Höchstens einmal im Jahr vielleicht, aber ich hab vergessen, wie er aussieht. Ich weiß nur, dass er einen echten Revolver hat.“
„Typisch Jungs“, sagte meine Mutter. „Denken immer an Waffen!“
Meine Mutter holte den Schuhkarton aus dem Schrank, in dem sie alle Bilder aufbewahrte, und wühlte darin herum.
„Das ist er – na ja, vor sechzig Jahren.“
Ich schaute mir das Bild an. Es war noch schwarz-weiß. In der Mitte lehnte ein Mann an einem alten Opel, hatte eine Zigarre im Mund und schaute in die Ferne.
„Das war sein erstes Auto, ein blauer Opel“, sagte meine Mutter. „Er hat immer davon geschwärmt.“
„Aber das Auto ist doch gar nicht blau“, meinte Anna.
„Damals waren die Bilder alle schwarz-weiß!“, erklärte meine Mutter.
„Er raucht“, sagte ich und blickte meine Mutter an. Rauchen war bei uns zu Hause verpönt.
„Ich hoffe, dass er inzwischen nicht mehr raucht. In meiner Wohnung wird jedenfalls nicht geraucht. Das kann er bei sich tun.“
Auf dem Bild sah er ganz nett aus und lächelte leicht. Seine Haare waren dunkel, fast schwarz, ziemlich dicht und wirr, als ob er gerade einen Sturm hinter sich hätte.
„Er sieht gar nicht wie ein Großvater aus“, meinte ich. „Und der Name Elias passt eigentlich auch nicht zu ihm.“
Wir kannten uns bei den biblischen Figuren ganz gut aus, weil wir eine dicke Kinderbibel mit Bildern hatten und meine Mutter uns regelmäßig daraus vorlas. Jedenfalls sah der Prophet Elias in der Bibel viel wilder aus als mein Großvater. Er trug einen langen Mantel mit Gürtel und einen Bart, der ihm bis zur Brust reichte, und geraucht hat er auch nicht, höchstens, als er den Altar von Gott anzünden ließ. Vermutlich hatte er vorher Benzin darübergegossen und sein Feuerzeug heimlich angemacht. Und die Leute damals dachten, es sei Wasser gewesen, und wunderten sich, dass das Wasser brannte.
„Ist doch klar, dass Opa auf dem Bild nicht wie ein Großvater aussieht, weil er da noch kein Großvater war“, sagte mein Bruder und verdrehte die Augen nach oben.
„Ich hab noch ein neueres Bild.“ Meine Mutter wühlte weiter und zeigte auf das farbige Bild eines alten Mannes mit weißgrauen Haaren, der an einem Stock ging und ein rotkariertes Hemd anhatte. Das war schon besser.
„Was hat er denn so gemacht?“ , fragte Sven, „ich meine, beruflich?“
„Er war bei der Lufthansa.“
„Was?“ Mein Bruder blickte uns an. „Er war Pilot?“
„Nein“, lachte meine Mutter, „er war am Flughafen angestellt und für die Sicherheit der Flugzeuge verantwortlich.“
„Vielleicht kann er uns billig Flüge besorgen?“, überlegte Sven. „Er hat doch sicher noch Beziehungen! Ich finde, wir sollten ihn für eine Probezeit aufnehmen.“
„Das sagst du nur, weil er ein Auto hat und vielleicht Flüge …“
„Nein, ich verehre ihn aufrichtig!“, lachte Sven.
„Schön“, sagte meine Mutter, „wie auch immer, ich werde ihn zu uns einladen, und dann werden wir ja sehen, ob es funktioniert. Aber wundert euch nicht, wenn er sich mit euch anlegt. Er redet ziemlich direkt. Ich will’s nur schon mal ankündigen.“
Das war dann also geklärt. Großvater würde kommen und uns Flüge besorgen, wenn wir uns mit ihm gutstellten.
„Hat er irgendwelche Hobbys?“, fuhr Sven mit seiner Fragerei fort. „Und wie alt ist er überhaupt?“
„Hm“, meinte meine Mutter. „Soweit ich mich erinnere, sammelt er Artikel von seltsamen Ereignissen, die er irgendwo liest. Und er schreibt gerne Leserbiefe an die Zeitung. Er ist jetzt …“, sie überlegte, „… bald einundneunzig.“
„Was?“, rief Sven aus. „So alt? Dann war er ja schon uralt, als du zur Welt gekommen bist.“
„Ja“, sagte meine Mutter, „ich war die Überraschung meiner Eltern. Keiner hat mehr mit mir gerechnet.“
„Aber einundneunzig! Das hört sich ja nach Friedhofsgemüse an!“
„Sven, also bitte! Du wirst dich wundern, wie fit er noch ist!“
„Geht er in die Kirche?“, fragte Anna.
Unsere Mutter zuckte mit den Schultern. „Er ist zwar evangelisch-lutherisch, aber mit der Kirche hat er nicht viel am Hut. Zu Hause gab es immer Streit wegen Glaubensfragen.“
„Er kann sich ja mal unseren Gottesdienst ansehen“, meinte meine kleine Schwester.
Dazu muss man wissen, dass wir keine Lutheraner sind, sondern zu einer Freikirche gehören, zu den Baptisten. Das ist derselbe Klub, zu dem auch Martin Luther King und der Präsident Jimmy Carter gehörten und übrigens auch Mahalia Jackson, diese dicke Gospelsängerin. Aber die kennt heutzutage kaum noch jemand.
Bei uns Baptisten geht es etwas familiärer zu. Es gibt keine feste Ordnung im Gottesdienst, und die Leute werden getauft, wenn sie es wollen, also eher ab zwölf, dreizehn und mehr. Wir haben keine Kirchensteuer und müssen unseren Pastor selber bezahlen. Aber wir sind auch evangelisch und glauben im Prinzip an dieselben Sachen wie die Lutheraner, nur nicht so förmlich, und im Gottesdienst singt auch der Pastor kein Solo auf drei Tönen.
Für mich waren die Baptisten zu der Zeit die einzige Kirche, die ich wirklich kannte, und ich war der Meinung, dass ich ein unwahrscheinliches Glück hatte, ausgerechnet zu der richtigen Kirche zu gehören. Obwohl ich selber noch nicht getauft war.
Jedenfalls, Großvater wurde immer interessanter für mich: Biber, Lufthansa, lutherisch, Raucher, Revolver, Leserbriefschreiber und Autofahrer.
2
Wenige Wochen später war es dann so weit. Ein Sprinter rauschte an, mit einigen Sachen von Opa. Sein Bekannter hatte sich angeboten, ein paar Möbel für ihn zu transportieren. Opa kam erst am nächsten Tag in seinem eigenen Wagen, einem alten VW Passat Combi und drei Koffern und noch ein paar anderen Kleinigkeiten.
„Wir haben seine Wohnung noch nicht ganz aufgelöst, falls er es sich überlegt und wieder zurückziehen will“, meinte meine Mutter.
„Oder falls wir es uns überlegen“, sagte Sven.
„Dann muss er wieder zurück zu den Bibern“, sagte ich.
„Zu den was?“
„Na ja“, meinte ich, „Biberach ist doch die Stadt, wo es so viele Biber geben soll.“
Sven tippte sich an die Stirn.
In dem Sprinter waren zwei Stühle, sein Schreibtisch, ein kleines Tischchen und ein gewaltiger Ohrensessel aus dunklem Holz, mit rotem Samt ausgeschlagen.
„Sieht aus wie ein Thron“, meinte Sven.
„Den Schreibtisch braucht er, um seine Leserbriefe zu tippen und seine Seltsamkeiten zu sortieren“, sagte meine Mutter.
Wir sahen uns den Schreibtisch an und bekamen große Augen. Er war massiv und schwarz lackiert.
Der Fahrer grinste: „Das Teil ist geleimt und muss als Ganzes runter. Besorgt euch schon mal ein paar Leute. Ich hab mir mit einem Freund zusammen fast den Rücken kaputtgehoben.“
Zum Glück war noch unser Nachbar da, der ein Gestell mit Rädern hatte.
Zu viert bugsierten sie den Schreibtisch auf ein dickes Brett und schoben ihn, in Decken gehüllt, vom Wagen auf das Fahrgestell. Das ging noch.
Aber man musste ihn ein paar Stufen zur Einliegerwohnung hochtragen.
„Jedenfalls“, meinte Sven mit hochrotem Gesicht: „Der Schreibtisch ist ein Argument, dass Opa bleibt.“
Den roten Thron dagegen konnten zwei Männer bequem tragen.
Es war Frühling, als Opa am nächsten Tag kam, und meine Mutter hatte ihm auf seinen Schreibtisch eine Vase mit den ersten Tulpen gestellt.
Er sah sich die Vase an, deutete mit seinem Stock darauf und sagte nur: „Was soll denn das Gemüse hier?“
„Ein Willkommensgruß, Papa!“
Neben der Vase lag ein bunter Zettel, auf dem „Grüß Gott“ stand.
„Ich kann mit Blumen nichts anfangen, außer mit der Tabakpflanze.“
„In unserer Wohnung wird nicht geraucht“, sagte sie. „In deinem Reich kannst du natürlich machen, was du willst und weiter deine Gesundheit ruinieren.“
„Danke für deine frommen Wünsche, Annika.“
Da wir in der Nähe von Tübingen wohnten, sprachen wir ein leichtes Schwäbisch. Meine Mutter sowieso, ich auch. Nur mein Bruder dachte, er sei etwas Besonderes, weil er Theologie studierte. Deshalb bemühte er sich, auch zu Hause Hochdeutsch zu sprechen. Mein Großvater hatte für das Schwäbische noch nie etwas übrig gehabt, dabei war seine Frau eine Schwäbin gewesen, und er hatte sein halbes Leben in Biberach verbracht. Er stammte aus der Nähe von Leipzig, aber das Sächsische hatte er auch nie für voll genommen.
Obwohl ich noch nicht erwachsen war, merkte ich bei diesem kurzen Schlagabtausch zwischen meiner Mutter und ihm, dass es nicht langweilig werden würde.
Mit seinem Stock dirigierte er die Möbel an die richtigen Plätze.
„Willst du vielleicht ein Bild an die Wand?“, fragte meine Mutter.
„Was für ein Bild?“
„Irgendein Bild, das dir gefällt. Ihr habt doch zu Hause auch Bilder an den Wänden gehabt.“
„Die hat deine Mutter ausgesucht. Ich überleg mir‘s noch“, sagte er und ließ sich mit Ächzen auf seinem roten Thron nieder. „Ganz schön anstrengend, so ein Umzug“, sagte er.
„Besonders für die Leute, die deine Sachen schleppen“, sagte Sven und grinste.
„Sei nicht so frech!“, polterte Opa los.
Für eine Sekunde war es still, dann sagte meine Mutter: „Ach, Papa, das hat doch Sven nicht so gemeint. Soll ich dir helfen, deine Koffer auszupacken?“
„Nee, nee, lass man. Das mach ich lieber selber.“
„Na gut“, sagte meine Mutter, „um halb eins gibt es Mittagessen. Wenn du dreimal klingelst, wissen wir, dass es jemand aus der Familie ist. Ich habe zur Feier des Tages Salzkartoffeln, Gemüse und Hackbraten gemacht.“
„Na wenigstens nicht diese ewigen Spätzle“, sagte er.
Daraufhin schwieg meine Mutter, und wir ließen ihn allein.
Bisher hatte mich mein Großvater nicht richtig bemerkt. Ein kurzer Gruß am Anfang, das war alles. Nachher, beim Essen, wurde das dann anders.
Es klingelte dreimal. Opa marschierte mit seinem Stock in die Essküche und setzte sich ohne zu fragen auf meinen Platz. Etwas mürrisch setzte ich mich neben ihn. Bevor wir mit dem Essen anfingen, gab es eine gewisse Unsicherheit, bis meine Mutter sagte: „Wir beten vor dem Essen immer.“
„Ja, das habe ich schon befürchtet“, kommentierte mein Großvater, „fromm wie deine Mutter.“
„Du bist doch lutherisch getauft“, hielt meine Mutter dagegen, „und Martin Luther hat sicher auch vor dem Essen gebetet.“
„Ist ja gut, Annika.“
„Schweine beten vor dem Essen auch nicht“, sagte Sven, dem es Spaß machte, unseren neuen Gast zu ärgern. Vielleicht wollte er ihn damit auch nur loswerden.
Großvater schoss unter seinen buschigen Augenbrauen einen Blitz in Svens Richtung und sagte mit scharfer Stimme: „Hör mal gut zu, mein Junge, ich habe einen Weltkrieg überlebt und muss mir von einem pickeligen Studenten nicht ans Bein pinkeln lassen. Ist das klar?“
„Also bitte, Sven!“ Meine Mutter war leicht rot geworden.
„Außerdem“, fuhr Opa fort, „sollten wir alle etwas mehr Respekt vor den Hausschweinen haben. Sie bringen sich wenigstens nicht gegenseitig um. Also sind sie dem Menschen in einer Hinsicht überlegen.“
„Ich bete jetzt!“ Meine Mutter senkte den Kopf und betete: „Alle guten Gaben …“
Wir aßen schweigend, bis Großvater sich herabließ und das Essen kommentierte: „Die Kartoffeln sind zu mehlig.“
Beim Nachtisch, einem Apfelkompott, befasste er sich eingehender mit uns Kindern.
„Also, Sven. Was macht die Uni?“
„Hm“, überlegte er, „ich bin noch mit den Sprachen beschäftigt, Hebräisch und Griechisch, und mach was in Kirchengeschichte. Außerdem höre ich eine Einleitung zu den biblischen Fächern. Dann gibt es noch ein Seminar über Philosophie …“
„Sven ist stinkfaul“, sagte Anna, „aber schlau. Der kriegt ohne Lernen gute Noten. Das find ich gemein.“
„Stimmt“, nickte Sven. „Warum soll ich lernen, wenn man die Sachen von Anfang an kapiert?“
„Und du bist also das fleißige Lieschen?“, fragte Elias Anna.
„Nein, ich heiße Anna. Ich kapier die Sachen jedenfalls nicht gleich und muss das üben. Aber die meisten Wörter kann ich fast schon lesen …“
„Ja“, sagte ich. „Aaaaalllleeee meeeiiiine Eeeentchchchcheeen.“
„Blödmann! Wir lernen gleich ganze Wörter und nicht so doofe Buchstaben. Haustür kann ich schon auf einen Schlag lesen.“
„Und deine Lieblingsfächer?“
„Erdkunde. Und später will ich unbedingt Französisch lernen. Englisch kriegen wir dann sowieso.“
„Französisch kann ich auch noch“, meinte unser Großvater.
„Wirklich?“
„Ja, ich war im Krieg in Frankreich. Da lernt man das zwangsläufig. J‘espère que nous allons vivre bien ensemble.“
„Ich hoffe, dass wir … ähm …“, fing Sven an.
„… gut zusammenleben werden“, fuhr Opa fort.
Dann fragte Sven mit seiner freundlichsten Stimme: „Stimmt es, dass du bei der Lufthansa warst, Opa?“
„Ja.“
„Könntest du uns nicht einen Flug besorgen und …“
„Sven!“ Der strafende Blick meiner Mutter.
Opa richtete sich auf: „Ach so! Jetzt kapier ich’s, Annika! Hab mich schon gewundert, wie du die Kinder überredet hast, mich aufzunehmen. Du hast sie mit möglichen Flügen geködert, damit sie den Alten ertragen.“ Er stieß mit seinem Stock, der an der Wand gelehnt hatte, kurz auf, dass wir zusammenzuckten.
„Aber da habt ihr euch geschnitten. Aus Billigflügen wird nichts.“
Meine Mutter kniff ihren Mund zusammen und sagte: „Also Papa! Ich hab die Kinder mit nichts geködert. Das mit den Flügen war einfach eine Idee von Sven. Jungs sind nun mal so, dass sie alles Technische …“
Elias fuhr mit seiner Hand durch die Luft. „Erledigt, ich weiß Bescheid!“
Dann richtete sich sein Blick auf mich.
„Und du, René?“
Ich blickte auf. „Ich?“
„Ja, du. Du bist doch ziemlich patent und hast es bestimmt faustdick hinter den Ohren.“
Patent kannte ich nicht, ein seltsames Wort. Es hörte sich an, als ob man es in eine Schachtel legen konnte. Und was sollte Faustdick hinter den Ohren bedeuten?
„Ja“, sagte Sven, „er wäscht sich nicht gerne hinter den Ohren.“
Großvater Elias beachtete die Zwischenbemerkung nicht und fuhr fort: „Und wie läuft die Schule?“
Ich zuckte die Schultern. „Na ja, es geht.“
„René ist seit einem Jahr im Gymnasium“, sagte meine Mutter. „Im Uhland-Gymnasium.“
„Hoffentlich bleibt er dabei“, sagte Sven.
„Warum? Ist er nicht so intelligent wie du?“
„Das ist das Problem“, nickte Sven.
„Aber ich hab in Religion und in Musik eine Eins“, verteidigte ich mich.
„Das sind ja zentrale Fächer!“ Großvater hustete. Oder lachte er? Ich merkte, dass er vorher geraucht hatte, weil ich neben ihm saß.
„Und ich kann schon kleine Geschichten schreiben“, sagte ich schnell, „und ich habe ein Gedächtnis wie ein Tesafilm.“
„Aha“, brummte Großvater. „Kannst mir ja die eine oder andere Geschichte mal vorlesen. Kennst du Hermann Hesse?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Und ihr?“ Großvater blickte in die Runde.
Sven hatte den Kopf gesenkt, aber ich wusste, dass er mit seinem neuen Handy im Internet war und den Namen eingegeben hatte.
Plötzlich blickte er auf und sagte: „Hermann Hesse war ja ein deutscher Schriftsteller, 1877 in Calw geboren, Literaturnobelpreis 1946.“
„Donnerwetter!“, rief Opa Elias. „Schlaues Bürschchen …“
„Na ja“, meinte Sven, „man tut, was man kann.“
Großvater schwieg und griff in seine Westentasche. Wir schauten uns an und überlegten, was jetzt wohl kam.
„Schlaues Bürschchen“, wiederholte Anna kichernd.
Schließlich förderte er einen zerknitterten Zeitungsausschnitt zutage und sagte: „Übrigens, ich sammle schon seit Jahren merkwürdige Nachrichten.“
„Ja, ich weiß, Papa.“ Meine Mutter klang so, als habe sie das befürchtet.
Opas Stimme wurde lebhafter, als er weiterredete: „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was alles auf der Welt passiert. Die absurdesten Sachen. Ich gebe euch mal eine Kostprobe.“
Er strich das Papier glatt, zog seine Lesebrille aus seiner Brusttasche, setzte sie sich umständlich auf und las, während es irgendwo leise klapperte. Meine Mutter sagte mir später, das sei sein Gebiss, das nicht richtig festsaß.
„Friedrichshafen, zweiundzwanzigster März. Überschrift: Klassenarbeiten im Abfalleimer. Wie der Redaktion zugetragen wurde, befanden sich die korrigierten Arbeiten der Klasse 7 C des Hindenburggymnasiums nicht in der Schule, sondern in einer Mülltonne. Folgendes war geschehen: Einer der Lehrer, der auf dem Weg zum Unterricht war, hatte von seiner Frau den Müllbeutel in die Hand gedrückt bekommen, um ihn an der Straße zu entsorgen. Noch ganz in Gedanken, entsorgte er aber stattdessen die Aktentasche in der Mülltonne und kam mit dem Abfallbeutel in der Schule an. Durch das beherzte Eingreifen einiger Schüler der Klasse 7 C wurde die Tasche in der Mülltonne entdeckt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt. Der Fall war das Tagesgespräch der Schule. Der Direktor versicherte unserer Zeitung, dass es ein einmaliger Fall von Verwechslung war und der Kollege ansonsten korrekt seine Arbeit ausführe.
Na? Was haltet ihr davon?“
Wir hatten schon während des Artikels gegluckst und gelacht.
„Hast du noch mehr Artikel von der Art?“
„Oh ja. Er hat mindestens vier oder fünf Leitzordner voll“, sagte meine Mutter.
„Sechs“, verbesserte Opa. „Jetzt bin ich aber müde und muss mich etwas hinlegen. Tut mir leid, dass ich in der Küche nicht helfen kann.“
„Tut es dir wirklich leid?“, fragte Sven.
„Ein bisschen.“ Er stand auf. „Jedenfalls, das sehe ich schon, werden wir interessante Gespräche führen. Und wundert euch nicht, wenn ich gelegentlich auf meiner Schreibmaschine tippe.“
Er wartete nicht ab, was wir dazu meinten, und humpelte davon.
Als die Haustür ins Schloss fiel, fragte Anna: „Und warum sammelt er diese … diese komischen Nachrichten?“
Meine Mutter zuckte mit den Schultern. „Ich habe keine Ahnung. Er fing vor zwanzig Jahren damit an, da war ich gerade noch zu Hause. Und am Anfang fanden wir es alle ganz lustig, aber mit der Zeit … na ja, ihr werdet es selbst sehen.“
„Habt ihr ihn denn nie gefragt, warum er das macht?“, meldete sich Sven.
„Natürlich. Aber er ist uns immer ausgewichen und hat so allgemein geredet, dass er es eben interessant fände, was es so alles gibt. Aber es muss etwas dahinterstecken, sonst würde er es nicht schon so lange machen.“
Sie dachte nach und sagte dann zu Sven: „Und bitte sei nicht so frech zu ihm. Er ist unberechenbar und kann jähzornig werden, wenn man ihn reizt.“
„Ja, ja, er hat ja auch schon einen Weltkrieg überlebt. Aber was soll ich machen, wenn er unverschämt wird? Wie hast du es nur zu Hause ausgehalten?“
„Die Berufstätigkeit der Männer ist ein Segen“, sagte sie, und ich verstand nicht ganz, was sie damit meinte. Aber sie fuhr gleich fort: „Sven! Er ist ein alter Mann. Du kannst ihn nicht ändern. Wir haben schon alles ausprobiert. Und bei dem Thema Glauben kann er manchmal direkt ausfallend werden. Am besten gar nicht groß darauf eingehen, dann beruhigt er sich.“
„Da würde ich mir an seiner Stelle verarscht vorkommen.“
„Also bitte, Sven, deine Wortwahl ist wirklich ordinär! Woher hast du das bloß?“
„Ich rede völlig normal. Du musst mal hören, was andere so sagen. Dagegen bin ich der reinste Musterknabe.“
„Aha!“
Mit diesem Kommentar beschlossen wir das Essen. Zum Glück war Anna mit dem Ausräumen der Spülmaschine dran. Um die Teller wegzuräumen, musste sie allerdings auf einen Stuhl steigen.
3
Mitten in der Nacht wurde ich wach. Es war, als ob in den Wänden Tiere wären, die hin- und hertrippelten. Vielleicht Mäuse? Sie trippelten eine Zeitlang, waren still, als ob sie lauschten, dann rannten sie wieder los.
Ich fand es ein bisschen eklig, dass Tiere in unserem Haus waren und Lärm machten. Warum hatte ich sie nicht früher gehört? Vielleicht nagten sie die Holzbalken an, und eines Tages würde dann das ganze Haus zusammenbrechen. Zum Glück stand mein Bett an der Wand, da war es am sichersten. Aber trotz der Mäuse schlief ich dann doch wieder ein.
Morgens, beim Frühstück, saß Opa fertig angezogen und rasiert wieder auf meinem Platz und ließ sich von meiner Mutter bedienen.
„Der Kaffee kann ruhig ein bisschen stärker sein“, meckerte er. Meine Mutter tat so, als ob sie ihn nicht hörte, und fragte: „Wie hast du geschlafen, Papa?“
Er schlürfte lautstark seinen Kaffee und sagte: „Geht so. War eine Zeitlang wach und habe getippt.“
„Was hast du denn getippt, Opa?“, fragte Anna. „Schreibst du ein Buch?“
„Inzwischen könnte es fast ein Buch sein“, brummte er.
„Opa schreibt Briefe an die Zeitung“, sagte meine Mutter und holte ein neues Marmeladenglas. Sie sah ihren Vater an und fuhr fort: „Obwohl es mir schleierhaft ist, was du da schreibst. Du bist doch gestern erst angekommen …“
„… und hab gestern schon euer Käseblatt durchgelesen. Abgesehen von den zahlreichen Schreibfehlern gab es einiges zu bemerken. Wo ist eigentlich Sven?“
„Schon weg“, mampfte ich.
„Erst schlucken, dann reden, und jetzt das Ganze in einem richtigen Satz!“
„Wieso?“ Ich sah ihn erstaunt an. „Was denn für einen Satz?“
„Subjekt, Prädikat, Objekt, eben ein vollständiger Satz“, erklärte Opa, „nicht solche hingeworfenen Halbsätze. Also: Sven ist gegangen. Wohin? Zur Universität.“
„Aber Opa“, sagte ich, „das hört sich doch komisch an: Sven ist gegangen zur Universität. Es heißt doch: Sven ist zur Uni gegangen, und dann ist doch das Verb am Schluss!“ Ich merkte, wie meine Mutter kurz grinste, aber sofort wieder damit aufhörte.
Opa presste aus irgendeinem Grund die Zähne oder sein Gebiss zusammen und sagte: „Das weiß ich auch. Das liegt an dem zusammengesetzten Verb. Im Deutschen steht dann das Verb am …“
„Sven musste schon los“, sagte Anna und blickte ihren Großvater glücklich an.
„Falsch!“, grunzte Opa. „Müssen ist ein Hilfsverb und kann nicht allein stehen. Es heißt: Sven musste schon losgehen.“
„Aber wir sagen doch auch: Ich muss aufs Klo“, warf ich ein.
„Das ist Umgangssprache!“
„Sind wir hier in der Schule?“, fragte meine Mutter. „Also bitte, Papa!“
„Annika, du lässt hier viel zu viel durchgehen. Meine Enkel sollen richtiges Deutsch sprechen.“
„Was ist denn ein Werb?“, fragte Anna. „Ist das was aus der Werbung?“
„Das ist ein … ein Tuwort“, erklärte Opa. „Das richtige Sprechen bringe ich euch im Laufe der Zeit noch bei.“
„Auf die Art werden sie es nicht lernen. Und wenn du sie so anmachst, sagen sie lieber gar nichts, wenn du dabei bist.“
„Ich finde, Opa redet wie ein Ausländer“, sagte ich: „Sven ist gegangen zur Universität. Das ist ein ganz falsches Deutsch.“
„Zum Kuckuck!“, rief Opa und setzte seinen Becher etwas laut ab, sodass ein bisschen Kaffee danebenschwappte. „Ich lass mir von deinen Kinder nicht sagen, dass ich wie ein Ausländer rede!“
„Aber vorhin hat Opa gesagt …“, begann ich …
„Schluss jetzt, René. Er wollte damit etwas anderes klarmachen. Ihr könnt euch nach dem Essen von mir aus stundenlang über Grammatik unterhalten, aber nicht unbedingt in der Küche.“
„Was ist Gramaatik?“, fragte Anna.
„Wie die Sätze aufgebaut sind“, erklärte Opa.